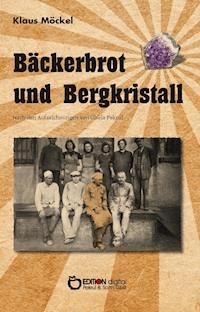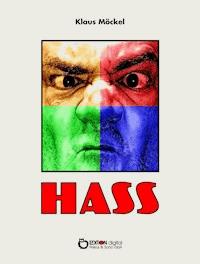8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in eine Sammlung meisterhafter Erzählungen von Klaus Möckel, die das Leben in all seinen Facetten widerspiegeln. In „Der undankbare Herr Kerbel“ erleben Sie die ungewöhnliche Freundschaft zwischen drei ungleichen Männern, die versuchen, den traurigen Herrn Kerbel aus seiner Lethargie zu befreien. Doch wird seine dunkle Vergangenheit sie alle in den Abgrund reißen? Ein schockierendes Verbrechen erschüttert einen verschlafenen Ort im Schwarzwald. Kommissar Offmann, ein unkonventioneller Ermittler, deckt zwischen Kaffee und Klarem die Wahrheit hinter einem Netz aus Eifersucht, Verrat und tragischen Missverständnissen auf. Ein modernes Märchen vermischt die klassischen Elemente von Rotkäppchen mit der Härte der heutigen Realität. Begleiten Sie Rotkäppchen auf eine gefährliche Reise in die Vorstadt, wo sie gegen einen listigen und gefährlichen Wolf kämpft, der an den wertvollen Schmuck ihrer Großmutter will. Literaturkritiker Hans-Gerd Talhart, der sich immer für einen rationalen Mann hielt, wird durch einen mysteriösen Sturz und eine besondere Brille in eine Spirale aus Wahrheit und Täuschung gezogen. „Wahrheiten I“ zeigt, wie die Suche nach der absoluten Wahrheit das eigene Leben zerstören kann. Diese vielfältige Sammlung, die tiefgründig amüsiert und schockiert, ist ein Muss für alle, die das Leben mit einem Augenzwinkern und scharfsinnigem Humor betrachten. Lassen Sie sich von Möckels Erzählkunst fesseln und in eine literarische Welt entführen, die gleichermaßen zum Nachdenken anregt und unterhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Klaus Möckel
Flusspferde eingetroffen
Lachen mit Möckel
ISBN 978-3-68912-134-1 (E-Book)
Das Buch erschien 1991 im Reiherverlag Berlin.
Das Titelbild wurde mit KI erstellt.
© 2024 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Ein Wort voran
Klaus Möckel war (und ist, sollte man denken) auf jenem Gebiet, das vor kurzem noch DDR hieß, einem sehr großen Publikum bekannt. Mit seinen Kriminalromanen, seinen phantastischen Erzählungen, seinen satirischen Sprüchen und Gedichten, aber auch mit „Hoffnung für Dan“, diesem erschütternden Bericht über ein mehrfach behindertes Kind, traf er den Nerv der jungen wie älteren Leser. Die Vielfalt seines bisherigen Schaffens, das mit dem Herbst 89 keineswegs außer Kraft gesetzt ist, zeigt sich nicht nur in den unterschiedlichen Genres, die er benutzt, in den immer neuen Einfällen, mit denen er die Zeitprobleme angeht, sondern ebenso in den Mitteln, die er gebraucht, in der ganzen Art, wie er sich uns nähert. In den Krimis ist es das soziale Gespür, das er mit der Fähigkeit verbindet, Spannung hervorzurufen, in „Hoffnung für Dan“ vereinigen sich Dokument und literarische Überhöhung zu bitterer Anklage, in den Zukunftsgeschichten wird der Leser von der Fantasie gefesselt, amüsiert oder schockiert. Bei alldem aber erkennt man in den Büchern des Schriftstellers eine besondere Vorliebe für Humor und Satire – für einen mitunter freundlichen, mitunter schwarzen Humor, für eine heitere oder bissige, gewissermaßen mit knirschenden Zähnen geschriebene Satire.
Gerade die Heiterkeit und Ironie in Möckels Büchern waren Anlass für die folgende Auswahl. In der Erzählung „Die gläserne Stadt“ wurde bereits neunzehnhundertachtzig der Zusammenbruch einer Welt vorausgesagt, deren Führungsschicht abgeschirmt hinter Glaswänden lebt und hohl gewordene Prinzipien zum Gesetz erklärt. Im „Märchen von den Porinden“ (1988) regiert der „Große Popanz“ mit seinen willfahrigen Ratgebern über ein Tal, das im Unrat erstickt, und auch in anderen Geschichten, Gedichten, Aphorismen werden ähnliche Themen behandelt. Der Humor hat viele Gesichter; bei diesem Autor, der hierzulande außerdem eine Menge französischer Literatur herausgab und sich dem gallischen Esprit verpflichtet fühlt, schließt er die witzige Pointe im „kriminellen“ Spruch ein, das geistreiche Wortspiel im Nonsensvers und den Schauereffekt in der „Gespensterballade“. Das alles einmal zusammenzufassen und, ergänzt durch unveröffentlichte Texte, dem Leser im gesamten deutschen Sprachraum anzubieten, erschien sowohl wichtig als auch reizvoll.
Hier wird Möckel als ein Schreiber ganz eigener Art vorgestellt. Sein Lachen, so glauben wir, wirkt weiter.
Zeitsprüche
Wie geht’s? fragte der Tausendfüßler.
Man beißt sich durch, erwiderte der Holzwurm.
Man wird angenagt, aber man steht’s durch, sagte der Birkenpilz.
Jetzt bloß nicht den Kopf verlieren, dachte der Champignon, als die Pilzsammler kamen.
In jeder Lage den Hut aufhaben (Leitspruch der Pilze).
Es bleibt dabei, sagte der Steinpilz, immer wird den Standhaften der Kopf abgeschnitten.
Wie ich gefilmt wurde
Kürzlich wurde ich gefilmt. Vom Fernsehn. Es war das erste und vielleicht letzte Mal in meinem Leben. Ich bin kein fotogener Typ und kann mich vor der Kamera nicht so richtig in Szene setzen. Ich tröste mich aber damit, dass sich meine Leistungen irgendwann nach meinem Tode herumsprechen werden.
Diesen einen Auftritt im Studio kann man mir jedenfalls nicht mehr nehmen. Ich glaube, ich habe mich ganz wacker geschlagen. Ich hatte mich ja auch vorbereitet, indem ich alle möglichen Größen aus der Kunst- und Kulturszene auf dem Bildschirm beobachtete. Wie sie sprachen und sich gaben. Ich hatte gewissermaßen das Fluidum studiert, die Atmosphäre zu schnuppem versucht. Aber ich versichere, wenn man das ganze Drum und Dran, die Kameras, Scheinwerfer, Kabel und natürlich die Menschen dort selbst erlebt, ist es etwas völlig anderes.
Schon die Vorbereitung gehört dazu, die äußerliche, meine ich, das Make-up und so. Im Allgemeinen schminke ich mich nicht, am wenigstens auf dem Kopf, an der Stelle, wo die Haare bereits recht spärlich sind. In diesem Falle war das allerdings notwendig, damit im Lampenlicht nicht plötzlich die falsche Birne blitzte.
Ich habe etwas dazugelernt, und meine Achtung vor den Damen der Maske wie auch vor den Regisseuren, Schauspielern, Dekorateuren, Kameraleuten, Schnitt- und Tonmeistern ist gestiegen, ganz im Ernst.
Unter anderem lernte ich bei dieser Gelegenheit, was ein Spratzer ist, ich komme gleich darauf zurück.
Mein Auftritt bestand aus zwei Teilen, von denen jeder seine Wichtigkeit besaß. Schauspieler sollten Szenen aus einem meiner Bücher interpretieren, und ich durfte ein paar Fragen zu meinem Schaffen beantworten. Am ersten Tag wurde ich zu diesem Zweck vom Regisseur durch einen Türrahmen geführt, schüttelte stumm aber freundlich den Mimen die Hand, ging, von den Kameras erfasst und begleitet, weiter zu einem Podest und setzte mich dort an einen Tisch.
Vor eine Art Sonnenjalousie, obwohl gar keine Sonne schien und es im Raum keine Fenster gab, durch die sie hätte hereinblinzeln können. Ich stellte seither aber fest, dass in ähnlichen Sendungen die Schriftsteller meist vor genau dieser Jalousie sitzen.
Die erste Szene: die etwa fünfzehn Meter meiner Vorwärtsbewegung zum Tisch, das Hinsetzen und auch das Händeschütteln vorher, wurden mehrmals geprobt. Man glaubt nicht, wie schwer es sein kann, bei Beobachtung elastisch auszuschreiten und dabei einigermaßen geistreich an den Kameras vorbeizuschaun. Auch auf natürliche Weise Platz zu nehmen, ist unter solchen Umständen nicht ganz einfach.
Schließlich wurde gedreht, einmal, zweimal – hinterher sieht man sich die Aufzeichnung auf dem Bildschirm an.
Ich gefiel mir nicht besonders, wirkte irgendwie gehemmt. Der Regisseur und die Dramaturgin meinten jedoch, das sei in Ordnung, und so fühlte ich mich dennoch erlöst.
In diesem Augenblick rief einer der Assistenten aus dem Hintergrund: „Nein, wir können es nicht nehmen. Es sind ein paar Spratzer drauf.“
Spratzer? Ich hatte nichts gesehen. Was war das?
Man erklärte mir, es seien kleine Risse, die den Gesamteindruck beeinträchtigten.
„Kratzer also?“
„Na ja, so ähnlich.“
Ich ging ein weiteres Mal an den Kameras vorbei, diesmal zeigten sich leichte grüne Schatten; es ist teuflisch, worauf von zehn verschiedenen Leuten bei solchen Aufnahmen genauestens geachtet werden muss.
Endlich war die Arbeit geschafft, und ich begab mich zufrieden nach Hause. Am Abend lief zufällig „Mephisto“ von István Szabó nach dem Roman von Klaus Mann im ersten Programm, ein, wie man weiß, beeindruckender antifaschistischer Film. Meine Frau und ich hatten ihn bereits gesehen, schauten ihn uns aber ein zweites Mal an.
Ziemlich am Anfang gibt es eine Art Liebesszene, an die sich vor allem die Männer erinnern werden. Im Verlauf einer länger währenden, erregten Diskussion entkleidet der Hauptdarsteller, der Österreicher Klaus Maria Brandauer, seine Partnerin, eine junge Tanzlehrerin (den Namen verschweige ich diskret).
Genauer: er entkleidet sie nicht einfach, er wirft sich auf sie, streift, reißt ihr die Hüllen vom Leib – sie liegt auf einem breiten Pfühl – er dreht und wendet sie wie ein noch zu formendes Stück Ton, bevor er sie über den (auffallend sauberen) Parkettfußboden kugelt beziehungsweise rollt. Eine besonders von ihr starke artistische Leistung.
Nackt! Das heißt, sie ist nackt, er hat ein etwas lächerlich wirkendes Tanzkostüm an.
Es dauert eine Weile, bis er sie wieder einhüllt, ihre Blößen mit einem großen weichen Tuch bedeckt.
Wir saßen da und folgten dem Vorgang gefesselt, aber plötzlich ging mir ein Gedanke durch den Kopf. Ich sagte: „Großartig gespielt. Doch was mögen sie gemacht haben, wenn Spratzer auf dem Band waren?“
„Wenn was war?“, fragte meine Frau.
„Spratzer“, erwiderte ich. „Kleine Risse, Kratzer, so dass die ganze Szene noch mal gedreht werden musste.“
„Dann haben sie sie eben noch mal gedreht.“
Das sagst du so einfach, weil du keine Vorstellungen hast. So vor zwanzig Leuten ausgezogen und auf dem Fußboden herumgerollt zu werden, macht bestimmt keinen Spaß. Ich meine, man ist froh, wenn man derlei Prozeduren hinter sich gebracht hat.“
Meine Frau warf mir einen abschätzenden Blick zu. „Woher willst du wissen, was in diesem Fall Spaß macht. Für solche Rollen nehmen sie Mädchen, die das, na ja, die das eben nicht so eng betrachten.“
„Das da vorn ist nicht irgendein Mädchen, es ist eine richtige ernstzunehmende Schauspielerin. Du siehst ja, was für eine wichtige Rolle sie spielt.“
„Genau. Also hör jetzt auf, dich über Nebensächlichkeiten zu ereifern. Ich möchte bitte den Film sehen.“
Das Wort ereifern fand ich übertrieben, aber sonst hatte sie recht. Deshalb schwieg ich und widmete mich dem Geschehen auf dem Bildschirm. Versuchte es wenigstens. Doch im Unterbewusstsein beschäftigte mich die Angelegenheit weiter. Später am Abend kam ich darauf zurück.
„Vielleicht waren es keine Spratzer, sondern irgendwelche grünen Schatten. Auf ihren Beinen oder dem Po. Vielleicht hat sie der Schauspieler zuerst über die linke Schulter gedreht, doch der Regisseur wollte, dass er sie über die rechte herumwirbelte. Weil das besser aussah. Wer weiß, wie oft sie nackt übers Parkett kugeln musste.“
„Du malst dir das richtig aus. Du kommst von der Frau nicht los, was?“
„Ich bewundere, wie sie das über die Bühne gebracht hat.“
„Soso, deshalb bewunderst du sie“, sagte meine Frau mit leichtem Hohn in der Stimme.
„Dein Spott ist unangebracht, glaub mir, ich bin jetzt ein Insider. Ich weiß, was getan werden muss, damit eine solche Szene in den Kasten kommt. Alle müssen zufrieden sein, der ganze Drehstab. Und die Schauspieler natürlich auch. Stell dir vor, der Regisseur sagt: ‚Topp, die Sache ist gekauft‘, die junge Dame aber meint, sie sei auf dem Bett viel zu zapplig gewesen. Oder sie habe an einer Stelle, als er sie von der Seite auf den Rücken wirft, die Beine ein bisschen zu weit gespreizt, du verstehst schon. Das ist doch eine schwierige Entscheidung für sie. Entweder sie muss das Ganze noch mal machen, vor fünfundzwanzig Leuten ...“
„Vorhin waren es noch zwanzig“, korrigierte meine Frau.
„Bei solchen Geschichten finden sich immer neue Personen ein. Auch solche, die gar nicht dazugehören. Außerdem gibt es die Schnittmeister im Nebenraum. Die alles auf dem Schirm verfolgen und kontrollieren müssen.“
„Bei dir wird eine Staatsaktion draus. Ich glaube eher, dass bei derlei Dreharbeiten so wenig Zuschauer wie möglich im Raum sind. Nur die unbedingt notwendigen.“
Ich ließ diesen Einwand unbeachtet. „... oder sie muss sich so, gewissermaßen allem aufgeschlossen, der Öffentlichkeit darbieten“, vollendete ich meinen Gedanken von vorher. „Wie würdest du dich denn in solch einem Fall verhalten?“
„Ich?“
„Ja, du.“
Meine Frau verweigerte die Antwort.
Am nächsten Tag hatte ich den zweiten Teil meines Auftritts zu bewältigen, das erwähnte kurze Interview. Ich war ein bisschen aufgeregt, denn sprechen, möglichst klug sprechen, Aussagen machen, die alle hören können und die man hinterher nicht bereut, ist etwas anderes, als durch einen Türrahmen gehn. Ich legte mir deshalb geistreiche Antworten zurecht, wendete sie in meinem Kopf hin und her. Den gesamten langen Weg zur Fernsehanstalt war ich damit beschäftigt.
Und doch betrat ich das Studio letztlich festen Schrittes.
Vor der Studiotür erinnerte ich mich nämlich an den vorigen Abend, an die Eingangsszene vom „Mephisto“-Film, und fühlte mich plötzlich sicher.
Was auch geschehen sollte, ich hatte einen Pullover an, ein Jackett, eine Hose, Schuhe und Strümpfe, die mir keiner ausziehen würde. Und ich wusste: Niemand, kein Regisseur, Schauspieler oder Kameramann, keine Dame von der Maske würden mich nackt über einen Parkettfußboden kugeln, sei er auch noch so sauber.
Kurzer Lebenslauf
Die Gelbsucht besiegt,
Die Geldsucht gekriegt.
Der Geldquell versiegt,
Die Gelbsucht gekriegt.
Die Vampire
(Ein Fernsehgedicht)
Wenn über Dorf und Stadt
die Dunkelheit sich breitet
wenn düstre Schatten
Baum und Strauch umfließen
doch auch bei Mondschein
wenn die Sterne grüßen
zwar der Verkehr noch grollt
die Leute aber
in ihren Wohnungen
den Feierabend froh genießen
wenn selbst der Wind sich legt
ermattet alle Tiere
dann aufgepasst
Das ist die Stunde der Vampire
Der schlimmen Greifer
mit den scharfen Zähnen
die euch die Säfte
aus dem Körper saugen
Gefährlich lockend
ihre Mädchenaugen
Die Brüste weich und weiß
die nicht zum Kosen taugen
Die schlanken Arme
mit den sanften Tatzen
die Haut und Fleisch
euch von den Knochen kratzen
Herbei auf Schwingen
wie vom Wind getragen
Doch nicht auf leeren Plätzen
lassen sie sich nieder
nicht in den Wäldern
hallt ihr Gurren wider
es zieht sie zu den Menschen
die in ihren Sesseln
vorm Flimmerkasten hocken
brav und bieder
auf jedes Wort auf jedes Bild
versessen
die dabei Zeit und Raum
und Freund und Kind
vergessen
Als graue Schatten
aus der Fernsehröhre
mitunter auch als
bunte Vögel fliegen
sie euch entgegen
sich an euch zu schmiegen
euch zu umgarnen
euch herumzukriegen
sich an euch festsaugen
euch zu fassen
und nicht vor Mitternacht mehr
aus dem Griff zu lassen
Sie pirschen sacht sich an
ein Säuseln Tönen
Sie wechseln ihr Gewand
antik oder im Flimmer
moderner Eleganz
bald Mönch bald Frauenzimmer
Noch haben sie euch nicht
noch wehrt ihr euch
doch immer
begehrlicher nahn sie
euch zu umschlingen
euch bis ins Herz
und bis ins Hirn zu dringen
Ein Liebeslied zuerst
ein Herzzerbrechen
Danach ein Abenteuer
mit Korsaren
Im hohen Norden
hingemetzelt Scharen
stahlharter Ritter
Nächtliche Gefahren
in einem Krimi
wo die Kugeln pfeifen
und Spinnenhände
aus dem Dunkel greifen
Allmählich sinkt ihr hin
durchzuckt von Schauern
Sie wenden kneten euch
wie weiche Lappen
Ihr glaubt das nackte Weib
dort vorn zu schnappen
in Wirklichkeit müsst ihr
mit eurem Leib
mit eurem Geist
berappen
Das gute Buch
liegt achtlos in der Ecke
Sie haben euch
Sie machen euch zur Schnecke
Ihr habt kein Ohr mehr
für normale Laute
Im Kopf nur Talg
doch keinerlei Gedanken
Um elf Uhr fünfzig
gleicht ihr armen Kranken
Um eins sieht man euch fahl
ins Bette wanken
Wie würde sanfte Ruhe
euch bekommen
doch selbst die Fähigkeit zum Schlaf
ist euch genommen
Nun endlich
haben sie euch losgelassen
Mit gutem Grund
Wart ihr doch ganz zu Willen
Sind eure Leiber doch nichts mehr
als leere Hüllen
Dumpf liegt ihr da und dumm
und matt im Stillen
Sie aber vollgesaugt mit eurem Grips
die Ungeheuer
sind schon am Abend
gierig wieder da
Beim nächsten Fernsehabenteuer.
Die seltsame Verwandlung des Lenny Frick
Lenny Fricks Verwandlung begann an jenem Tag, da er den Sanften Blitz erstand. Vorher war er ein vernünftiger Mensch gewesen; man hatte sich mit ihm über die Dinge des Lebens und der Welt unterhalten können, über den Fußball in Dresden und Rio de Janeiro, über die beste Art, Rohstoffe aus Wüstensand zu gewinnen, aber auch über den Beruf – wir waren beide in einem Institut für die Bekämpfung überflüssiger Artikel angestellt.
Doch an einem Mittwochabend stand er mit seinem Cabriolet SB vor unserem Haus, und damit fing das Elend an. Eine Entwicklung, die ich nur abwegig und verhängnisvoll nennen kann. Allerdings dauerte es eine ganze Weile, bis ich das begriff.
Gewiss, mit Röntgenaugen betrachtet, hatte es bereits vorher Andeutungen gegeben. Eigenheiten, die von seinem besonderen Interesse für moderne Autos sprachen. Seinen japanischen Tukiwaki hatte er schon immer mit größter Hingabe gepflegt, kein Stäubchen durfte Dach und Motorhaube verunzieren, wenn er mit Frau und Sohn in sein Unterwasserhaus fuhr, und ein Kratzer im Bronzelack ließ ihn wochenlang mit finsterer Miene umherlaufen. Aber das bewegte sich im Rahmen des Normalen, auch Benni Torst, Katja Alsen und andere Kollegen verhielten sich so. Das brachten die Zeit, die fortgeschrittene Technik mit sich. Weshalb hätte es mich ausgerechnet bei Lenny beunruhigen sollen?
Jener Mittwoch dagegen hat sich mir eingeprägt. Es war gegen achtzehn Uhr, ein blauseidener Frühlingstag, die Türrassel schnarrte, und als ich den Öffner betätigt hatte, stand mein Freund auf der Schwelle. Er wirkte sonderbar: fröhlich und unruhig zugleich.
„Grüß’ dich, Maltus“, warf er lässig hin. „Ist Pimpella da? Ruf sie, ich muss euch was zeigen.“
„Willst du nicht einen Augenblick Platz nehmen? Pimpa sitzt an ihrem magischen Durchlichter. Da reißt sie sich nicht so schnell los.“
„Sie soll entweder gleich kommen oder gar nicht. Wir müssen weiter.“
„Wir“, fragte ich, „hast du Rasa mit?“
„Ach, Unsinn. Rasa ist zu Hause. Ich will euch etwas vorführen.“
Meine Frau kam die Treppe herunter, sie hatte Lenny gehört und ihr Hobby beiseite geschoben. Mein Freund hatte bei ihr einen Stein im Brett.
„Hallo, Lenn, was führt dich her?“
Das „Lenn“ klang in meinen Ohren eine Nuance zu sanft; seit ein paar Wochen hatte ich Pimpella in Verdacht, auf einen Flirt mit ihm aus zu sein. Die Kinder waren aus dem Haus, und meine Gesellschaft schien ihr nicht mehr zu genügen. Doch ich hatte keinen Grund zur Beunruhigung, mein Freund ging nicht auf ihren Ton ein. Er gab überhaupt keine Antwort auf ihre Frage. Er öffnete vielmehr weit die Haustür und schaute uns erwartungsvoll an.
Wir traten zur Tür: Am Bordstein, direkt hinter dem Parkerlaubnisschild, war ein Auto abgestellt. Ein schnittiges Modell, nichts dagegen zu sagen.
„Na, wie findet ihr sie?“
„Sie?“, fragte ich erstaunt.
„Naja.“ Lenny war leicht verlegen. „‚Sie’ klingt vielleicht ungewohnt. Aber ihr müsst zugeben, dass ihre Formen, die Eleganz etwas unbestreitbar Weibliches haben.“
Ich warf Pimpa einen fragenden Blick zu, mehr als Lennys Worte überraschte mich der Ton, in dem sie gesprochen waren. Ich konnte nichts Ironisches darin entdecken.
„Ein toller Schlitten“, sagte ich, „wo hast du ihn her?“
Das Wort Schlitten missfiel ihm, er runzelte die Stirn. „Einem Ausländer abgeluchst. Hab’ meine Sparflasche bis auf den Grund geleert. Ich konnte nicht anders. Liebe auf den ersten Blick.“
„Hoffentlich weiß ‚sie’ das zu würdigen“, sagte Pimpa schnippisch.
„Da sei unbesorgt.“ Lenny tätschelte seinem Auto die Hinterflanke.
„Dann können wir am Sonntag ja gemeinsam zum Forellensee fahren“, schlug ich vor.
„Ach, ich weiß nicht. Die Straße dorthin ist zu schlecht. Das möchte ich ihr nicht zumuten.“
„Deinem Tukiwaki hat das nie was ausgemacht.“
„Das kann man nicht vergleichen.“
„Was sagt denn deine Frau zu dem Griff in die Flasche?“ Pimpa bemühte sich um Neutralität.
„Sie nimmt’s locker. Rasa hat schließlich ihr eigenes Sparwasser. Und ihre Hobbys. Wahrscheinlich wird sie sich einen einfachen Flitzer zulegen.“
Demnach würden die beiden in Zukunft getrennt fahren; nach den Jahren, da sie alles gemeinsam gemacht hatten, wunderte uns das doch. Aber weder Pimpa noch ich wollten sich einmischen. Ohne weitere Fragen zu stellen, gingen wir ins Haus zurück. Lenny kam mit, freilich nur, weil ihn meine Frau drängte.
Doch an diesem Abend war nichts Vernünftiges mit ihm anzufangen. Er beteiligte sich kaum am Gespräch und lief alle zwei Minuten zum Fenster, um nach seinem Cabriolet zu schauen. Nachdem er, wohl bloß der Höflichkeit halber, ein Glas Fresh mit uns geleert hatte, verabschiedete er sich auch prompt: Er habe jetzt leider in der Garage zu tun. Wir beobachteten, wie er in den Sanften Blitz stieg. So behutsam hatten wir ihn noch nicht mit einem Auto umgehen sehn.
Pimpa war ein wenig sauer, was mich innerlich amüsierte, aber noch hielten wir alles für eine Marotte. Da ich am nächsten Tag zu einer Konferenz in die Hauptstadt fuhr, bekam ich Lenny eine Weile nicht zu Gesicht. Am Wochenende telefonierte ich mit meiner Frau; sie erzählte, dass sie bei den Fricks gewesen sei, jedoch nur Rasa angetroffen habe. Lenny sei ständig mit dem neuen Wagen unterwegs. „Einmal tauchte er kurz auf“, sagte Pimpa, „nahm aber kaum Notiz von mir. Rasa war es richtig peinlich. Er bringt sich fast um mit seinem Sanften Blitz.“
„Lasst ihm etwas Zeit, er war schon immer ein Autonarr.“
„Natürlich. Ihr Männer müsst euch ja gegenseitig in Schutz nehmen.“
Am Institut fiel Lenny zunächst nicht durch Besonderheiten auf. Ich hatte erwartet, dass er jedermann von dem Cabriolet vorschwärmen würde – das Gegenteil trat ein. Als wollte er keinen an seinem neuen Glück teilhaben lassen, behielt er wissenswerte Fakten über den Wagen – Motorstärke, Kraftstoffverbrauch, Straßenlage usw. – für sich. Er sprach auch nicht über die Fahrten, die er am Wochenende oder abends unternahm. Morgens allerdings kam er seit kurzem sehr früh ins Institut. Ich merkte bald, dass er es nur wegen einer bestimmten günstigen Parklücke tat.
Seine Arbeit verrichtete Lenny mit Routine, aber ohne die innere Anteilnahme, die ich an ihm kannte. Stattdessen erregte er sich über Nebensächlichkeiten. Über die neue Tiefgarage im Zentrum zum Beispiel, die nach seiner Meinung zu dunkel und zu eng war, und über eine Kollegin, die aktiv im Komitee für Umweltschutz mitarbeitete.
„Aber was hast du plötzlich gegen den Umweltschutz? Du warst doch immer für grüne Städte, für die Erhaltung der Natur.“
„Siehst du nicht, dass sie die Autos völlig aus den Städten hinausdrängen will? Sie ist eine fanatische Fußgängerin.“
„Was heißt fanatisch. Sie will die Fußgängerzonen erweitern, das ist ein allgemeiner Trend.“
„Genau. Und du wunderst dich noch, dass ich dagegen auftrete. Man muss die Sache doch auch mal von der Seite der Kraftfahrzeuge betrachten. Was leisten sie für uns Menschen, und wie vergelten wir’s ihnen? Indem wir sie von allen schönen Plätzen vertreiben!“
Ich schaute ihn erstaunt an, ich fragte mich, ob er Witze riss. Aber seine Miene war ernst. Ein wenig verbissen sogar.
Durch das Auftauchen eines Ingenieurs der Nachbarabteilung, der meinen Rat brauchte, wurden wir von unserem Disput abgebracht. Ich vergaß das Gespräch, doch zwei Tage später kam es zwischen Lenny und unserem Direktor zu einer bedenklichen Auseinandersetzung. Ein Betrieb für Kinderschuhe überschwemmte den Markt mit einem neuen, werkfremden Produkt, einem Radverzierer für Kraftfahrzeuge. Das waren Gummikappen mit schimmerndem Farbeffekt, die dem Käufer als moderner Autoschmuck angepriesen wurden. Zu einem gepfefferten Preis natürlich. Ein klassischer Fall für unser Institut. Wertvolles Material wurde vergeudet, nur damit sich die Firma gesundstoßen konnte.
Grivas, der bei uns für diesen Bereich zuständige Mitarbeiter, hatte deshalb auch gleich seinen Bericht in die Kassette gegeben und die Zustimmung des Chefs erhalten, etwas zu unternehmen. Ein ganz normaler Vorgang. Wir würden beim Vertriebsamt, das die Genehmigung erteilt hatte, Protest einlegen.
Doch für Lenny, der mit dieser Angelegenheit im Grunde nichts zu schaffen hatte, war das anscheinend nicht normal. Kaum erfuhr er durch das Informationszirkular von der Sache, sprang er hinter seinem Schreibtisch auf und rannte aus dem Zimmer. Ich hatte keine Ahnung, wohin er wollte.
Er lief in die Direktion – eine Stunde später, beim Mittagessen, hörte ich es von der Chefsekretärin. „Stellen Sie sich vor“, sagte sie, noch immer vor Erregung zitternd, „er riss plötzlich die Tür auf und stürmte, ohne Notiz von mir zu nehmen, zu Dr. Kahl hinein. Der nicht mal allein war, er empfing gerade einen ausländischen Gast. Einen Eindruck muss der von uns kriegen! Ich sauste hinterher, ich wollte Ihren Kollegen zurückholen und mich entschuldigen, doch er stand schon mitten im Raum, redete auf den Chef ein. Das mache er nicht mit, er schaue nicht länger zu, wie sich alles gegen die Automobile verschwöre, dieser Grivas sei ein Schuft. Wir wussten überhaupt nicht, wovon er sprach.
Dr. Kahl wurde energisch, fragte, ob er nicht sähe, dass ein Gast anwesend sei – da kam Herr Frick etwas zu sich. Nun sehr förmlich, meldete er seinen energischen Protest im Vorfall Radverzierung an. Dann verschwand er. Ich hab’ ihn – mitten am Arbeitstag – in seinen Wagen steigen und wegfahren sehn.“
Das Ereignis sprach sich schnell im Institut herum, und nur die Tatsache, dass der Chef den Kopf mit dem Jahresplan voll hatte, bewahrte Lenny vor größerem Ärger.
Da er seine Attacken „zugunsten der benachteiligten Motorfahrzeuge“, wie er das mir gegenüber einmal nannte, jedoch weiterhin störrisch gegen jedermann führte, konnten die Beschwerden über ihn nicht ausbleiben. „Frick hat einen ganz üblen Autotick“, sagten die Kollegen, „er muss zum Arzt, bevor er endgültig durchdreht.“
Sie sagten es ihm nicht direkt ins Gesicht, baten mich als seinen Freund aber, ihn zu einem Besuch in der Nervenklinik zu überreden. Ich nahm mir vor, zunächst mit seiner Frau zu sprechen.
Das geschah an einem Sonnabend. Es war nicht schwer, Rasa allein zu Hause anzutreffen, denn Lenny trieb sich in der Freizeit nur noch mit dem Sanften Blitz herum. „Es ist schlimmer, als wenn er’s mit irgendeinem Flittchen hätte“, erklärte seine Frau, „ich weiß nicht mehr, was ich davon halten soll.“
„Deshalb bin ich hier, Rasa. Auch im Institut benimmt er sich sonderbar. Wir alle machen uns Sorgen um ihn. Vielleicht sollte er einmal einen Psychiater aufsuchen.“
„Dazu wird er sich auf keinen Fall bereit finden.“
„Auch nicht, wenn du mit ihm sprichst? Schließlich habt ihr gemeinsam einen Sohn großgezogen, in den Jahren eurer Ehe so manches Hindernis genommen.“
„Ich fürchte, er wird mir gar nicht zuhören. Oder noch schlimmer, jedes Wort als Provokation auffassen. Du hast ja keine Ahnung, wie empfindlich er in letzter Zeit reagiert.“
„Versuch es trotzdem“, bat ich, „und ruf mich an, wenn du mit ihm geredet hast. Du weißt, ich bin jederzeit für euch da.“
Ich ging nach Hause und widmete mich einigen liegengebliebenen Arbeiten. Da die Sonne schien, setzte ich mich auf den Balkon. Es war kurz nach Mittag, als ein mir wohlbekannter PKW in die Allee vor unserm Haus einbog und direkt unter unserem Fenster hielt. Lenny Frick stieg aus, sah mich sitzen und rief im Befehlston: „Komm herunter, ich hab’ mit dir zu sprechen.“
„Wollen wir uns nicht lieber hier oben unterhalten, bei einem Glas Fresh?“
„Nein, komm runter.“
„Wie du wünschst“, erwiderte ich und legte meinen Papierkram beiseite.
Unten angelangt, sah ich ihn bereits wieder hinterm Lenkrad.
„Steig ein“, er hatte die rechte Tür geöffnet.
„Na hör mal. Ich hab’ zu arbeiten.“
„Das könnte dir so passen“, sagte er. „Rasa gegen mich aufhetzen und dann kneifen.“
Innerlich seufzend, stieg ich in den Wagen. Wahrscheinlich wollte er mich zu seiner Frau fahren. Vielleicht hatte sie darum gebeten.
Der Sanfte Blitz setzte sich lautlos in Bewegung, Sitz- und Rückenpolster schmiegten sich dem Körper schmeichlerisch an. Lenny sagte: „Na, spürst du nun, was das für ein Wesen ist. Du darfst von Glück reden, in den Genuss dieser Berührung zu kommen. Aber schließlich warst du mal mein Freund.“
„Bin ich es nicht mehr?“
„Sieht kaum so aus. Oder glaubst du, ich merke nicht, wie du mich mit ihr auseinanderzubringen suchst?“
„Mit Rasa?“
Er warf mir einen verächtlichen Blick zu, seine Hand streichelte das Armaturenbrett. „Sei nicht albern. Rasa und ich sind seit langem geschiedene Leute.“
„Bist du verrückt?“
Er lachte höhnisch. „Verrückt, das möchtet ihr alle. Mich in eine psychiatrische Klinik verfrachten, weil ihr die Zeichen der Zeit nicht versteht. Aber daraus wird nichts.“
„Lenny, was redest du. Können wir uns nicht in Ruhe und vernünftig unterhalten. Wenigstens fünf Minuten lang. Hat Rasa denn verdient, dass du so mit ihr umspringst?“
„Sie ist frei, kann tun und lassen, was sie will. Wie ihr alle. Nicht ich bin’s, der anderen das Leben beschneidet.“
Inzwischen hatte ich bemerkt, dass wir nicht zu Lennys Haus, sondern aus der Stadt hinausstrebten. Mir wurde unheimlich. „Wo fahren wir hin?“, fragte ich.
„Wirst es gleich sehn.“
In Wirklichkeit glitten wir noch eine ganze Weile dahin. Kreuz und quer, durch eine Gegend, in der ich mich nicht auskannte. Schließlich bog Lenny von der Straße ab und in einen grasbewachsenen Feldweg ein. Nach kurzer Zeit erreichten wir ein alleinstehendes Bauernhaus, das einen verfallenen Eindruck machte. Nur die Scheune schien einigermaßen intakt.
„Wir sind da“, sagte Lenny und hielt vor dem Scheunentor.
Wir stiegen aus, alles blieb still. „Gehört das dir?“, fragte ich.
„Uns. Rasa kann die alte Wohnung behalten.“
Ich zog es vor, auf eine Antwort zu verzichten, und schaute zu, wie Lenny das Scheunentor öffnete. Der Anblick, der sich mir im Innern des Gebäudes bot, war mehr als verblüffend. Man stelle sich einen großen Raum vor, der halb Wohnzimmer, halb Garage ist. Die Wände weiß gestrichen, an Möbeln gerade das Nötigste für eine Person: ein Schrank, eine Liege, ein Stuhl, ein Tisch, und all das auf die eine Seite des Zimmers verteilt. Auf der andern dagegen eine große, flache Mulde, mit dicken Schaumstoffmatten ausgelegt. Poster und Fotos von schnittigen Automobilen bzw. von Männern, die sich an sie lehnten.
Während ich noch staunte, saß Lenny bereits wieder im Wagen, dirigierte ihn mit sicheren Bewegungen durch die Toröffnung in das Zimmer. Sacht glitt der Sanfte Blitz an den Möbeln vorbei in die Mulde. Als wollte er es sich so recht bequem machen, ruckte er ein wenig vor, ein wenig zurück und gab dann ein Geräusch von sich, das man für ein zufriedenes Ächzen halten konnte.
„Ruh dich jetzt aus, Liebling.“ Lenny kletterte aus dem Wagen und gab ihm einen Klaps aufs Dach. „Na, was sagst du nun“, wandte er sich an mich.
„Du hast das Gehöft gepachtet?“
„Gekauft, es war ganz billig. Hier werden wir in Zukunft leben.“
„Lenny“, sagte ich und versuchte meiner Stimme einen behutsamen Klang zu geben, „das kann nicht dein Ernst sein.“
„Und ob es mein Ernst ist. Schluss mit dem Versteckspiel. Ich liebe sie und bin bereit, das vor aller Welt zu bekennen.
„Es handelt sich um ein Auto, ein totes Ding.“
„Das behauptet ihr, die ihr eure Herrenideologie begründen müsst. Für euch haben Maschinen keine Seele. Wenn du wüsstest, wie zärtlich sie mich überallhin trägt. Wie dankbar sie sein kann, wenn man sie pflegt und mit Treibstoff versorgt.“
„Hör auf, Lenny, ich kann nicht glauben, dass du dich so verrennst.“
Sein Gesicht wurde hart. „Dann geh doch zurück zu den andern und erzähl ihnen, was für ein Narr ich bin. Das war ja von jeher eure Art, euch mit Avantgardisten auseinanderzusetzen. Los, hau schon ab, servier’s den lieben Kollegen brühheiß. Ich will mit ihnen sowieso nichts mehr zu tun haben. Sie und du, ihr seid eine Sorte. Überheblich, rückständig, egoistisch. Lauf nach Hause zu deinem Volvano und behandle ihn als Sklaven. Wie ihr’s seit hundert Jahren gewohnt seid. Aber wundere dich nicht, wenn die Entwicklung über dich hinweggeht. Wenn dich die Woge überrollt, wir sind viel mehr, als du ahnst. Die neue Welt der Symbiose wird kommen, verlass dich drauf. Der Automensch steht vor der Tür, das Menschauto begehrt mit Donnerhupen Einlass!“ Er wandte mir den Rücken zu und schloss mit einem Knall das Tor. Der Sanfte Blitz ruckte in seinem Bett, als schüttle er sich vor Empörung.
Ich fuhr per Anhalter in die Stadt zurück und berichtete Pimpella von diesem Erlebnis. Ich rief auch Rasa an, versuchte ihr die Szene zu beschreiben, schonend beizubringen, dass kaum mehr mit einer Rückkehr Lennys ins normale Leben zu rechnen sei. Sie wusste es längst. „Es ist sinnlos, ich werde die Scheidung einreichen“, sagte sie.
Am Montag erfuhr ich im Institut, dass Lenny gekündigt hatte. Was unseren Chef der Pflicht enthob, etwas zu unternehmen. Ich fragte mich, wovon mein Freund nun seinen Lebensunterhalt bestreiten wollte. Die Pkw-Steuer und das Benzin für den Sanften Blitz musste er ja gleichfalls bezahlen.
Einige Monate hörte ich nichts von Lenny. Ich war mehrfach versucht, zu jener abgelegenen Scheune zu fahren, aber abgesehen davon, dass ich mir den Weg nicht gemerkt hatte, hielt mich die Furcht ab, noch schlimmerer Abnormität zu begegnen. Rasa wusste ebenfalls wenig von ihm, sie war vorübergehend zu ihrem Sohn gezogen. Sie meinte, er schreibe Artikel für die Zeitschrift „Dein Motor“ und lebe von der Hand in den Mund. Kürzlich sei er mit Gleichgesinnten bei einer Plakatklebeaktion gesehen worden. Das hatte sie freilich nur über drei Ecken gehört, von einem Freund ihrer Freundin.
Ich hatte Lenny fast vergessen, als er mich eines Nachts aus dem Schlaf holte. Es war später Oktober, der Sturm heulte ums Haus, schneidende Kälte stand vorm Fenster. Ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir und schlief fest, als mich das ununterbrochene Schnarren des Tür-Videofons weckte. Erst begriff ich nicht, was los war, dann drückte ich den Empfangsknopf. Ein Gesicht, das mir zugleich fremd und bekannt vorkam, erschien auf dem Minischirm, und eine an das Tuckern eines Viertakters erinnernde Stimme sagte: „Maltus, hier ist Lenny, du musst mir helfen.“
„Lenny Frick? Du lebst noch? Was treibt dich mitten in der Nacht hierher?“
„Entschuldige, dass ich dich geweckt habe. Wir sind in Not. Du musst mir deinen Wagen leihen.“
„Den Volvano? Jetzt?“
„Ja. Nur für eine Fahrt nach Rieftal: Dort gibt’s einen Nachtservice. Es geht um … um meine Frau.“
„Du hast wieder geheiratet“, sagte ich erleichtert, „ich gratuliere. Komm rauf.“
„Nein, ich muss sofort los. Ein wichtiges Medikament. Sie ist … schwanger.“
Etwas in seiner Tonlage hätte mich stutzig machen müssen, aber ich war noch zu benommen. Ich warf einen Mantel über, griff zu Auto- und Garagenschlüssel, ging nach unten. „Lenny, altes Haus. Ich freu’ mich, dass du dich an mich wendest.“
Er schien meinen Enthusiasmus nicht zu teilen. Mit großen Scheinwerferaugen sah er an mir vorbei. „Danke, wir werden es dir nicht vergessen.“
Es war keine Zeit, nach Einzelheiten zu fragen, er rauschte ab. „Ich stell’ den Wagen nachher in die Garage und werf die Schlüssel in den Briefkasten“, sagte er noch. Ich ging ins Haus zurück und legte mich wieder ins Bett. Pimpella hatte von all dem nichts mitgekriegt.
Am andern Morgen stand der Volvano tatsächlich in der Garage, und wären nicht die Schlüssel im Briefkasten gewesen, ich hätte an einen Traum geglaubt. Von Lenny jedenfalls keine Zeile. Nun ja, er war wohl in Eile und in Gedanken bei seiner Frau gewesen. Wie mochte er überhaupt nach Hause gekommen sein? Per Anhalter oder mit dem Nachtbus? Vielleicht war sein Sanfter Blitz in der Werkstatt, oder er hatte ihn gar verkauft. Das allerdings schien mir nach dem, was vorangegangen war, doch ziemlich unwahrscheinlich.
Ich schwor mir, ihn in seinem Bauernhaus zu besuchen, aber eine Dienstreise und ein langer strenger Winter hielten mich erneut davon ab. Außerdem wartete ich auf eine Nachricht von ihm. Erst im Mai raffte ich mich auf. Pimpella, gespannt auf seine zweite Frau, begleitete mich.
Wie vermutet, hatten wir Mühe, den Weg zu finden, wir kurvten lange zwischen Fluren und Wäldern umher. Aber als wir schon aufgeben wollten, lag das Gebäude plötzlich vor uns. Wir hatten uns ihm, ohne es zu merken, von hinten genähert.
Ganz heranzufahren war nicht möglich; wir stiegen aus und legten die letzten fünfzig Meter zu Fuß zurück. Ein löchriger Zaun hinderte uns nicht, bis zu jener Scheune zu gelangen, die ich bereits kannte. Das Wohnhaus daneben sah baufälliger aus als vorher, doch sie selbst war renoviert und außen frisch gestrichen. Auch ein Fenster war in die Rückwand gebrochen worden.
„Er scheint tatsächlich noch in diesem Schuppen zu wohnen“, sagte ich enttäuscht zu Pimpella, „wer weiß, was uns hier erwartet.“
„Wollen wir nicht erst mal einen Blick durchs Fenster werfen?“
Wir schlichen uns an die Scheune heran, pressten unsere Nasen gegen die Scheibe.
Was wir sahen, war eine Idylle besonderer Art. Inmitten des Mobiliars, das sich kaum verändert hatte, nur durch Sessel und eine große Duschanlage neben der Tür ergänzt worden war, lagerten Lenny und der Sanfte Blitz. Um ein Spielgitter, wie wir es noch von unseren Kindern her in Erinnerung hatten. Sie waren in aufgekratzter Stimmung, sie amüsierten sich über zwei Babys, die bei bester Gesundheit schienen. Kentaurzwillinge mit einem Menschenkopf und einem Hinterteil aus Blech. Die Babys brummten, quietschten, lallten mit Autostimme, und eins von ihnen, ich schwör’s, hielt sich schon ziemlich gut auf seinen vier kleinen Rädern.
Flusspferde eingetroffen
Bella-X 3 sah fasziniert auf die Anzeige im Schaufenster der Zoohandlung. „Flusspferde eingetroffen!“ stand da in leuchtender Phosphorschrift. Das war eine echte, sehr angenehme Überraschung. Gerade gestern, kurz vor dem Rückflug aus der Hauptstadt, hatte sie wie nebenbei gehört, dass Flusspferde der letzte Schrei waren. Wer etwas auf sich hielt, versuchte eins für sein Grundstück zu ergattern. Ihre Freundin Carry-Gama war ganz traurig gewesen, dass sie noch keins hatte. „Es ist schwer ranzukommen“, hatte sie gesagt, „wenn du wüsstest, wie selten die Tiere sind.“
Bella-X 3 betrat aufgeregt den Superladen, der vom Lärm trillernder Vögel und kreischender Affen erfüllt war. Sie hatte keine genaue Vorstellung vom Aussehen eines Flusspferdes, erinnerte sich aber an ein Tierkarussell ihrer Kindheit, mit dem sie ein paar Mal gefahren war. Deshalb dachte sie an eine Art Pony mit Schwimmhäuten an den Hufen oder mit Rückenflosse. Ja, wenn es um das neueste Modell des Königsflyers gegangen wäre oder um den Springwagen Typ Magnifique. Die waren in jeder Wochenzeitschrift fotoplastiert und in allen Einzelheiten beschrieben. Aber Flusspferde? Bella-X 3 konnte sich nicht erinnern, jemals eins abgebildet oder gar in natura gesehen zu haben. Im Tierpark der Hauptstadt, dem einzigen, den es im Land gab, sollte man ein oder zwei Exemplare besichtigen können. Vielleicht hätte sie die Gelegenheit wahrgenommen, hätte sie nicht nach Hause zurück gemusst.
In dem weiträumigen Laden herrschte ein bläuliches Halbdunkel, doch die junge Frau wusste sofort, wohin sie sich zu wenden hatte. Hinten rechts stand eine Schlange, und dort wurde ihr auch in der gleichen leuchtend grünen Schrift wie im Fenster bedeutet: „Flusspferde hier!“ Zu sehen war keins der seltenen Tiere, das verwunderte aber auch niemanden. In diesem Vorraum war nur der Automat aufgestellt, der das Geld entgegennahm und den entsprechenden Bon aushändigte. Die Tiere befanden sich in der hinteren Halle, wo man sie auch besichtigen konnte.
Aber wer nahm sich dafür schon die Zeit. Es kam darauf an, sich sofort in die Schlange einzureihen, um nicht vielleicht in letzter Minute leer auszugehen. Wenn es sich um so etwas Kostbares drehte! Die anderen kauften ja gleichfalls unbesehen.
Bella-X 3 stellte sich also an und kramte in ihrer Handtasche nach den großen Scheinen. Eine solche Erwerbung würde nicht ganz billig sein. Etwas verlegen fragte sie einen untersetzten, vierschrötigen Kerl vor ihr, ob er etwas über den Preis wüsste. „Drei Rote“, erwiderte der Mann unfreundlich, „da steht’s doch groß und breit, können Sie nicht lesen?“
Drei Rote, tatsächlich, an einer Tafel über ihr blinkte alle paar Sekunden der Preis auf. Bellas Enthusiasmus bekam einen starken Dämpfer. Mit vier Gelben hatte sie gerechnet, höchstens mit fünf. Drei Rote dagegen – dafür konnte man einen halben Flyer kaufen. Das lag, bei Licht besehen, über ihren finanziellen Möglichkeiten. So viel Geld trug sie natürlich auch nicht bei sich, sie musste es vom Konto abbuchen lassen. Eduard-Orion würde rot und blass werden, wenn er das hörte. Aber sollte sie deswegen diese einmalige Gelegenheit auslassen? Er würde sich schon wieder abregen. Irgendwie waren sie immer zusammengekommen.
Der Automat erledigte seine Arbeit zuverlässig und schnell. Bella-X 3 bewegte sich in der Schlange, die keineswegs kürzer wurde, zügig voran. Aber kurz vor dem Ziel war erst einmal Schluss. „Die kommen mit der Auslieferung nicht nach“, sagte eine dralle Frau hinter ihr. Es war immer dasselbe bei solchen Einkäufen.
Zwei Männer in der Schlange unterhielten sich, Bella spitzte die Ohren. Sie hätte gern Genaueres über die Tiere erfahren, scheute sich aber, durch Fragen ihre Unwissenheit einzugestehen. Dabei war es eigentlich keine Schande: Woher sollte man in dieser Welt aus Plast und Beton solche Kenntnisse haben. Wenn sie wenigstens einen Blick in die hintere Halle hätte werfen können. Vielleicht hätte sie jetzt Zeit dazu gehabt, aber konnte man denn wissen, ob der Automat nicht doch im nächsten Augenblick weiterarbeitete? Dann war ihr Platz vergeben, und sie hätte sich wieder hinten anstellen müssen. Wer aber konnte sagen, wie weit der Vorrat reichte. Da verließ sie sich lieber auf Carry-Gama. Wenn die so von diesen Flusspferden geschwärmt hatte, ging die Sache schon in Ordnung.
Etwas Exaktes konnte Bella-X 3 nicht erlauschen, sie erfuhr nur, dass die Tiere am liebsten Schlingpflanzen fraßen und – wie der eine Mann meinte – sehr gutmütig waren. Na also, dachte sie, Ponys mit einer Neigung zum Wasser. Da muss Eduard Orion eben ab und zu zum See rüber, einen Packen Schilf holen. Hat er eine neue Freizeitbeschäftigung. Sonntags können wir das Tierchen ja auch mal an den Fluss führen. Als wir noch unseren Spitz hatten, waren wir sowieso öfter am Fluss als jetzt. Hat uns eigentlich ganz gut getan.
Gerade als Bella-X 3 ihren Scheck einwerfen wollte, erhaschte sie noch einen Satz über Eisen- oder besser Elektrobarrieren, die man brauche, um das Flusspferd ungefährdet in Schach zu halten. Sie stutzte, erschrak sogar etwas, kam aber nicht mehr zum Überlegen. „Möchten Sie zurücktreten?“, fragte mit knarrender Stimme der Automat.
„Nein, nein, ich bin sehr interessiert“, stotterte Bella. Sie warf ihren Scheck in den dafür bestimmten Kasten. Das Signal, das die Richtigkeit des Papiers bestätigte, kam eine Sekunde später. Nun waren die Würfel gefallen, es gab kein Zurück mehr.
Von leisen Zweifeln geplagt, nichtsdestoweniger aber mit einem Gefühl stolzer Genugtuung betrat Bella-X 3 die hintere Halle. Eine Menge Schaulustiger drängte sich an der Auslieferung, so dass ihr die Sicht verdeckt war. Erst als sie ihren Bon schwenkte, machten ihr die Leute widerwillig Platz. Ein Verkäufer in grauer Berufskleidung, mit Goldlitzen auf den Ärmeln, winkte sie nach hinten. „Kommen Sie, noch haben Sie die Wahl“, sagte er fröhlich.
Die Flusspferde standen in großen, kahlen Boxen bis über den Bauch im Wasser und glotzten unbeteiligt vor sich hin. Sie waren so mächtig und massig, dass Bella-X 3 zunächst an eine Verwechslung glaubte. Pferde hatte sie zur Genüge in alten Büchern gesehen – diese gewaltigen plumpen Tiere konnten nicht von der gleichen Rasse sein. Als sie dann begriff – begreifen musste –, was sie gekauft hatte (für einen so unmäßigen Preis), blieb ihr fast das Herz stehen. Sie musste sich abwenden und zwei ihrer Coeur-fit-Tabletten schlucken. Worauf, heiliger Kosmos, hatte sie sich da eingelassen. Was sollte sie mit einem solchen Vieh anstellen?
Der Verkäufer, geschäftig und vom Wert seiner Ware überzeugt, merkte nichts von ihren Nöten. „Na“, sagte er, „sind das nicht ein paar prächtige Exemplare. Zum Beispiel die junge Dame hier“ – er wies auf einen der nackthäutigen Kolosse, der gähnend das breite Maul aufriss –, „sie hat einen Appetit wie zehn Ochsen. Sie wird Ihren See wunderbar von allem Geschling und Geranke frei halten.“
„Wir haben keinen See“, flüsterte Bella-X 3.
„Oder der Herr mit dem – verzeihen Sie – Supergesäß. Beachten Sie, wie wuchtig seine Bewegungen sind. Wie stark seine Eckzähne. Keine Ihrer Freundinnen dürfte einen so schönen Bullen aufzuweisen haben.“
„Besitzen Sie keine kleineren Exemplare?“
„Kleinere?“, fragte der Mann indigniert. „Da bekommen wir zum ersten Mal seit Jahren für den Allgemeinbedarf direkt aus Afrika richtige ausgewachsene Flusspferde, und Ihnen sind sie zu groß. Man kann den Leuten eben nichts recht machen. Kaufen Sie sich doch ein Meerschweinchen, wenn Sie ein kleineres Tier haben wollen.“
Bella-X 3 schwieg eingeschüchtert. Als ihr aber der Herr mit dem Supergesäß in wahrscheinlich durchaus friedlicher Absicht den Kopf zuwandte und die herrlich riesigen Elfenbeineckzähne zeigte, nahm sie all ihren Mut zusammen. „Ich möchte den Kauf rückgängig machen“, sagte sie.
Der Verkäufer maß sie eisig von Kopf bis Fuß. „Ganz unmöglich, das geht nicht.“
„Aber ich … es handelt sich um einen Irrtum. Ich habe keine Verwendung dafür.“
„Das hätten Sie sich schon eher überlegen müssen, liebe Frau. Schließlich handelt sich’s nicht um eine Zahnbürste.“
„Na, wie ist’s, geht’s hier endlich weiter“, drängte in diesem Augenblick ein junger Mann, der seiner Uniform nach zum Wartungspersonal der unterirdischen Wasserreservoirs gehörte, „ich hab’ nicht so lange Zeit, muss wieder an die Arbeit.“
„Da beschweren Sie sich bitte bei dieser Dame“, sagte der Verkäufer steif, „manche Leute wissen einfach nicht, was sie wollen.“
„Ich … ich hab’ nicht gedacht, dass diese Flusspferde so groß sind“, flüsterte Bella-X 3.
„Nehmen Sie doch das kleine da drüben“, empfahl der junge Mann und wies auf eine Eckbox. „Es passt genau zu Ihrem Typ.“ Er lachte unverschämt.
Tatsächlich schien das Tier in der Ecke etwas weniger massig. Während die anderen Flusspferde durchweg vier bis fünf Meter maßen, mochte es nicht mehr als drei fünfzig lang sein.
„Wenn Sie es unbedingt wieder los sein wollen, brauchen Sie nur eine Anzeige in der Abendzeitung aufzugeben“, sagte der Verkäufer etwas freundlicher. „Es ist ja ein Modeartikel. Interessenten finden sich genug.“
Bella-X 3 gab sich geschlagen. „Und wie kriege ich das Tier auf mein Grundstück?“
„Fürs Abholen ist der Kunde selbst zuständig“, sagte der Verkäufer. „Sie wissen doch, Personalmangel.“ Und er fügte humorvoll hinzu: „Immerhin ist es ja keine siebenteilige Anbauwand, die Sie zu Hause selbst zusammenbauen müssten.“
Der Transport des Flusspferdes auf ihr kleines Grundstück kostete Bella-X 3 weitere zwei Gelbe, aber sie konnte von Glück reden, dass sie überhaupt einen LKSW, einen Luftkissenspezialwagen, dafür bekam, die Nachfrage war in diesen Tagen ungeheuer. Wenigstens bedeutete ihr das der Vermietungsautomat am Videofon.
Mit der Anlieferung des Tieres ergaben sich dann sofort neue Probleme. Nicht, dass Dickbein, wie es von dem zunächst entsetzten, später resignierenden Eduard-Orion getauft wurde, aggressiv gewesen wäre – es schickte sich durchaus in sein Los, schien sogar froh, der tristen Box in der Zoohandlung entronnen zu sein. Aber Bella-X 3 war doch gezwungen, seinen Eigenheiten Rechnung zu tragen. So musste zum Beispiel der Swimmingpool erweitert und eine Elektrobarriere errichtet werden, die das Tier an Ausflügen in die Nachbargärten hinderte. Schon am zweiten Tag seiner Anwesenheit war nämlich ein unangenehmer Zwischenfall eingetreten, als Biggi-F, der Nachbarsjunge, das Flusspferd mit gespaltenen Laserstrahlen beschoss. Nach einer Zeit geduldigen Kopfschüttelns war Dickbein urplötzlich aus dem Wasser gerast und hatte in blinder Wut den Elastikzaun, die Beleuchtungsanlage des Nachbarn, seine erst kürzlich aus Betonsilber errichtete Veranda niedergerissen. Biggi-F hatte sich vor dem heranstürmenden Tier gerade noch durch einen Sprung in den Dungkompressor retten können, der glücklicherweise nicht in Betrieb war. Lediglich die Tatsache, dass besagtes Betonsilber (ein Mangelartikel) vom Nachbarn illegal beschafft worden war, hatte Bella-X 3 vor einem Prozess bewahrt.
All die uneingeplanten Kosten zehrten das ohnehin reduzierte Konto der X-Orions mit bestürzender Schnelligkeit auf. Allein das Futter, das einmal in der Woche durch einen Flyer des Großhandels herangeschafft werden musste, verschlang soviel wie der normale Haushalt der Familie. Dass Dickbein eine echte Sensation für Verwandte und Bekannte, ja sogar für die gesamte nähere Umgebung darstellte, war dabei nur ein schwacher Trost. Gewiss, es schmeichelte Bellas Stolz, wenn Enrico Plü beeindruckt sein Kunstbärtchen zwirbelte und vor den versammelten Freundinnen vom Club Future ausrief: „Du bist doch die Größte!“ oder wenn ihr durch die Tätowiererin im Schönheitssalon „Blau auf Weiß“ zugetragen wurde, die Schwestern Elektron, die immer im Mittelpunkt stehen wollten, seien ganz krank vor Neid. Aber die Arbeit mit dem Flusspferd, die Geldsorgen blieben ihr trotz allem. Der Swimmingpool war blockiert, der Rasen davor nicht passierbar, wenn Dickbein seinen Kot, wie bei Flusspferden üblich, im Kreis verteilt hatte. An Wochenendruhe war auf dem Grundstück erst recht nicht mehr zu denken. Dafür sorgten schon die Pilgerzüge von Neugierigen, die sich ständig am Zaun vorbeibewegten. Von Sonnenaufgang bis in die späte Nacht hinein ging das. Wenn sich die Leute wenigstens mit Anschauen begnügt hätten. Aber nein, da flogen Lebensmittelreste aller Art in den Garten, doch auch andere Gegenstände und sogar Steine. Um Dickbeins Fresslust zu testen, es anzustacheln, wenn es einmal nicht gewillt war, sein Konterfei zu zeigen. Der Zaun wurde beschädigt, die Nachbarn beschwerten sich über den Lärm und reichten Klage ein. Die X-Orions hatten stundenlang mit Reparaturen zu tun, mussten alle paar Tage eine Ladung Müll zum Schuttplatz fahren. Vitaminpastetuben, große Eislimonadenbeutel, Kunststoffmelonen, Zuckerersatzstäbe. Schließlich waren sie sogar gezwungen, einen Stachelbetonzaun zu errichten. Erst danach wurde es auf dem Grundstück etwas ruhiger.
Natürlich hatte Bella, dem Rat des Verkäufers aus der Zoohandlung folgend, Dickbein wieder abstoßen wollen. Sie hatte eine fett gedruckte Anzeige in der Abendzeitung aufgegeben, doch ohne jeden Erfolg. Das war auch nicht erstaunlich, nahmen doch die Verkaufsangebote von Flusspferden in der Presse urplötzlich lange Spalten ein. „Vielen Leuten ist es wie Ihnen ergangen“, sagte mit belustigtem Lächeln das Roboterfräulein in der Anzeigenannahme, „sie haben die Viecher erstanden, ohne zu wissen, was sie taten. Versuchen Sie’s doch mal im Tierpark oder beim Säuberungsdienst der Talsperren. Da müssen Sie freilich stark im Preis heruntergehen.“
Aber auch dort kam Bella zu spät. Selbst geschenkt nahmen die erwähnten Institutionen keine Flusspferde mehr an. Wenigstens für die nächsten zwei Jahre nicht. Erst mussten die Investitionen genehmigt sein, die für die Versorgung und den Schutz der Tiere notwendig waren. Die junge Frau wollte einen Rat von Carry-Gama einholen, Dickbein, wenn irgend möglich, an sie abtreten, doch die Freundin befand sich auf einer Studienreise in der Antarktis. Der Himmel mochte wissen, wer ihr die Genehmigung hierzu verschafft hatte. Auf jeden Fall war sie für die folgenden Monate außer Reichweite.
Da half alles nichts, die Sache musste durchgestanden werden. Um das Futter bezahlen zu können, nahm Eduard-Orion einen Kredit bei der Naturschutzbank auf. Außerdem vermieteten sie ihre Wohnung an einen auf Stadttrubel bedachten Mars-Eremiten. Sowohl Bella als auch ihr Mann machten Überstunden. Für ihn als Dispatcher von Gebäudereinigungsautomaten war das nicht ganz so anstrengend wie für sie, die nach sieben Stunden intensiver visueller Konzentration ohnehin ziemlich durchdrehte. Sie arbeitete nämlich in einer Textilschweißanstalt und hatte die Lichtbündel zu beobachten, mit denen farbige Muster in Exportteppiche gebrannt wurden. Wenn Bella-X 3 nun nach neun oder zehn Stunden dieser Tätigkeit in die Aluzementhütte zurückkehrte, die jetzt ihr Zuhause war, hatte sie keinen Blick mehr für den eigentlich recht freundlichen Dickhäuter. Höchstens, dass sie manchmal nach kargem Abendbrot durch ein jähes Schnauben auf ihn aufmerksam gemacht wurde, das aus dem Dunkel des Wasserbassins zu ihr herüberdrang.
So vergingen zwei Jahre, und eines Tages geschah, was die X-Orions nach den Strapazen der Vergangenheit nur als einen großen Glücksfall ansehen konnten. Die Frist jenes Kredits war abgelaufen, den die Naturschutzbank gewährt hatte, und da es den Ehepartnern unmöglich war, die Summe nebst Zinsen aufzubringen, wurde ihr Besitz gepfändet. Genauer gesagt, das Flusspferd, einziger noch vorhandener Wertgegenstand (immerhin hatte es zwei herrliche Elfenbeineckzähne), wurde beschlagnahmt. Mit einer Träne im Auge, aber Freude im Herzen sah Bella seinem Abtransport zu. Dickbein gähnte zum Abschied melancholisch, ehe es in den Luftkissenspezialwagen stieg. Man würde es in einer Talsperre im Süden unterbringen, die Gelder für die hierzu notwendigen Investitionen waren inzwischen genehmigt worden.
Am nächsten Tag kehrten Bella und Eduard in ihre Wohnung zurück. In Anbetracht der bevorstehenden Pfändung hatten sie dem Mars-Eremiten gekündigt und eine Woche unbezahlten Urlaub genommen. Sie wollten nur eins tun: sich erholen. Schlafen, essen, vorm Panotelevisor sitzen. Gerade hatten sie eine Werbeschau für das neuste Modell des Königsflyers angestellt, knabberten jeder an einer Synthetikdelihasenkeule, als der Gästeanzeiger zu summen begann.
Bella erhob sich äußerst unwillig und ging zur Tür. Draußen stand, in eine Art Plastschutz gehüllt und mit einer Aluzell-Kiste unterm Arm, ihre Freundin Carry-Gama.
„Carry, du“, rief Bella mehr erstaunt als erfreut, „seit zwei Jahren hab’ ich nichts mehr von dir gehört. Erst hieß es, du seist in der Antarktis, dann sagte man mir, du hieltest dich in Südamerika auf. Nie hast du uns eine Zeile geschrieben. Wo kommst du auf einmal her?“