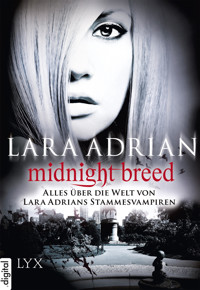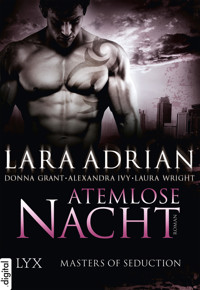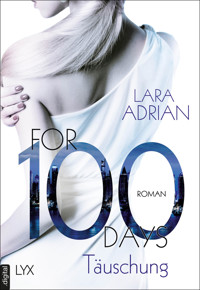
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die 100-Reihe
- Sprache: Deutsch
Jede Täuschung hat ihren Preis ...
Drei Monate Housesitting in einem Luxus-Apartment in Manhattan - die Künstlerin Avery Ross kann ihr Glück kaum fassen, schlägt sie sich doch gerade so mit ihrem Kellnerjob durch. Avery betritt eine Welt der Dekadenz, die ihr den Atem raubt - die Welt von Dominic Baine: reich, arrogant und absolut unwiderstehlich. Der Milliardär, der das Penthouse im selben Gebäude bewohnt, erweckt ungeahnte geheime Sehnsüchte in ihr. Doch die Schatten ihrer Vergangenheit drohen Avery schon bald einzuholen und jegliche Hoffnung auf eine Zukunft mit Nick zu zerstören ...
Der neue Roman von Bestseller-Autorin Lara Adrian: For 100 Days - Täuschung.
Prickelnde Unterhaltung für Fans von erotischen Liebesromanen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839DanksagungDie AutorinDie Romane von Lara Adrian bei LYXImpressumLARA ADRIAN
For 100 Days
Täuschung
Roman
Ins Deutsche übertragen von Firouzeh Akhavan-Zandjani
Zu diesem Buch
Drei Monate gut bezahltes Housesitting in einem Luxus-Apartment in Manhattan – die Künstlerin Avery Ross kann ihr Glück kaum fassen, schlägt sie sich doch gerade so mit ihrem Kellnerjob durch, um zu überleben. Zudem hat sie soeben eine Kündigung von ihrem Vermieter erhalten. Avery betritt eine Welt der Dekadenz, die sie sich niemals vorstellen konnte – die Welt von Dominic Baine: unfassbar reich, arrogant und absolut unwiderstehlich. Der Milliardär, der das Penthouse im selben Gebäude bewohnt, erweckt geheime Sehnsüchte in ihr und erfüllt ihre dunkelsten Fantasien. Doch ganz gleich wie groß ihr Verlangen füreinander und wie ekstatisch der Sex sein mag, Avery macht sich keine Illusionen, dass sie für Nick mehr als eine Affäre sein könnte. Obwohl er kaum etwas von sich preisgibt, spürt sie, dass Nick genau wie sie selbst tiefe Narben in seiner Seele trägt. Aber auch Avery spielt nicht mit offenen Karten, und ihre schmerzliche Vergangenheit droht schon bald den erotischen Traum zu zerstören, in den Nick sie entführt. Ein Traum, in den sich unweigerlich tiefe Gefühle schleichen, ganz gleich, wie sehr Avery versucht, ihr Herz zum Schweigen zu bringen …
1
Der kalte Nachmittagsregen sticht wie feine Nadeln in meine Wangen, als ich zusammen mit der Menge, die gerade aus der U-Bahn gestiegen ist, die Grand Central Station verlasse. Ich zucke zusammen und ziehe mir die Kapuze meiner Jacke etwas tiefer ins Gesicht, während ich wegen des Nieselregens mit gesenktem Kopf losmarschiere und versuche, das böige Aprilwetter zu ignorieren, dessen Winde mit einem leisen Heulen durch die tiefen Täler zwischen den Wolkenkratzern der Innenstadt pfeifen.
Ich habe wirklich das Gefühl, als würde New York seit dem Tage meiner Ankunft buchstäblich mit allen Mitteln versuchen, mich fertigzumachen und wieder ins heimische Pennsylvania zurückzutreiben.
Mittlerweile sollte ich eigentlich auf launische Wetterumschwünge eingestellt sein und bin sauer, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, wieder das warme Innenfutter in meine Jacke zu knöpfen, ehe ich meine Wohnung in Brooklyn verlassen habe. Ich bin einfach zu gedankenverloren und nervös gewesen, als ich mich für die Arbeit fertig machte, und diese Stimmung begleitet mich auch jetzt, während ich die U-Bahn-Station hinter mir lasse.
Das Restaurant, in dem ich sechs Tage die Woche hinter der Bar stehe, befindet sich in der Madison Avenue ein paar Straßen weiter. Ich fange an zu zittern, als die Feuchtigkeit langsam durch meine Kleidung dringt, und strebe eilig meinem Ziel entgegen, während ich voller Neid die Leute um mich herum beäuge, die einen Regenschirm haben, der sie vor dem Regen schützt. Ich hätte meinen Schirm mitnehmen sollen. Vielleicht hätte ich das sogar getan, wären die Speichen nicht ein Opfer früherer Stürme geworden. Mal sehen … vielleicht komme ich ja irgendwann dazu, ihn zu ersetzen.
Ja, genau. Allein bei der Vorstellung muss ich fast höhnisch schnauben. Angesichts der unschönen Mitteilung, die mir mein Vermieter Anfang der Woche an die Tür geklebt hat, sind ramponierte Regenschirme eigentlich mein geringstes Problem.
Völlig orientierungslos und finanziell aus dem letzten Loch pfeifend.
Das beschreibt eigentlich genau, wie mein Leben in letzter Zeit aussieht.
Mehr als einmal war ich in den letzten anderthalb Jahren kurz davor aufzugeben und diese verfluchte Stadt gewinnen zu lassen.
Aber heute nicht.
Heute bin ich von etwas erfüllt, das ich schon lange nicht mehr hatte.
Hoffnung.
Sie durchströmt mich angenehm warm und stark, als ich endlich die doppelflügelige Tür aus Rauchglas des Vendange erreiche und das Handy in meiner Jackentasche zu klingeln beginnt. Ich habe den ganzen Tag auf diesen Anruf gewartet – seit ich die Nachricht meiner Freundin Margot auf dem Anrufbeantworter abgehört habe, in der sie mir mitteilte, sie hätte Neuigkeiten für mich, wolle mir die Einzelheiten aber persönlich übermitteln.
Geduld ist noch nie meine Stärke gewesen. Besonders wenn mein Auskommen davon abhängt. Ich hatte Margot sofort zurückgerufen, aber ihre Mitarbeiterin teilte mir mit, dass sie gerade in einer Ausstellungsbesprechung von Dominion wäre und nicht gestört werden dürfe. Das ist jetzt Stunden her.
Seitdem habe ich mir ihre Nachricht mindestens ein Dutzend Mal angehört und versucht, Margots Stimme irgendwelche Hinweise zu entnehmen, aber aus ihr spricht nur sachliche Professionalität. Warum auch nicht? Wir sind zwar befreundet, aber ich bin auch ihre Klientin. Allerdings keine sonderlich gewinnbringende. Ich kann nur hoffen, dass sich das heute Abend ändern wird. Himmel! Ich hoffe es inständig.
Ich bekomme vor Aufregung kaum noch Luft, als ich schnell ins Restaurant schlüpfe, um aus der Kälte und Nässe herauszukommen. Mein Herz rast, während ich mit halb erfrorenen Fingern in meiner Tasche wühle, um das Handy herauszuholen, das die ganze Zeit weiterklingelt.
Obwohl es noch früher Abend ist, haben sich bereits Geschäftsleute und Kreative aus der näheren Umgebung eingefunden. Anzugträger mischen sich unter Leute aus der Modebranche und Künstler an den dicht nebeneinander stehenden Tischen im Restaurantbereich und am langen, glänzend polierten Bartresen, an dem eine meiner Kolleginnen, Tasha Lopez, Drinks ausschenkt und schamlos mit einer Gruppe männlicher Gäste flirtet, die nicht ahnen, dass der verführerische Rotschopf glücklich verheiratet ist und ein kleines Kind zu Hause hat.
Tasha erspäht mich sofort, als ich zur Tür hereinkomme, und nickt mir zur Begrüßung zu, während ich an der Neuen, die am Empfangstresen steht, und an den wartenden Gästen, die bereits anfangen, eine Schlange zu bilden, vorbeigehe. Ich habe noch ein paar Minuten, ehe ich zu meiner Schicht antreten muss, und deshalb begebe ich mich in den Umkleideraum der Angestellten, um den Anruf entgegenzunehmen.
Als ich endlich mein Handy in der Hand halte, bin ich enttäuscht. Auf dem Display steht die Vorwahlnummer 570 und nicht die 212. Also ein Anruf aus Pennsylvania und nicht New York.
»Mist.« Das Wort kommt mit einem leisen Stoßseufzer über meine Lippen.
Das ist nicht der Anruf, auf den ich schon die ganze Zeit warte, und obwohl Gespräche mit meiner Mutter nie länger als eine Viertelstunde dauern, will ich die Leitung nicht so lange blockieren. Deshalb unterbreche ich das Klingeln und drücke den Anruf weg.
Denn ich bin jetzt wirklich nicht in der Verfassung, mich mit ihr zu unterhalten. Nicht jetzt. Nicht heute. Und auch nicht hier, wo ich ein freundliches Lächeln aufsetzen und mich den ganzen Abend mit Fremden unterhalten muss, während ich ihnen überteuerte Cocktails vorsetze und so tue, als wäre mein Leben nicht die völlige Katastrophe, die es nun mal ist.
Doch nichts davon verringert meine Schuldgefühle ihr gegenüber, wenn ich mir vorstelle, wie enttäuscht sie wohl gerade ist. Ich weiß, wie wichtig es für meine Mutter ist, den Kontakt zu mir zu halten. Es hat ihr fast das Herz gebrochen, als ich so weit weggezogen bin. Sie hat kein Geheimnis daraus gemacht, aber ich glaube, sie versteht, dass ich keine andere Wahl hatte. Schließlich musste ich irgendetwas für mich tun.
Ich verziehe das Gesicht und atme unwillkürlich tief durch, während ich mein Handy auf Vibrationsalarm stelle und wieder in die Tasche meiner schwarzen Jeans schiebe. Eigentlich dürfen die Angestellten bei der Arbeit keine Handys mit sich führen, aber ich hoffe, dass es unter dem locker hängenden Saum meiner schwarzen Bluse während meiner Schicht nicht zu sehen sein wird. Wenn ich es nicht dicht bei mir trage, würde ich mich heute Abend sowieso auf nichts konzentrieren können.
»Hi, Süße!« Tasha kommt in den Umkleideraum, während ich meine nasse Jacke aufhänge, und drückt mich einmal kurz. »Danke noch mal, dass du gestern Abend meine Schicht übernommen hast, Avery. Du bist die Beste.«
»Kein Problem«, erwidere ich. Und das stimmt auch. Ich konnte das zusätzliche Trinkgeld gut gebrauchen, und auch wenn nicht, hätte ich auf keinen Fall Nein gesagt. Ich weiß, dass auch Tasha an ihrem freien Tag für mich einspringen würde, wenn ich sie darum bitte.
Sie sieht mir dabei zu, wie ich meine flachen Schuhe ausziehe und schwarze, hochhackige Pumps aus meinem Beutel hervorhole, die meine Uniform für die Bar vervollständigen. Tasha hat die Arme vor der Brust verschränkt, die durch den tiefen V-Ausschnitt ihres schwarzen Oberteils großzügig zur Schau gestellt wird. Auch in der Hinsicht sind wir sehr ähnlich gekleidet – eine weitere Bekleidungsvorgabe des Vendange, die ich verabscheue. »Das meine ich wirklich ernst, Avery. Du hast mir das Leben gerettet. Joel hatte mir angedroht, einen ganzen Tageslohn einzubehalten, wenn ich nicht für eine Vertretung an der Bar sorgen würde.«
Ich verdrehe die Augen, als sie den schmierigen Restaurantmanager erwähnt. »Joel ist ein Blödmann. Wie geht es Zoe heute?«
»Viel besser. Ist nur ’ne leichte Magen-Darm-Geschichte, aber meine Schwiegermutter ist gleich in Panik geraten.« Tasha schüttelt den Kopf, sodass ihre rötlichbraunen Korkenzieherlöckchen die milchkaffeefarbenen glatten Wangen streifen. »Es ist lange her, dass Inez sich um ein vier Monate altes Baby gekümmert hat, und Zoe quengelt viel. Aber ich weiß, dass sie in guten Händen ist. Außerdem schadet es auch nicht, dass ich durch Inez nichts mehr für die Kinderbetreuung ausgeben muss, seit sie bei uns wohnt.«
Ich lächle und höre die Erleichterung, die in ihrer Stimme mitschwingt. »Ich bin froh, dass alles in Ordnung ist.«
»Ja, ich auch. Ach, übrigens … du hast Farbe am Kinn.«
»Wirklich? Mist.« Ich reibe mir das Gesicht und fische dann einen kleinen Kosmetikspiegel aus meiner Tasche. Der dunkellilafarbene Acrylfleck auf meinem Kinn sieht wie eine verblasste Prellung aus. »Ich bin mit einem meiner Bilder fast fertig«, erzähle ich, während ich den Farbfleck mit dem Daumen wegreibe. »Es ist noch nicht perfekt, aber ich arbeite daran. Ich will es fertig haben, um es Margot so schnell wie möglich zeigen zu können.«
»Der Margot aus der Galerie?«
Ich nicke und kann ein Lächeln nicht unterdrücken. »Ich erwarte heute Abend einen Anruf von ihr. Sie will mir irgendetwas mitteilen. Sie hat heute Morgen auf meinem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen, dass sie es mir persönlich sagen möchte.«
»Wow, Avery!« Tasha bekommt ganz große Augen. »Das ist ja toll. Du hast bestimmt noch ein Bild verkauft.«
Sie sagt es so, als ob meine Werke sich regelmäßig verkaufen. Das ist nicht der Fall. Außer dem einen Gemälde, das fast sofort verkauft wurde, nachdem Margot mich vor mehr als einem Jahr bei Dominion aufgenommen hatte, ist es eine sehr lange Durststrecke gewesen.
Vielleicht war dieser erste Verkauf nur ein Glückstreffer. Diese Frage habe ich mir schon häufiger gestellt … oder eher gefürchtet. Man sagt mir nach, dass ich Talent hätte. Der Himmel weiß, dass ich nichts mehr liebe als das Malen. Es ist immer mein Ventil gewesen – meine Zuflucht. Aber vielleicht genügt Leidenschaft nicht. Vielleicht hätte ich zu Hause in meiner Heimatstadt bleiben und Geld sparen sollen, um die Kunstakademie zu beenden, statt in die größte Stadt abzuhauen, die mir einfiel, sobald ich die Gelegenheit dazu bekam, auszubrechen und meinem Traum hinterherzujagen.
Tatsache ist – ich wollte fliehen. Ich wollte verschwinden.
Ich wollte jemand Neues werden, jemand anders, jemand Besseres.
Ich wollte leben. Für mich – nicht für meine Mutter und all das, was sie von mir will. Nicht einmal für meine Großmutter, die ich zu Hause betreut hatte, bis sie vor zwei Jahren an einem Lungenemphysem gestorben war.
Wenn ich jetzt versage, werde ich alle enttäuschen.
Verdammt! Wem will ich eigentlich etwas vormachen? Ich habe doch längst versagt, und falls Margot mir nicht mitteilt, dass sie all meine Werke verkauft hat, stehen die Chancen gut, dass ich noch vor Ende des Monats im Bus zurück nach Scranton sitze.
Ich verstaue meinen Beutel in einem der Schränke, die den Angestellten zur Verfügung gestellt werden, und binde mein blondes Haar zu einem langen, tiefsitzenden Pferdeschwanz zusammen, wobei ich die feuchten Locken mit den Fingern durchkämme, um zumindest ein bisschen Ordnung in mein Haar zu bringen.
»Du gehst jetzt besser«, sage ich zu Tasha. »Ich muss mich noch einstempeln, und du musst hinter der Bar stehen, ehe Joel auftaucht und uns beiden den Lohn kürzt.«
Sie verzieht das Gesicht. »Stimmt. Wir sehen uns dann gleich hinter der Bar.« Sie will schon den Ankleideraum verlassen, als sie sich noch einmal umdreht und mir den Zeigefinger entgegenstreckt. »Ich will auf der Stelle wissen, wenn die Galerie sich bei dir meldet. Hast du mich verstanden? Auf der Stelle!«
»Ja, natürlich.« Ich nicke, doch mein Lächeln wirkt jetzt gezwungen, während mir Zweifel kommen und anfangen, die Hoffnung zu ersticken, der ich mich den ganzen Tag hingegeben habe. »Ich komme gleich nach.«
Sie geht, und ich höre, wie sie draußen auf dem Gang in ihrer heiteren, überschäumenden Fröhlichkeit einen Gast begrüßt. Ich lehne mich an die Schränke und hole mein Handy heraus, um Margot eine SMS zu schicken.
Bitte ruf so schnell wie möglich an. Ich komme um vor Neugier. Ich muss wissen, was los ist.
Ich drücke auf Senden, ehe ich meine Meinung ändern und die verzweifelt klingende Nachricht löschen kann. Ich hasse es, schwach zu erscheinen oder den Eindruck zu erwecken, ich hätte mich nicht unter Kontrolle, und bei der Erkenntnis, dass gerade beides auf mich zutrifft, wird mir ganz schlecht.
Ich unterdrücke das Gefühl und schiebe das Handy zurück in meine Hosentasche.
Dann trete ich aus dem Umkleideraum ins geschäftige Treiben des Restaurants, um meinen Dienst anzutreten. Meine Miene, die Selbstvertrauen ausstrahlt, liegt wie eine unverrückbare Maske auf meinem Gesicht.
2
Wir haben an der Bar so viel zu tun, dass fast eine Stunde vergeht, ehe ich mich überhaupt mit der Tatsache beschäftigen kann, immer noch nichts von Margot gehört zu haben. Ich schenke ein Glas Pinot noir für eine gut gekleidete rotblonde Frau ein, die am anderen Ende der Bar sitzt, und bringe es ihr. Obwohl sie atemberaubend schön wie ein Model aussieht, sitzt sie allein und ist seit ihrer Ankunft vor einer Viertelstunde die ganze Zeit damit beschäftigt, SMS zu schreiben und zu telefonieren.
Wortlos stelle ich den Rotwein vor ihr hin. Sie schaut auf und zieht die elegant geschwungenen Augenbrauen hoch, als sie mich ansieht.
»Kann ich Ihnen noch etwas anderes bringen?«, frage ich sie.
»Nein, danke.« Sie stößt einen frustriert klingenden Seufzer aus, legt das Handy auf den Tresen und schüttelt den Kopf. »Eigentlich soll ich mich hier mit einer Freundin treffen, ehe ich los muss, um meinen Flug zu erwischen.« Sie wirft einen Blick auf die schmale Armbanduhr an ihrem linken Handgelenk und runzelt die Stirn. »Anscheinend verspätet sie sich.«
»Okay. Dann frag ich in ein paar Minuten noch einmal nach«, sage ich, obwohl ich bezweifle, dass sie überhaupt hinhört. Ehe die Worte über meine Lippen sind, greift sie schon wieder nach ihrem Handy und tippt hektisch eine weitere SMS ein.
Ich mache auf dem Absatz kehrt und nehme Getränkebestellungen von drei Mittdreißigern im Businessanzug an, die gerade hereingekommen sind und sich am anderen Ende des Tresens frisch freigewordene Plätze schnappen. Sie bestellen Single-Malt-Scotch und machen dann halbherzige Flirtversuche, während ich die Flasche hole und drei Gläser mit unverdünntem zwölf Jahre alten Macallan fülle.
Ich kenne die Spielregeln, die ich hinter dem Tresen einhalten sollte, um mein Trinkgeld zu erhöhen, aber es gelingt mir noch nicht einmal so zu tun, als wäre ich an einem kleinen Geplänkel interessiert. Ich bin immer noch angespannt und nervös und frage mich, wie lange Margot mich noch auf die Folter spannen will.
Gerade als ich denke, dass ich es keine Sekunde länger aushalte, fängt das Handy in meiner Gesäßtasche an zu vibrieren. Nur mit Mühe verhindere ich, dass mir die Whiskey-Flasche entgleitet, als ich sie zurückstelle, weil ich es so eilig habe, den Anruf anzunehmen. Ich ziehe mich in den hinteren Teil des Barbereichs zurück, hole mein Handy heraus und sehe verstohlen nach, wer mich anruft.
Es ist Margot.
Endlich.
»Deckst du mich?«, frage ich Tasha lautlos, als sie in meine Richtung schaut.
Sie nickt und hält ihre gedrückten Daumen hoch. Ich hole tief Luft und husche mit dem Handy in der Hand zur Damentoilette. Es überrascht mich, wie locker und ruhig ich klinge, als ich den Anruf entgegennehme, obwohl mir das Herz bis zum Hals schlägt. »Hi, Margot. Wie geht’s?«
»War ’n langer Tag«, erwidert sie. »Der Galeriebesitzer war heute da, um mit mir und den anderen Angestellten zu reden. Die Sitzung ist vor fünf Minuten zu Ende gewesen, und ich habe gerade deine SMS gelesen.«
Ich zucke zusammen, als ich an meinen Moment der Schwäche erinnert werde. »Ja, ähm, tut mir leid, dass ich deinen Anruf heute Morgen verpasst habe. Ich saß gerade an meinem neuen Bild und hab das Telefon wohl nicht gehört. Ganz abgesehen davon kann ich es gar nicht erwarten, es dir zu zeigen. Ich glaube, es wird dir wirklich gefallen.«
»Da bin ich mir sicher. Du weißt, dass ich deine Bilder liebe«, sagt sie. »Aber ich bin diejenige, die sich entschuldigen muss. Ich hätte überhaupt keine Nachricht hinterlassen sollen. Das wäre auch nicht passiert, wenn ich geahnt hätte, wie hektisch es heute werden würde. Ich habe dich nicht den ganzen Tag hängen lassen wollen.«
In ihrer Stimme schwingt ein Zögern mit, bei dem mein Mund ganz trocken wird. Ich husche zur hintersten Kabine und schließe mich darin ein, um etwas ungestörter zu sein. Dann versuche ich die Geräusche auszublenden, die vom steten Strom der plaudernden Restaurantgäste erzeugt werden, die im Waschraum ein und aus gehen, sodass auch immer wieder Musik durch die Tür dringt und die Wände beben lässt.
Margot hat nicht weitergeredet, und ich merke, dass sie nicht angerufen hat, um mir etwas Positives mitzuteilen.
»Irgendetwas stimmt nicht«, sage ich leise und versuche zu erraten, wie schlimm der Schlag sein wird, der mich erwartet. Normalerweise drängt sie mich, mit Einzelheiten über meine Arbeit herauszurücken, und will wissen, wann sie das neue Bild sehen kann. Aber diesmal hält sie sich zurück. »Du wirst das neue Bild nicht nehmen, stimmt’s?
Sie schweigt und seufzt dann leise. »Es tut mir wirklich leid, Avery.«
Ihre Entschuldigung triff mich wie ein Schlag, und einen Moment lang bin ich so verblüfft, als wäre mir tatsächlich ein Hieb versetzt worden. »Nein, ist in Ordnung. Ich verstehe das. Du hast schon so viele Bilder von mir. Vielleicht können wir darüber reden, nachdem wieder etwas von mir verkauft worden ist oder –«
»Avery«, sagt sie, und ihr Tonfall wird jetzt noch sanfter. »Wie ich schon sagte … der Galeriebesitzer war heute da. Wir haben über die Einführung von ein paar Veränderungen bei den Sammlungen gesprochen. Es soll ein bisschen frischer Wind reinkommen, ein paar Bilder sollen abgehängt werden, um vielversprechenden neuen Künstlern Platz zu machen, von denen der Galeriebesitzer sehr angetan ist …«
Und ich gehöre nicht dazu.
Ich lasse sie nicht weitersprechen. Dazu besteht keine Notwendigkeit. Ich weiß, dass diese Unterhaltung für sie bestimmt nicht einfach ist. Himmel, für mich ist es auch nicht leicht.
Ich sacke gegen die verputzte Wand der WC-Kabine und schließe die Augen. »Wie schnell müssen meine Bilder abgehängt werden?«
Sie atmet geräuschvoll ein und aus. »Verdammt, Avery. Du weißt, dass mir das hier zuwider ist, ja? Ich wünschte, ich wäre diejenige, die das entscheiden könnte, aber –«
»Ist schon in Ordnung. Ich verstehe das. Du brauchst nichts mehr zu sagen.«
Ich bin kurz angebunden und ruhig – aber nicht aus Wut. Und auf Margot schon gar nicht. Sie ist der einzige Grund, warum meine Bilder es überhaupt in eine Galerie geschafft haben. Dominion ist eine der kleineren Galerien in der Stadt, steht aber in dem Ruf, auf höchste Qualität zu achten und ein Gespür für hervorragende Künstler zu haben. Die Galerie ist ebenfalls dafür bekannt, auch mal Risiken einzugehen, wenn es um die Künstler geht, die in den kleinen, aber feinen Räumen in der Fifth Avenue ausgestellt werden.
Margot Chan-Levine ist sowohl die Leiterin als auch die verantwortliche Kuratorin der Galerie. Ich wusste das damals nicht, als ich sie vor anderthalb Jahren kennenlernte, genauso wenig hätte ich mir träumen lassen, dass ihr meine Werke so gut gefielen, um einige in der Galerie zum Verkauf auszustellen.
Leider scheint ihr Instinkt auszusetzen, wenn es um mich geht.
»Sonntags ist momentan mein einziger freier Tag in der Woche«, sage ich zu ihr. »Oder ich komme diese Woche einen Abend, bevor ich zur Arbeit muss, vorbei und regle die Abholung meiner Sachen.«
»Nein, mach dir deswegen keine Gedanken«, beruhigt sie mich. »Wir haben zurzeit viele Veranstaltungen in der Galerie laufen, und ehrlich gesagt besteht kein Grund zur Eile. Ich kann deine Bilder eine Weile bei uns einlagern, bis du eine Gelegenheit findest, sie abzuholen. Ich weiß, dass dich das wie aus heiterem Himmel treffen muss, und fühle mich deshalb ganz schrecklich. Davon abgesehen weiß ich, dass du in deiner Wohnung gar keinen Platz für die Bilder hast. Deshalb lass mich zumindest das für dich tun.«
Ihr Angebot, mir zu helfen, sollte den Schlag mildern, den mir das Leben mal wieder versetzt hat, aber stattdessen kommen wieder alte Verhaltensmuster zum Vorschein, die die Hilfe nicht annehmen wollen. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, sie um noch mehr zu bitten, nachdem sie doch schon so viel für mich getan hat. Allerdings hat sie in Bezug auf meine möblierte Einzimmerwohnung recht. Da ist wirklich kein Platz. Sogar für New Yorker Verhältnisse ist sie klein, aber das ist nicht das Schlimmste daran. In ein paar Wochen werde ich nicht einmal mehr dieses armselige Dach über dem Kopf haben.
Das Gebäude, in dem ich wohne, ist vor ein paar Monaten verkauft worden, und die Mietwohnungen sollen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Ich habe mich so lange an meine Wohnung geklammert, wie es der Gesetzgeber und die Beharrlichkeit erlauben, doch jetzt lässt sich zeitlich nichts mehr ausreizen. Die Ankündigung der Zwangsräumung, die ich erhalten habe, beweist das.
»Sag doch was, Avery. Alles in Ordnung mit dir?«
»Ja. Klar. Mir geht’s gut.«
Die Worte kommen ganz automatisch, ohne mein Zutun, aus meinem Mund, während sich in meinem Kopf alles dreht und mein Magen wohl gleich revoltieren wird. Vor mir liegen viele Entscheidungen – und auf viele davon bin ich nicht sonderlich erpicht–, aber jetzt muss ich erst einmal den Abend überstehen, um dann nach Hause zu gehen und zu überlegen, was ich tun soll. In einem Winkel meines Kopfes weiß ich allerdings, dass diese Unterhaltung gerade die Tatsache bestätigt hat, dass ich meine Sachen packen muss, um mich … auf den Weg zu machen.
Ich habe das Gefühl, als würden die Mauern immer näher rücken, um mich zu zerquetschen, je länger das Gespräch dauert. Ich muss mich in Bewegung setzen. Ich muss etwas tun, sonst werde ich gleich anfangen zu schreien.
Ich räuspere mich. »Hör mal … hier ist heute Abend richtig viel los. Ich muss wieder raus an die Bar.«
»Oh ja, natürlich. Ich dachte mir schon, ich würde im Hintergrund Restaurantgeräusche hören. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, wenn du heute Abend also noch irgendetwas brauchst – wenn du einfach nur noch ein bisschen reden willst –, dann ruf mich an, ja?«
»Das werde ich«, lüge ich.
»Avery, es tut mir wirklich sehr leid.«
»Ich weiß. Ich hab’s verstanden, und es ist in Ordnung.« Ich bin verlegen und fühle mich minderwertig. Außerdem kann ich nicht leugnen, dass es mir fast das Herz bricht, den Galeriebesitzer mit meiner Kunst nicht genügend beeindruckt zu haben. Und ich ärgere mich über mich selbst, dass ich tatsächlich geglaubt hatte, es könnte doch der Fall sein. »Ich muss jetzt los. Ich werde dich in ein paar Tagen anrufen. Danke, Margot. Für alles.«
Ich drücke das Gespräch weg und lasse dann den Kopf nach hinten gegen die Wand sinken, während ich einen leisen Fluch ausstoße.
Was zum Teufel soll ich jetzt tun?
3
Als ich wieder hinter den Tresen trete, gibt mir Tasha nicht einmal eine Sekunde, um mich wieder zu sammeln, sondern kommt sofort direkt auf mich zu. »Also? Erzähl schon! Was hat sie … oh, Shit!«
Mein Gesichtsausdruck sagt offensichtlich alles.
»Ach, Süße. Komm her.« Mit ihren siebenundzwanzig Jahren ist sie nur zwei Jahre älter als ich, aber sie schaltet völlig mühelos in den Hege- und Pflegemodus, legt einen Arm um meine Schultern und führt mich vom trubeligen Bereich der Bar weg. »Erzähl. Was ist passiert?«
»Ich habe meine Ausstellungsfläche bei Dominion verloren. Sie holen bessere Künstler rein und brauchen den Platz. Deshalb bin ich draußen.«
»Wie bitte?« Tasha lässt ihre Wut ganz deutlich heraus, und verlegen bemerke ich, dass bestimmt ein Dutzend Gäste, die an der Bar sitzen, in unsere Richtung schauen. »Das ist doch Schwachsinn. Du bist eine hervorragende Künstlerin, Avery. Du verdienst diesen Platz in der Galerie mindestens im gleichen Maße wie irgendwelche anderen Künstler.«
Ich gebe ein leicht zittriges Lachen von mir. »Offensichtlich sehen das die Kunden der Galerie nicht so – und der Galeriebesitzer auch nicht.«
»Nun, sie haben unrecht.« Tashas dunkle Augen mustern mich mit wachsender Sorge. Sie legt eine Hand auf meinen Unterarm und zwingt mich, ihr in die Augen zu sehen. »Zur Hölle mit denen, Avery. Die haben alle unrecht.«
Ich schüttele den Kopf und entziehe mich ihrer tröstenden Berührung, ehe ihre gütige Wärme mich zusammenbrechen lässt. »Das ist keine große Sache. Eigentlich hatte ich es schon kommen sehen. In der ganzen Zeit habe ich nur ein einziges Bild verkauft. Margot glaubt an meine Arbeit, aber sie leitet keinen Wohltätigkeitsverein. Und weiß Gott – nur mit Freundlichkeit lässt sich keine Miete finanzieren. Und wo ich gerade von Finanzen rede … ich muss mich um die Gäste kümmern.«
Tasha stellt sich mir in den Weg und vereitelt meine Flucht. »Geht’s dir gut?«
»Ja.« Ich weiche ihrem besorgten, viel zu klugen Blick nicht aus und zucke mit den Schultern. »Glaub mir. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Mir geht’s gut.«
Sie rührt sich nicht von der Stelle und durchbohrt mich weiter mit ihrem Blick. Hinter ihr ruft einer der Kellner ihr eine Getränkebestellung zu. Tasha bedeutet ihm mit erhobener Hand, sich zu gedulden, während ihre ganze Aufmerksamkeit mir gilt. »Ich bin deine Freundin, verdammt noch mal. Mach mich nicht wütend, indem du so tust, als wäre ich es nicht. Steht es im Moment wirklich so schlecht um dich?«
Ich will es eigentlich rundheraus leugnen, aber die Worte wollen nicht über meine Lippen kommen.
Vor Tasha kann ich offensichtlich nichts richtig verbergen, und ihre Miene sagt mir, dass ich sie noch nicht einmal zum Narren halten könnte, wenn ich es versuchte. Doch obwohl sie mich, seitdem wir zusammenarbeiten, sehr gut kennengelernt hat, gibt es immer noch Dinge von mir, die sie nicht weiß. Dinge, die keiner von mir weiß. Zumindest nicht hier in dieser neuen Stadt, in diesem neuen Leben, das ich mir zu schaffen versuche.
Und so gern ich meine gegenwärtigen Probleme auch vor Tasha verheimlichen würde, ist sie offensichtlich nicht bereit, sich ausschließen zu lassen.
»Alle Wohneinheiten in dem Gebäude, in dem ich wohne, werden in Eigentumswohnungen umgewandelt, und man wird mich zwangsräumen.« Ich sprudele damit heraus, ohne auch nur einmal Luft zu holen. »Ich habe zwei Wochen, um meine Wohnung entweder zu kaufen oder sie zu verlassen.«
»Himmel, Avery. Nur zwei Wochen? Was wirst du tun?«
»Das Einzige, was mir übrigbleibt: ausziehen. Ich kann mir den Erwerb nicht leisten, und auch wenn ich das Geld hätte, würde ich trotzdem nichts in diesem mit Kakerlaken verseuchten Gebäude kaufen wollen.«
»Shit, Süße. Wo willst du hin?«
»Ich weiß es nicht.« Das ist die traurige Wahrheit. Und auch wenn ich spüre, wie Pennsylvanias Würgegriff immer fester wird, bin ich noch nicht bereit, mich zu meiner endgültigen Niederlage zu bekennen. Ich bin noch nicht bereit aufzugeben.
Tasha nickt und runzelt nachdenklich die Stirn. »Wenn du ein Plätzchen brauchst, wo du unterschlüpfen kannst, bis du dir alles in Ruhe überlegt hast, kannst du gern zu Antonio und mir kommen. Wir haben zwar kein Gästezimmer, aber im Wohnzimmer steht ein Schlafsofa, das dir gehört, solange du es brauchst.«
»Nein, danke.« Ich bin von ihrer Großzügigkeit gerührt, aber ich kann mich ihr nicht in dieser Form aufbürden. Ihr Haus ist auch so schon mit dem Baby und einer Schwiegermutter, die vor Kurzem eingezogen ist, voll genug. Ich schüttle den Kopf. »Danke, aber nein. Um so etwas würde ich dich niemals bitten.«
»Hast du ja auch nicht«, stellt sie fest. »Davon abgesehen bittest du sowieso nie jemanden um etwas, nicht wahr?«
Es ist keine Frage. Und deshalb gebe ich auch keine Antwort. »Ich schaff das schon. Ich stehe schon eine ganze Weile auf eigenen Füßen. Das hier werde ich auch bewältigen.«
Auf der anderen Seite des Tresens ruft uns ein weiterer Kellner seine Bestellung zu.
»Bin gleich da«, ruft ihm Tasha über das Stimmengewirr im Restaurant zu. Sie mustert mich eine ganze Weile mit ihren sanften Rehaugen, und es liegt ein bekümmertes Verstehen meiner Situation darin. »Du weißt schon, dass es okay ist, gelegentlich andere um Hilfe zu bitten? Es ist okay, anderen zu erlauben, sich um dich zu kümmern.«
Ich kann ihr nicht zustimmen. Ich kann mich noch nicht einmal zu einem schwachen Nicken überwinden, um sie zu beschwichtigen.
Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, dass Hilfe nie umsonst ist und seinen Preis hat – egal, ob man ihn sieht oder nicht. Und gerade die Leute, die behaupten, sich die größten Sorgen um einen zu machen, können sich im Bruchteil einer Sekunde gegen einen wenden.
Sie geht weg, um die Getränkebestellungen fürs Restaurant fertig zu machen, und ich spute mich, um die Gäste, die am langen Tresen sitzen, mit frischen Drinks zu versorgen. Ich merke, dass die Frau am anderen Ende der Bar immer noch allein ist und wartet. Das Glas Pinot vor ihr ist unberührt, und das Handy liegt neben den nervös trommelnden Nägeln ihrer linken Hand.
Als ich mich ihr nähere, um zu fragen, ob ich noch etwas für sie tun kann, sieht sie auf ihr Handy und nimmt es hoch, um wohl eine SMS zu lesen, die gerade hereingekommen ist. Erst runzelt sie die Stirn, doch dann verzieht sich ihr Gesicht zu einer Miene absoluter Verzweiflung. »Oh nein! Das meinst du ja wohl nicht im Ernst! Das kann doch nicht wahr sein.«
Offensichtlich bin ich heute Abend nicht die Einzige, die mit einer Enttäuschung zu kämpfen hat.
Ich bin keine, die ihre Nase in anderer Leute Angelegenheiten steckt, deshalb reagiere ich nicht auf ihren Ausbruch. »Möchten Sie sonst noch etwas haben?«
Sie atmet tief durch und richtet den Blick ihrer grünen, von dichten Wimpern umkränzten Augen auf mich. »Wie wär’s mit einem Wunder?«
»Entschuldigung?«
»Ach, egal.« Ungeduldig schiebt sie das Handy in ihre Handtasche und schüttelt den Kopf. »Ich hatte mich darauf verlassen, dass eine Freundin was für mich tut, aber sie hat gerade abgesagt. Und jetzt sitze ich in der Patsche.«
»Das tut mir leid.« Man sieht deutlich, wie bekümmert sie ist. Und dann erinnere ich mich, dass sie heute Abend eigentlich noch einen Flug erwischen muss. »Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn Sie zahlen wollen.«
Sie nimmt einen Schluck von ihrem Wein und sieht dann auf ihre Uhr. »Ein paar Minuten hab ich noch. Ich bleibe lieber hier, als auch nur eine Minute länger als notwendig auf dem Flughafen zu warten. Ich bin übrigens Claire.«
»Nett, Sie kennenzulernen«, erwidere ich. »Ich heiße Avery.«
»Ich weiß.«
Ich sehe sie mit zur Seite gelegtem Kopf an und wirke vielleicht ein bisschen zu überrascht, weil sie sofort zusammenzuckt und ein verlegenes Lachen ausstößt.
»Tut mir leid. Das hörte sich jetzt ein bisschen so an, als wäre ich eine Stalkerin, nicht wahr?« Sie winkt ab, als wolle sie damit andeuten, dass kein Grund besteht, sich unbehaglich zu fühlen. »Wir sind uns zwar nicht vorgestellt worden, aber ich bin ab und zu hier und habe gehört, wie die anderen Angestellten Sie ansprechen.«
»Oh.« Ich tue es mit einem leichten Schulterzucken ab. »Null problemo.«
Sie ist kein Mensch, den man leicht übersehen würde, und trotzdem kann ich nicht behaupten, sie jemals zuvor im Restaurant bemerkt zu haben. Allerdings ist New York voller wunderschöner Menschen, und ich musste es mir früh angewöhnen, nicht jeden Promi, jeden bekannten Sportler oder irgendwelche Supermodels anzustarren, die mir über den Weg laufen.
»Ich habe ein paar Straßen von hier entfernt eine Wohnung«, setzt sie von sich aus die Unterhaltung fort, während ich nach einem Lappen greife und den Tresen ein paar Plätze von ihr entfernt anfange zu polieren, wo eben noch ein Pärchen gesessen hat. »Aber um ehrlich zu sein, bin ich nie lange genug in einer Stadt, um wirklich behaupten zu können, dass ich dort lebe. Vor knapp einer Woche bin ich von einem Auftritt in Paris zurückgekommen, und heute Abend fliege ich für ein paar Monate nach Tokio, um ein paar Werbefilme und die erste Folge einer Gameshow zu drehen.«
»Das klingt aufregend.« In mir ist immer noch so viel von meiner ländlichen Herkunft, dass angesichts ihres Lebensstils im Jetset und ihres glamourösen Jobs leichte Neidgefühle in mir hochkommen.
»Ja, langweilig ist es nie«, bestätigt sie, ehe sie noch einen Schluck von ihrem Wein nimmt. »Aber ich lass meine Wohnung nicht gern über einen längeren Zeitraum leer stehen, während ich weg bin. Meine Freundin, die mich heute Abend sitzen gelassen hat, sollte eigentlich bei mir wohnen, während ich in Japan bin. Aber jetzt ist über meine armen Pflanzen gerade das Todesurteil gesprochen worden.«
Ich verziehe das Gesicht. »Das ist echt blöd.«
»Wem sagen Sie das … Sie kennen wohl nicht eine gute Agentur für Housesitter, an die ich mich wenden könnte, oder? Eine Agentur, die mir einen Housesitter vermitteln könnte, der ab sofort für die nächsten vier Monate einspringt?«
Sie braucht einen Housesitter für vier Monate? Die Verzweiflung, die ich eigentlich nicht wahrhaben will, stöhnt förmlich angesichts der Ironie der Situation. Ich werde schon bald kein Dach mehr über dem Kopf haben, und diese Frau – Claire – hat mehr Wohnraum als sie überhaupt nutzen kann.
Obwohl ich mir sicher bin, dass ihre Frage nur rhetorisch gemeint ist, ertönt Tashas Stimme hinter mir, ehe ich etwas erwidern kann.
»Avery, warum übernimmst du das nicht?«
Bis zu diesem Moment habe ich gar nicht bemerkt, dass sie in der Nähe ist. Ich drehe mich zu ihr um und sehe sie empört an. Was zum Teufel soll das?
Ich weiß, dass sie diesen Gedanken von meinem Gesicht ablesen kann. Sie erkennt es an meinem beschämten Blick. Aber Tasha ist nun einmal Tasha und somit völlig unbeeindruckt davon. Sie lächelt mich an, als würde sie gar nicht merken, wie wütend und sprachlos ich wegen ihrer Einmischung bin.
»Überleg doch mal«, meint sie fröhlich und so laut, dass auch Claire sie hören kann. »Der Zeitpunkt wäre perfekt. Du hast mir doch erst heute erzählt, dass dein Haus saniert wird und du da nicht wohnen bleiben kannst, wenn die Arbeiten beginnen.«
Saniert? Ich schüttele den Kopf. »Ich habe nicht gesagt …«
»Doch. Das hast du.« Sie spricht langsam und sieht mich mit diesem gewissen Ausdruck in den Augen an. Ich bin mir sicher, dass dieser Blick selbst ihren Mann dazu bringt, etwas gerader zu stehen. Ich muss gestehen, dass er auch auf mich seine Wirkung nicht verfehlt.
Aber ich kann das nicht machen. Es wäre nicht recht. Ich bin eine Wildfremde für diese Frau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es überhaupt in Erwägung ziehen würde …
»Stimmt das, Avery? Brauchen Sie eine Ersatzwohnung?«
Ich drehe mich zu Claire um. »Ja, das stimmt, aber … Sie kennen mich doch gar nicht.«
Sie stellt ihr Weinglas ab und mustert mich einen kurzen Moment lang. »Wie lange arbeiten Sie schon hier?«
»Fast anderthalb Jahre.«
»Nun, das sagt mir, dass Sie ein verantwortungsbewusster Mensch sind«, stellt sie fest.
»Und zuverlässig ist sie auch«, fügt Tasha hinzu. »Avery ist sechs Tage die Woche hier. Manchmal sogar alle sieben. Sie ist immer zum Dienst erschienen und war in der ganzen Zeit nicht einen Tag krank.«
»Beeindruckend.« Claire nickt, als hätte sie sich bereits entschieden. »Sie würden mir einen Riesengefallen tun. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen wäre.« Sie schaut auf ihre Uhr und schnappt erschreckt nach Luft. »Shit. Ich muss los, sonst komme ich zu spät. Wenn Sie das für mich tun, Avery, muss ich es jetzt wissen.«
Tasha sieht mich erwartungsvoll an, während ich zwischen ihr und Claire hin und her schaue und sich mir der Magen vor Unsicherheit zusammenzieht. Ich glaube nicht an Glück oder höhere Mächte, aber es scheint so, als würde mir der Himmel gerade eine Rettungsleine zuwerfen. Kann ich es mir wirklich leisten, so ein Angebot auszuschlagen? Angesichts der Tatsache, dass ich binnen kürzester Zeit kein Dach mehr über dem Kopf haben werde, und die Aussicht, mit meiner Kunst in nächster Zeit Geld zu verdienen, auch verschwindend gering ist, habe ich eigentlich gar keine andere Wahl.
»Ich werde Sie natürlich bezahlen.« Unauffällig nimmt Claire einen Umschlag aus ihrer schwarzen Birkin-Tasche. »Fünftausend für die vier Monate. So viel wollte ich auch meiner Freundin geben.« Sie hält mir den cremefarbenen Umschlag hin und spricht mit leiser Stimme weiter: »Es ist in bar. Ich hoffe, das stört Sie nicht.«
Allein bei der Vorstellung dreht sich bei mir alles. Es mag Leute wie Claire geben, die mit fünf Riesen um sich werfen, als wäre das nichts, aber für mich ist das in diesem Moment ein kleines Vermögen.
Nein, die Summe grenzt fast an ein Wunder.
Und das Sahnehäubchen ist, dass meine Obdachlosigkeit um vier Monate hinausgezögert wird.
Die Erkenntnis, welch unglaubliche Wendung mein Schicksal genommen hat, ist so überwältigend, dass ich kaum Worte finde. »Ich, ähm …«
»Sie wird es machen«, springt Tasha für mich in die Bresche. »Das wirst du doch, nicht wahr, Avery?«
Ich muss wohl zustimmend genickt haben. Denn um ehrlich zu sein, verschwindet die nächsten paar Minuten für mich alles in einem Nebel, der alles verschwimmen lässt. Sie nennt mir ihren vollen Namen – Claire Prentice – und kritzelt ihre Adresse auf die Rückseite ihrer Visitenkarte, ehe sie mir den Schlüssel zu ihrer Wohnung reicht. Sie schreibt sich meinen Namen und meine Handynummer auf und nimmt dann zwanzig Dollar aus ihrem Portemonnaie, die sie auf den Tresen legt.
»Damit müsste der Wein beglichen sein.« Lächelnd lässt sie sich vom Barhocker gleiten und greift nach ihrer Jacke, die sie überstreift. »Ich werde mich bei Ihnen melden, sobald ich in Tokio etwas zur Ruhe gekommen bin, um mich zu erkundigen, ob in der Wohnung alles in Ordnung ist, okay?«
Automatisch nicke ich. »Äh, okay.« Ich werde keinen Einspruch erheben. Aber ich gehe ohnehin nicht davon aus, dass sie mir Gelegenheit dazu geben würde.
Claire Prentice bedankt sich noch einmal schnell, ehe sie eilig das Restaurant verlässt und in ein Taxi springt, das gerade angehalten hat.
Wie vor den Kopf geschlagen stehe ich einen Moment lang nur völlig sprachlos da, während ich zu erfassen versuche, was gerade passiert ist.
Ich halte fünftausend Dollar in Händen. Auf dem Tresen vor mir liegt eine Adresse in der Park Avenue. Und daneben ein glänzender Schlüssel, der mir vier Monate Unterschlupf gewährt. Volle vier Monate Aufschub.
Ich habe gerade eine einmalige Gelegenheit in einem Moment bekommen, wo ich sie nicht dringender hätte brauchen können.
Ich sehe Tasha an und schüttle den Kopf in sprachloser Verwirrung. Ein leises Kichern steigt in mir auf. Und dann noch eins. Ich kann nicht mehr an mich halten. Das ist alles zu viel – diese wunderbare Wendung, die Hoffnung … die unglaubliche Erleichterung.
Ich lege eine Hand über meinen Mund, aber die Freude sprudelt in einem atemlosen Lachen aus mir heraus. »Ist das wirklich gerade passiert?«
Tasha nimmt mir den Umschlag ab und wirft einen Blick hinein. »Tja, hier sind fünfzig Hunderter drin, die sagen, dass es passiert ist.« Sie grinst mich an. »Erinnerst du dich noch an das, was ich gesagt habe? Dass man sich ab und zu mal helfen lassen sollte? Tja, jetzt kannst du dich bei mir bedanken.«
4
Tasha besteht darauf, mich zu Claires Wohnung zu begleiten. Ich war mir eigentlich gar nicht sicher gewesen, ob ich heute noch hin wollte, aber Tasha lässt sich nicht abwimmeln, und ich kann auch nicht leugnen, dass ich neugierig bin. Plötzlich erfordert die Vorstellung, sich erst morgen die Wohnung anzusehen, in der ich die nächsten vier Monate leben werde, eine Geduld, die ich nicht habe.
Den ganzen Abend hat der Schlüssel zu Claires Wohnung fast ein Loch in meine Hosentasche gebrannt. Der Schlüssel macht mich kribbeliger als das Geld, welches ich nur widerwillig tief in meine Handtasche geschoben habe, die während meiner Arbeitszeit im Spind liegt.
Nachdem das Vendange geschlossen hat, ruft Tasha zu Hause an, um Bescheid zu geben, dass es später wird, und dann machen wir zwei uns auf den Weg zu der Adresse in der Upper East Side, die Claire mir gegeben hat.
Normalerweise würde ich mir nichts bei einem längeren Fußmarsch durch die Stadt denken – nicht einmal in einer kalten, regnerischen Aprilnacht. Aber so eine Strecke nach zwei Uhr morgens mit fünftausend Dollar in bar in der Tasche wäre eine Dummheit, die ich nicht riskieren will.
Als wir aus dem Restaurant treten, winke ich Tasha zu, mir an die Straße zu folgen. »Komm. Wir gönnen uns ein Taxi. Das geht auf meine Rechnung.«
Manhattan ist zu jeder Stunde beeindruckend, ob bei Tag oder bei Nacht. Doch so spät am Abend hat dieser Teil der Stadt etwas ganz besonders Magisches. Während das Taxi langsam die durch einen mit Bäumen bestandenen Mittelstreifen geteilte Park Avenue entlangfährt, saugt mein Künstlerauge gierig die ganze Umgebung in sich auf. Straßenlaternen und Scheinwerfer übersäen die nassen Bürgersteige mit bunten Lichterfetzen. Die Mischung aus Backstein- und Kalksandsteingebäuden aus der Vor- und Nachkriegszeit zu beiden Seiten des breiten Boulevards behauptet sich trotzig neben den glitzernden Ungetümen aus Glas und Stahl und den eleganten Fünf-Sterne-Hotels. Vor diesen Gebäuden zieht auf dem Bürgersteig ein steter Strom aus Fußgängern in Businesskleidung, schickem Partydress und abgerissenen Lumpen vorbei.
Die Farben, die Formen, die Energie, das quirlige Leben, das sogar zu dieser späten Stunde herrscht … all das berührt eine Seite in mir, deren Träume von Licht und Schatten erfüllt sind, jenen Teil von mir, der sich nur mit einem Pinsel ausdrücken kann.
Heute Abend, nach Margots Anruf, schmerzt es, das Wispern dieser Stimme zu hören und all die Bilder zu sehen, die die jungfräuliche Leinwand in meinem Kopf füllen. Ich schließe die Augen, um den Impuls zu unterbinden, aber es gelingt mir nicht. Diese Gewohnheit begleitet mich schon zu lange, um sich jetzt einfach ablegen zu lassen. Meine Kunst ist immer eine Fluchtmöglichkeit für mich gewesen, eine Zuflucht – der einzige Ort, an dem ich leben konnte, wenn alles andere mich zu vernichten suchte.
Doch jetzt frage ich mich unwillkürlich, wie lange diese Seite von mir überleben wird, wenn sich herausstellt, dass der Besitzer des Dominions recht hat und meine Kunst es nicht verdient, ausgestellt zu werden.
»Heiliger Bimbam«, keucht Tasha und holt mich damit ins Hier und Jetzt zurück. Das Taxi fährt gerade auf meiner Seite an den Kantstein und biegt in eine U-förmige Auffahrt vor einem gigantischen Hochhaus ein. Tasha drängt mich gegen die Rückenlehne, als sie auf meiner Seite aus dem Fenster schaut. »Avery, ist das die richtige Adresse?«
Ich linse aus dem Fenster, während der Fahrer langsam unter dem gläsernen Vordach zum Halten kommt und verkündet, dass wir unser Ziel erreicht haben. Trotzdem überprüfe ich die in die schimmernde Silberplatte eingravierte schwarze Hausnummer über dem Eingang des Hochhauses mit der Adresse, die Claire mir gegeben hat.
»Wir sind richtig.«
Tasha steigt auf ihrer Seite aus, während ich dem Taxifahrer seine zwölf Dollar gebe. Sie steht bereits neben meiner Tür, als ich aus dem Taxi klettere. Auf ihrem Gesicht liegt ein ehrfürchtiger Ausdruck. Sie hakt sich bei mir unter und hält sich an mir fest, als wir vom Taxi wegtreten.
»Süße, ist dir klar, wo wir hier sind? Dieser Teil der Park Avenue ist die beste Adresse überhaupt. Die Ecke, wo die Milliardäre wohnen. Ich wette mit dir, dass sogar ein winziges Apartment hier mehrere Millionen kostet.«
»Ernsthaft?« Überrascht ziehe ich die Augenbrauen hoch. »Offensichtlich sind internationale Werbespots und japanische Gameshows ein einträgliches Geschäft.«
Tasha brummt irgendetwas, das ich nicht verstehe, während ich den Kopf in den Nacken lege, um an dem aufschießenden Koloss aus Glas hochzusehen. Das Gebäude ist so hoch, dass sich die Spitze im Baldachin aus dunklen Wolken, die den Nachthimmel verdecken, verbirgt. Noch nie habe ich den Fuß in ein Gebäude dieses Kalibers gesetzt, und während wir uns der hell erleuchteten Empfangslobby nähern, kann ich nicht erkennen, ob mein rasender Herzschlag von Aufregung oder Zweifel herrührt.
Von Anfang an war ich bei dieser Sache unsicher gewesen und bin jetzt immer weniger überzeugt, das Richtige getan zu haben. Ich habe das Gefühl, dass alle mich anstarren, und bin nervös. Das ist nicht meine Welt. Das ist noch nicht einmal derselbe Orbit, in dem ich die letzten fünfundzwanzig Jahre verbracht habe.
Was zum Teufel hat Claire Prentice sich dabei gedacht, jemanden, den sie gar nicht kennt, zum Housesitter in so einem Gebäude zu machen?
Verzweifelt war sie gewesen. Verzweifelt und ohne eine andere Möglichkeit. Das hatte sie offen zugegeben. Genauso verzweifelt wie ich, die ich unbedingt ein Dach über dem Kopf brauche, bis ich irgendwie wieder auf die Beine komme.
Aber mit so etwas wie diesem hier habe ich im Leben nicht gerechnet.
Während ich die mit poliertem Marmor ausgekleidete Lobby, an deren Decke riesige, glitzernde Kristalllüster hängen, durch die ultramoderne Glasfassade hindurch mustere, wird mir klar, dass ich abgesehen davon, von Claire auch noch dafür bezahlt zu werden, dass ich hier wohne, bei der Sache das bessere Geschäft gemacht habe.
Ein Portier mittleren Alters mit dunklem Gehrock und schwarzer Kopfbedeckung öffnet eine der mit Chrom verzierten Glastüren und hält sie uns auf.
Er begrüßt Tasha und mich mit einem freundlichen Nicken. »Guten Abend, Ma’am … Ma’am.« Der Mann ist sehr groß und hat einen leichten Bauch, was trotz des dicken wollenen Gehrocks nicht zu übersehen ist. Aber seine haselnussbraunen Augen strahlen echte Freundlichkeit aus, und sein herzliches Lächeln wird von einem grau gesprenkelten Bart umrahmt. »Wie kann ich den Damen behilflich sein?«
Ich bleibe stehen und erwidere sein Lächeln. »Hallo. Ich bin Avery Ross, und das ist meine Freundin Tasha. Claire Prentice schickt mich. Ich bin, äh … sie hat mich eingestellt, um auf ihre Wohnung aufzupassen, während sie außer Landes ist.«
Ich beginne nervös, in meinem Beutel nach ihrer Visitenkarte zu kramen, als würde die irgendetwas beweisen, doch der Portier nickt schon, ehe ich ihm die Karte hinhalte. »Miss Prentice hat bereits angerufen, um mich wissen zu lassen, dass Sie kommen, Miss Ross. Bitte, meine Damen, kommen Sie doch ins Warme.«
Tasha und ich treten gefolgt vom Portier ins Gebäude. Der Boden ist vom Eingang bis zu den imposanten Fahrstühlen mit von silbernen Adern durchzogenem, schimmerndem Marmor bedeckt. Hoch aufragende, mit exotischen, dunklen Hölzern verschalte Wände und gemaserter Stein rahmen die Fahrstuhltüren aus poliertem Edelstahl ein. Über unseren Köpfen hängen gewaltige Kristalllüster, die an Wasserfälle aus glitzernden Eisstückchen erinnern.
»Ich heiße Manny«, sagt der Portier. Er führt uns quer durch die weitläufige Lobby zu einem Empfangstresen. Er greift nach einem Tablet-PC, tippt ein paarmal auf den Bildschirm und reicht ihn mir dann. »Bitte, unterschreiben Sie an der Stelle, die ich markiert habe, Miss Ross. Werden Sie von heute Abend an in Miss Prentices Wohnung bleiben?«
Die Frage verschlägt mir im ersten Moment den Atem, denn ich bin immer noch dabei, mir klarzumachen, dass ich wirklich hier stehe und nicht träume. Ich schüttle den Kopf, während ich eine völlig unleserliche Unterschrift auf das Display setze. »Nein, ich habe nicht vor, zu bleiben. Es ist spät, und ich komme gerade von der Arbeit. Ich wollte nur kurz vorbeikommen, um mir alles anzuschauen.«
»Dann weiß ich Bescheid.« Manny holt eine Karte hinter dem Tresen hervor und reicht sie mir. »Das ist die Telefonnummer vom Empfang. Wenn Sie irgendetwas brauchen, sagen Sie es mir einfach, und ich werde mich darum kümmern.« Er zeigt in Richtung der Fahrstühle. »Miss Prentices Wohnung befindet sich im fünften Stock – Nummer 501. Gehen Sie nach links, wenn Sie aus dem Fahrstuhl steigen.«
»Danke, Manny.« Ich nicke ihm zu und stecke die Karte ein. Ich bin froh, dass er so eine warmherzige Art hat. Sein freundliches Lächeln hat meine Nervosität etwas gemildert. Vielleicht, denke ich bei mir, fühle ich mich nicht so allein oder fehl am Platz, wenn ich weiß, dass zumindest einer hier ein freundliches Lächeln für mich übrig hat.
Ich winke ihm kurz zu, dann ziehen Tasha und ich in Richtung Fahrstühle ab. Keiner von beiden befindet sich gerade im Erdgeschoss, und so kann ich nicht widerstehen, mich noch einmal umzudrehen und mich in der großzügig geschnittenen Lobby umzuschauen, während wir darauf warten, dass einer herunterkommt.
Einen Moment später ertönt hinter mir ein leises Klingeln, als ein Fahrstuhl hält. Ich mache auf dem Absatz kehrt und trete auf die Türen zu, sobald sie aufgleiten.
Ich merke erst, dass es sich bei der Wand vor mir um einen Menschen handelt, als ich schon fast in ihn hineingerannt bin.
Ich bleibe abrupt stehen, hebe den Kopf und habe schon eine Entschuldigung auf den Lippen. Doch die löst sich in Luft auf, als ich nach oben schaue und einem Blick aus himmelblauen Auen begegne, die mich unter tiefschwarzen Augenbrauen hervor durchbohren.
Augenbrauen, die sich finster zusammenziehen, während der große, schlanke Mann den ungehobelten Bauerntrampel mustert, der ihn fast über den Haufen gerannt hätte, als ich in den Fahrstuhl treten wollte.
»Ähm. Entschuldigung.«
Keine Antwort. Noch nicht einmal das geringste Anzeichen einer höflichen Entgegnung in seinem hübschen, scharf geschnittenen Gesicht. Das dunkle Haar ist kurz geschnitten, wie es sich für einen Geschäftsmann gehört, aber gleichzeitig dicht und etwas widerspenstig, sodass der rabenschwarze Schopf im Licht schimmert. Ich wäre versucht, das Gesicht mit den hohen Wangenknochen und dem kantigen Kiefer als hart zu beschreiben, wären da nicht die weich geschwungenen Lippen.
Er ist groß und muskulös, bekleidet mit einer dunkelgrauen Trainingsjacke und einer eng anliegenden Jogginghose, die nichts von seinem muskulösen Körper verbirgt. Trotz seiner sportlichen Erscheinung erkenne ich sofort, dass ich nicht irgendeinen Muskelprotz mit mehr Muskeln als Hirn vor mir habe. Nein, dieser Mann sieht mich mit einem vernichtenden Blick an, aus dem Intelligenz und Strenge sprechen – ein überdurchschnittliches Selbstvertrauen, das mir nicht entgeht.
Eine schockierende und unerwartete Wärme breitet sich in mir aus, als er mich mit seinem Blick fixiert. Er sieht mich unverhohlen durchdringend an, als sei er es gewohnt, alles ausgiebig zu mustern. Die Überheblichkeit, die er dabei ausstrahlt, sollte mich eigentlich aus vielerlei Gründen stören, doch während der Blick seiner strahlendblauen Augen über meinen Körper gleitet, spüre ich nur, wie in jeder Faser meines Leibes ein Feuer entfacht wird.
Tasha räuspert sich, als sie den Eindruck bekommt, dass ich wohl nichts mehr sagen werde. »Entschuldigen Sie uns bitte.«
Er nimmt sie kaum zur Kenntnis, genauso wenig wie ihr entrüstetes Schnauben, als eine Reaktion ausbleibt. Nein, diese durchdringenden Augen bleiben alleine auf mich geheftet. Ich fühle mich völlig entblößt unter seinem stechenden Blick, denn er vermittelt mir den Eindruck, als könne er direkt in mich hineinsehen und würde erkennen, dass ich nicht hierhergehöre. Und schlimmer noch … der fast unmerkliche Zug um seine sinnlichen Lippen scheint zu sagen, dass er sich der Wirkung, die er auf mich hat, nur allzu bewusst ist.
Er rührt sich nicht von der Stelle, und ich versinke vor Scham fast im Boden, als mir klar wird, dass ich ihm immer noch den Weg versperre.
Innerlich zucke ich zusammen und trete zur Seite, während ich mir wünsche, ich könnte mich einfach in Luft auflösen, ehe ich mich noch mehr in Verlegenheit bringe.
Nachdem er nun freie Bahn hat, tritt er wortlos in die Lobby.
Ich folge Tasha in den Fahrstuhl, doch meine ganze Aufmerksamkeit ist auf den arroganten, dunkelhaarigen Fremden gerichtet, der jetzt mit fließendem, fast eiligem Schritt über den glatten Marmorboden läuft.
Ich höre noch, wie Manny ihn grüßt, während sich die Fahrstuhltüren schließen und ich nichts mehr sehen kann.
»Guten Abend, Mr. Baine. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Laufen, Sir.«
Sobald wir in der Fahrstuhlkabine unter uns sind, stoße ich den angehaltenen Atem mit einem Stöhnen aus.
Tasha sieht mich mit hochgezogener Augenbraue an. »Der ist echt heiß, aber offensichtlich ein Mistkerl erster Güte. Tu dir einen Gefallen und geh dem Typen aus dem Weg, Süße.«
Als würde ich diese Warnung brauchen.
Wer immer er sein mag … ich bezweifle, dass ich viel von Mr. Baine sehen werde. Tatsächlich gebe ich mir bereits selbst das Versprechen, die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen, wenn ich ihm hier jemals wieder über den Weg laufen sollte. Ich brauche in nächster Zeit weiß Gott keine Wiederholung dieser peinlichen Begegnung.
Ich drücke auf den Knopf für den fünften Stock und wünsche mir, dass sich die Erinnerung an die stechenden blauen Augen auch auf Knopfdruck auslöschen ließe. Der Mann hatte eine Hitze und Kraft ausgestrahlt, die ich immer noch meine – mit allen Sinnen – auf meiner Haut zu spüren, während wir zu Claires Wohnung hochfahren.
Oh ja, ich habe die feste Absicht, diesem »heißen«, arroganten – beunruhigend aufregenden – Mr. Baine um jeden Preis aus dem Weg zu gehen.
5
»Allmächtiger! Sieh dir das an!« Tasha stürmt mir voraus in Claires leere Wohnung, während ich stehen bleibe, um die Tür hinter uns zu schließen. »Avery, das musst du dir ansehen. Das ist unglaublich!«
Sie hat recht. Das ist es. Ich bin kaum in der Lage, mein Erstaunen zu verbergen, als ich ihr nach drinnen folge. Auch hier oben bedeckt schimmernder Marmor den Boden im Eingangsbereich, in dem die Hälfte meiner Wohnung in Brooklyn Platz finden würde. Die luftige Eleganz setzt sich in alle Richtungen vom Eingang aus fort.
Im Wohnzimmer verbreitet ein gedimmter Kronleuchter ein einladendes Licht über cremefarbenen Polstermöbeln und einem hellgrau gemusterten Teppich. Die Wand am anderen Ende des Raumes ist mit einem eingebauten Bücherregal bedeckt, in dem genug Lesestoff steht, um jemanden über mehrere Jahre zu beschäftigen. Auf zierlichen Beistelltischchen stehen Kunstgegenstände und interessanter Schnickschnack, den Claire wahrscheinlich von ihren verschiedenen Reisen mitgebracht hat. Der gesamte Raum ist ein eleganter optischer Genuss, der vor zwei drei Quadratmeter großen Fenstern, durch die man einen freien Blick auf die funkelnden Lichter der Großstadt hat, perfekt dargeboten wird.
Und nicht zum ersten Mal kann ich es nicht fassen, dass Claire Prentices Pech zu meiner Rettungsleine geworden ist.
Und was für eine Rettungsleine!
Ich trete an die riesigen Fenster und betrachte voller Ehrfurcht die unglaubliche Aussicht. Ich habe mich nie nach einem extravaganten Lebensstil gesehnt und bin dem – weiß Gott! – auch nie nahegekommen, aber jetzt fühle ich mich wie eine Prinzessin in ihrem Turm, als ich in Claires elegantem Wohnzimmer stehe und die Lichter der Großstadt auf mich wirken lasse. Die Gebäude stehen so eng zusammen, dass sie einander teilweise verdecken, Tausende von erleuchteten Fenstern glitzern wie Diamanten in der Dunkelheit. Ich kann es gar nicht erwarten, das Bild bei Tageslicht in Augenschein zu nehmen. Durch Claires mehrmonatige Abwesenheit ergibt sich für mich vielleicht sogar die Gelegenheit, die Aussicht zu malen.
»He, sieh dir mal diese tolle Küche an!«, ruft Tasha von nebenan. »Bist du dir sicher, dass du nicht bei mir wohnen willst und ich Claires Blumen die nächsten vier Monate gieße? Himmel, meinetwegen könntest du sogar das Geld behalten.«
Ich lache leise und schüttle den Kopf. Bestimmt würde ich mich in Tashas kleiner Doppelhaushälfte in Queens viel wohler fühlen als hier, aber ich weiß, dass ihr Vorschlag mit dem Tausch nur ein Scherz ist. Zumindest glaube ich, dass es ein Scherz ist.
Die nächste Stunde verbringen wir mit einer Bestandsaufnahme von Claires atemberaubender Wohnung. Während Tasha Claires Designerkleidung beäugelt und die beneidenswerte Schuhsammlung, gehe ich durch die Wohnung und mache mir in Gedanken eine Liste der Dinge, die ich mit Manny oder dem Hausverwalter klären muss, wenn ich wiederkomme.
Schließlich verlassen Tasha und ich die Wohnung und begeben uns nach unten in die Lobby und dann nach draußen. Vor dem Haus verabschieden wir uns voneinander und ich gehe über ihre Einwendungen hinweg und spendiere uns zwei Taxis, eines für jede von uns. Nachdem sie mir Vorhaltungen darüber gemacht hat, ich wäre stur und würde das schöne Geld verschwenden, umarmt sie mich schnell und folgt Manny, der ihr die Tür ihres Taxis aufhält. Vor der Abfahrt winkt sie mir noch einmal zu.
Ich gehe zu dem anderen wartenden Taxi.
»Bitte schön, Miss Ross«, sagt Manny und hält auch mir die Tür auf. »Dürfen wir dann morgen mit Ihnen rechnen?«
»Oh, ich glaube schon«, sage ich, während ich hinten einsteige, obwohl ich die Vorstellung, meine winzige Wohnung gegen so eine vornehme Behausung zu tauschen – und sei es auch nur auf Zeit – immer noch nicht verdaut habe.
Das ist nicht meine Welt, und ich tue gut daran, das nicht zu vergessen. Nach vier Monaten wird meine Zeit hier um sein, und ich werde zu dem Leben zurückkehren, das ich mir in meiner Welt geschaffen habe. All meine Probleme werden dort auf mich warten, um mich nach dieser kurzen Flucht aus der Realität wieder in Besitz zu nehmen … zusammen mit den Geheimnissen, die ich mit mir herumtrage und die mich niemals loslassen werden.
Während ich noch Erinnerungen an die Vergangenheit nachhänge, halte ich inne, um zu dem freundlichen Portier aufzuschauen, ehe er die Tür schließt. »Gute Nacht, Manny. Und, bitte, nennen Sie mich Avery.«
»Wie Sie wünschen. Gute Nacht, Miss Avery.« Er zwinkert mir zu und deutet eine Verbeugung an, während er die Tür schließt. Dann klopft er leicht aufs Dach des Taxis, um dem Chauffeur anzuzeigen, dass er losfahren kann.
Ich gebe dem Fahrer meine Adresse und mache es mir dann für die gut halbstündige Heimfahrt bequem. Während es die Park Avenue entlanggeht, mustere ich die Gegend, in der ich die nächsten drei Monate wohnen werde.
Als ich die dunkle Gestalt eines einsamen Joggers auf der gegenüberliegenden Straßenseite erspähe, der zum Gebäude zurückläuft, durchzuckt es mich, ohne dass ich etwas dagegen tun kann, als ich den Mann wiedererkenne.
Mr. Baine.
Er macht lange, ausholende Schritte. Aggressive Schritte. Sein muskulöser Körper pflügt wie eine Klinge durch die Dunkelheit … wie ein Mann, der meint, alle müssten ihm Platz machen, nur weil er da ist.
Wenn ich Gründe brauche, um mich von einem Mann wie ihm fernzuhalten – eigentlich von jedem Mann –, gibt es dafür viele. Aber das hält meinen Herzschlag nicht davon ab, schneller zu werden, während ich die Bewegungen seines kräftigen Körpers beobachte. Es verhindert nicht, dass meine Haut bei der Erinnerung daran, wie er mich vorhin mit seinen stechenden blauen Augen durchbohrt – mich förmlich entblößt – hat, heiß wird und anfängt zu kribbeln.
Er ist nichts für mich. Das weiß ich.
Aber kaum habe ich ihn erspäht, kann ich den Blick nicht mehr abwenden.
Erst als der Abstand zwischen uns zu groß wird und er in der Nacht hinter mir verschwindet, lasse ich mich wieder gegen die Rückenlehne sinken.
Nach einer unruhigen Nacht in meinem Schrankbett in meiner Ein-Zimmer-Wohnung holt mich die Wirklichkeit wieder ein, als mein Vermieter kurz vor acht am Morgen gegen meine Tür klopft. Träume von glitzernden Hochhäusern und blauäugigen Fremden lösen sich im rücksichtslosen Hämmern an meine Wohnungstür auf.
Das Donnern hört nicht auf.
»Avery, ich weiß, dass Sie da drin sind!« Mein Vermieter, Leo, brüllt mit seiner Raucherstimme durch die verriegelte Tür. »Wir müssen über die Wohnung reden.«
Wieder schlägt er mit der Faust an die Tür.
»Na los, machen Sie jetzt endlich auf. Ich weiß, dass Sie den Räumungsbescheid bekommen haben, den ich Ihnen eingeworfen habe. Was glauben Sie wohl, wie lange Sie mir noch aus dem Weg gehen können, Avery?«
Er fängt wieder zu klopfen an. Im selben Moment klingelt plötzlich mein Handy.
Stöhnend schlage ich die Bettdecke zurück und mache mühsam die Augen auf, um zu sehen, wer mich anruft.