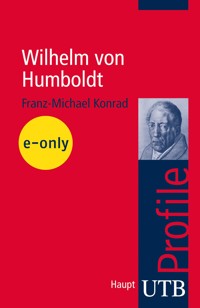Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Das Buch führt in alle gängigen Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft ein. Dabei werden die texthermeneutischen Methoden ebenso wie die qualitativ- und die quantitativ-empirischen Methoden vorgestellt. Knappe wissenschaftsgeschichtliche und wissenschaftstheoretische Hinweise erleichtern die Einordnung der Methoden und zahlreiche Beispiele aus der erziehungswissenschaftlichen Forschung veranschaulichen ihre Anwendung in der Forschungspraxis. Auf diese Weise werden Studierende dazu befähigt, kleinere und größere Forschungsvorhaben eigenständig zu planen und durchzuführen - von der Problembeschreibung über die Hypothesenbildung und Datengewinnung bis zur Auswertung und Interpretation der Daten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autoren
Franz-Michael Konrad, Jg. 1954, ist emeritierter Professor für Historische und Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Maximilian Sailer, Jg. 1973, ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Passau.
Franz-Michael Konrad Maximilian Sailer
Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft
Eine Einführung
Unter Mitarbeit von Christina Herrmann
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-021799-7
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-044425-6
epub: ISBN 978-3-17-044426-3
Vorwort
Nach langen Jahren der Vorbereitung freuen wir uns, dass dieses Buch nunmehr erscheinen kann. Die vorliegende Einführung in die Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft ist zum einen das Ergebnis unserer vielfältigen praktischen Erfahrungen, die wir über Jahrzehnte bei der Durchführung von Forschungsprojekten sammeln konnten. Wichtiger aber noch waren die zahllosen Rückmeldungen von Studierenden aus unseren Lehrveranstaltungen zu den forschungsmethodischen Grundlagen des Faches Erziehungswissenschaft. Es waren letzten Endes unsere Studierenden und ihre klugen Fragen, Zweifel und weiterführenden Gedanken, die dem Buch, das sich ausdrücklich an Studienanfänger des Faches Erziehungswissenschaft wendet, zur Entstehung verholfen haben. Diesen jungen Leuten, deren erste Schritte auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Befassung mit Problemen der Erziehung und Bildung wir anleiten und begleiten durften, gebührt vordringlich unser Dank.
Zu danken haben wir allerdings auch unseren Mitarbeiterinnen Monika Hilbert (Sekretariat Passau) und Elisabeth Mossburger (Sekretariat Eichstätt). Hinzu kommen die zahlreichen studentischen Hilfskräfte an beiden Universitäten, die über Jahre hinweg mit großem Eifer und steter Zuverlässigkeit Literaturbeschaffung, allgemeine Recherche etc. erledigt haben. Schließlich sind wir Christina Herrmann (Passau) verpflichtet, die insbesondere an der Endfassung dieses Buches intensiv mitgewirkt und wertvolle Hinweise beigesteuert hat. Last but not least – das Buch wäre ohne die geduldige Begleitung und Ermutigung durch unseren Lektor Klaus-Peter Burkarth vom Kohlhammer Verlag nie erschienen. Zu danken haben wir auch Kerstin Weissenberger und Elisabeth Häge, ebenfalls Kohlhammer Verlag, für ihre wertvolle Unterstützung bei der Herstellung der Druckfassung dieses Buches.
Möge das Buch einen kleinen Beitrag zu der wissenschaftsgeschichtlich recht späten, erfreulicherweise aber doch seit einiger Zeit mit Macht in Gang gekommenen methodologischen Fundierung des Faches Erziehungswissenschaft leisten und schon Studienanfänger*innen einen Eindruck von den Besonderheiten ihres Faches vermitteln. Übrigens: Kritische Rückmeldungen sind uns immer willkommen.
Eichstätt und Passau im Januar 2024
Franz-Michael Konrad
Maximilian Sailer
Inhalt
Vorwort
Vorbemerkung
1 Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft
1.1 Die Forschungsmethoden in der Geschichte der Erziehungswissenschaft
1.1.1 Einleitung
1.1.2 Immanuel Kant und die Aufklärungspädagogik
1.1.3 Das 19. Jahrhundert
1.1.4 Die experimentelle Pädagogik
1.1.5 Die Geisteswissenschaftliche Pädagogik
1.1.6 Die empirische Wende
1.1.7 Erziehungswissenschaft in der DDR (1949–1990)
1.1.8 Bildungsforschung und Schulleistungsstudien
1.2 Anwendungsfelder Erziehungswissenschaftlicher Forschung
1.2.1 Grundlagenforschung
1.2.2 Angewandte Forschung
1.2.3 Die Forschungsmethoden im pädagogischen Alltag
2 Die Phasen des Forschungsprozesses
2.1 Zum Problem der Methode
2.2 Die Phasen des Forschungsprozesses
3 Die Themenfindung – Beschreibung und Begründung
4 Die Operationalisierung
5 Das Forschungsdesign
6 Die Datenerhebung
6.1 Erziehungswissenschaftliche Daten
6.1.1 Nonreaktive Daten: Texte, Bilder und Dinge
6.1.2 Reaktive Daten: Visuelle Daten und Verbale Daten
6.2 Die Datenerhebungsmethoden
6.2.1 Erhebungsmethoden Nonreaktiver Daten
6.2.2 Erhebungsmethoden reaktiver Daten
6.2.2.1 Die Beobachtung: Visuelle Daten
6.2.2.2 Das Interview: Verbale Daten
6.2.2.3 Der Fragebogen: Verbale Daten
6.2.2.4 Soziale Netzwerkanalyse: Relationale Daten
6.2.2.5 Das Experiment: Ein Multitalent
6.2.2.6 Die Methodentriangulation (Mixed Method Research)
7 Die Datenanalyse – Verschiedene Zugänge
7.1 Verstehen, Geschichte, Sinnsuche: Hermeneutik in der Erziehungswissenschaft
7.1.1 Vorbemerkungen zur Klassischen Hermeneutik
7.1.2 Verstehen in der Erziehungswissenschaft
7.1.2.1 Texthermeneutik
7.1.2.2 Bildhermeneutik
7.1.2.3 Dinghermeneutik
7.2 Zusammenfassen, Explizieren, Strukturieren: Qualitative Verfahren in der Erziehungswissenschaft
7.2.1 Gegenstandsbezogene Theoriebildung (Grounded Theory) und Qualitative Inhaltsanalyse
7.2.2 Objektive Hermeneutik
7.2.3 Psychoanalytische Textinterpretation
7.2.4 Die dokumentarisch-rekonstruktive Methode
7.2.5 Abschließende Bemerkungen
7.3 Zählen, Messen, Quantifizieren: Quantitative Verfahren in der Erziehungswissenschaft
7.3.1 Statistik in der Erziehungswissenschaft
7.3.2 Deskriptive Statistik
7.3.3 Inferenzstatistik
7.3.3.1 Signifikanz und Signifikanzniveau
7.3.3.2 Die Effektstärke
7.3.3.3 Verfahren zur Bestimmung von Zusammenhängen – Korrelation
7.3.3.4 Einfache lineare Regression
7.3.3.5 Multiple lineare Regression
7.3.3.6 Mediation und Moderation in der multiplen Regression
7.3.3.7 Die Varianzanalyse (ANOVA)
7.3.3.8 Mehrfaktorielle Varianzanalyse
8 Die Ergebnispräsentation – der Forschungsbericht
Nachwort
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Literatur
Vorbemerkung
Was bietet dieses Buch?
Gegenstand dieses Werkes sind die in der Erziehungswissenschaft und ihren Teildisziplinen (Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik, Sozialpädagogik/Soziale Arbeit, Erwachsenenbildung, Wirtschaftspädagogik usw.) gebräuchlichen Forschungsmethoden. Es wird sowohl der texthermeneutische Zugang vorgestellt – ergänzt um die Bild- und die (seltene) Dinghermeneutik – als auch die sog. qualitativ-empirischen und die quantitativ-empirischen Methoden. Diese Forschungsmethoden werden beschrieben, auf ihre Einsatzmöglichkeiten hin befragt und so erklärt, dass die Leser*innen des Buches nachvollziehen können, wie die Erziehungswissenschaft zu ihren Ergebnissen kommt.
An wen wendet sich dieses Werk?
Da keine Voraussetzungen fachlicher Art gemacht werden, sondern alles grundlegend erklärt wird, sind insbesondere Leser*innen angesprochen, die am Beginn ihrer Beschäftigung mit den Fragestellungen, den Befunden und eben den Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft stehen. Vor allem ist dabei an Studierende des Faches in den ersten Semestern, im Rahmen des Bachelor-Studiums etwa, gedacht. Denn ein zeitgemäßes wissenschaftliches Studium kann auf eine solide Grundlegung der forschungsmethodischen Kompetenz nicht verzichten.
Warum braucht es dieses Buch?
Natürlich stellt sich die Frage: Gibt es nicht längst eine Fülle an Literatur zu Forschungsmethoden? In der Tat ist die sozialwissenschaftliche Methodenliteratur kaum noch zu überblicken. Das gilt schon für den deutschen Sprachraum und viel mehr noch, wenn man fremdsprachige Beiträge einbezieht. Darunter finden sich auch zahlreiche Beiträge grundlegenden bzw. einführenden Charakters. Wenn das so ist, warum dann ein weiteres Werk zu diesem Thema?
So vielfältig die Methodenliteratur tatsächlich ist, Erziehungswissenschaftler*innen treten zumindest im deutschsprachigen, sozialwissenschaftlichen Methodendiskurs bisher vergleichsweise wenig in Erscheinung, auch wenn erziehungswissenschaftliche Beiträge zur Methodendiskussion inzwischen durchaus häufiger geworden sind und überdies einführende Werke aus der Feder von Erziehungswissenschaftler*innen in wachsender Zahl vorliegen. In diesem Umstand einer immer noch merklichen Abstinenz der Erziehungswissenschaft auf dem Gebiet der sozialwissenschaftlichen Methodendiskussion liegt eine erste Begründung für das vorliegende Buch. Da es durchaus einen Unterschied macht, ob man in fremden disziplinären Kontexten entwickelte und erprobte Methoden rezipiert oder sich unter einer genuin erziehungswissenschaftlichen Perspektive die entsprechenden Forschungsmethoden des Faches aneignet, braucht die Erziehungswissenschaft sehr wohl ihre eigene Methodenlehre. Zurecht hat schon der Philosoph und Pädagoge Johann Friedrich Herbart (1776–1841) in seiner »Allgemeinen Pädagogik« von 1806 gefordert, die Pädagogik solle sich »so genau als möglich auf ihre einheimischen Begriffe besinnen« (Herbart 1983, S. 34). Dementsprechend muss sich die Pädagogik, die wir heute aus Gründen, die in diesem Buch noch dargestellt werden, Erziehungswissenschaft nennen, auf ihre ›einheimischen Methoden‹ besinnen. Zwar gibt es keine genuin erziehungswissenschaftlichen Forschungsmethoden, wie übrigens ebenfalls keine genuin soziologischen oder psychologischen oder politologischen usw. Forschungsmethoden existieren. Es gibt nur sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden bzw. – noch grundsätzlicher betrachtet – überhaupt nur wissenschaftliche Forschungsmethoden. Gleichwohl kann es natürlich nicht ohne Auswirkung auf die Gestalt eines Faches sowie seine Geltung und Reputation bleiben, wenn dieses Fach die ihm angemessenen Forschungsmethoden immer wieder aus Kontexten importiert, die nicht die seinen sind. Oder anders ausgedrückt: Der Blickwinkel, unter dem beispielsweise in der Soziologie die soziale Wirklichkeit wahrgenommen wird, ist ein anderer als in der Erziehungswissenschaft; und auch z. B. die Psychologie versteht ›Lernen‹ anders als die Erziehungswissenschaft etc. Wenn dies aber so ist, dann ist es umso bedauerlicher, wenn den Studierenden des Faches Erziehungswissenschaft keine Methodenlehre zur Verfügung steht, die eine explizit und ausschließlich erziehungswissenschaftliche ist. Der von vielen erfahrenen Lehrenden des Faches beklagte Umstand, dass nicht wenige ihrer Studierenden bis ans Ende ihres Studiums nicht eigentlich anzugeben vermögen, worin das Eigenständige, das sog. Proprium der Erziehungswissenschaft besteht, mag u. a. aus diesem Defizit herrühren.
Ein weiteres Motiv, das diesem Werk zur Entstehung verholfen hat, ist mit dem eben genannten Aspekt eng verbunden. Aus Gründen, die später noch zu erörtern sein werden, bedient sich die Erziehungswissenschaft einer Vielfalt unterschiedlichster Forschungsmethoden. Dieser Umstand würde eigentlich vermuten lassen, in den vorhandenen erziehungswissenschaftlichen Methodenlehren einführenden Charakters alle jene Methoden dargestellt zu finden. Das ist allerdings gerade nicht der Fall. Wenn wir recht sehen, gibt es bislang kein Werk auf dem reichhaltigen Markt der Methodenliteratur, welches alle relevanten erziehungswissenschaftlichen Forschungsmethoden in einem Band versammelt. Unseres Wissens haben zuletzt in den 1970er Jahren (!) zwei Bücher diesen Anspruch erhoben – und sind an ihm gescheitert, weil sie eben doch nur eine subjektive Auswahl aus dem (damaligen, inzwischen ohnehin nur noch begrenzt aktuellen) erziehungswissenschaftlichen Methodenarsenal geboten haben (Röhrs 1971; Mollenhauer & Rittelmeyer 1977). Wer sich gegenwärtig über die erziehungswissenschaftlichen Forschungsmethoden in einführender Weise informieren möchte, sieht sich also der Notwendigkeit ausgesetzt, nacheinander mehrere unterschiedlichste Werke konsultieren zu müssen. Hier versucht das vorliegende Buch ebenfalls zu helfen. Es will alle in der Erziehungswissenschaft verwendeten Forschungsmethoden wenigstens grundrissartig vorstellen, und es will durch die eingestreuten Beispiele aus der erziehungswissenschaftlichen Forschungspraxis die nämlichen Forschungsmethoden als explizit erziehungswissenschaftliche identifizieren. Ebenso erfolgen die wissenschaftstheoretischen und wissenschaftsgeschichtlichen Exkurse, soweit dies möglich ist, am Beispiel der Erziehungswissenschaft. Wer dieses Buch liest, nimmt die Forschungsmethoden also immer sowohl aus dem Blickwinkel des Faches als auch aus dessen spezifischen Frage- und Problemstellungen wahr.
1 Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft
Bevor wir die Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft im Einzelnen beschreiben und ihre Anwendung diskutieren, wollen wir im Überblick darstellen, wie sich diese Forschungsmethoden im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Dabei wird einerseits deutlich, dass die Erziehungswissenschaft über ihre Methodenpraxis in die allgemeine Wissenschaftsentwicklung verwoben ist, wie sie sich andererseits erst über ein festes Set an Forschungsmethoden als eigenständige wissenschaftliche Disziplin etabliert hat. Die Methodenreflexion bietet also ein Stück Wissenschaftsgeschichte der Erziehungswissenschaft im Kurzdurchgang.
1.1 Die Forschungsmethoden in der Geschichte der Erziehungswissenschaft
1.1.1 Einleitung
Die Einsicht in die Lernbedürftigkeit des Menschen gehört zu den grundlegenden Erkenntnissen der Anthropologie. Als »physiologische Frühgeburt« hat der Biologe und Anthropologe Adolf Portmann (1897–1982) den Menschen einmal bezeichnet, weil das Menschenjunge den Reiferückstand, den es bei der Geburt gegenüber anderen Lebewesen aufweist, durch extrauterines Lernen ausgleichen muss. Daneben wird immer wieder auf die Instinktarmut des Menschen verwiesen. Was bei den Tieren die Instinkte regulieren, muss der Mensch mühsam lernen. Dafür ist dem Menschen ein Lernvermögen eigen, das die Lernfähigkeit aller anderen Lebewesen bei weitem übersteigt.
Solange die Verhältnisse einfach und überschaubar waren, waren es diese ›Verhältnisse‹ – Lebenslage, Tradition, Sitte, das Vorbild der Älteren –, die dem Nachwuchs vermittelten, was er zu wissen und zu können hatte. Niemand dachte genauer über das Wie, Warum und Wozu nach. Die wenigen Akte absichtsvoller Erziehung erfolgten intuitiv und aus Erfahrung. Von einem nur zögerlichen und schrittweisen Erwachen der »pädagogischen Frage« hat der Erziehungswissenschaftler Erich Weniger (1894–1961) einmal gesprochen (Weniger 1975, S. 114).
Ein solches Erwachen fand möglicherweise schon in vorgeschichtlicher Zeit statt, als Priester und Schamanen im Rahmen von Initiationsriten tätig wurden, ganz sicher aber spätestens mit dem Übergang zur Literalität z. B. im alten Ägypten (vgl. Brunner 1991). Das Lesen und Schreiben zu erlernen, war eine neue Herausforderung, die beiläufig und von Laien angeleitet nicht zu bewältigen war. Im alten Ägypten traten deshalb erstmals Lehrer in Erscheinung, die aus den »Weisheitsbüchern« vortrugen und eine kleine Zahl von männlichen Kindern im Lesen, Schreiben und in elementarer Mathematik unterwiesen. In Griechenland übernahmen diese Aufgabe die Elementarlehrer, zu denen die kleinen Jungen gingen, um das Lesen und Schreiben zu lernen und eine musische Grundbildung zu erhalten. Später, im Gymnasion, kamen die philosophischen Lehrer hinzu.
Seit dieser Zeit haben wir es in pädagogischer Hinsicht mit einem zweigeteilten Feld zu tun. Auf der einen Seite die Praktiker*innen, die sich in den Niederungen des Alltags um Erziehung und Bildung bemühen. Im Mittelalter ist an die in den Dom- und Klosterschulen lehrenden Kleriker zu denken, in den Städten an die Lehrer der Klipp- und Winkelschulen oder die Theologen an den höheren Schulen und in späteren Jahrhunderten an die ungezählten Dorfschulmeister und ihre Kollegen an den städtischen Gymnasien, die zuvor eine Reihe von Jahren als Privaterzieher (sog. Hofmeister) gearbeitet hatten. Im 19. Jahrhundert begegnen wir vermehrt auch Lehrerinnen und den ersten Kleinkinderzieherinnen, oftmals Mitglieder christlicher Orden. Die Arbeit dieser Pädagog*innen beruhte auf Erfahrung, auf Versuch und Irrtum, und war darin dem Laienhandeln, der elterlichen Erziehung, eng verwandt. In diesem Sinne hat der Theologe Friedrich Schleiermacher (1768–1834) in seinen Pädagogik-Vorlesungen, die er 1826 an der Berliner Universität hielt, der pädagogischen Praxis ihre ganz eigene Würde (»Dignität«) zugesprochen – und zwar ausdrücklich »unabhängig von der Theorie« (Schleiermacher 1964, S. 40).
Gleichwohl ist schon in der Antike der Wunsch entstanden, über Erziehung und Bildung ganz grundsätzlich auch nachzudenken. Immerhin waren Bildung und Erziehung bereits als öffentliche Aufgabe etabliert und ein einschlägiger Beruf war entstanden. So erwachte das Interesse an – noch einmal in den Worten Wenigers – »pädagogischer Theorie«. Schon Schleiermacher sah im alten Griechenland Erziehung und Bildung erstmals zum Gegenstand des Philosophierens geworden. Auch die heutige Erziehungsgeschichtsschreibung siedelt »die Geburt der Idee der abendländischen Pädagogik« (Böhm 2004, S. 12) in der Zeit zwischen dem achten und dem dritten vorchristlichen Jahrhundert an. Die Sophisten, die griechischen Weisheitslehrer, sind hier beispielhaft zu nennen, ebenso ihre Gegenspieler, die Sokratiker. Die Griechen, später die Römer, waren es auch, die den ersten Bildungskanon der abendländischen Geschichte formulierten, die Sieben Freien Künste (septem artes liberales), die so hießen, weil ihre Kenntnis den Menschen frei mache und weil ihr Studium den frei Geborenen vorbehalten war. Der im abendländischen Denken wohl berühmteste Versuch, zu klären, was unter »Bildung« und »Erziehung« zu verstehen ist, stammt ebenfalls aus der Antike. Gemeint ist das »Höhlengleichnis« des Philosophen Plato (428/27–348/47 v. Chr.). Zugleich verweist das Höhlengleichnis darauf, dass diese ersten theoretischen Überlegungen im Umfeld von Bildung und Erziehung (Paideia) in andere, größere Zusammenhänge eingelagert waren, denn das Höhlengleichnis erscheint im siebten Buch von Platos Schrift über den Staat (Plato 1991).
Während die Sokratiker und Sophisten noch selbst praktizierten, was sie an Lehr- und Unterrichtsmethoden propagierten, wurde das Theoretisieren über Bildung und Erziehung – wovon Plato und andere antike Denker eine Vorahnung geben – bald schon eine dem Alltag entrückte Angelegenheit, die in normativ ausgerichtete Erziehungs- und Bildungslehren mündete. Vom Mittelalter an waren diese Erziehungslehren ihrerseits in den größeren Rahmen philosophischer oder theologischer Denksysteme eingebunden. Ein bekanntes Beispiel ist der böhmische Theologe Jan Amos Comenius (1592–1670), dessen pädagogisches Denken in seiner pansophischen Theologie wurzelte.
Zwar waren diese Pädagogiken, wie gesagt, theoretischer Natur, auch wenn sie sich wie bei Comenius praktisch gaben. Und ein wesentliches Erfordernis von Wissenschaft war mit ihrer Theorieförmigkeit erfüllt. Allerdings: Bewegten sich die pädagogischen Praktiker im Zirkel ihres praktischen Tuns, so verharrten die Denker im Bannkreis ihrer Theorien – und die waren so defizitär wie es auf seine Weise der pädagogische Alltag war. Was dem Nachdenken über Erziehung und Bildung und der daraus gewonnenen Theorie abging, das war die Konfrontation mit der Wirklichkeit. Es mag deshalb mithilfe dieser Theorien die Erziehung, wie Schleiermacher meinte, »eine bewußtere« (Schleiermacher 1964, S. 40) geworden sein. Dieses Bewusstsein hat sich in der Hauptsache aber auf die Idee einer besseren Erziehung bezogen, ohne dass sich daraus zwingend für eine auch in der Praxis bessere Erziehung Dienliches ergeben hätte. »Ideen« waren nämlich nach der Lehre des Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant (1724–1804) aus Prinzipien der reinen Vernunft konstruiert, vollkommen und aller Erfahrung vorgeordnet. In diesem gewissermaßen utopischen Charakter liegt ihr Wert bis heute, hat Kant doch der Idee die Aufgabe gestellt, sie solle dem praktischen Handeln als (nie ganz erreichbarer) Maßstab bzw., wie er das ausdrückte, »zur Regel dienen« (zit. n. Delekat 1969, S. 160). Aus diesem Umstand hat sich allerdings gerade in der deutschen Erziehungs- und Bildungswissenschaft eine idealistische Schlagseite ergeben, die bis in unsere jüngere Vergangenheit hinein das Entstehen normativer, appellativer, kurz: idealistischer Pädagogiken begünstigt hat. Freilich gab es lange keine Methoden, um Ideen an der Wirklichkeit zu prüfen. Erst mit dem Experiment wurde im 17. Jahrhundert eine Forschungsmethode entwickelt, die es erlaubte, systematisch beobachtbare Tatsachen zu ermitteln, um auf diesem Wege objektive Ergebnisse zu erhalten. Damit begann die Methodendiskussion. Im folgenden Kapitel werden die Namen Galilei, Descartes und Vico fallen, Vertreter jener Epoche, die der Methodendebatte erste wichtige Impulse gaben. Theorien konnten nun regelgeleitet auf ihren Realitätsgehalt überprüft werden. Das setzte im 18. Jahrhundert in Deutschland den Impuls frei, auch über Erziehung und Bildung nicht nur nachzudenken, sondern dieses Denken auf den empirischen Prüfstand zu stellen. Zwar sollte es bis zum vollständigen Durchbruch dieses neuen Ansatzes in der Pädagogik noch dauern – ein Anfang war jedoch gemacht.
1.1.2 Immanuel Kant und die Aufklärungspädagogik
Immerhin wusste schon kein Geringerer als der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, dass aus dem Philosophieren allein keine das pädagogische Handeln verbessernden Hinweise zu gewinnen waren. Man bilde sich eben nur ein, schrieb er, »dass man schon aus der Vernunft urteilen könne, ob etwas gut, oder nicht gut sein werde.« Das aber sei falsch, denn »die Erfahrung lehrt, dass sich oft bei unseren Versuchen ganz entgegengesetzte Würkungen zeigen von denen, die man erwartete« (Kant 1964, S. 708). Man musste die pädagogische Sache also systematisch angehen und durfte sich nicht auf die Vernunft (allein) verlassen.
Außer Kant forderten auch viele andere Zeitgenossen im 18. Jahrhundert, oft vom pädagogischen Alltag frustrierte Praktiker, sich der Herausforderung, die Erziehung zu verbessern, nicht länger entweder über theologische und philosophische Deduktionen oder mittels bloßen Herumprobierens zu stellen. Man solle auf Theorie nicht verzichten, aber es brauche eine andere, eine bessere Theorie, eine solche, die auf Erkenntnissen beruhe, die aus der systematisch angeleiteten Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit resultierten. Darin fanden sie sich von der aus England stammenden, auf Francis Bacon (1561–1626) und Thomas Hobbes (1588–1679) zurückgehenden Schule des Sensualismus bzw. Empirismus bestärkt, die – sehr vereinfacht gesprochen – menschliches Erkennen an das band, was in der Realität erfahren werden konnte. In die Behandlung pädagogischer Vorgänge hat der Sensualismus über den englischen Philosophen John Locke (1632–1704) und dessen 1693 veröffentlichtes Buch »Some Thougths concerning Education« (Locke 1970) Eingang gefunden, worin Locke als Bedingung ihres Gelingens fordert, Erziehung habe die Natur des Zöglings zu kennen und zu beachten.
Eine Gruppe fortschrittlicher Pädagogen in Deutschland, die sog. Aufklärungspädagogen, folgten dieser Empfehlung Lockes und haben in ihren Reformschulen, den sog. Philanthropinen, ›natürliche‹ Erziehung praktisch umzusetzen versucht. Mit anderen Worten: Sie wollten »von richtigen Vorstellungen über die Natur und die Gesetze der einzelnen Kräfte, welche wir in der menschlichen Seele antreffen, ausgehen, und auf eine diesen Gesetzen entsprechende Art ihr Werk beginnen«, wie es einer der ihren, August Hermann Niemeyer (1754–1828), ausdrückte (Niemeyer 1970 [erstmals 1796], S. 105). Einsichten in die menschliche Natur seien, wie das von den Sensualisten vorgedacht worden war, auf dem Wege der Beobachtung und des Experiments zu gewinnen. Darauf also sollte sich die neue Theorie gründen, an die Niemeyer die Hoffnung band: »Je vollständiger und richtiger man … die Theorie kennt, desto geschickter sollte man auch in der Kunst [der Erziehung] sein« (Niemeyer 1970, S. 105).
Zu diesen Neuerern gehörte auch Ernst Christian Trapp (1745–1818), der von einem aufgeschlossenen preußischen Kultusminister auf die erste Professur ausdrücklich für Philosophie und Pädagogik in Deutschland, ab 1779 an der Universität Halle, berufen worden war. Auch Trapp kritisierte den »Mangel sorgfältig und lange genug angestellter anthropologischer Beobachtungen, und daraus fliessender zuverlässiger Erfahrungen« und forderte eine »gehörige Anzahl richtig angestellter pädagogischer Beobachtungen«, die es dann erlauben würden, »ein richtiges und vollständiges System der Pädagogik [zu] schreiben.« Bezüglich der systematisch anzustellenden pädagogischen Beobachtungen entwarf Trapp ein geradezu modern anmutendes Untersuchungsdesign:
»Man gebe mehrern Kindern von einerlei Alter verschiedene Gegenstände, Spielzeug, Bücher, Modelle, Gemälde etc. und lasse sie damit nach Belieben schalten und walten. Nun gebe man Acht auf die Verschiedenheit ihrer Äußerungen, Empfindungen, Handlungen, Erfindungen u. s. w. Man sehe, welche Gegenstände sich dieser, und welche sich der wählt, wie bald er ermüdet, wie lange er bei einem Gegenstand aushalten kann. Man zähle, wie viele und welche Idee, Empfindungen und dadurch veranlasste Äußerungen und Handlungen in einer gewissen Anzahl von Minuten und Sekunden in den Kindern entstehen und zum Vorschein kommen. Man mache das Experiment mit Kindern von zwei bis sechszehn Jahren oder noch weiter. Man gebe auf die Verschiedenheit der Wirkungen Acht, wenn, bei den nemlichen Gegenständen die Zahl der Kinder von zwei bis zwanzig, oder wie weit man will, verschieden ist; oder, wenn bei den nemlichen Gegenständen das Alter der Kinder verschieden ist; oder wenn beides Zahl und Alter verschieden sind; kurz, man führe das Experiment durch alle mögliche Combinationen von Alter der Kinder, von Zahl, Beschaffenheit, Verschiedenheit der Kinder und der Gegenstände durch« (Trapp 1977 [zuerst 1780], alle Zitate § § 25–29).
Trapp konnte sogar an der Universität eine Übungsschule einrichten, um die Lehrerbildung auf der Basis genauer Beobachtungen realitätsnäher zu gestalten. Daneben gab es zu jener Zeit engagierte Laien, Väter, die Beobachtungen an ihren Kindern anstellten und in akribisch geführten Tagebüchern dokumentierten, die anschließend in Zeitschriften publiziert wurden (Schmid 2001). So entstanden die ersten empirischen Untersuchungen über kleine Kinder, die ersten entwicklungspsychologischen Darstellungen in deutscher Sprache.
Zu den Verfechtern einer an der Wirklichkeit ausgerichteten, methodisch fundierten Erziehungslehre gehörte auch, es ist schon angeklungen, Kant. Da Studenten der Philosophie ebenso wie solche der Theologie, sei es als Gymnasiallehrer, als Hauslehrer oder als Pfarrer, später auch praktisch-erzieherisch tätig wurden, sollten sie diesbezügliche Grundkenntnisse erwerben, und dafür waren ihre philosophischen und theologischen Lehrer zuständig. So hatte der Philosoph Kant Pädagogik-Vorlesungen zu halten. In seinen Pädagogik-Vorlesungen setzte sich Kant entschieden für »Experimentalschulen« ein, die man einrichten müsse, »ehe man Normalschulen errichten kann« (Kant 1964, S. 708). Als beste Experimentalschule seiner Zeit rühmte Kant das Dessauer Philanthropin des Bernhard Basedow (1724–1790), an dem auch Trapp eine Zeitlang tätig gewesen war. In dieser Schule, so Kant, hätten die Lehrer alle Freiheiten des Unterrichtens und Erziehens, sodass hier die für die Verbesserung der Erziehung so notwendigen Experimente angestellt werden könnten. Auch Kant war ein großer Anhänger des Experiments. Das oben schon ausschnitthaft wiedergegebene Kant-Zitat lautet vollständig nämlich so: »Man bildet sich zwar insgemein ein, dass Experimente bei der Erziehung nicht nötig wären, und dass man schon aus der Vernunft urteilen könne, ob etwas gut, oder nicht gut sein werde.« (Kant 1964, S. 708).
Die schon von Trapp in seinem Buch getroffene Unterscheidung zwischen den Zielen der Erziehung und den Mitteln und Wegen, die zur Erreichung der Erziehungsziele eingeschlagen werden müssten, findet sich auch bei Kant. Die Ziele der Erziehung sollten von der Ethik, einem Teilgebiet der Philosophie, mit allgemein gültigem Geltungsanspruch vorgegeben, die Mittel und Wege der Erziehung aber erfahrungswissenschaftlich bestimmt werden. Wobei Kant, das sei hier nur angemerkt, kein bedingungsloser Anhänger des sich methodisch im Bekenntnis zum Experiment äußernden Empirismus war, sondern vielmehr der Überzeugung war, Erkennen ruhe zwar auf einem sinnlichen Fundament, gehe also von der Erfahrung aus, werde zu Erkenntnis aber nur mittels apriorisch gegebener begrifflicher Vorschematisierungen, die das vernünftige Denken liefere.
1.1.3 Das 19. Jahrhundert
Mit dem Ende des Aufklärungszeitalters war auch das Werben für eine erfahrungswissenschaftlich begründete Erziehungslehre an ihr Ende gekommen. Nach Trapp geriet die Lehrerbildung an der Universität Halle in die Hände des Philologen und Neuhumanisten Friedrich August Wolf (1759–1824), der gemäß der neuhumanistischen Doktrin an der Universität keine praxisnahe Berufsausbildung, sondern nur reine Wissenschaft treiben wollte. Eine der ersten Amtshandlungen Wolfs bestand folgerichtig in der Schließung der Universitätsübungsschule und in der Umwandlung des Trappschen Institutum Paedagogicum in ein Institutum Philologicum, an dem die angehenden Philologen ihre Studien trieben – fernab jeglicher Pädagogik, auch wenn viele von den Studenten anschließend als Gymnasiallehrer tätig werden sollten. Die Bildungsfrage wurde mit dem emphatischen Anruf der Antike beantwortet. Die Griechen, hatte Humboldt 1793 bekannt, würden für ihn »immer … einzig bleiben« (zit. in Konrad 2010, S. 26). Die Bildung des Menschen zu wahrem Menschentum lasse sich deshalb am besten in der Beschäftigung mit den Hervorbringungen dieser klassischen Epoche der europäischen Geistesgeschichte bewirken. Nicht die Hinwendung zum Alltag der Erziehung stand auf dem Programm, sondern das Gegenteil, dessen ästhetische Überwindung. Es ist kein Zufall, dass die im Zeichen des Neuhumanismus stehende Reform des höheren Schulwesens mit dem humanistischen Gymnasium die alten Sprachen, überhaupt das Literarisch-Ästhetische, so sehr in den Mittelpunkt des Curriculums rückte.
Allerdings verloren sich die Impulse der Aufklärungspädagogik nicht nur an der Universität. Auch in den im 19. Jahrhundert zur Verbesserung der Volksschullehrerbildung eingerichteten Seminaren kamen sie nicht zum Zuge, denn auch dort waren sie nicht gewünscht. So äußerte sich der Volksschulpädagoge Friedrich Adolph Diesterweg (1790–1866) sehr distanziert zum Wert des aus wissenschaftlicher Forschung gewonnenen Wissens für eine gelingende Praxis: »Die Praxis lernt sich nur in der Praxis, im Leben«, meinte Diesterweg (zit. in Tenorth 1990, S. 82). Eine auf Forschung beruhende Lehrerbildung sah Diesterweg in der Gefahr von zu großer Praxisferne. Besserung im pädagogischen Alltag versprach sich Diesterweg dagegen von intern erzeugtem Wissen, aufgeklärte und reflektierte Praxis von Praktiker für Praktiker sozusagen (vgl. auch Tenorth 1994). Deshalb bestanden die Lehrerseminare immer in enger Verbindung mit Übungsschulen, auch wenn diese – anders als bei Trapp – nicht der wissenschaftlichen (z. B. experimentellen) Forschung, sondern dem Erwerb von Unterrichtspraxis dienen sollten.
Für die Seminarausbildung galt darüber hinaus: Was die jungen Lehramtsanwärter nicht bei den Praktikern abschauen konnten, sollten sie ergänzend aus der historischen Literatur gewinnen. Lehren lernt man eben auch, war die Meinung, indem man sich mit den Schriften der Meister der Vergangenheit auseinandersetze, mit Comenius etwa oder den Didaktikern des 17. und 18. Jahrhunderts. Nicht zuletzt sollte die Beschäftigung mit der Geschichte die angehende Lehrerkraft »vor allzu blindem Vertrauen auf die Macht einer Theorie« warnen, ihr dagegen die großen Pädagogen »in ihrem Tun und Lassen« vorstellen, auf dass diese ihr zu Vorbildern würden (Königbauer 1897, o. S.). Bildungsgeschichte als Anregung und Motivationshilfe sozusagen. Dem dienten die emsig verfassten Lehrbücher der Erziehungs- und Bildungsgeschichte, die an den Seminaren eingesetzt wurden.
Ein gutes Beispiel für die Seminarpädagogik des 19. Jahrhunderts ist der sog. Herbartianismus. Dessen Begründer, der schon erwähnte Philosoph Johann Friedrich Herbart, forderte zwar, die Pädagogik dürfe nicht länger »als entfernte, eroberte Provinz von einem Fremden aus regiert« werden (Herbart 1983, S. 34) – und meinte damit die Philosophie, von der sich die Pädagogik emanzipieren solle. Auch Herbart erklärte den misslingenden Alltag aus dem »Rückstand der pädagogischen Experimente« (Herbart 1983, S. 33), aus einem Mangel an systematischer Wirklichkeitsbeobachtung also, womit er sich durchaus in großer Nähe zu den Aufklärungspädagogen befand.
Experimentalforschung betrieb Herbart allerdings selbst nicht. Immerhin eröffnete er an seiner Universität in Königsberg in Ostpreußen, wo er als Nachfolger Kants lehrte, eine Übungsschule, in der die Studenten im Unterricht zur Anwendung bringen konnten, was Herbart ihnen zuvor aus seinen eigenen Erfahrungen als praktischer Lehrer, v. a. aber aus seinem Wissen als Psychologe und systematischer Philosoph als Theorie vermittelt hatte. Die im praktischen Unterrichten gewonnenen Erkenntnisse sollten die Studenten anschließend im Gespräch mit Herbart überdenken, um ihr Wissen erneut, nun reflektierter als zuvor, an der Universitätsschule dem Praxistest zu unterziehen. In diesem Kreislauf aus Theorie, Praxis und erneuter Reflexion der Theorie unter Herbarts Anleitung sollte die Ausbildung dessen erfolgen, was Herbart den »pädagogischen Takt« nannte; von pädagogischer Professionalität würden wir heute sprechen. Während jedoch die Aufklärer der Hoffnung gewesen waren, eine auf systematischer Forschung beruhende Theorie müsste sich umstandslos anwenden lassen (Niemeyer!), hatte Herbart erkannt, die Sache ist komplizierter, es gibt in der Erziehung kein kausales Ursache-Wirkungs-Prinzip nach der Art ›Gute Theorie, gute Praxis‹. Herbart wusste, jeder Lehrer konnte mit der besten Theorie, die ihm die besten Handlungsanweisungen zulieferte, scheitern, war er nicht in der Lage, die pädagogische Situation, in der er stand, richtig zu deuten. Diesem Problem aber war auf dem Wege empirischer Forschung nicht beizukommen (Herbart 1997).
Herbarts Ansatz hätte modellhaft sowohl für eine realistische Einschätzung der Wirksamkeit von Theorie wie auch für eine reformierte Lehrerbildung an den Seminaren stehen können. Die wenigen Schüler und Anhänger Herbarts auf universitären Lehrstühlen griffen jedoch diese Vorlage ihres Meisters nicht auf, sondern entwickelten aus vagen Überlegungen, die Herbart an anderer Stelle seines Werkes zur »Artikulation« des Unterrichts anstellte, eine Unterrichtsmethode, mit deren Hilfe der Unterricht in einzelne Lehr- und Lernschritte gegliedert werden konnte. Wer als Lehrer diese Schritte beherrschte, konnte jederzeit und stets in derselben Weise Unterricht machen. Damit aber war aus dem offenen Ansatz Herbarts, der eher einer Suchbewegung glich, eine Technik geworden, die an den Übungsschulen der Lehrerseminare vorgeführt und eingeübt wurde. Die darauf bezogene Forschung war zwar praktisch, vollzog sich aber innerhalb der durch die Methode gezogenen Grenzen. An dieser Limitierung scheiterte die Methode schließlich und wurde nach 1900 von den Unterrichtsmethoden der sog. Reformpädagogik abgelöst.
In den Jahrzehnten davor jedoch waren die Herbartianer, vermittelt über die Lehrerseminare, im Volksschulwesen höchst einflussreich, während sie im akademischen Betrieb, also an den Universitäten, Außenseiter blieben. Nur vereinzelt, z. B. Tuiskon Ziller (1817–1880) in Leipzig oder Wilhelm Rein (1847–1929) in Jena, kamen sie zu Lehrstühlen. Das Gros der Universitäts-Philosophen hielt es auch in ihren Pädagogik-Vorlesungen mit Humboldts Konzept von der Wissenschaft als »reine[r] Idee«. Für ihn sei Pädagogik »nichts anders als praktisch gewendete Philosophie« (Natorp 1985, S. 152), bekannte einer der Klügsten unter ihnen freimütig, Paul Natorp (1854–1924). Ebenso die Theologen, zu deren Aufgaben es ebenfalls gehörte, zu pädagogischen Fragen vorzutragen, nur, dass diese eben theologisch argumentierten. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert gab es nicht nur jene mit der Philosophie verschwisterte Universitätspädagogik, sondern eine ebensolche an die Theologie (katholischer oder protestantischer Provenienz) gebundene. So finden sich unter den Verfassern der bedeutendsten Abhandlungen zur Geschichte der Pädagogik neben Historikern wie Karl von Raumer (1783–1865) und Karl Adolf Schmid (1804–1887) und Philosophen wie Friedrich Paulsen deshalb auch Theologen wie Friedrich Heinrich Christian Schwarz (1766–1837). Ob aber nun philosophische Pädagogen oder theologische Pädagogen: Die Erziehungswirklichkeit wurde von beiden gleichermaßen ignoriert bzw. kam eben nur in historischer Gestalt vor, in den Quellen und Dokumenten der Vergangenheit, wo man sie textauslegend zu erfassen suchte.
Nun kann man fragen: Was ist mit Comenius, Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), Friedrich Fröbel (1782–1852)? In der Tat sind alle vier bis heute viel rezipierte, durchaus theorieaffine pädagogische Autoren und sie waren zweifellos gute Beobachter kindlicher Lebensäußerungen. Pestalozzi und Fröbel gründeten zudem Erziehungseinrichtungen, waren also erfahrene Praktiker. Systematische Forschung aber betrieben sie nicht. Zudem wurzelten sie, von Rousseau abgesehen, mit ihren Pädagogiken in spekulativen philosophischen Systemen, die fragwürdige Begründungen für an sich treffliche Einsichten und eingängige Empfehlungen lieferten. Das gilt z. B. für das von Comenius schon im 17. Jahrhundert propagierte, bis heute aktuelle didaktische Prinzip der Anschaulichkeit, das Comenius aber nicht etwa psychologisch, konkret: sensualistisch, sondern theologisch begründete. Der Erziehungswissenschaftler Heinrich Roth (1906–1983) sprach einmal von »genialen Pädagogen« und ihren »intuitiven Treffern«. Das trifft es im Falle von Comenius, Rousseau, Pestalozzi und Fröbel sehr gut.
1.1.4 Die experimentelle Pädagogik
Um die Wende zum 20. Jahrhundert regten sich erneut Impulse, die auf eine Änderung drängten. Fragen der Schulreform standen auf der Agenda. Die bis heute viel diskutierte »reformpädagogische Bewegung« steuerte auf ihren Höhepunkt zu. In den Schulen wurden wie nie zuvor neue Unterrichtsformen erprobt, neue Schularten entstanden, Modell- und Versuchsschulen wurden eingerichtet. Nun galt es, die ins Auge gefassten Reformen zu überprüfen. 1906 gründete der Leipziger Lehrerverein das »Institut für experimentelle Pädagogik und Psychologie«; vergleichbare Einrichtungen in anderen Großstädten Deutschlands folgten noch vor dem Ersten Weltkrieg. 1914 urteilte der herausragende Vertreter dieser neuen Bewegung, Ernst Meumann (1862–1915), »die empirische und experimentelle Forschung in der Pädagogik« allein sei jene »objektive Instanz«, die »im Geiste reiner Wahrheitsforschung das Zweckmäßige, Wertvolle und Brauchbare in den ›modernen Ideen‹ der Erziehungsreform« herausfinden könne (Meumann 1914, S. 3). Meumann griff die schon von Trapp und Kant getroffene (und auch von Herbart bestätigte) Unterscheidung in eine pädagogische Ziellehre und eine pädagogische – sagen wir – Mittellehre auf und nahm nur für letztere das Primat empirischer Forschung in Anspruch. Wilhelm August Lay (1862–1926), der zweite Protagonist dieser Richtung, kam selbst aus dem Volksschullehrerstand und betrieb in jenen Jahren Unterrichtsforschung mittels Beobachtung und Experiment (vgl. Lay 1903). Zu den Anwendungsfeldern dieser Forschung gehörten u. a. die Suche nach neuen und besseren Unterrichtsmethoden, besseren Lehrmitteln und optimalen Organisationsformen (Klassengröße, Dauer der Schulstunde usw.), die Frage nach der Entstehung des Schülerinteresses an bestimmten Unterrichtsinhalten u. ä. m. (z. B. Lay 1914). So wollte man die Pädagogik aus dem Nebel der philosophischen Spekulation holen und sie zu einer exakten Wissenschaft machen.
An den Universitäten gab es freilich nur wenige, von denen die Verfechter von Experiment und Beobachtung Unterstützung erwarten konnten. Zwar hatte Meumann das Glück, an der gerade neu gegründeten Hamburger Universität tätig sein zu können. Lay aber blieb Zeit seines Lebens Dozent an einem Lehrerseminar. Eine der wenigen Ausnahmen unter den Universitätspädagogen war Aloys Fischer (1880–1937), der 1913 eine »Wendung« anmahnte, die die Pädagogik dringend vollziehen müsse, um zu einer »exakten« und »autonomen Pädagogik«, zu einer »Erfahrungswissenschaft«, zu werden (Fischer 1964, S. 43). Zwar sprach auch Fischer dem Philosophieren über Erziehung die Berechtigung nicht ab, warnte aber vor der Gefahr, »in den Fehler einer deduktiven Systematik zurückzufallen und insbesondere von philosophischen Grundanschauungen abhängig zu werden, die ohne alle Rücksicht auf die Tatsachen und die Aufgaben der Erziehung konzipiert werden« (ebd., S. 44). Von einer derartigen Neuorientierung der wissenschaftlichen Pädagogik aber wollten Fischers akademische Kollegen wenig wissen. Entweder fühlten sie sich im Hauptamt nach wie vor der Philosophie verpflichtet, oder – das betraf die Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik unter ihnen – sie lehrten zwar inzwischen die Pädagogik, verstanden diese aber als eine philosophische, allenfalls eine historische Disziplin und ergingen sich in der Auslegung der pädagogischen Klassiker. Sie fielen damit sogar hinter den schon erwähnten Natorp zurück, der zwar für eine philosophische Grundlegung der Pädagogik plädiert hatte, dies aber nur auf die »sichere Deduktion ihrer Grundbegriffe« bezogen haben wollte, darüber hinaus aber konzedierte, sie möge sich »des weiteren so konkret, so empirisch, so praktisch gestalten wie nur möglich« (Natorp 1985/1909, S. 218).
Wer die Wissenschaft von Erziehung und Bildung konkret, empirisch und praktisch fundieren wollte, der musste sich umorientieren, Anschluss an eine andere Disziplin suchen. Diese andere Disziplin war die Psychologie. Nicht wie die Universitätspädagogen, die weiter in den Bahnen philosophisch grundierter Ideenlehren dachten und argumentierten, betrieben die Universitätspsychologen, auch wenn sie formell zumindest anfangs noch Lehrstühle für Philosophie innehatten, längst Psychologie im Sinne Wilhelm Wundts (1832–1920), nämlich als Experimentalforschung. Als Teildisziplin dieser experimentell ausgerichteten Psychologie entstanden in den 1920er Jahren die Pädagogische Psychologie und die Entwicklungspsychologie. Beide zusammen nahmen jene Fäden wieder auf, die Ende des 18. Jahrhunderts die Aufklärungspädagogen hatten liegen lassen, nun aber eben unter dem Dach der Psychologie. Insgesamt handelte es sich um einen disziplinären Ausdifferenzierungsprozess, der auf Seiten der Pädagogik zum (vorläufigen) Abgang des zarten Pflänzchens der empirischen Forschung führte.
Neben Fischer ist als weitere Ausnahme unter den Universitätspädagogen Peter Petersen (1884–1952) zu erwähnen, der 1923 an die Universität Jena berufen wurde. Die dortige von seinem herbartianischen Vorgänger Wilhelm Rein eingerichtete Universitätsschule schloss Petersen nicht, sondern machte sie zum Schauplatz seiner »pädagogischen Tatsachenforschung«. Petersen, der aus seiner Zusammenarbeit mit Meumann in Hamburg Erfahrung in der empirischen Forschung mitbrachte, setzte zum einen auf die Beobachtung als Forschungsmethode und zog zum andern aus Frischeisen-Köhlers Kritik am Experiment (Kap. 6.2.2.5) den Schluss, Experimente nur unter natürlichen Bedingungen zuzulassen (vgl. Petersen 1965). Derartige Bedingungen ergaben sich täglich in Unterricht und Schulleben an der Jenaer Universitätsschule. In Petersens Ansatz waren, weil der Forschungsgegenstand der Erziehungsalltag war, zugleich die Einsichten Herbarts realisiert wie auch die Anwendung empirischer Forschungsmethoden gegeben. Im Grunde also ein idealer Ansatz. Limitiert war Petersens »pädagogische Tatsachenforschung« nur insofern, als sie sich – darin dem Vorgehen der Herbartianer verwandt – innerhalb der Grenzen des von Petersen entwickelten Reformmodells (Jena-Plan) bewegte. Man hat Petersen deshalb vorgehalten, Ziel seiner Forschung sei es letztlich nur gewesen, die Überlegenheit des Jena-Plans empirisch zu bestätigen (Benner 1972, S. 47).
Wissenschaftsgeschichtlich ist die experimentell verfahrende Pädagogik eine kurze Episode geblieben. Von einer »versäumten Chance« ist in der Literatur die Rede. Die Pädagogik habe »die Weichenstellung zur Geisteswissenschaft« vollzogen und sich damit »von der Anstrengung dispensiert, ein kritisches Methodenbewusstsein auszubilden, ihr eigenes Wissen als prüfbar und prüfungsbedürftig einzuschätzen, und damit auch … ihre Ideen und Ambitionen der Realitätskontrolle zu unterwerfen« (Tenorth 1989, S. 317).
1.1.5 Die Geisteswissenschaftliche Pädagogik
An der Einlösung ihres Praxisanspruchs ist die Geisteswissenschaftliche Pädagogik allerdings gescheitert. Wohl konnte man sich in seiner nahezu ausschließlichen Fokussierung auf schriftliche Zeugnisse der Vergangenheit durchaus auf Dilthey berufen, der gemeint hatte: »Was wir einmal waren, wie wir uns entwickelten und zu dem wurden, was wir sind, erfahren wir daraus, wie wir handelten, … aus alten verschollenen Briefen, aus Urteilen über uns, die vor langen Tagen ausgesprochen wurden« (Dilthey 1981, S. 99). Das aber war von Dilthey als Spitze gegen die unhistorische, aus philosophischen Systemen deduzierte Ziellehre der Pädagogik gedacht (z. B. Natorp), nicht aber als Plädoyer gegen bestimmte Forschungsmethoden. Als Praxiswissenschaft hätte sich die Pädagogik also nicht im Rekurs auf Gedrucktes erschöpfen müssen. Als später die geisteswissenschaftliche Pädagogik unter Veränderungsdruck geriet (Kap. 1.1.6), war denn auch nicht von Texten und einer Texthermeneutik die Rede, sondern von einer »Hermeneutik der Erziehungswirklichkeit« (Blankertz 1966, S. 67), die eine zeitgemäße Pädagogik zu betreiben habe. Der Verweis auf die Wirklichkeit blieb jedoch deklamatorisch, insofern sich die geisteswissenschaftlichen Pädagogen in ihrer Mehrheit um diese Erziehungswirklichkeit wenig kümmerten. Während Dilthey postuliert hatte, nur »aus dem Ziel des Lebens« könne das Ziel der Erziehung abgeleitet werden, glaubten seine Schüler, vorrangig den Zeugnissen der Vergangenheit Hinweise auf die Gestaltung der Gegenwart entlocken zu können. Wenn Herman Nohl (1879–1960) über ein sozialpädagogisches Problem referierte, argumentierte er mit Pestalozzi; Eduard Spranger (1882–1963) empfahl, sich bei Fröbel kundig zu machen, als es um die Reform des Kindergartens ging. Durch ihre Fokussierung auf Texte von Pestalozzi, Fröbel und anderen Autoren haben die Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik diese zu »Klassikern« mit überzeitlichem Rang werden lassen. Sie haben damit eine Theorie vergangener pädagogischer Praxis entworfen, nicht aber eine Theorie für eine künftige Praxis. Immerhin haben die Geisteswissenschaftlichen Pädagogen die Werke von Pestalozzi & Co. erstmals einigermaßen vollständig wissenschaftlich ediert. Darin liegt ein nicht geringzuschätzender Beitrag zum wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt.
Dass sich die Geisteswissenschaftliche Pädagogik gegen die experimentelle Richtung hat durchsetzen können, hatte auch damit zu tun, dass sie sich ideal in das Altvertraute fügte. Zwar wurde jetzt an den Universitäten Pädagogik als eigenständige Disziplin gelehrt, nicht bloß als Anhängsel an die Philosophie oder die Theologie. Aber es war eben doch eine Pädagogik mit stark historisch-philosophischer Prägung.
Von der Hermeneutik als Verstehenslehre abgesehen, interessierten sich die Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik kaum für Methodenfragen. Immerhin einer von ihnen, der Mitarbeiter Diltheys und ab 1915 Professor für Philosophie und Pädagogik in Halle-Wittenberg, Max Frischeisen-Köhler (1878–1923), setzte sich mit der empirischen Königsmethode auseinander und schrieb dazu ein über die Jahrzehnte viel rezipiertes Buch. Darin bündelte Frischeisen-Köhler (1931 [zuerst 1918]) Argumente gegen das Experiment in der pädagogischen Forschung: Zu abstrakt und steril die Laborsituation, die Individualität des Kindes oder Jugendlichen nicht erfassend, so sei das Experiment. Komplexere Persönlichkeitsmerkmale, etwa das, was sich mit Charakter und Wille bezeichnen ließe, gerate dem Experimentator nicht in den Blick. Der Mensch als sittliches und religiöses Wesen – kein Fall für das Experiment. Nur für die Unterrichtsforschung mochte Frischeisen-Köhler das Experiment zulassen. Wolle man »die günstigsten Bedingungen der Schularbeit ermitteln« oder sei das Interesse auf »eine exakte Erkenntnis der Unterrichtsmethoden gerichtet«, dann war Frischeisen-Köhler bereit, das Experiment zu akzeptieren (ebd., S. 142). Das war gar nicht so weit weg von den Vorstellungen Meumanns und hätte eine Verständigung mit der empirischen Richtung vielleicht zugelassen, wäre diese nicht bereits zur Psychologie abgewandert gewesen.
Einige der führenden Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik verloren nach 1933 ihre Professuren. Andere gingen in die innere Emigration, weil sie sich mit der rassistischen und politisch instrumentalisierten NS-Pädagogik nicht einlassen wollten. Ohnehin planten die Nationalsozialisten, die gesamte Lehrerbildung an nicht-wissenschaftliche Einrichtungen zu verlegen, was den bescheidenen Stellenwert einer wissenschaftlichen Pädagogik weiter minimiert hätte. Die Stunde der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik schlug dann erneut nach 1945. Als kleines äußeres Zeichen mag gelten, dass die 1925 als Zentralorgan der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik von Herman Nohl, Wilhelm Flitner, Theodor Litt (1880–1962) und Aloys Fischer gegründete Zeitschrift »Die Erziehung« (die ihr Erscheinen 1943 eingestellt hatte) von exakt denselben Personen (außer dem 1937 verstorbenen Fischer) 1956 unter dem Namen »Zeitschrift für Pädagogik« (ZfPäd) wieder begründet wurde. Gleichwohl blieb die Pädagogik, was sie schon in den 1920er Jahren gewesen war, eine »noch wenig gesicherte Einzelwissenschaft« (Flitner 1989, S. 310 [zuerst 1956]). Die an der Universität ausgebildeten Gymnasiallehrer, die Philologen, taten sich schwer mit der Pädagogik. Wer nur recht die Wissenschaften studiert habe, werde auch ein guter Lehrer sein, glaubte man seit den Zeiten Wolfs im ausgehenden 18. Jahrhundert. Einen Studiengang, der auf außerschulische pädagogische Einsatzfelder vorbereitet hätte, gab es noch nicht.
1.1.6 Die empirische Wende
Im Gründungsjahr der ZfPäd stellte der Frankfurter Pädagoge Erich Hylla (1887–1976), ein profunder Kenner der internationalen erziehungswissenschaftlichen Diskussion, einen Mangel an empirischer pädagogischer Forschung in Deutschland fest und kritisierte: »Heute reicht in Deutschland das reine pädagogisch-philosophische Denken noch weit in das Gebiet hinab, das grundsätzlich der empirischen Forschung durchaus zugänglich wäre« (Hylla 1956, S. 194). Von einem Mehr an empirischer Forschung erhoffte sich Hylla »eine umfassende Theorie der Bildung und Erziehung …, die nicht in den Wolken schwebt« (ebd.), also das, was schon die Aufklärungspädagogen gefordert hatten. Kurz darauf fragte Hyllas Kollege, der schon erwähnte Heinrich Roth: »Muss die Forschung in der Pädagogik auf historische, philologische und hermeneutische beschränkt bleiben? Ist die Pädagogik nicht auch zur empirischen Forschung aufgerufen und verpflichtet?« (Roth 1976, S. 28) Der herrschenden Universitätspädagogik warf Roth vor, nur »Bücherforschung« zu betreiben. Mit den Einwänden Frischeisen-Köhlers gegen das Experiment befasste sich Roth ausführlich, verwarf sie aber mit dem Hinweis auf die Fortschritte, die die empirische Forschung zwischenzeitlich erzielt habe. Mit Blick auf die künftige Entwicklung der Pädagogik als wissenschaftlicher Disziplin wollte Roth deshalb jede »Beschränkung auf bestimmte, etwa nur im strengen Sinne geisteswissenschaftliche Methoden« (ebd., S. 29), ausgeschlossen sehen. In der von Hylla gegründeten Frankfurter Hochschule für Internationale Pädagogische Forschung wurden sog. »Zeitweilige Wissenschaftliche Mitarbeiter« beschäftigt, abgeordnete Lehrkräfte, die kleinere schul- und unterrichtsnahe empirische Forschungsarbeiten durchführten. Alle diese Maßnahmen und Mahnrufe waren auch aus der Sorge heraus zu verstehen, die Pädagogik als Wissenschaft könnte überflüssig werden, versäume sie es, sich zu einer modernen, auch empirisch forschenden Disziplin zu entwickeln. Roth plädierte deshalb für eine »realistische Wendung« (Roth 1962, S. 115) in der Pädagogik und für die Öffnung der Wissenschaft von Bildung und Erziehung nicht-historisch-philosophischen Disziplinen gegenüber. Namentlich erwähnte Roth die Psychologie, die Soziologie, die Biologie und die Medizin. In seinen Beiträgen zur pädagogischen Anthropologie praktizierte Roth diesen multiperspektivischen Ansatz selbst eindrücklich (vgl. Roth 1966). Auch Wolfgang Brezinka (1928–2020) – wissenschaftstheoretisch ganz anders aufgestellt als Hylla und Roth – forderte in diesen Jahren die Neuorientierung der Pädagogik und mahnte in diesem Zusammenhang neue Forschungsmethoden an. Konkret nannte er das Experiment, die Beobachtung, das Interview. Dabei argumentierte er wie Hylla und Roth:
»Ohne empirische Forschung bleibt die Pädagogik in der unfruchtbaren Wiederholung von inhaltsarmen ›Prinzipien‹ stecken, in vagen Ideen, wirklichkeitsfernen Konstruktionen und wenig überzeugenden philosophischen Ableitungen, vor allem auch in nicht durchschauten Abhängigkeitsverhältnissen ideologischer und weltanschaulicher Art« (Brezinka 1959, S. 7).
Allerdings wollte Brezinka die Pädagogik nicht etwa als Praxiswissenschaft begründen. Ihm war es allein um die pädagogische Theoriebildung zu tun. Gute Theorie aber dürfe sich nicht auf Meinungen und Vermutungen stützen, sondern sei auf eine solide empirische Basis angewiesen, so Brezinka. Groß war damals die Schar der Hochschulpädagogen (darunter einige wenige Hochschulpädagoginnen), die eine Neujustierung der Pädagogik in punkto Methoden verlangte. Selbst prominente Namen aus dem geisteswissenschaftlichen Lager, wie Josef Dolch (1899–1971) und Wilhelm Flitner, gehörten dazu.
Alle drei, Hylla, Roth und Brezinka, unterließen es, die Philosophie aus der Pädagogik hinauszudrängen. Hylla fand die »philosophisch-pädagogische Forschung« keineswegs überflüssig (Hylla 1956, S. 100), Brezinka wollte »durchaus nicht den philosophischen Aspekt der Pädagogik gering schätzen« (Brezinka 1959, S. 5), und Roth meinte zwar, dass ohne empirisches Fundament die Aussagen der philosophischen Pädagogik nicht mehr als den Status »bloße[r] Meinungen oder leere[r] Behauptungen« (Roth 1962, S. 123) besäßen. Umgekehrt akzeptierte er aber, dass zu einer vollständigen Wissenschaft von der Erziehung auch die Begründung von Sollensforderungen gehöre, wie sie sich etwa aus der philosophischen Ethik gewinnen ließen. Schließlich beschränke sich die Pädagogik nicht nur auf die Untersuchung der Erziehungswirklichkeit, sondern sie wolle die Erziehungswirklichkeit auch zum Besseren hin verändern. Und da müsse man schon wissen, worin dieses Bessere bestehen solle. Nicht zuletzt in dieser Hinsicht erinnerte Roths Argumentation an Aloys Fischer, als dessen Erben und Testamentsvollstrecker er sich durchaus sah. Dass Roth 1961 auf einen Lehrstuhl ausgerechnet an der Universität Göttingen wechseln konnte, die mit dem kurz vorher verstorbenen Herman Nohl und dessen Schüler Erich Weniger über Jahrzehnte hinweg ein Zentrum der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik gewesen war, belegt, dass die Zeit offensichtlich reif war für einen Paradigmenwechsel. Dafür sind mindestens zwei Gründe zu nennen:
Zum einen begann sich in dieser gerade an den Universitäten unruhigen Zeit die Kritische Theorie Geltung zu verschaffen. Roth suchte bewusst die Nähe zu den Protagonisten der »Frankfurter Schule«, Max Horkheimer (1895–1973) und Theodor W. Adorno (1903–1969), und kündigte an, mit seinem Programm einer erfahrungswissenschaftlich fundierten Pädagogik die Entideologisierung der Pädagogik und ihre Befreiung von falschem Bewusstsein betreiben zu wollen. Die Kritische Theorie aber stand dem empirischen Forschen positiv gegenüber. Adorno und Horkheimer führten selbst sozialwissenschaftliche Befragungsstudien durch. Zum andern fanden die Argumente Hyllas und Roths Anklang, weil die damals im Zeichen der »deutschen Bildungskatastrophe« (Georg Picht) angedachten Schulreformen einen Bedarf an Bildungsplanung erzeugten, der mit der Auslegung der Texte längst verblichener pädagogischer Genies bzw., wie Hylla schrieb, »durch Nachdenken, Bücherstudium und Beratungen allein« (Hylla 1956, S. 105) nicht zu befriedigen war. Führen wir uns nur die Auseinandersetzungen um die Gesamtschule oder die umstrittene Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe vor Augen. Die Pädagogik sah sich in die ihr ungewohnte Rolle der Politikberatung gedrängt. Dass sie dazu ihr Methodenarsenal neu sortieren müsse, wurde, von wenigen opponierenden Stimmen (z. B. Henningsen 1964) abgesehen, kaum bestritten. Es »leidet die Schulreform darunter, dass nicht genügend experimentiert wird«, klagte der Pädagoge Werner Loch (1928–2010) auf dem Höhepunkt der Reformdebatten (Loch 1968, S. 124). Den angestrebten Reformen mangele es an empirischer Evidenz und somit an »Überzeugungs- und Anziehungskraft« (ebd.), so noch einmal Loch, der auch explizit an Kants Forderung nach der experimentellen Prüfung dessen, was sich angeblich allein schon aus Vernunftgründen gebiete, erinnerte. Dabei mochte Loch z. B. an die Reform des Lehrplans (Stichwort: Curriculumreform) oder andere Spezialprobleme gedacht haben, wie z. B. die richtige Leselern-Methode, wo man zu dieser Zeit tatsächlich Studien durchführte und hoffte, durch empirische Forschung Klarheit gewinnen zu können (vgl. die Beiträge in Kluge & Reichel 1979).
Auch stand der alte Fröbel-Kindergarten auf dem Prüfstand und eine heute kaum glaubliche Fülle an empirischen Untersuchungen, die stark auf das Experiment und den Test setzten, wurde ab Ende der 1960er Jahre im vorschulischen Bereich initiiert (vgl. dazu Ingenkamp et al. 1992, Bd.1). Da arbeitete das 1963 in Berlin als Speerspitze der vom Deutschen Bildungsrat geforderten empirischen Großforschung gegründete Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPI) schon seit einer Reihe von Jahren. Das MPI war dazu ausersehen, die empirische erziehungswissenschaftliche Forschung in Gang zu bringen. Dass dies gelungen ist, zeigt sich daran, dass bald schon der zuvor unbekannte Begriff der »Bildungsforschung«, genauer: der »empirischen Bildungsforschung«, in aller Munde war. Lehr-Lern-Forschung kam in Gang, die Lehrer*innenpersönlichkeit und die der Schüler*innen wurden zum Gegenstand von Tests und Fragebogenerhebungen einer »empirischen Pädagogik«, die freilich sehr oft von Psychologen betrieben wurde (vgl. die Beiträge in Ingenkamp et al. 1992, Bd. 2). 1969 erfolgte die Einrichtung des Diplom-Studienganges und damit die Ausdehnung des erziehungswissenschaftlichen Feldes über die Lehrer*innenbildung hinaus. Neue Subdisziplinen, wie etwa die Sozialpädagogik, die Elementarpädagogik, die Berufspädagogik oder die Erwachsenenbildung, entstanden bzw. gewannen ein Gewicht und eine Eigenständigkeit, die sie zuvor so nicht besessen hatten. Verfahren, die die Wirklichkeit messend und quantifizierend in den Blick nahmen, kamen in allen den eben genannten erziehungswissenschaftlichen Subdisziplinen in Gebrauch. In der Schulpädagogik etwa wurden alternative Unterrichtsverfahren experimentell geprüft (Dietrich 1969). Selbst in der Historischen Pädagogik wandte man sich in den 1970er Jahren mit den von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten »Datenhandbüchern