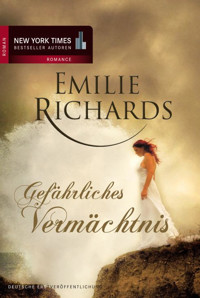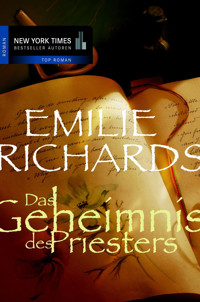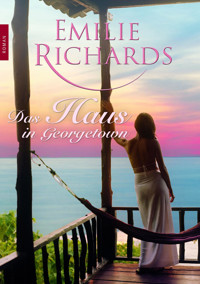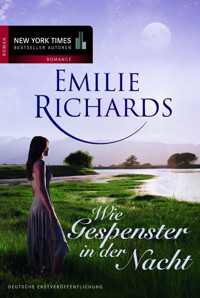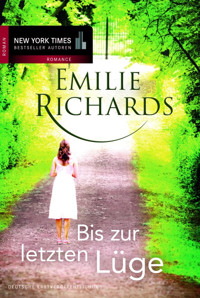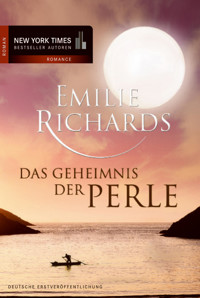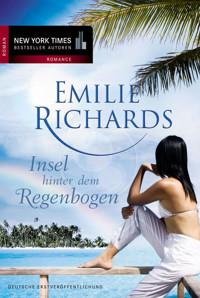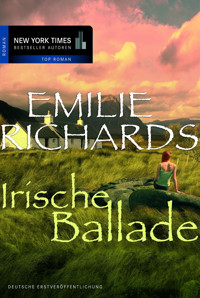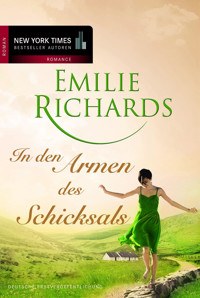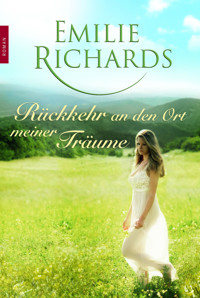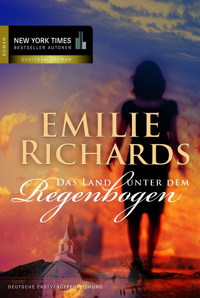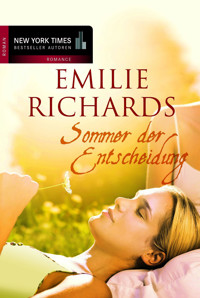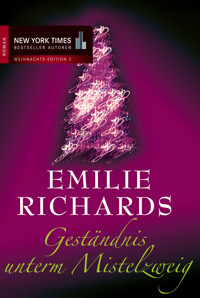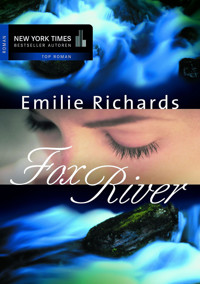
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre Ehe existiert nur noch auf dem Papier, seit Lombard Warwick seine Frau Julia wegen ihrer Erblindung in ein Heim abgeschoben hat. Jetzt lebt sie bei ihrer Mutter - gefangen in einer ewigen Nacht - in der die Verzweiflung schlimmer ist als die Tatsache, dass sie nie wieder als Malerin tätig sein wird. Doch dann tritt zum zweiten Mal Christian Carver in ihr Leben: Ihn liebte Julia damals, bis er wegen Mordes verurteilt wurde. Jetzt ist seine Unschuld bewiesen, nun will er den wahren Täter finden, der sich inmitten der High Society von Ridge’s Race verbergen muss ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 821
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Alle Rechte, einschließlich das der vollständigen oder auszugsweisen Vervielfältigung, des Ab- oder Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten und bedürfen in jedem Fall der Zustimmung des Verlages.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fox River
Dass ihr Mann sie nach einem Unfall, bei dem sie erblindete, kaltherzig in ein Heim abschiebt, erschüttert Julia zutiefst. Doch dann wird sie in einer Nacht- und Nebelaktion von ihrer Mutter gerettet und auf deren Anwesen Ashbourne gebracht, wo sie von nun an mit ihrer kleinen Tochter Callie, friedlich umsorgt, leben soll. Da erscheint eines Tages Christian Carver auf Ashbourne. Er war es, den Julia liebte und von dem sie schwanger wurde, bis man ihn wegen Mordes an ihrer Freundin Fidelity verurteilte. Jetzt ist er frei – und zurückgekehrt, um den wahren Mörder zu finden ...
Die Handlung und Figuren dieses Romans sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
Emilie Richards
Fox River
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Rainer Nolden
MIRA® TASCHENBÜCHER
erscheinen in der Harlequin Enterprises GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
Fox River
Copyright © 2001 by Emilie Richards McGee
erschienen bei: Mira Books, Toronto
Published by arrangement with
Harlequin Enterprises II B.V., Amsterdam
Konzeption/Reihengestaltung: fredeboldpartner.network, Köln Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln Titelabbildung: GettyImages, München und The Image Bank, München
Autorenfoto: © by Harlequin Enterprise S. A., Schweiz Satz: Berger Grafikpartner, Köln
ISBN (eBook, PDF) 978-3-86278-293-2 ISBN (eBook, EPUB) 978-3-86278-292-5
www.mira-taschenbuch.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
FOX RIVER
Aus dem unveröffentlichten Roman „Fox River“ von Maisy Fletcher
Wenn ich heute an Fox River zurückdenke und an all die Dinge, die dort vor so vielen Jahren geschehen sind, fallen mir vor allem die unterschiedlichen Grüntöne wieder ein: das frische, lebhafte Grün der Weiden, das zum Horizont hin dunkler wird; das Dunkelgrün der schattigen Wälder, das so untrennbar mit dem Blaugrün der Hügel von Virginia verbunden ist und bis dorthin reicht, wo die Grenze zwischen den Bergen und dem dunstigen Himmel schließlich verschwimmt.
Es ist mehr oder weniger derselbe Himmel, den auch alle anderen Menschen sehen. Der Himmel, der sich von Kalifornien über China bis hin in die entferntesten Regionen der Antarktis erstreckt. Es ist der Himmel, unter dem ich geboren wurde, unter dem ich Augenzeugin der Ereignisse wurde, die in diesem Buch geschildert werden. Derselbe Himmel, an dem die Sonne scheint und von dem der Regen fällt, um das Gras auf den Hügeln von Fox River genauso leuchtend grün und saftig zu machen wie in anderen fruchtbaren Regionen der Erde.
Aber ich, Louisa Sebastian, sehe als Einzige die Silhouette des stolzen Mannes, die sich vor dem Himmel von Fox River abzeichnet. Er sitzt auf einem Hengst, auf den kein anderer steigt. Ein Mann, der so sehr eins mit dem Pferd unter ihm ist, dass ich unwillkürlich an den Zentaur der griechischen Mythologie denken muss, und trotz allem, was ich über diesen Mann weiß, stockt mir vor Bewunderung der Atem.
Wenn ich mich heute an die Ereignisse in Fox River erinnere, scheine ich in den unterschiedlichen Grüntönen und in dem Blut zu versinken, das vor langer Zeit den Rasen rot gefärbt hat. In den zahlreichen Jahren, die seither vergangen sind, ist das Gras gewachsen, und der Regen hat das Blut fortgespült. Aber ich weiß, dass sich die Erde darunter noch immer nicht vollständig erholen konnte, undwenn ich an diesem besonderen Ort graben würde, wäre der Schmutz unter meinen Fingernägeln nach wie vor rostrot.
Hätte ich geahnt, was mich an jenem ersten Nachmittag, als ich nach Fox River ritt, erwartete, dann wäre ich in fliegendem Galopp zum Landsitz meiner Cousine zurückgekehrt, um mich in meinem Zimmer einzuschließen. Ich hätte eine Krankheit oder eine Verletzung vorgeschützt und darauf bestanden, dass man mir sofort meine Koffer packt, damit ich nach New York zurückkehren kann.
Aber natürlich wissen wir nie, was die Zukunft für uns bereithält. Wir kennen nur unsere Vergangenheit. Über sie können wir nachdenken – und unentwegt trauern.
1. KAPITEL
Die Bewohner von Ridge’s Race in Virginia behaupteten stets, dass sich Maisy Fletcher genauso wenig entscheiden könne wie eine Meute Fuchshunde, die zwischen zwei Fährten hin und her gerissen ist. Sie hatte während ihrer fünfzig Lebensjahre häufig versucht, diesen Eindruck zu zerstören, doch immer war sie die chronisch unentschlossene Frau geblieben, die jeden zur Raserei treiben konnte. Jake Fletcher, seit zwanzig Jahren ihr Ehemann, teilte diese Meinung allerdings nicht. Er vertrat die Auffassung, dass sich seine Frau sehr gut entscheiden könne – und zwar jeden Tag anders.
Am heutigen Tag allerdings wären jene, die Maisy kannten, verblüfft gewesen, hätten sie die Entschlossenheit in ihrem Gang sehen können und die Art und Weise, wie sie alles und jeden ignorierte, der zwischen ihr und dem Eingang zur Gandy-Willson-Klinik stand, die am Rande des historischen Ortes Leesburg lag. Sie würdigte weder die mit Pferdeköpfen verzierten Pfähle eines Blickes, die den gepflasterten Gehweg zu beiden Seiten säumten, noch beachtete sie die Magnolien, die den Säulenvorbau flankierten. Das junge Paar, das auf einer grünen Bank zu ihrer linken unter den Magnolien saß, nahm sie nicht einmal aus den Augenwinkeln wahr. Am überraschendsten aber war die Tatsache, dass sie an dem jungen Sicherheitsbeamten vorbeirauschte, ohne ihm ihren Ausweis zu zeigen.
„Ma’am, Sie dürfen da nicht hineingehen, ohne dass ich Ihren Ausweis gesehen habe“, sagte der junge Mann, der sich an ihre Fersen geheftet hatte.
Maisy blieb kurz stehen, um ihn von oben bis unten zu mustern. Mit seinem Bürstenhaarschnitt und den Aknenarben sah er aus, als wäre er gerade von der Militärakademie von Virginia geflohen. Er fixierte sie mit einem feindlichen Blick, den sie von vielen neuen Kadetten kannte und der wohl das Resultat von extremer Erschöpfung und ständiger Schikane war.
Unter normalen Umständen hätte sie ihm zugezwinkert, sich nach seinem Elternhaus erkundigt, ihn gefragt, wie er die Chancen der Washington Redskins in dieser Saison einschätzte oder seine Meinung über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen hören wollen, aber heute war ihr nicht danach zu Mute. „Versuchen Sie ja nicht, mich aufzuhalten, junger Mann. Ich bin ungefährlicher als ein Schmetterling in einem Hagelschauer. Kümmern Sie sich besser um Ihre eigenen Angelegenheiten.“
„Ma’am, ich muss ...“
„Meine Tochter ist Patientin in diesem Haus.“
„Ich muss trotzdem Bescheid geben ...“
Sie griff nach der Klinke und öffnete die Tür.
Noch nie zuvor hatte sie die Gandy-Willson-Klinik aufgesucht. In den vergangenen Jahren waren Bekannte von ihr hinter diesen Mauern verschwunden, um sich eine Zeit lang „zu erholen“. Einige gaben mit den Monaten an, die sie hier verbracht hatten, und setzten ein „Ü.G.W.K.“ hinter ihren Namen, als handelte es sich um einen akademischen Grad. Dieses in der ganzen Gegend bekannte Kürzel bedeutete „Überlebender der Gandy-Willson-Klinik“ und sollte entweder zum Ausdruck bringen „Bieten Sie mir nur nichts Alkoholisches an“ oder „Geben Sie mir das Hochprozentigste, was Sie im Hause haben“ – je nachdem, wie lange die Behandlung schon zurücklag.
Maisy war nicht überrascht von dem Anblick, der sich ihr bot. In der Gandy-Willson-Klinik wurde die wohlhabende Elite umsorgt. Das Kristall des Kronleuchters, der einem Ballsaal alle Ehre gemacht hätte, glitzerte und funkelte, und der Teppich, der sich vor ihr erstreckte, hatte vermutlich Dutzende von Kindern aus der Dritten Welt daran gehindert, eine normale Jugend zu erleben.
Der Sicherheitsbeamte war ihr nicht ins Haus gefolgt, aber ein anderer, älterer Mann kam aus seinem Büro, um sie aufzuhalten, als sie sich dem Empfangsbereich näherte. Er war mindestens sechzig Jahre alt, trug eine Brille sowie einen exzellent sitzenden Anzug und hatte ein großväterliches Lächeln aufgesetzt, das jedoch wenig überzeugend wirkte.
„Ich glaube, wir sind einander noch nicht vorgestellt worden.“ Er streckte ihr seine Hand entgegen. „Ich bin Harmon Jeffers, der Leiter der Gandy-Willson-Klinik.“
Einen kurzen Moment überlegte sie, ob sie die Hand ignorieren sollte. Doch als sie das Zittern wahrnahm – war der Mann schon so alt? –, ergriff sie sie, um ihn zu beruhigen. „Ich bin Maisy Fletcher, und meine Tochter Julia Warwick ist eine Ihrer Patientinnen.“
„Julias Mutter, natürlich, man sieht’s ja.“ Sein unaufrichtiges Lä-cheln zog sich von einer Wange zur anderen.
Der Zusatz „man sieht’s ja“ war vollkommen fehl am Platz. Maisy und Julia ähnelten einander wie eine Rose einem Hibiskus. Praktisch gesehen gehörten sie zwar zur selben Familie, aber damit endete die Gemeinsamkeit auch schon. In diesem Monat hatte Maisy ihr Haar rot gefärbt und mit einer starken Dauerwelle verunstal-tet; Julias Haare dagegen waren seit jeher glatt und schwarz. Maisy hatte leider jedes Jahr ein Kilo zugelegt; Julia schien praktisch von Luft und Liebe zu leben. Maisy war mittelgroß, wohingegen ihr die zierliche Julia kaum bis zur Schulter reichte.
So viel zum Thema „Ähnlichkeit“.
Maisy richtete sich auf, so dass ihre ein Meter fünfundsechzig voll zur Geltung kamen, was ihr Kreuz jedoch mit einer kurzen Schmerzattacke quittierte. „Ich bin gekommen, um meine Tochter zu besuchen.“
„Wollen wir nicht in mein Büro gehen? Ich lasse uns einen Tee bringen, und dann können wir uns unterhalten.“
„Das ist sehr freundlich von Ihnen, Dr. Jeffers, aber ich fürchte, dafür habe ich keine Zeit. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Julias Zimmer zeigen könnten. Im Grunde hasse ich es nämlich, einfach so hereinzuplatzen.“
„Das geht nicht.“
„In Ordnung. Dann sagen Sie mir bitte, wo ich meine Tochter finden kann.“
„Mrs. Fletcher, wir müssen unbedingt miteinander reden. Die Genesung Ihrer Tochter hängt davon ab.“
Maisy hob ihr Kinn an – eines von mehreren. Die anderen folgten mit kurzer Verzögerung. „Meine Tochter sollte überhaupt nicht hier sein.“
„Sie sind also der Meinung, Ihre Tochter braucht keine Therapie?“
„Meine Tochter sollte zu Hause bei den Menschen sein, die sie lieben.“
Das junge Paar, das draußen auf der Bank gesessen hatte, war ins Haus gekommen und schlurfte über den Teppich. Jeffers legte Maisy eine Hand auf die Schulter und schob die rothaarige Frau von der Tür weg. „Mrs. Warwicks Ehemann vertritt einen vollkommen anderen Standpunkt als Sie. Er glaubt, dass sie bei uns gut aufgehoben ist, weil sie sich hier ausruhen und jeden Tag professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kann.“
Maisy kochte vor Wut und redete nicht lange um den heißen Brei herum. Beides war untypisch für sie. „Wie viele Fälle von hysterischer Blindheit sind Ihnen in Ihrer beruflichen Laufbahn denn schon untergekommen?“
„Dies ist eine psychiatrische Klinik. Wir ...“
„... behandeln meistens Tabletten- und Drogensüchtige sowie Alkoholiker“, beendete sie seinen Satz. „Auf meine Tochter trifft keine dieser Bezeichnungen zu. Aber das könnte eines Tages der Fall sein, wenn sie noch länger hier bleiben muss. Sie werden sie noch in die Abhängigkeit treiben.“
„Es gibt Leute, die der Ansicht sind, dass Ihre Tochter sehr gute Fortschritte macht.“ Als wolle er seinen Worten besonderen Nachdruck verleihen, zog er seine buschigen weißen Brauen hoch. „Ihre Augen sind zwar vollkommen in Ordnung, aber sie kann trotzdem nichts sehen. Sie ist praktisch total blind. Wollen Sie etwa behaupten, dass das normal ist?“
Sie holte tief Luft und wählte ihre Worte mit Bedacht. „Mein Schwiegersohn hat meine Tochter vom Krankenhaus direkt zu Ihnen gebracht, weil er sich ihrer schämt. Sie ist hier, weil sie von ihm dazu gezwungen wurde. Aber sie ist nicht hier, weil sie glaubt, dass Sie ihr helfen können.“
„Bis jetzt darf sie noch gar nicht telefonieren. Woher wollen Sie das also wissen?“
„Weil ich meine Tochter kenne.“
„Wirklich, Mrs. Fletcher?“
Diese Frage verfehlte nicht die von Dr. Jeffers beabsichtigte Wirkung. Maisy hielt einen Moment lang inne und überlegte, ob Ärzte während ihrer medizinischen Ausbildung vielleicht lernten, Widersprüche in Argumentationsketten aufzuspüren, und dies so lange üben mussten, bis es ihnen ebenso leicht fiel, wie Rezepte für die gängigsten Medikamente auszustellen.
Sie brauchte eine Weile, um sich zu sammeln und ihre beträchtliche Energie auf das zu konzentrieren, was sie jetzt zu erledigen hatte. „Ich werde meine Tochter besuchen.“ Sie war von sich selbst überrascht, als sie, ohne mit der Wimper zu zucken oder Dr. Jeffers aus den Augen zu lassen, sagte: „Sie haben die Wahl, ich bekomme jetzt entweder Ihre Hilfe oder einen Tobsuchtsanfall.“
„Wir sollten uns erst einmal hinsetzen und ein paar Minuten miteinander reden. Wenn Sie Ihre Tochter dann immer noch sehen möchten, werde ich das arrangieren. Aber wenn sie keinen Kontakt zu Ihnen haben will, müssen Sie gehen.“
Enttäuscht schlug sie die Hände zusammen, und ihre zahlreichen Ringe blitzten.
Er führte sie den Gang entlang bis zu der Tür, durch die er vorhin auf sie zugestürmt war. Sein Büro sah genauso aus, wie sie es sich vorgestellt hatte: eine Ledergarnitur, dunkel getäfelte Wände, an denen gerahmte Diplomurkunden hingen, und ein Schreibtisch, der wahrscheinlich so groß wie das Ego eines Psychiaters war. Sie fragte sich, ob berufstätige Männer die Maße ihrer Schreibtische vielleicht ebenso verglichen wie pubertierende Jungen die Größe ihrer Geschlechtsteile.
„Nehmen Sie bitte Platz.“
Sie hatte zwei Möglichkeiten: Entweder setzte sie sich wie ein Kind beim Schuldirektor auf die Kante der Couch, oder sie lehnte sich zurück, wodurch sie jedoch vollkommen schutzlos wirken würde. Sie war davon überzeugt, dass man die Form des Sofas absichtlich so gewählt hatte. Sie lehnte sich zurück.
Dr. Jeffers beugte sich über seinen Schreibtisch, legte die Hände auf einen Stapel Papier und nickte weise. „Sie glauben also, Mrs. Warwick sollte nicht hier sein.“
Maisy schaute auf ihre Uhr. Sie trug das wertlose, mit Strass und falschen Perlen besetzte Stück zu jeder Gelegenheit. Jetzt wünschte sie sich, die Zeiger würden sich schneller drehen.
„Wir reden hier über meine Tochter. Niemand kennt sie besser als ich, was natürlich nicht bedeutet, dass ich alles über sie weiß. Doch einer Sache bin ich mir sicher: Sie ist ein zurückhaltender Mensch, der über eine große innere Stärke verfügt. Darüber möchte Julia jedoch nicht reden – ebenso wenig wie über ihre Schwächen. Vor allem nicht mit einem Fremden. Und Sie sind ihr fremd.“
„Und mit Ihnen will sie darüber sprechen?“
„Könnten Sie bitte aufhören, mir die Worte im Munde herumzudrehen?“
„Korrigieren Sie mich, falls ich mich irre: Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie glauben, ihr helfen zu können, was ich Ihrer Meinung nicht kann.“
„Es wird ihr gut tun, mit Menschen zusammen zu sein, die sie lieben. Ich weiß, dass ihr viel daran liegt, Callie wiederzusehen ...“
„Wie wollen Sie denn davon erfahren haben, Mrs. Fletcher? Ist das nicht eher Wunschdenken? Seit Ihre Tochter hier ist, hat sie mit niemandem gesprochen außer ihrem Ehemann.“
„Ich weiß, dass ihr viel daran liegt, Callie wiederzusehen“, wiederholte sie ein wenig lauter. „Sie ist vollkommen außer sich, weil sie ihr kleines Mädchen endlich wieder in die Arme schließen möchte. Wenn Sie glauben, dass eine Frau in dieser Gemütsverfassung eine geeignete Kandidatin für eine Therapie ist, dann sollten Sie noch einmal die Universität besuchen.“
„Es gibt nur eine Frau in dieser Klinik, die außer sich ist, und die sitzt mir gerade gegenüber“, entgegnete er mit seinem Pseudolächeln.
Sie erhob sich mit einiger Mühe vom Sofa. Bevor sie etwas erwidern konnte, läutete das Telefon auf dem Schreibtisch. Während Dr. Jeffers zum Hörer griff, hob er eine Hand, um Maisy am Gehen zu hindern. Nachdem er das Gespräch beendet hatte, schaute er auf und zuckte mit den Schultern.
„Es scheint, dass Sie doch nicht die einzige Frau in dieser Klinik sind, die außer sich ist. Ihre Tochter hat herausbekommen, dass Sie hier sind.“
Maisy wartete darauf, dass er fortfuhr.
Er stand auf. „Sie will mit Ihnen reden. Ihr Zimmer ist oben. Gehen Sie den Korridor entlang bis zum Ende. Dort sehen Sie auf der linken Seite eine Treppe. Steigen Sie sie hinauf, und biegen Sie oben erst links und dann rechts ab. Ihr Zimmer ist am Ende des Flurs. Aber ich sag’s Ihnen gleich: Ich bin verpflichtet, Mr. Warwick davon zu unterrichten, dass Sie Mrs. Warwick entgegen ärztlichem Rat besucht haben.“
„Dr. Jeffers, sind Sie eigentlich Psychiater oder Spion?“
„Meine verehrte Dame, Sie haben ein paar psychische Probleme, die Sie dringend einmal angehen sollten.“
Als wolle sie ihm ihre mentale Gesundheit demonstrieren, verließ sie grußlos sein Büro.
Julia wusste, dass ihre Mutter gekommen war. Das Motorengeräusch von Maisys und Jakes Pick-up war markerschütternd und ebenso wenig zu überhören wie der knatternde Auspuff. Bard hatte Jake schon seit Jahren zu überreden versucht, einen neuen Truck zu kaufen, aber Julias Stiefvater hatte sich standhaft geweigert. Er gehörte zu den Männern, die eher auf Bequemlichkeit verzichteten, als Geld unnötig zum Fenster hinauszuwerfen. Dabei war er nicht einmal knauserig, sondern nur der Meinung, dass man sein Eigentum pfleglich behandeln sollte, um lange etwas davon zu haben.
Als das Motorengeräusch vom Parkplatz empordrang, war Julia zum Fenster gelaufen, um sich zu vergewissern, dass sie mit ihrer Vermutung Recht hatte. Sie war sich nicht sicher, was sie damit bezweckte. Erwartete sie, dass die Dunkelheit plötzlich dem Licht wich oder sie einen verstohlenen Blick auf eine Welt werfen konnte, die sie seit Wochen nicht gesehen hatte? Mit den Fingerkuppen betastete sie die kühle Glasscheibe, fuhr über den glatten Fenstersims und das Gitter, das offensichtlich als Verzierung gedacht war. Doch das Vergnügen, die frische Nachmittagsluft einzuatmen, blieb ihr verwehrt. Das Fenster war verschlossen.
Sie erkannte, dass sie um Hilfe bitten musste – und zwar um tatkräftige und nicht um solche, wie sie ihr hier geboten wurde. Schon nach dem ersten Tag in der Gandy-Willson-Klinik hatte sie gemerkt, dass dies nicht der richtige Ort für sie war. Ihre Sitzungen bei Dr. Jeffers kamen eher einem Zweikampf gleich: Sie versuchte, so gut es ging, ihre Gefühle zu verbergen, und er tadelte sie dafür unterschwellig für ihren Mangel an Mitarbeit.
Zum Glück gab es wenigstens eine Angestellte, die ihr hier freundlich gesonnen war. Karen, die Dienst habende Schwester, hatte sich bereit erklärt, Dr. Jeffers zu verständigen und Julias Bitte weiterzuleiten. Wenn Maisy Fletcher gekommen war, um ihre Tochter zu besuchen, dann hatte er kein Recht, ihre Mutter fortzuschicken. Und wenn er es dennoch tun sollte, würde Julia ebenfalls das Haus verlassen.
Als Maisy um die Ecke des Korridors bog, erkannte Julia sofort die vertrauten hastigen Schritten. Ihre Mutter hatte es nämlich immer eilig, als ob sie dringend irgendwohin musste. Dabei kam es in Wahrheit selten auf das zu erreichende Ziel an, sondern eher auf die Geschwindigkeit der Fortbewegung.
„Julia?“
„Hier, in dieses Zimmer, Maisy.“
Die Tür flog auf, so dass eine Brise frischer Luft hereinströmte, und fiel dann wieder sanft ins Schloss.
„Liebling.“
Julia hörte und roch, dass ihre Mutter da war. Kurz darauf spürte sie Maisys weiche Hände auf ihren Wangen. Und dann hüllte eine große Wolke von Veilchenduft die junge Frau ein, während ihre Mutter sie zärtlich in die Arme nahm.
Julia umfasste die Taille ihrer Mutter, als sie sich gemeinsam aufs Bett setzten.
„Woher wusstest du, dass ich hier bin?“ wollte Maisy wissen.
„Ich habe den Pick-up gehört. Es ist eigentlich doch gut, dass Jake keinen neuen Wagen gekauft hat.“
„Der Meinung war ich vorhin allerdings ganz und gar nicht, als ich hergefahren bin. Ich hätte ihn fast am Straßenrand stehen gelassen. Diese verdammte Kiste hat mich nie leiden können.“
„Das liegt daran, dass du ihn zu sehr malträtierst.“ Maisy hatte ein gespaltenes Verhältnis zu dem Wagen, seit er angeschafft worden war.
„Wie geht es dir?“
Julia richtete sich kerzengerade auf und faltete die Hände im Schoß. Wenigstens dieses eine Mal schien Maisy die Geste zu verstehen und rückte ein wenig von ihrer Tochter ab, um sie nicht zu sehr zu bedrängen. „Nicht besser, aber auch nicht schlechter“, antwortete Julia.
„Dr. Jefferson ist ein Mistkerl, den nur die Vorschriften interessieren und der höchstwahrscheinlich noch nicht mal einen Niednagel richtig behandeln kann.“
„Urteile nicht zu leichtfertig über ihn.“
Unter normalen Umständen wäre Julia jetzt aufgestanden und durchs Zimmer gelaufen. Doch diesmal wäre ihre Flucht mit Gefahren verbunden gewesen. Obwohl sie sich die Anordnung der Möbel so gut wie möglich eingeprägt hatte, befürchtete sie, sich unsicher durch den Raum zu bewegen, weil ihre Mutter ihr jetzt zusah. Ein paar Sekunden lang schien Julias Herz schneller zu schlagen. Ihr Atem ging stoßweise. Die Welt war ein schwarzes Loch, das sie zu verschlingen und für immer gefangen zu halten drohte.
„Was tust du hier eigentlich, Liebling?“ fragte Maisy.
Julia zwang sich, ruhig zu bleiben. „Ein Zimmer unterscheidet sich nicht groß von einem anderen, wenn man nicht sehen kann.“
„Das stimmt einfach nicht. Du musst mit Menschen zusammen sein, die dich lieben, nicht mit Fremden, und dich an einem Ort aufhalten, der dir vertraut ist.“
„Schau dich um. Es ist doch fast wie zu Hause. Ich habe meinen eigenen Kamin, ein Zimmer voller Antiquitäten – jedenfalls hat man mir das gesagt. Und die Aussicht ist zweifellos überwältigend.“
„Das einzig Überwältigende an diesem Zimmer ist meine Toch-ter, und sie gehört überhaupt nicht hierher.“
Julias blicklose Augen füllten sich mit Tränen. Sie stand auf. Lieber wollte sie das Risiko eingehen, gegen Möbelstücke zu laufen, als ihrer Mutter Kummer zu bereiten. „Bard hat gedacht, es sei für alle das Beste.“
„Und du bist seiner Meinung?“
„Ich mache nicht immer, was er will, Maisy. Diesmal glaube ich allerdings, dass er Recht hat.“
„Wieso bist du dieser Ansicht?“
„Er macht sich Sorgen um Callie.“ Julia streckte eine Hand aus und wunderte sich, dass sie nicht so nahe an der Wand war, wie sie erwartet hatte. Mit kleinen Schritten ging sie vorwärts, bis sie sie berühren konnte. Dann erst sprach sie weiter.
„Er sagt, dass mein ... Zustand sie verunsichert und wütend macht und dass sie sich irgendwie schuldig fühlt ...“
„Lächerlich.“
Julia drehte den Kopf in Maisys Richtung – das hoffte sie jedenfalls. „Woher willst du das wissen?“
„Weil ich ihre Großmutter bin. Seit dem Unfall habe ich sie jeden Tag angerufen, und gestern sind wir nach der Schule Eis essen gegangen. Callie weiß, dass es nicht ihre Schuld war, dass Duster vor dem Hindernis gescheut hat und du kopfüber von ihm geschleudert worden bist. Damit muss jeder rechnen, der anfängt, ein Pferd zu trainieren.“
„Gleich nach dem Sturz teilte mir Callie mit, sie sei sicher, dass Duster gescheut habe, weil sie ihn mit ihrem neuen Pony erschreckt hat.“
„Aber hast du ihr nicht erklärt, dass Duster schon vorher ein halbes Dutzend Mal gescheut hat und es jederzeit wieder tun könnte? Das hat sie mir nämlich erzählt. Ich glaube nicht, dass sie noch unter Schuldgefühlen leidet. Sie ist einfach nur einsam und hat Angst, dass du nicht zurückkommst.“
Julia schluckte die Tränen hinunter. „Hast du ihr gesagt, dass ich zurückkomme, sobald es mir wieder besser geht?“
„Sie ist erst acht. In diesem Alter gilt das Wort einer Großmutter weitaus weniger als das einer Mutter.“
„Der Sturz hat überhaupt nichts mit meinem ... meinem Zustand zu tun. Hast du sie auch darüber informiert?“
„Ja, aber das kann sie erst recht nicht begreifen.“
„Wie sollte sie auch? Ich verstehe es ja selbst kaum. Von einem Moment auf den anderen sehe ich nichts mehr. Dabei ist mit meinen Augen alles in Ordnung. Mein ganzer Körper funktioniert tadellos – nur mein Verstand will nicht mehr.“
Maisy schwieg. Vermutlich wartet sie darauf, dass ich mich wieder unter Kontrolle habe, dachte Julia. Eines war Mutter und Tochter nämlich gemeinsam: ihre Abneigung gegen Gefühlsausbrüche. Julia begann, mit ausgestreckten Armen im Zimmer auf und ab zu gehen. Sie kam an einen Schreibtischstuhl und hielt sich daran fest. „Ich bin nicht verrückt“, sagte sie schließlich.
„Befürchtest du, dass ich das glaube?“
„Bard behauptet, mein Verstand ist für meinen Zustand verantwortlich. Er möchte, dass ich ein großes Mädchen bin, mich zusammenreiße und alles für meine Genesung tue. Wenn ich mich voll darauf konzentriere und hart arbeite, während ich hier bin, werde ich wieder sehen können.“ Sie hoffte, ein ironisches Lächeln zustande zu bringen. „So würde er sich jedenfalls verhalten.“
„Wenn er da mal keine Überraschung erlebt. Es gibt nämlich Dinge im Leben, auf die selbst Lombard Warwick keinen Einfluss hat.“
„Ich schließe oft meine Augen, und jedes Mal, wenn ich sie öffne, erwarte ich, wieder sehen zu können, aber dem ist nicht so. Ich bin früher häufig vom Pferd gefallen, aber diesmal war es irgendwie anders. Ich erinnere mich, dass ich an Christopher Reeve denken musste, während ich stürzte. Sein Pferd hat auch gescheut, und jetzt ist er für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt. Nachdem ich auf den Boden aufgeschlagen war, hatte ich Angst, mich zu bewegen, weil ich befürchtete, mich nicht mehr hinsetzen oder nicht mehr laufen zu können. Dann muss ich ohnmächtig geworden sein.“
Sie tastete sich um den Schreibtisch herum und ging zum Fenster hinüber. Wieder wandte sie das Gesicht ihrer Mutter zu. „Als ich wieder zu mir kam, habe ich meine Augen nicht aufgeschlagen, sondern nur ein Bein hochgehoben und dann einen Arm. Ich war so erleichtert. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr. Ich hatte mir überhaupt nichts gebrochen. Erst dann habe ich die Augen geöffnet.“
„Und du konntest nichts mehr sehen.“
Julia hatte ihrer Mutter alles bereits im Krankenhaus erzählt, wohin sie nach dem Unfall gebracht worden war, aber sie sprach weiter, weil sie aus irgendeinem Grund den Wunsch verspürte, den Unfall noch einmal Revue passieren zu lassen. „Merkwürdig, dachte ich, ich liege bestimmt schon seit Stunden hier. Callie ist wohl zurückgeritten, um Hilfe zu holen, und sie können mich jetzt nicht finden. Ich habe angenommen, es wäre Nacht, aber so eine tiefschwarze Nacht? Später hat sich dann herausgestellt, dass ich weniger als eine Minute bewusstlos gewesen bin.“
„Hilft es dir, wenn du ständig davon sprichst?“
„Nichts hilft. Der Nebel lichtet sich nicht. Er bewegt sich nicht einmal. Aber weißt du, was am schlimmsten war? Noch schlimmer, als blind aufzuwachen? Der Moment, als man mir sagte, dass mit meinen Augen alles in Ordnung sei und es sich um eine hysterische Reaktion handele. Ich bin eine Hysterikern.“
„Du bist eine wundervolle, gefühlvolle und intelligente Frau. Du bist kein Fall für die Psychiatrie.“
„Ich bin in einer psychiatrischen Klinik! Mag sein, dass es hier Kamine und Antiquitäten gibt, aber es bleibt eine Klinik für Geistesgestörte.“
„Du gehörst nicht hierher.“
Julia erkannte, dass sie ihrer Mutter nun auch den Rest erzählen musste. „Da gibt es noch ein paar Dinge, von denen du nichts weißt.“
„Das höre ich nicht zum ersten Mal.“
Julia versuchte zu lächeln, aber es gelang ihr nicht. „Der ganze Tag, ich meine, bevor ich Duster damals gesattelt habe, ist nicht gut gelaufen.“
Maisy schwieg.
Hätten mir meine Augen den Dienst nicht versagt, dann könnte ich jetzt bestimmt sehen, wie meine Mutter mit den Händen ringt, überlegte Julia, ihre Finger sind bestimmt wie immer mit Ringen übersät.
Maisy liebte alles, was glitzerte. Sie liebte helle Farben, merkwürdige Stoffe, lose flatternde Kleider, die Julia stets an einen Harem oder an festlich gekleidete Teilnehmerinnen eines polynesischen Festmahls erinnert hatten. Aus jeder Menschenmenge stach sie hervor – die Mutter, über die sich Julias Schulfreundinnen lustig gemacht hatten, die grelle exotische Erscheinung in einer Masse von ehrwürdigem Tweed und auf redliche Weise abgetragenen Bluejeans.
„Du willst das nicht hören, stimmt’s?“ fragte Julia.
„Julia, was meinst du, warum ich hier sitze und warte?“
„Du willst nie hören, wenn es im Leben mal nicht so gut läuft, Maisy. Wenn du eine Brille tragen würdest, hätte sie rosarote Gläser.“
„Vollkommen richtig“, stimmte Maisy zu. „Eine Schmetterlingsbrille mit Strass, und du würdest sie hassen. Aber nur weil ich versuche, das Leben positiv zu betrachten, blende ich ihre negativen Seiten noch lange nicht aus.“
Julia fühlte sich beschämt. Sie liebte ihre Mutter, aber zwischen ihnen erstreckte sich ein Graben, der in den neunundzwanzig Jahren ihres gemeinsamen Lebens immer tiefer geworden war. Sie wusste nicht, wie er entstanden war, und nahm an, dass es Maisy ebenso ging. Es grenzte fast an ein Wunder, dass zwei Frauen, die so wenig Ähnlichkeit besaßen und zwischen denen eine solch große Distanz lag, sich so sehr lieben konnten.
„Es tut mir Leid. Ich wollte dich nicht kränken.“ Vorsichtig tastete sich Julia zum Bett zurück. Sie hoffte, die richtige Richtung eingeschlagen zu haben. „Ich möchte nur nicht, dass es noch schlimmer für dich wird ...“
„Lass uns lieber dafür sorgen, dass es für dich besser wird. Erzähl mir, was passiert ist. Und halte dich ein bisschen weiter links“, sagte Maisy.
Julia tat, wie ihr geheißen, und stieß mit dem Schienbein gegen die Bettkante. „Ich werde einen Blindenstock benötigen.“ Der letzte Satz wirkte wie ein Donnerschlag.
Maisy ergriff die Hand ihrer Tochter, um ihr beim Hinsetzen zu helfen. „Hat Dr. Jeffers dich über den Krankheitsverlauf informiert?“
„Nein. Während unserer Sitzungen spricht er kaum, und wenn, dann stellt er nur Fragen: Warum ich mir nicht gleich Hilfe gesucht habe, als die Probleme das erste Mal auftauchten. Warum ich so zu-
rückhaltend bin. Warum ich nicht möchte, dass mein Mann in die Therapie mit einbezogen wird.“
„Würde Bard denn gerne einbezogen werden?“
„Das bezweifle ich, aber ich bin sicher, dass er es dem Doktor gegenüber niemals klar zum Ausdruck gebracht hat.“
„Erzähle mir von den Problemen, die du eben erwähnt hast.“
„Ich konnte vor Kopfschmerzen kaum aus den Augen sehen.“ Sie lächelte grimmig.
„Wissen die Ärzte darüber Bescheid?“
„Ja. Sie haben jeden Zentimeter meines Gehirns untersucht, haben alle möglichen Tests gemacht, die sich ein Neurologe nur ausdenken kann, und zahlreiche Spezialisten zu Rate gezogen. Sie haben nichts gefunden – jedenfalls nichts Physisches.“
„Und sonst?“
„Ich ...“ Julia überlegte, wie sie den nächsten Satz formulieren sollte. „Meine Arbeit hat gelitten.“
„Deine Malerei?“
Julia nickte. „Ich sollte ein Familienporträt der Trents anfertigen. Sie besitzen in der Nähe von Middleburg neben dem Anwesen der Gradys eine hübsche kleine Farm. Sie haben zwei hellblonde Kinder, die mit ihren Ponys in derselben Reitveranstaltung wie Cal-lie aufgetreten sind. Ein Junge und ein Mädchen. Erinnerst du dich noch an sie?“
„Ich glaube, ja.“
„Die ganze Familie hat mir drei Mal Modell gesessen, aber ich brachte nichts Anständiges zu Papier. Es war wirklich schlimm. Den Trents schwebte etwas Zwangloses vor; sie wollten mit ihren Pferden und Haustieren in freier Landschaft abgebildet werden. Die Skizzen, die ich anfertigte, waren eigentlich ganz gut. Ich hatte auch ein paar gute Ideen für die Ausführung in Öl. Aber als ich begann zu malen, gelang es mir nicht, meine Vorstellungen umzusetzen. Das Bild entwickelte eine Art Eigenleben. Mr. Trent – immer steif und korrekt – ist ein sehr strenger Vater. Das war alles, was ich auf die Leinwand bringen konnte. Irgendwie sah er aus wie ein SA-Mann.
Einmal ertappte ich mich sogar dabei, wie ich ein Hakenkreuz auf seinen Ärmel gezeichnet habe.“
„Möglicherweise hast du nicht gemalt, was du gesehen, sondern was du gefühlt hast. Macht das aber nicht jeder Künstler so?“
„Ja, nur hatte ich mich irgendwie nicht mehr unter Kontrolle.“ Julia merkte, dass ihre Stimme schriller wurde. Sie hielt inne, um tief durchzuatmen. „Das war bei allen Bildern so, die ich in dem Monat vor dem Unfall gemalt habe. Die Jagdszenen, an denen ich mich versuchte, verloren auf irgendeine Art ihren positiven Charakter. Dabei jagen wir Füchse doch in erster Linie um des Spaßes willen und nicht, weil wir sie töten wollen. Aber auf jedem Gemälde, das ich anfing, schien im Mittelpunkt zu stehen, wie die Hunde den Fuchs in Stücke rissen. Sie waren ... beunruhigend, und jedes Mal, wenn ich mit dem Malen aufhörte, fühlte ich mich so durcheinander, dass ich Angst hatte, am nächsten Tag wieder zu beginnen.“
„Vielleicht war es nur die Erschöpfung. Vielleicht brauchtest du eine Pause.“
„Na ja, jetzt habe ich ja eine, oder?“
Maisy schwieg, was Julia nicht wunderte. Was hätte sie auch schon sagen sollen.
Schließlich meinte Maisy: „Als du noch ein kleines Mädchen warst und Kummer hattest, bist du immer in dein Zimmer gegangen und hast gemalt. Auf diese Weise verliehst du deinen Gefühlen Ausdruck.“
„Das würde ich auch jetzt gerne tun. Aber so wird es nie wieder sein, wenn sich nicht etwas radikal ändert.“
„Komm mit mir nach Hause, Julia. Wenn Bard dich in Millcreek nicht will, dann begleite mich nach Ashbourne. Du weißt, dort gibt es genug Platz für dich und Callie. Wir suchen einen Therapeuten, zu dem du Vertrauen hast. Jake möchte auch, dass du bei uns wohnst.“
Julia liebte ihren Stiefvater, der Maisy zu einer gewissen Stabilität verhalf und sie selbst mit liebevoller Fürsorge behandelte. Er war ein freundlicher, ruhiger Mensch, dem die Verschrobenheit seiner Frau noch immer Rätsel aufgab. Julia wusste, dass er sie mit offenen Armen empfangen würde.
Einen Moment lang war sie versucht, zuzustimmen, in das Haus ihrer Kindheit zurückzukehren und ihre Tochter mitzubringen, um dort so lange zu bleiben, bis sie wieder sehen konnte oder gelernt hatte, mit ihrer Behinderung zu leben. Doch dann holte sie die Wirklichkeit wieder ein.
Entschlossen schüttelte sie den Kopf. „Das kann ich nicht tun. Meine Güte, Bard würde außer sich sein. Er musste seine Verbindungen spielen lassen, damit ich hier einen Platz bekomme. Er ist der Ansicht, dass ich mich so lange von allem und jedem fernhalten muss, bis es mir wieder besser geht.“
„Und was ist deine Meinung?“
„Ich hoffe, dass sie mir hier tatsächlich schnell helfen können, wie Bard immer behauptet. Denn ich glaube nicht, dass ich es in dieser Klinik sehr lange aushalte. Ich komme mir vor wie im Gefängnis. Ich weiß, wie Christian ...“
Unvermittelt hielt sie inne, erschrocken über das, was sie beinahe gesagt hätte.
„Du weißt, wie Christian darüber denkt“, beendete Maisy den Satz für sie. „Du hast ihn schon lange nicht mehr erwähnt.“
Julia erstarrte. „Ich habe eben gar nicht an Christian gedacht. Es ist mir schleierhaft, warum er mir plötzlich einfiel.“
„Du hast dein Sehvermögen verloren und er seine Freiheit. Ihr lebt beide an Orten, die ihr euch nicht selbst ausgesucht habt. Das ist die Verbindung.“
„Ich möchte nicht über Christian sprechen.“
„Das wolltest du noch nie.“
An der Tür raschelte es. Erleichtert drehte Julia den Kopf in diese Richtung.
„Eine Krankenschwester ist gekommen“, sagte Maisy.
„Mrs. Warwick?“ Karen, die Schwester, die ausgerichtet hatte, dass Julia ihre Mutter treffen wolle, betrat das Zimmer so geräuschvoll, dass Julia mitbekam, an welcher Stelle im Raum sich die Klinikangestellte befand. „Dr. Jeffers meint, dass Sie sich jetzt ausruhen sollten.“
Wenigstens dieses Mal war Julia mit ihrem Therapeuten einer Meinung. Plötzlich fühlte sie sich schrecklich müde. Sie spürte, wie sich die Matratze hob, als Maisy aufstand.
„Du siehst tatsächlich erschöpft aus. Ich komme morgen wieder“, meinte Maisy. „Soll ich Callie irgendetwas ausrichten?“
„Sag ihr, dass ich sie liebe und dass ich bald nach Hause komme. Und dass ich sie in meinen Träumen sehen kann.“
„Lässt du dir mein Angebot durch den Kopf gehen?“
Julia nickte. Dann fiel ihr ein, dass ihre Mutter sie möglicherweise gar nicht anschaute. Eine Sache, über die sich kein Sehender Gedanken zu machen brauchte.
„Ich werde darüber nachdenken.“ All die Worte, die sie nicht ausgesprochen hatte, schnürten ihr die Kehle zu. Ein Teil von ihr wollte Maisy bitten, sie mit nach Hause nach Ashbourne zu nehmen, in das idyllische Landhaus, in dem sie bis zu ihrer Heirat gelebt hatte. Der andere Teil bestand darauf, dass sie hier blieb und weiter litt, um vielleicht eines Tages geheilt zu werden, wenn die Leiden schwer genug gewesen waren.
Karen ergriff das Wort. Sie hatte eine leise, heisere Stimme und warme Hände. Merkwürdig, worauf man so achtet, wenn man blind ist, dachte Julia. „Sicherlich wissen Sie ja, dass Mrs. Warwick eigentlich nur von ihrem Mann besucht werden darf. Doch unglücklicherweise hat Dr. Jeffers morgen Nachmittag um drei Uhr eine Verabredung. Er wird also nicht im Hause sein. Jeder könnte einfach so hereinkommen ...“
„Ich verstehe“, erwiderte Maisy.
„Vielen Dank.“ Auch Julia begriff den Wink mit dem Zaunpfahl.
„Auf Wiedersehen, Liebling.“ Sie spürte erst die Hand ihrer Mutter auf ihrer Schulter und dann Maisys Lippen an ihrer Wange. Als Karen und Maisy sie verlassen hatten, war das Zimmer ebenso leer wie Julias Herz.
2. KAPITEL
Ashbourne war ein riesiges, eigenwilliges Haus auf einem 120 Hektar großen Grundstück. Es lag zwischen gewundenen Hügelketten und Bächen voller Felsbrocken. Die Blue Ridge Mountains dominierten die Landschaft. Maisy hatte nie aufgehört, die Schönheit der Gegend zu bewundern und ihrem Schicksal zu danken, das sie als junge Braut von Harry Ashbourne, dem Master der hiesigen Fuchsjagd, hierher geführt hatte.
Harry war nun schon fast seit fünfundzwanzig Jahren tot, doch Ashbourne existierte noch und wartete darauf, wie Maisy sich einredete, dass Julia Anspruch darauf erheben und es in alter Pracht wieder auferstehen lassen würde.
Das Haupthaus des Anwesens war ein elegantes, klassizistisches Gebäude mit roten Ziegeln und dorischen Säulen. Es war drei Stockwerke hoch. Die symmetrisch angelegten Seitenflügel, die die große rückwärtige Veranda und die steingeflieste Terrasse säumten, verfügten jedoch nur über zwei Etagen. Als Harry noch lebte, waren die Holunderbüsche und der Berglorbeer, der persische Flieder und die Glyzinien stets sorgfältig gepflegt worden. Sie wirkten mustergültig und geschmackvoll wie das Haus selbst, aber niemals über-trieben perfekt.
Mit den Jahren war der Garten verwildert. Alte Akazien, Ahorn- und Walnussbäume waren Blitzeinschlägen oder Dürreperioden zum Opfer gefallen; die Buchsbaumbüsche, die Harry während Maisys Schwangerschaft gepflanzt hatte, waren zu einer undurchdringlichen Hecke zusammengewuchert und hatten die Bewegungsfreiheit und die Sicht eingeschränkt, bevor ein Landschaftsarchitekt sie entfernt hatte. Im Laufe der Zeit waren die in Reihen gesetzten Knollengewächse und immergrünen Pflanzen wild gewachsen, hatten dem Gras und den Büschen den Lebensraum streitig gemacht und sich in jedem Sommer weiter ausgebreitet.
Maisy liebte den Garten, so wie er war. Das Haus stand jetzt leer, und die Schwarzäugige Susanne, der Klatschmohn, die Wegwarte und die blauen Glockenblumen ließen die verwitternde Fassade weicher und wärmer erscheinen. Weder das Haus noch der Garten wirkten ungepflegt. Maisy sorgte stets für die nötige Pflege. Aber auch Jack – in seiner geschickten und gutmütigen Art – kümmerte sich um vieles. Doch es wurde allmählich Zeit, dass Harrys Tochter sich entschied, was mit dem Besitz geschehen sollte.
Maisy und Jake lebten im Cottage des Hausmeisters. Es war das älteste Gebäude auf dem Anwesen und lag am Rande eines Waldes, in dem sich Füchse und Murmeltiere in ihre Höhlen verkrochen und Eulen die einsamen Nächte durchwachten.
Das zweistöckige Haus hatte eine große Halle und gemütliche Zimmer, die sich ohne einen erkennbaren Bauplan aneinander reihten oder übereinander schichteten. Der Heizkessel ächzte, die Wasserrohre gluckerten, und der Wind pfiff durch die Ritzen der Fensterrahmen und Simse. Maisy und Jake waren sich einig, dass diese Absonderlichkeiten ebenso den Charme des Hauses ausmachten wie das Schieferdach und die zahlreichen Kamine.
Es dämmerte bereits, als Maisy aus der Gandy-Willson-Klinik zurückkam. Schwarze Wolken schoben sich ineinander und behinderten die Sicht auf einen prächtigen Sonnenuntergang. Auch in dieser Nacht würde man die Sterne nicht sehen können. Wie schade! Sonst lief sie nämlich oft zwei oder drei Mal pro Abend vor die Tür, um das nächtliche Schauspiel am Himmel zu bewundern. Sie suchte immer einen Vorwand, um hinauszugehen, obwohl Jake sie bestimmt durchschaute. Manchmal behauptete sie, die Katzen in der Scheune füttern zu wollen, drei alternde Schildpattkatzen, die auf die Namen Winken, Blinken und Nod hörten. Mitunter gab sie vor, dem Farmer, der auf den saftigen Weiden von Ashbourne seine langhörnigen, zotteligen Hochlandrinder grasen ließ, bei der Kontrolle seiner Gatter zu helfen. Kein Vorwand war ihr zu fadenscheinig, solange er sie nur nach draußen führte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!