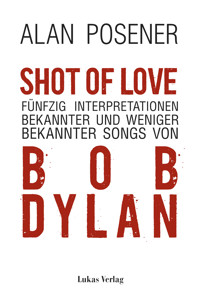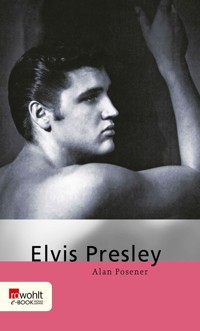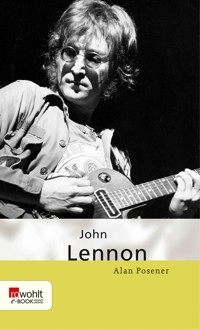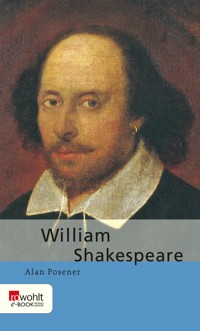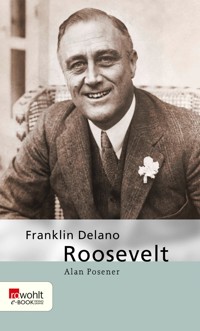
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Rowohlt Monographie
- Sprache: Deutsch
Franklin Delano Roosevelt wurde als einziger Präsident der USA viermal ins Weiße Haus gewählt. Im deutschen Bewusstsein wenig präsent, vielleicht weil seine Amtszeit mit den zwölf Jahren des «Tausendjährigen Reichs» zusammenfällt, ist «FDR» eine der herausragenden politischen Gestalten des zwanzigsten Jahrhunderts. Sein Name steht für den Aufstieg der USA zur führenden Weltmacht und – mit seinem «New Deal» – für einen Kapitalismus mit menschlichem Gesicht. Unkonventionell wie seine Politik war auch das Privatleben Roosevelts, der in der Mitte des Lebens zum Krüppel wurde und sein Land vom Rollstuhl aus regierte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Alan Posener
Franklin Delano Roosevelt
Über dieses Buch
Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) wurde als einziger Präsident der USA viermal ins Weiße Haus gewählt. Im deutschen Bewusstsein wenig präsent, vielleicht weil seine Amtszeit mit den zwölf Jahren des «Tausendjährigen Reichs» zusammenfällt, ist «FDR» eine der herausragenden politischen Gestalten des zwanzigsten Jahrhunderts. Sein Name steht für den Aufstieg der USA zur führenden Weltmacht und – mit seinem «New Deal» – für einen Kapitalismus mit menschlichem Gesicht. Unkonventionell wie seine Politik war auch das Privatleben Roosevelts, der in der Mitte des Lebens zum Krüppel wurde und sein Land vom Rollstuhl aus regierte.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Impressum
rowohlt monographien
begründet von Kurt Kusenberg
herausgegeben von Uwe Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2019
Copyright © 1999 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten
Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg
Umschlagfoto ullstein bild (Franklin Delano Roosevelt als Gouverneur von New York, um 1930)
ISBN 978-3-644-00428-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ein Kind der herrschenden Klasse
Noblesse oblige
Am 11. Dezember 1941 nachmittags um drei Uhr trat Adolf Hitler ans Rednerpult des deutschen Reichstags und verkündete, Deutschland sehe sich «endlich gezwungen», den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg zu erklären. Der Beifall nach der langen und weitschweifigen Rede war «pflichtgemäß, aber dünn»; kaum einer unter den Abgeordneten dürfte vergessen haben, dass der Kriegseintritt Amerikas nicht einmal ein Vierteljahrhundert zuvor zur Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg geführt hatte. Hitler selbst hatte aber am 8. Dezember die Nachricht vom Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, der den unwilligen Riesen USA in den Krieg zog, mit dem Ausruf «Endlich!» begrüßt. Für ihn, so musste es seinen Zuhörern zuweilen vorkommen, reduzierte sich der Weltkrieg nunmehr auf das Kräftemessen mit einem Menschen, den er schon 1938 als seinen «ärgsten Feind» bezeichnet hatte: Franklin Delano Roosevelt. In ihm sah Hitler den «Repräsentanten jener anderen Welt», die er vernichten wollte.
«Ich verstehe nur zu wohl, daß zwischen der Lebensauffassung und Einstellung des Präsidenten Roosevelt und meiner eigenen ein weltweiter Abstand ist», führte Hitler aus. «Roosevelt stammt aus einer steinreichen Familie, gehörte von vornherein zu jener Klasse von Menschen, denen Geburt und Herkunft in den Demokratien den Weg des Lebens ebnen und damit den Aufstieg sichern. Ich selbst war nur das Kind einer kleinen und armen Familie und mußte mir unter unsäglichen Mühen durch Arbeit und Fleiß meinen Weg erkämpfen.» Roosevelt habe den Ersten Weltkrieg «aus der Sphäre des Verdienenden miterlebt», Hitler «als gewöhnlicher Soldat»; Roosevelt habe in der Nachkriegszeit «seine Fähigkeiten in Finanzspekulationen erprobt», während Hitler im Lazarett gelegen habe; Roosevelt habe schließlich «die Laufbahn des normalen, geschäftlich erfahrenen, wirtschaftlich fundierten, herkunftsmäßig protegierten Politikers beschritten», während Hitler «als namenloser Unbekannter» für sein Volk gekämpft habe. «Zwei Lebenswege!» rief Hitler aus. «Als Franklin Roosevelt an die Spitze der Vereinigten Staaten trat, war er der Kandidat einer durch und durch kapitalistischen Partei […]. Und als ich Kanzler des Deutschen Reiches wurde, war ich der Führer einer Volksbewegung […].»[1]
Franklin D. Roosevelt erblickte 1882 in Hyde Park am Hudson, Adolf Hitler sieben Jahre später in Braunau am Inn das Licht der Welt. Die Amtszeit Roosevelts – er wurde als einziger Präsident der USA viermal ins Weiße Haus gewählt – deckt sich genau mit den Jahren der Hitler-Diktatur, was vielleicht mit erklärt, weshalb dieser bedeutendste Präsident des «amerikanischen Jahrhunderts» noch heute so wenig im Bewusstsein der Deutschen präsent ist. Als Hitler am 30. Januar 1933 in Berlin Reichskanzler wurde, feierte Roosevelt als gewählter, aber noch nicht in sein Amt eingeführter Präsident in Hyde Park seinen 51. Geburtstag; und als Roosevelt am 4. März 1933 auf der alten holländischen Bibel seiner Vorfahren den Amtseid vor dem Kongressgebäude in Washington ablegte, machten nationalsozialistische Schlägertrupps in Vorbereitung auf die Reichstagswahl vom nächsten Tag Jagd auf Oppositionelle – eine Wahl übrigens, die, Hitlers «Volksbewegung», Terror und Propaganda zum Trotz, nur 44 Prozent der Stimmen brachte. Als Roosevelt am 12. April 1945 starb, saß Hitler im Bunker der Berliner Reichskanzlei, während amerikanische und britische Bomber die geplante Welthauptstadt «Germania» in Schutt und Asche legten. «Mein Führer, ich gratuliere Ihnen! Die Wende ist da! Die Zarin ist gestorben!» rief Propagandaminister Joseph Goebbels aus. (1762 hatte der Tod der Zarin Elisabeth zum Auseinanderbrechen einer gegen Preußen gerichteten Kriegskoalition geführt.) Aber Hitler überlebte seine Nemesis Roosevelt um ganze achtzehn Tage.
Das «Tausendjährige Reich» hinterließ nur Tote und Trümmer, Schrecken und Abscheu. Die Träume der wichtigsten Partner Roosevelts in der Anti-Hitler-Koalition – Josef Stalins düstere Vision einer bolschewistischen Weltrevolution, Winston Churchills verzweifelte Illusion einer Erneuerung des britischen Weltreichs – sind zerstoben. Roosevelts oft als utopisch und naiv belächelte Vorstellung einer liberalen Weltordnung aber, die von ihm zur Sicherung dieser Ordnung ins Leben gerufene Organisation der Vereinten Nationen und die von ihm als moralische Grundlage dieser Ordnung proklamierten vier Freiheiten – Freiheit der Rede, Freiheit des Glaubens, Freiheit von Not und Freiheit von Furcht – haben das Auseinanderbrechen der Kriegskoalition, den Kalten Krieg, die antikoloniale Revolution und den Zusammenbruch des Kommunismus überlebt. Der Gang der Geschichte hat seine Politik nicht revidiert, sondern bestätigt.
In jener Zukunft, die wir sichern wollen, sehen wir eine Welt, die sich auf vier wesentliche Freiheiten gründet. So hatte Roosevelt bereits am 6. Januar 1941, ein Jahr vor dem Kriegseintritt der USA, die weltumspannenden Ziele seiner Außenpolitik umrissen. Die erste heißt Freiheit der Rede und der Meinung – überall auf der Welt. Die zweite ist die Freiheit eines jeden Menschen, auf seine Weise Gott zu dienen – überall auf der Welt. Die dritte heißt Freiheit von Not – […] – überall auf der Welt. Die vierte heißt Freiheit von Furcht – und […] das bedeutet: Abrüstung, und zwar derart umfassend, daß keine Nation in der Lage sein wird, irgendeinen ihrer Nachbarn anzugreifen – überall auf der Welt.
Das ist nicht die Vision eines weit entfernten Millenniums. Es handelt sich um die konkrete Grundlage einer in unserer Zeit und von dieser Generation zu errichtenden Weltordnung. Eine solche Welt ist geradezu die Antithese jener sogenannten neuen Ordnung der Tyrannei, die einige Diktatoren mit Bomben herbeiführen wollen. Jener Ordnung setzen wir dieses große Konzept entgegen – eine moralische Weltordnung.[2]
Wir sind es gewohnt, dem Pathos der Politiker zu misstrauen. Und doch war es Roosevelt mit diesem Ziel genauso ernst wie mit seinem einfach formulierten – und erreichten – innenpolitischen Ziel, mehr Sicherheit und mehr Glück für mehr Menschen in allen Lebenslagen und in allen Teilen des Landes zu erreichen; ihnen mehr von den guten Dingen des Lebens zu geben[3].
Roosevelt gehörte, wie Hitler richtig bemerkte, von Geburt an zur Klasse der Menschen, denen die Welt zu Füßen liegt. Von den guten Dingen des Lebens hatte er immer mehr, als er brauchte. Zum Teil war es gerade das Bewusstsein dieses privilegierten Daseins, das ihn zum Reformer machte: Dieser Unterschied [zwischen Arm und Reich] ist zu groß, er muß viel geringer werden, erklärte er seinem Biographen Emil Ludwig, den Hitler aus Deutschland vertrieben hatte. Das zu versuchen, sind die Reichgeborenen doppelt verpflichtet. […] Wer für sein Brot nicht zu sorgen hat, ist sicherer und freier. Wer von unten kommt, behält noch spät bittere Erfahrungen an seine Jugend, und so liebt er weniger die Menschen. Der Armgeborene hat Ressentiments, ich kann keine haben. Das ist mein persönliches Motiv.[4]
Hinzu kam ein Familienmythos, den der neunzehnjährige Harvard-Student wie folgt formulierte: Ein Grund, vielleicht sogar der Hauptgrund, für die Kraft der Roosevelts ist [ihr] demokratischer Geist. Sie waren nie der Meinung, daß sie aufgrund ihrer guten gesellschaftlichen Stellung einfach die Hände in die Taschen stecken könnten.[5] Als einzigen Bürgen für diese Familienlegende könnte man Roosevelts Urahn Isaac Roosevelt anführen, der sich – weniger aus antimonarchistischer Gesinnung denn aus Empörung über die hohen Steuern – auf die Seite George Washingtons und der Unabhängigkeit schlug. Isaac gehörte zu den Autoren der Verfassung des Staats New York, wobei er, wie ein Historiker feststellte, «sich Mühe gab, die Ausweitung der Demokratie zu beschränken und die Rechte der Begüterten zu schützen»[6], zu denen er als Präsident der Bank of New York gehörte. Bei Franklins Vater James regte sich wohl kurz der demokratische Geist der Roosevelts, als er im Revolutionsjahr 1848 eine standesgemäße «Grand Tour» durch Europa unternahm. Er freundete sich mit einem herumirrenden Priester an – sprach nur Latein mit ihm – und wanderte mit ihm durch Italien. Als sie Neapel erreichten, wurde die Stadt gerade durch Garibaldis Truppen belagert. Sie schlossen sich beide dieser Armee an, trugen einige Monate lang ein rotes Hemd, und als sie der Sache überdrüssig wurden, weil nichts passierte, gingen sie zu Garibaldis Zelt und baten um Entlassung.[7] Damit hatte es sich schon. Die Roosevelts waren traditionell aristokratisch-liberale «Whigs». Als die Frage der Sklaverei das Gewissen der Nation spaltete, gingen viele Whigs – darunter auch Theodore Roosevelt sen., Vater des späteren Präsidenten Theodore Roosevelt – zu Abraham Lincolns Republikanischer Partei über. James aber ging zu den Demokraten, die den Ausgleich mit dem Süden predigten. Am Krieg gegen die Sklavenhalterstaaten nahm er nicht teil.
Als Kind wurde Franklin Roosevelt verhätschelt; in seiner Jugend wirkte er fast gänzlich unpolitisch und verdiente sich auf Bällen und Soupers Spitznamen wie «der lustige Kavalier» und – wegen seines intellektuellen Leichtgewichts – «Staubwedel»; seine Laufbahn als Berufspolitiker begann er, so scheint es, aus Ehrgeiz, Gefallsucht und Langeweile. Woher dieser aristokratisch erzogene, zuweilen arrogant und oberflächlich wirkende Mensch den Idealismus, die Kraft und das politische Genie bezog, die es ihm ermöglichten, in einer «gewaltlosen Revolution», wie es seine Frau Eleanor zu Recht nannte[8], Amerika zu demokratisieren, zu modernisieren und zu humanisieren, um es dann im Zweiten Weltkrieg zur führenden Macht der Erde zu machen – das bleibt seinen Biographen im Grunde ein Rätsel.
Emil Ludwig erklärte schlicht «die Lebensfreude» zum entscheidenden Charakterzug Roosevelts und gab seiner Biographie den Untertitel einer «Studie über Glück und Macht». Tatsächlich lässt sich kaum eine weniger tragische politische Gestalt denken als «FDR», wie er von seinen Anhängern und Freunden genannt wurde. Sein Markenzeichen war ein breites, optimistisches Lächeln, beinahe ein Grinsen, wobei er den Kopf mit einer charakteristischen, unwillkürlichen Geste herausfordernd nach hinten warf, sodass sein Kinn hervorstach und er von oben herab durch seinen Zwicker blinzeln musste, während die zwischen die Zähne geklemmte Zigarettenspitze steil nach oben ragte – geradezu eine Karikatur des amerikanischen Kapitalisten und seiner «Nichts-ist-unmöglich»-Mentalität.
Die bewusst zur Schau gestellte und doch ungekünstelt wirkende Lebensfreude aber war ihrerseits ein kleines Rätsel. Denn dieser ehrgeizige, gutaussehende Liebling der Götter und der Frauen, dem Reichtum und Beziehungen den Weg nach oben geebnet hatten, war – was Hitler in seiner Hasstirade vor dem Reichstag nicht erwähnte – auf dem Höhepunkt seiner Karriere und in der Mitte des Lebens an Kinderlähmung erkrankt und hatte sich nach einem jahrelangen Kampf gegen die Krankheit mit der Tatsache abfinden müssen, dass er zum Krüppel geworden war, der keinen Schritt ohne fremde Hilfe gehen konnte.
Einem derart geschlagenen Menschen wären Bitterkeit und Selbstmitleid zu verzeihen gewesen. Wenn Roosevelt solche Gefühle empfand: Er zeigte sie nie, nicht einmal den Menschen, die ihm am nächsten standen. Er war nach eigenem Selbstverständnis ein Gentleman[9], und wenn auch seine Reformen gerade seiner eigenen Klasse die Lebensgrundlage entzogen, so blieben ihre Maximen – zu denen das Verbot des Selbstmitleids gehörte – für sein Leben bestimmend. «Da mag man noch so demokratisch sein», schrieb seine Mutter Sara 1917 an den Sohn nach Washington, wo er als Vizemarineminister arbeitete, «der dumme alte Spruch ‹noblesse oblige› ist doch gut […].»[10]
Kindheit am Hudson
Die Welt, in die Franklin Delano Roosevelt hineingeboren wurde, war die wohlhabende, vornehme, selbstbewusste und snobistische Welt der Hudson-Aristokratie im Bundesstaat New York – «the River», wie sie sich nannte, um sich sowohl von der kleinbürgerlich-bäuerlichen Welt ihrer Nachbarn vom «Dorf» wie auch von der hektischen Geschäftigkeit der wenige Bahnstunden entfernten «City» von New York abzugrenzen. Diese amerikanischen Aristokraten genossen «das englische Leben in seiner ganzen Vollkommenheit», wie einer ihrer Apologeten[11] am Ausgang des 19. Jahrhunderts das Dasein in Springwood, dem Landsitz der Roosevelts in Hyde Park, beschrieb.
Der Snobismus dieser Schicht saß tief. Er kommt etwa in einem Romanfragment zum Ausdruck, das Franklin Roosevelt irgendwann vor 1910 zu Papier brachte; dort ist von einem Seifenkönig des Westens die Rede: ein Selfmademan zwar, jedoch nicht wie der neureiche amerikanische Millionär der Bühne oder von Palm Beach. Vielleicht war es seine gute, solide neuengländische Herkunft, die ihn das Licht der Öffentlichkeit meiden ließ, ihn vom Kunstsammeln, von Reisen nach Paris und Monte Carlo und dem üblichen erbarmungswürdigen Versuch abhielt, in die «Gesellschaft» vorzustoßen.[12] Das Fortdauern dieses Klassenbewusstseins belegt eine Tagebuchnotiz Margaret Suckleys, einer entfernten Cousine und engen Freundin, deren Familie in dem Börsenkrach von 1893 alles außer ihrem Landsitz «Wilderstein» am Hudson verloren hatte, wo die unverheiratete Margaret in vornehmer Armut residierte. Nachdem FDR einmal den neuseeländischen Premierminister und seine Frau zum Nachmittagstee mitgebracht hatte, schrieb sie, ihre Gäste seien «gute, solide Mittelklasse» gewesen, und fügte hinzu: «Der P[räsident] stimmte mir zu, als ich bemerkte, daß man in den Kolonien (wie bei uns) nicht oft einen Mann findet, der ein Gentleman ist – und daß diese Tatsache für F.D.R. von großem Vorteil ist, denn […] die Leute schauen doch aus diesem Grund um so mehr zu ihm herauf.»[13] Das war 1944.
Die Roosevelts waren zwar weder so vornehm wie die alteingesessenen Suckleys, Livingstons, Schuylers oder Van Rensselaers – sie waren erst 1821 aus der City an den Fluß gezogen – noch so reich wie die Vanderbilts, die sich in Hyde Park ein italienisches Renaissanceschlösschen mit 54 Zimmern erbaut hatten, was die Roosevelts bei aller nachbarlichen Freundschaft ein wenig angeberisch fanden. Aber sie gehörten doch zu den tonangebenden Familien. Franklins Vater James etwa war einer der 25 «Patriarchen», die zu bestimmen hatten, wer zu den 400 Gästen beim Subskriptionsball der Caroline Astor und damit zur New Yorker «Gesellschaft» gehören durfte. In früheren Jahren hatte James einige Versuche unternommen, ein großes Kohle- und Eisenbahnimperium zusammenzubringen; es fehlten ihm aber wohl die Energie und Durchtriebenheit, ein zweiter Rockefeller zu werden, und so begnügte er sich mit der Verwaltung seines Aktienbesitzes und führte ansonsten das nicht sehr anstrengende Leben eines christlichen Gutsherrn. Bis zu seinem Tod war er – wie sein Sohn Franklin nach ihm – führend im Gemeindevorstand der kleinen anglikanischen Kirche von Hyde Park tätig. Sein erster Sohn, Franklins Halbbruder James «Rosy» Roosevelt, heiratete die Millionenerbin Helen Astor und widmete sein Leben hauptsächlich seiner Leidenschaft für Pferde und das Kutschenfahren.
Der mächtige und träge dahinfließende Hudson River, auf dessen hohen, dichtbewaldeten Ufern diese vom Glück ausgezeichneten Menschen ihre Villen, Landhäuser und Schlösser bauten, beherrschte ihre Phantasie. Angesteckt von der deutschen Romantik, sahen sie den Fluss als einen amerikanischen Rhein, wovon Namen wie «Rhinecliff», «Rhinebeck» oder «Wilderstein» zeugen. Er verband sie aber auch mit der Geschichte des Landes, das sie beherrschten: An seinen Ufern hatten Indianer gelebt, gejagt, Mais angebaut; hier war 1609 der englische Entdecker Sir Henry Hudson mit seinem Schiff «Half Moon» heraufgesegelt; ihm waren Pelzjäger, Händler und Bauern gefolgt – Holländer, Briten und Deutsche; George Washington, «der Vater seines Landes», war als junger Mann zur Erkundung der nördlichen Wildnis zu Pferd und zu Fuß den Hudson hinaufgezogen, und in den schmucken Dörfern entlang der alten Poststraße zwischen New York City und Albany findet man noch heute nicht nur die obligaten Betten, in denen Washington geschlafen haben soll, sondern schlichte Kirchen aus weißem Holz oder rotem Backstein, Friedhöfe mit windschiefen, bemoosten Grabsteinen und für amerikanische Verhältnisse uralte Gaststätten und Schulhäuser aus der Kolonialzeit. Der Hudson verband die «River»-Aristokraten aber auch mit den Realitäten und Interessen der Gegenwart – an den Slums und Finanzpalästen der West Side von Manhattan fließt der Strom vorbei, an der Freiheitsstatue und der Einwandererschleuse von Ellis Island und hinaus in den Atlantik, der als gewaltige Handelsstraße Amerika mit der Alten Welt verbindet. Und so vereinen sich in den besten Vertretern dieser Klasse nicht nur Patriziertum und demokratisches Engagement, sondern auch ein ausgeprägter Sinn für Geschichte und Tradition mit der Aufgeschlossenheit gegenüber Neuerungen, Yankee-Realismus mit einem Gefühl für Romantik, englische Lebensart mit der Bewunderung deutscher Kultur, ländliche Behaglichkeit mit Abenteuerlust, amerikanischer Patriotismus mit Weltbürgertum.
Wenn ich an meine frühesten Tage zurückdenke, drängt sich mir vor allem das Friedliche und Regelmäßige aller Einrichtungen auf, sowohl was die Menschen als auch was die Öffentlichkeit betrifft. Bis zum Alter von sieben Jahren war Hyde Park der Mittelpunkt der Welt, erinnerte sich FDR als Präsident.[14] Das Elternhaus blieb Mittelpunkt seines Lebens, Symbol der Beständigkeit inmitten der raschen gesellschaftlichen und politischen Wandlungen, deren Motor er selbst wurde. Sich selbst betrachtete er immer als «Menschen vom Lande»: Das Leben solcher Großstadtmenschen, wie Sie einer sind, ist künstlich, sagte der Neunundzwanzigjährige einem Reporter aus New York. Sie bringen nicht solche Menschen hervor wie wir auf dem Lande.[15] Immer wieder kehrte er an den Hudson zurück; 220000 Bäume ließ er über die Jahre auf dem Anwesen pflanzen; und im Rosengarten von Springwood ist er begraben, neben ihm seine Frau Eleanor und sein Lieblingsterrier «Fala». In Hyde Park steht auch die von ihm entworfene Bibliothek, in der seine persönlichen und amtlichen Papiere gesammelt sind.
Springwood war 1882 eine mit Holz verkleidete Gründerstilvilla auf einer Klippe mit einem herrlich weiten Blick durch hohe Bäume hindurch über das Hudson-Tal. Das verhältnismäßig bescheidene Haus stand auf einem allerdings riesigen Anwesen, das sich vom Fluss mehrere Kilometer landeinwärts erstreckte, Gärten, Wald und Farmland umfasste und teilweise von Pächtern bewirtschaftet wurde. Zwischen dem Haus und der Poststraße lag eine von vierhundertjährigen Eichen umsäumte Wiese, auf der sich nach FDRs Überzeugung eine Indianersiedlung befunden hatte; am Flussufer, wo die Roosevelt-Yacht «Half Moon» vor Anker lag, hatten die Roosevelts eine eigene Bahnstation, und James Roosevelt besaß für seine gelegentlichen Reisen zu Aufsichtsratssitzungen in der City einen eleganten Privatwaggon.
Für den jungen Franklin hatte der Vater viel Zeit. Er brachte ihm das Reiten und Schießen in den eigenen Wäldern, das Rudern, Segeln, Eissegeln und Schlittschuhlaufen auf dem Hudson bei, nahm ihn mit, wenn er zu Pferd seine Pächter besuchte oder seinen Arbeitern Anweisungen gab. Von frühester Kindheit an gewöhnte sich Franklin an den fast feudalen Respekt, den die Menschen seiner Umgebung dem Vater entgegenbrachten; und obwohl er mehr für die Demokratisierung der amerikanischen Gesellschaft geleistet hat als irgendein anderer Präsident, behielt er bis zu seinem Tod die aristokratische Gewohnheit bei, Hauspersonal und Diener einfach nicht wahrzunehmen. Als Kind durfte Franklin zwar mit den Stalljungen oder den Kindern der Pächter spielen, aber es war stets klar, dass er der junge Herr war. Als seine Mutter ihn einmal zur Rede stellte, weil er seine Freunde herumkommandierte, erwiderte er: Mami, wenn ich keine Befehle erteile, kommt gar nichts zustande![16]
James Roosevelt war ein weicher Vater, der seine Kinder nicht bestrafen konnte. Als der achtjährige Franklin seiner deutschen Gouvernante Fräulein Reinsberg einmal Brausepulver in den Nachttopf schüttete, was zu großer nächtlicher Aufregung führte, wurde der Delinquent zu seinem Vater geschickt, der ihn mit den Worten entließ: «Betrachte dich als körperlich gezüchtigt.»[17] Auch Franklin wurde ein weicher Vater – und brachte es übrigens als Präsident fast nie übers Herz, einen Mitarbeiter zu entlassen.
Die eigentliche Macht im «Vaterhaus» war Sara, eine «grande dame» und Abkömmling einer stolzen Hudson-Familie, die ihre amerikanischen Vorfahren bis zum Hugenotten Philippe de la Noye zurückverfolgen konnte, der 1621 in Plymouth gelandet war. Die Delanos waren noch reicher und erheblich konservativer als die Roosevelts. Saras Vater Warren pflegte zu sagen, dass zwar nicht alle Demokraten Pferdediebe, nach seiner Erfahrung aber alle Pferdediebe Demokraten seien. Seiner Tochter verschwieg dieser Anhänger von Gesetz und Ordnung allerdings die Tatsache, dass sein eigenes Vermögen nicht zuletzt aus der aktiven Beteiligung am Opiumschmuggel nach China stammte.
Franklin sei immer «ein braves kleines Muttersöhnchen» gewesen, befand die bissige Alice Longworth Roosevelt, Tochter des Präsidenten Theodore Roosevelt und Cousine Eleanor Roosevelts, der späteren Ehefrau FDRs.[18] Zweifellos war die Bindung zwischen Mutter und Sohn außerordentlich stark. Sara Delano war sechsundzwanzig, als sie den Witwer James Roosevelt heiratete; er war genau doppelt so alt wie sie. Die Geburt ihres Sohns war äußerst schwierig, und der Arzt riet von weiteren Schwangerschaften ab. Sara liebte und ehrte ihren Mann, den sie ihrem Sohn stets als Vorbild hinstellte; aber sie vergötterte Franklin. Er wurde der Mittelpunkt ihrer Welt. «Mein Sohn Franklin ist ein Delano, überhaupt kein Roosevelt», sagte sie oft.[19] Die Ähnlichkeit der Gesichtszüge ist in der Tat auffallend, aber Sara meinte mehr als das. Sein Wesen sollte so weit wie möglich allein von ihr geprägt werden – ein Anspruch, den der im ersten Jahr des neuen Jahrhunderts verstorbene Vater in seinem Testament anerkannte: Franklin solle «stets unter dem Einfluss seiner Mutter» bleiben, verfügte er.[20]
«Wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberungsgefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche nicht selten wirklich den Erfolg nach sich zieht», bemerkte Freud[21]; und diese «Zuversicht des Erfolges» scheint – noch mehr als die Lebensfreude – den Charakter des Mannes zu kennzeichnen, der als Krüppel zum Wettrennen um das höchste Staatsamt antrat und nach seinem Sieg dem amerikanischen Volk auf dem Tiefpunkt der Weltwirtschaftskrise zurief: Wir haben nichts zu fürchten außer der Furcht.[22]
Die Mutterliebe hatte jedoch ihre Schattenseite, die in einer Anekdote aus Saras Erinnerungen zum Ausdruck kommt. Eines Tages, Franklin war acht Jahre alt, «schien er sehr deprimiert zu sein […] und ließ sich von seiner Melancholie nicht abbringen. Schließlich […] fragte ich ihn, ob er unglücklich sei. Er […] antwortete sehr ernst: Ja, ich bin unglücklich. […] Dann machte er eine merkwürdige kleine, zugleich ungeduldige und flehentliche Geste […] und rief: Ach, Freiheit!»[23]
An Freiheit war jedoch unter dem wachsamen Auge Saras nicht zu denken, und so lernte der Junge frühzeitig, seine Gefühle und Gedanken für sich zu behalten und der Außenwelt immer ein angenehmes Gesicht zu präsentieren – eine Angewohnheit, die er als Erwachsener beibehielt und die ihm den Ruf der Unaufrichtigkeit – zumindest der Undurchsichtigkeit – eintrug. «Er hatte viele Menschen, mit denen er reden konnte», schrieb sein ältester Sohn James. «Was ihm in seinem Leben aber fehlte […], waren echte Vertraute. Es gehörte zu seiner rigiden Erziehung in Hyde Park, daß private, persönliche Angelegenheiten niemanden etwas angingen, mit keinem anderen Menschen zu besprechen seien. Auch sein Pfarrer […] sagte mir, daß es bei ihren Unterhaltungen nie um Vaters persönliche Trauer, Enttäuschungen oder Verletzungen ging.»[24]FDRs private Korrespondenz umfasst vier Bände mit fast 2800 Druckseiten, und doch findet sich darin kaum ein Wort, das tiefere Gefühle verrät.
Sara und die von ihr angestellten Gouvernanten taten alles, um den verrohenden Einfluss der Außenwelt von dem Jungen abzuhalten. Bis zum Alter von fünf Jahren trug er Mädchenkleider und lange Locken; und als er mit zwölf, wie bei Jungen seines Standes üblich, ins Internat gehen sollte, hielt seine Mutter den Gedanken an die Trennung nicht aus und setzte einen zweijährigen Aufschub durch. Bevor er 1896 in die Eliteschule Groton eingeschult wurde, hatte er nie ein Schulgebäude von innen gesehen – mit Ausnahme der Volksschule von Bad Nauheim in Hessen, die er 1891 während eines Kuraufenthalts der Eltern sechs Wochen lang besuchte. Ich gehe in die öffentliche Schule zusammen mit vielen kleinen Mickis [d.h. deutschen Kindern], schrieb der Neunjährige an zwei Delano-Vettern, und wir haben Lesen und Diktate auf deutsch, die Geschichte von Siegfried und Arithmetik […], und es gefällt mir sehr gut.[25]
«Die deutschen Wurzeln des Deutschenhassers»
So titelte 1995 eine deutsche Zeitschrift[26] – gegen den Willen der Autorin[27] – einen Artikel über die Beziehungen der Familien Delano und Roosevelt zu Deutschland. Offensichtlich wirkte noch ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Weltkriegs die nationalsozialistische Propaganda nach, der zufolge Roosevelt – so Reichspressechef Otto Dietrich – von «einem abgrundtiefen jüdischen Haß gegen Deutschland»[28] angetrieben wurde und, wie Hitler es formulierte, «seine einzige Aufgabe» darin sah, «die Feindschaft gegen Deutschland bis zum Kriegsausbruch zu steigern»[29].
Roosevelt war kein «Deutschenhasser». «Eins wußte ich jedenfalls, als ich das Arbeitszimmer […] verließ: dieser Mann ist bestimmt ein Freund des deutschen Volkes.»[30] So fasste der Sonderberichterstatter des «Berliner Lokal-Anzeigers» am 25. März 1933 – also nach der Machtergreifung Hitlers – seine Eindrücke nach einem Gespräch mit dem «Diktator der Vereinigten Staaten» zusammen. Auch im Krieg war Roosevelt bestrebt, zwischen den nationalsozialistisch-faschistischen Regierungen und ihren Völkern zu unterscheiden[31]. Gegenüber dem Verantwortlichen für psychologische Kriegführung kritisierte FDR den Versuch, nachzuweisen, daß die Deutschen als Nation seit tausend Jahren schon immer Barbaren gewesen seien. Das gehe ein bißchen zu weit. Stattdessen sollte man die moralische Verantwortung des deutschen Volks dafür betonen, daß es einer ganz und gar destruktiven Führung folgt – und die Schuld dieser Führer selbst.[32] In einem Brief an seinen Londoner Botschafter Joseph P. Kennedy, Vater des späteren Präsidenten John F. Kennedy, der nach dem Kriegsausbruch 1939 meinte, Deutschland werde entweder siegen oder im Falle einer Niederlage kommunistisch werden, hob FDR die positiven Seiten des deutschen Charakters hervor: [Die Deutschen] mögen zuweilen explodieren und Chaos haben, aber die seit Jahrhunderten wirksame deutsche Erziehung, ihr Bestehen auf der Unabhängigkeit des Familienlebens und dem Recht auf individuellen Besitzstand, würde meiner Meinung nach die russische Form der Brutalität auf Dauer nicht zulassen.[33] Und als sein Biograph Ernest Lindley behauptete, aufgrund seiner Familienbindungen neige Roosevelt zu einem probritischen und profranzösischen Standpunkt, kritisierte FDR Lindleys klägliche Geschichtskenntnisse und