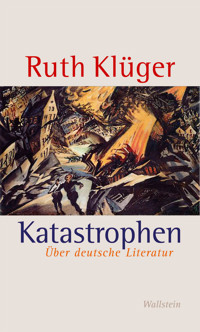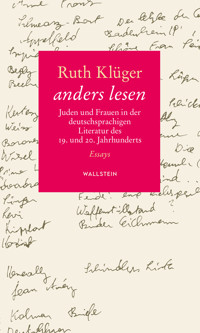Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Herausragende literaturwissenschaftliche Kompetenz in Verbindung mit Verve, Witz und großartiger Formulierungskunst. Ein originelles Vergnügen! »Die meiste Literatur, die ich kenne, ist von Männern. Lese ich sie anders? Ich meine schon. Aber wie denn?« Diese Frage bewegte die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Ruth Klüger von Anfang an. Antworten dazu gab sie selbst und veröffentlichte sie im Jahr 1996 erstmals unter dem Titel »Frauen lesen anders«. Wenn Klüger mit diesem Impetus Autoren wie Grimmelshausen, Goethe, Kleist, Stifter, Schnitzler und Kästner gegen den Strich liest, verbindet sie dabei literaturwissenschaftliche Kompetenz mit Verve, Witz und hoher Formulierungskunst. Die Zusammenstellung des Bandes wurde von Klüger selbst 1996 vorgenommen, dem folgt die vorliegende Ausgabe weitgehend. Zusätzlich aufgenommen wurde eine neuere bislang unveröffentlichte Untersuchung aus dem Nachlass: »›Das muss ein Mann mir sagen‹. Kleists Frauenbild«. Mit »Frauen lesen anders« werden die Essaybände von Ruth Klüger »Wer rechnet schon mit Lesern?« (2021) und »anders lesen. Frauen und Juden in der deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts« (2023) fortgesetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ruth Klüger
Frauen lesen anders
Essays
Herausgegeben von Gesa Dane
Allen amerikanischen Wiggies(Women in German) gewidmet
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2024
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Marion Wiebel, Wallstein Verlag
ISBN (Print) 978-3-8353-5668-9
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8688-4
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8689-1
Inhalt
Vorwort
Kind und Sklavin. Zur Frauenrolle im Unterhaltungsroman
Schnitzlers Therese – Ein Frauenroman
Korrupte Moral: Erich Kästners Kinderbücher
Frauen lesen anders
Goethes fehlende Väter
Die Hündin im Frauenstaat: Kleists Penthesilea
Die andere Hündin: Kleists Käthchen
»Das muss ein Mann mir sagen«.Kleists Frauenbild
Die Wahrheit des Chronisten. Laudatio auf Erich Hackl
Grimmelshausens weibliches Ich
Ehebruch in der heilen Welt. Stifters Das alte Siegel
Nachwort
Nachweise
Anmerkungen
Vorwort
Ob Frauen anders lesen? Ja, aber wie denn?
Wenn ich im Theater ein Stück sehe, das ich schon kenne, denke ich oft: Wie kann der (meist männliche) Regisseur den Text so verschieden von mir auffassen? Was reden denn diese Frauen in den klassischen Stücken so hochtrabend daher oder stehen so kleinmütig herum, wenn ihnen zum Beispiel Heinrich von Kleist doch das lebendige Wort in den Mund gelegt hat? Die Vielschichtigkeit der großen, oder auch nur der gelungenen, weiblichen Figuren erkenne ich schneller und besser, weil freudiger, als meine männlichen Kollegen in der Literaturwissenschaft. Und wundere mich oft, dass ihnen, den schreibenden und lesenden Männern nämlich, Goethe als Vaterfigur im Wege steht. Mit väterlicher Autorität ist doch gar nicht viel los bei ihm. Warum merkt das keiner?
Ich ärgere mich leichter als männliche Leser über die Trivialisierung und Stereotypisierung von Frauen, kein Wunder. Ich vermute, dass dahinter nicht nur eine gutgemeinte Verkennung meinesgleichen steckt, sondern auch gewisse Hoheitsansprüche, die mit Nationalismus und Herrenmenschentum zu tun haben. Denen kann man am besten in der einschlägigen Trivialliteratur nachgehen.
Erich Kästners Frauen haben mich schon als Kind geärgert, und aus den Sarkasmen, die er auf sie häufte, wenn sie nicht gerade als Mütter brauchbar für ihre Söhne waren, argwöhnte ich, dass es auch mit den moralischen Grundsätzen in seinen Kinderbüchern nicht weit her sein dürfte.
In Grimmelshausen, einen vom Krieg gebeutelten Macho hingegen, kann ich mich so leicht hineindenken, dass er es doch eigentlich auch mit mir können müsste. Meine Dankrede für den Grimmelshausen-Preis war ein Liebesangebot über die Jahrhunderte hinweg, wie ich es keinem anderen Dichter als diesem barocken Leidensgenossen und Kriegsgeschädigten machen würde.
Und wie lese ich die drei Österreicher, meine Landsleute sozusagen? Adalbert Stifter hat in seiner frühen Erzählung Der Condor, die von einer Ballonfahrt handelt, behauptet, »Das Weib erträgt den Himmel nicht«[1] – eine Feststellung, die ich mir jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug steige, seufzend wiederhole. Doch über den schwierigeren Machismo des reiferen Stifter lässt sich nicht so leicht lachen. Da liegen Probleme, die ideologisch verankert sind und biologisch gerechtfertigt werden. Arthur Schnitzler, auch er ein österreichischer Macho, macht es mir leichter. Denn er hatte nach und nach so viel über weibliche Lebensbedingungen gelernt, dass er in seinem Spätwerk Therese einen Menschen, der außerordentliches Pech hat, als Frau gestaltete. Erich Hackl, der dritte Österreicher, noch jung und sehr lebendig, vertritt für mich die Hoffnung, obwohl gerade er Frauen im Griff einer unnachgiebigen Staatsmacht schildert. Aber die Hoffnung, sagte mir einmal eine Freundin, liegt in unseren feministischen Söhnen. Darum habe ich so gerne eine Laudatio auf Erich Hackls Werk gehalten.
Der geneigten Leserin wird aufgefallen sein, dass es hier um Werke männlicher Schriftsteller geht. In diesem Buch kommen Autorinnen nur am Anfang – bei der Trivialliteratur – vor. Den Dichterinnen gebührt ein separates Buch. Die meiste Literatur, die ich kenne, ist von Männern. Lese ich sie anders? Ich meine schon. Aber wie denn?
Kind und Sklavin. Zur Frauenrolle im Unterhaltungsroman
In der Unterhaltungsliteratur des frühen 20. Jahrhunderts ist eine hartnäckige Tendenz spürbar, die Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft zu umreißen und festzulegen. Diese Tendenz soll hier anhand einiger Beispiele verfolgt werden. Außer dem Themenkreis, dem verhältnismäßig niedrigen literarischen Niveau und dem großen Publikumserfolg sind zunächst die Unterschiede dieser Romane augenfälliger als ihre Gemeinsamkeiten – Unterschiede in Art, Absicht und Background der Autoren bzw. Autorinnen. Nataly von Eschstruth war eine Hofdame, die ihre Romane gelegentlich keinem Geringeren als dem Kaiser widmete und gern einen den oberen Klassen angemessenen, gediegenen Patriotismus in sie einbaute. Hedwig Courths-Mahler begann hingegen als Dienstmädchen, schrieb mehr als zweihundert Romane, wurde durch ihre Schriftstellerei steinreich und hatte nach eigener Aussage keinen größeren Ehrgeiz, als »harmlose Märchen« für »einige sorglose Stunden«[1] zu verfassen. Bei ihr darf man also wohl von Büchern, die nach der Schablone gearbeitet sind, sprechen, während bei Agnes Günther, die nur einen Roman schrieb, das gerade Gegenteil zutrifft. Die Heilige und ihr Narr war auch insofern ihr Lebenswerk, als sie mit Einsatz aller ihrer Kräfte, noch in schwerer Krankheit und bis zum Tod daran arbeitete – mit einem Ernst, der von der Qualität des Hervorgebrachten ganz unabhängig war. Als sie 1911 starb, hinterließ sie mit den erst posthum veröffentlichten 750 Seiten ihres eigenartigen Schmökers einen der sensationellsten deutschen Bucherfolge. Er erreichte eine Millionenauflage; und noch nach 1957 fand es ein Verlag der Mühe wert, ein Fotobuch mit dem Titel Aus Agnes Günthers Wunderland herauszugeben.[2]
Trotz der Unterschiede zwischen eleganter Gesellschaftskritik bei der Eschstruth, verträumter Innerlichkeit bei der Günther und den kleinbürgerlich-hausbackenen, handlungsfrischen Wunschträumen der Courths-Mahler haben alle drei Autorinnen einen merkwürdigen Hang zur Verwendung von Mythologie und literarischen Leitmotiven. So ist zum Beispiel Eschstruths Die Bären von Hohen-Esp (1902) eine Parzivalerzählung, in der die Witwe eines früh verstorbenen Abenteurers ihren Sohn in weltfremder Einsamkeit auf dem Land erzieht. Er kommt als tumber Jüngling in die Hauptstadt, wird dort erst verspottet, erringt aber schließlich ein edles Weib und die Achtung der Welt. Die Autorin spricht selber ausdrücklich von Herzeloyde und Parzival, sodass dem Leser die Parallelen nicht entgehen können. Courths-Mahler, bei deren Leserkreis literarische Hochstapelei wohl ein vergeblicher Aufwand gewesen wäre, erzählt Einschichtiges, ohne direkten Hinweis auf die Mythologie, die ihr trotzdem oft als Vorlage dient. So bringt sie in Schweig still, mein Herz eine Orest-Hamlet-Handlung. Im Mittelpunkt steht ein Sohn, dessen Mutter unwissentlich den Mörder des Vaters geheiratet hat. Der Sohn lebt lange in der Verbannung (Amerika), von wo er ausschließlich mit der Schwester, die den Stiefvater hasst, Briefe wechselt. Reich geworden, kommt er zurück, rächt den Mord und befreit die Mutter.[3] Bei Agnes Günther tut sich ein wahrer Hexenkessel von Symbolen auf, besonders von naturpopularmystischen. Literarische Hinweise und Abwandlungen alter Themen von der Folklore bis zu Goethe sind bei ihr in solcher Hülle und Fülle zu haben, dass man damit mehrere dissertationshungrige Doktorkandidaten füttern könnte. Das Phänomen der Symbolik in der Trivialliteratur wäre in der Tat eine Untersuchung wert, die die positive Bewertung von Symbolik in eben genannten Romanen, wenn sie nicht mit anderen Maßstäben verbunden ist, zumindest in Frage stellen würde.
Auch Rudolf Herzog sah sich wohl nicht so sehr als Unterhaltungsschriftsteller wie als Erzieher der Nation. Man kann in seiner Geschichte Preußens (1913) nachlesen, wie ernst es ihm war, wenn er, wie in Die Stoltenkamps und ihre Frauen (1917), das Familienwohl mit dem staatlichen Interesse verband. Und über William von Simpson lässt sich jedenfalls sagen, dass er in dem Roman Das Erbe der Barrings (1937 erschienen, aber kein Nazibuch) den Verfall einer Familie mit ebenso emsiger Zähigkeit beschrieb, wie sie Thomas Mann bei ähnlicher Gelegenheit an den Tag legte.
Man kann also nicht behaupten, dass diese ganze, enorm vielgelesene und weitverbreitete Massenliteratur nur zynisch hergestellte Machwerke enthielte. Andererseits trifft es sicher zu, dass solche Bücher einen nicht geringen Einfluss auf den Inhalt der heutigen, nun wirklich ›am Fließband‹ hergestellten Heftchenromane und auch auf die Leihbibliothekenproduktion ausgeübt haben. Schon darum lohnt es sich, ihre Weltsicht und ihren Standort zu untersuchen.
Im Grunde handelt es sich um eine Sklavenliteratur. Besonders die Behandlung der Frau grenzt stellenweise nicht nur an Frauenfeindlichkeit, sondern überschreitet diese Grenze sogar. Mit Sklavenliteratur sind hier Bücher gemeint, in denen nur derjenige oder vielmehr diejenige ein sinnvolles Leben führen kann, die sich den bestehenden Machtverhältnissen anpasst und sich mit ihnen nicht nur abfindet, sondern ihnen auch mit Leib und Seele dient. Etwas davon steckt schon in den großen Schriftstellern des vorigen Jahrhunderts, Adalbert Stifter und Jeremias Gotthelf zum Beispiel; aber das ist eben ihre schwächste Seite. Doch gerade dieser Aspekt wird von den Unterhaltungsliteraten der späteren Epoche ausgebaut und aufgebauscht. Eine Sklavenmentalität wäre an sich legitimer literarischer Stoff, wenn die aus einer solchen Mentalität entspringenden Konflikte, Spannungen, Neurosen durchleuchtet und analysiert würden. Hier aber wird die Möglichkeit solcher Konflikte nicht bloß nicht zur Kenntnis genommen, sondern die ganze Problematik einer ›Selbstlosigkeit‹, die den Machthabern nicht zugutekommt, wird schlankweg verdächtigt. Die so entstandene Literatur speist wiederum den realen Verdrängungsprozess, sodass sich das krankhafte Resultat als das Schöne und Wahre zu geben vermag.
Die Traditionsgebundenheit dieser Literatur ist dermaßen stark, dass sie überhaupt nur solche Leser ansprechen kann, die sich mit dem Status quo abfinden müssen oder glauben, es zu müssen. Sie trägt zur Anpassungsfähigkeit der Minderberechtigten bei, und nur in diesem Sinne handelt es sich um Frauen-Romane. Denn ein vorurteilsloser Beobachter könnte doch wohl erwarten, dass diese Bücher das weibliche Leben mit liebevoller Sorgfalt und realistischen Einzelheiten beschreiben. Davon kann aber gar keine Rede sein. Vom Alltagsleben der Frauen wird nur sehr beschränkt gehandelt; Küche und Kinderzimmer, wo ja die Mehrzahl der Frauen ihre Lebensarbeit verrichten, sind nur selten der Schauplatz der Ereignisse. Schwangerschaften werden idealisiert oder ausgelassen; Kinder kommen in höchstens zwei Sätzen zur Welt, von denen anderthalb von der Aufregung des Vaters, ein weiterer halber von der Blässe der Mutter berichten. Einmal zur Welt gekommen, brauchen diese Wesen offenbar keine Windeln; denn die eigentliche Mühe der Kinderpflege wird ausgeklammert, während Männerarbeit stets betont wird. Menstruiert wird nie, nicht einmal andeutungsweise.
Was bleibt also übrig, wenn alles, was das Leben einer Frau ausmacht, hintangestellt wird? Vor allem mehr oder minder fantasievolle Abwandlungen der patriarchalischen Rangordnung. Fast immer denken und fühlen Mädchen und Frauen im Schatten eines Mannes oder von einem Mann geleitet. Wird eine Frau von einem Mann enttäuscht, so wird sie von einem anderen Mann getröstet. In den seltenen Fällen, wo Frauen untereinander sind, tauschen sie – wenn sie sich nicht gerade Eifersuchtsszenen liefern – entweder backfischhafte Dummheiten aus oder verhandeln über Junggesellen, die zu haben sind. Mit einer einzigen Ausnahme wird jede Unabhängigkeit als Charakterfehler bewertet und dementsprechend bestraft – meist durch Entziehung männlicher Gunst.
Diese Ausnahme bilden die Mütter, die womöglich (aber nicht unbedingt) verwitwet sind und für einen minderjährigen Sohn zu sorgen haben. Ihre Gestalt taucht wohl deshalb so häufig auf, weil sie eine gewisse Charaktererweiterung innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens erlaubt. Das Kind muss jedoch ein Sohn sein; Töchter gibt es nur als Nebenfiguren. Die Heldin beweist ihren höheren Wert durch männlichen Nachwuchs, der schon während der Schwangerschaft feststeht. Mit unfehlbarer Sicherheit sprechen die Eltern von ihrem ungeborenen Kind als »er«.
Dass Söhne besser als Töchter sind, ist zwar ein primitives und uraltes Vorurteil aller Kulturen. Bemerkenswert dürfte aber nicht bloß sein, dass es in der Trivialliteratur des 20. Jahrhunderts, in Romanen, die doch hauptsächlich für Frauen bestimmt sind, den Leserinnen brühwarm immer wieder aufgetischt wird. Auch die Art und Weise, in der das geschieht, verdient Beachtung. Der Vorteil der männlichen Nachkommenschaft ist nämlich vor allem in seinem Verhältnis zum Besitz zu suchen: Männer können ein Erbe antreten. So verschmelzen Mutterschaftsbereitschaft und Hochachtung für Besitz in Die Bären von Hohen-Esp:
›O du lieber Mann – ich habe nie darüber nachgedacht, wie schön es wohl sein müsse, die Mutter eines Sohnes zu sein, […] in der Burg deiner Väter, da überkommt es mich wie eine heiße, ehrfurchtsvolle Sehnsucht, wie eine jauchzende Begeisterung bei dem Gedanken, daß ich berufen sein möchte, diesem alten, trotzigen Bärengeschlecht einen Erben zu schenken, es fortzupflanzen in einem Sohn, welcher dereinst so edel, so ritterlich und herrlich sein wird, wie alle jene heldenhaften Männer.‹[4]
Dass es sich überhaupt um ein Heldengeschlecht handelt, ist nur durch das Bestehen des Grundbesitzes verbürgt; denn der Besitzer selbst, der Mann der Sprecherin, ist ein Spieler und Verschwender, der alles verliert, außer eben jene Stammburg.
Bei Agnes Günther lässt der Vater das Kind Rosemarie von Anfang an fühlen, dass sie nur ein armseliger Ersatz für einen Sohn ist, der das Fürstentum Brauneck erben könnte; und Rosemarie leidet auch unter dieser vermeintlichen Minderwertigkeit. Statt aber die nachteiligen Wirkungen einer solchen Behandlung in der Psyche des Kindes zu verfolgen, bewegt sich die Autorin im selben Fahrwasser. Rosemarie setzt nämlich später einen Sohn in die Welt. Durch ein kompliziertes gerichtliches Verfahren, das mit den Worten begrüßt wird: »›Rosemarie, wenn deine Söhne Herren von Brauneck würden!‹«[5], übernimmt das Kind Namen und Erbe seines Großvaters mütterlicherseits. Auf diese Weise wird Rosemarie sozusagen zum Sohn erhöht; denn die Brauneck’sche Linie pflanzt sich durch sie fort. Die patriarchalische Erbgeschichte wird mit unkritischer Genugtuung ausgemalt und als Erfüllung von Rosemaries Dasein dargestellt.
Mit der Verquickung von Frau, Eigentum und Heimat sind wir beim Kernproblem angekommen. Das Verhältnis Frau-Eigentum ist am leichtesten dort einzusehen, wo die Frau selbst als Eigentum gewertet wird. Selbständige Besitzerin kann sie nur dann werden, wenn sie die Ehe bereits hinter sich hat, also schon besessen worden ist. Bei der Eschstruth lässt sich das genau ablesen. Angesichts einer Verlobung heißt es: »›Ist es Wahrheit, hat Reimar es gewagt, Sie zum Eigentum zu begehren?‹«[6] Und an anderer Stelle: »›Ist denn das Frauenzimmer eigentlich Witwe, daß sie so allein in der Welt herumsegelt und so selbständig über derart große Summen […] verfügen kann?‹«[7] Was hier so unverblümt ausgedrückt wird, entspricht ganz einfach den wirtschaftlichen Tatsachen um 1900; es steht aber, gerade weil es nicht als kritische Aussage über den Sprecher aufzufassen ist, in scharfem, beinahe komischem Widerspruch zur Ritterlichkeit und Hofetikette, die das Lebenselement der Beteiligten sind.
Doch die Frau ist nicht nur Besitz, sondern fungiert auch als Bewahrerin bzw. Verschwenderin des Besitzes. Was aber ist Besitz? Dazu eine Stelle von Simpson:
›Dein Urgroßvater Barring […] hat uns Barrings mit unserem lieben Wiesenburg das Größte gegeben, was uns Menschen geschenkt werden kann, nämlich die Heimat, die niemand uns rauben kann […], und mit der gesicherten Heimat hat er uns als unsere vornehmste Aufgabe die Pflicht hinterlassen, den eigenen Herd, die ererbte Erde als höchstes Lebensgut zu hüten.‹[8]
Durch die Verwandlung von Privatbesitz in Heimat wird es zur patriotischen Tat, sein Eigentum zu vermehren. Reicher werden ist höchste Pflicht. In diesem Begriffskreis haben die Frauen ihren Platz: »›Daß wir das konnten, das verdanken wir zum großen Teil der hingebenden und selbstlosen Hilfe unserer Frauen.‹«[9] Und schließlich: »›Wiesenburg ist dankbar. Es läßt einen nicht im Stich, wenn man selbst ihm die Treue hält.‹«[10]
Im letzten Zitat ist das Gut selbst zum Lebewesen erhöht. Wirtschaftliche Tüchtigkeit hat sich in Treue verwandelt. Auf Frauen angewendet, ist es nur noch ein Schritt von solcher Treue zur ehelichen Treue. Er führt den Leser sachte zu der Einteilung von Frauen in zwei Gruppen: die guten, die den Besitz zusammenhalten und dementsprechend treu sind; und die bösen, die das Geld verschwenden und in assoziativ-unlogischer Folge schlechte Mütter und untreue oder gefährlich-sinnliche Gattinnen sind. Aber zuerst kommt das Geld; alles andere folgt aus dem mangelnden Verständnis fürs Eigentum.
Die Barrings sind ein vorzügliches, doch zugleich recht typisches Beispiel. Die eigentliche Handlung des Buches besteht im allmählichen Verlust eines preußischen Guts durch ein verschwenderisches Weib. Eine geschichtlich-symbolische Bedeutung gewinnt dieser Vorgang durch die persönliche Beziehung des alten Barring zu Bismarck. Eingeschobene Tagebuchstellen handeln von Politik und Vorgängen in der Hauptstadt: Wiesenburg ist in jeder Beziehung ein Stück Deutschland. Die Schuld der Frau besteht von Anfang an einfach darin, dass sie keinen Sinn für Immobilien hat. Am Ende des Romans wird sie Wiesenburg verkaufen; vorher aber macht sie nicht nur Schulden, sondern begeht noch alle erdenklichen Schlechtigkeiten, vernachlässigt ihre Kinder und ist grausam zu ihnen, ja quält am Ende sogar Tiere. Eine Szene, in der sie einen kranken, alten Hund an den Ohren zieht, passt keineswegs in das Charakterbild, das anfänglich von ihr entworfen wurde. Es passt nur in das Bild des bösen Weibs, das die Heimat verrät. Um das Schuldenmachen als gehörig unpatriotische Tat darzustellen, muss Gerda immer verabscheuungswürdiger werden, auch wenn ihre Schandtaten in unerklärtem Widerspruch zu ihrer adligen Erziehung stehen. Häufig spricht der Autor mit frauenfeindlicher Verachtung von ihren Evaskünsten, ihrer weiblichen Schlauheit und der seelenlosen Sinnlichkeit, womit sie ihren Mann stets aufs Neue bestrickt. Dass eine erotisch erfüllte Ehe ja glücklich genannt werden könnte, wird weder von Simpson noch von den anderen Autoren auch nur in Betracht gezogen.
Bei Agnes Günther gibt es ebenfalls ein böses Weib, dessen Haupteigenschaften der Hang zur Verschwendung und Pietätlosigkeit gegenüber alten Schlössern sind. Sie vergeht sich an der Tradition, indem sie moderne Möbel haben möchte, sich nach Zentralheizung in Berlin sehnt, ein Auto kaufen will und sich nicht über reiche Amerikaner entsetzt. Daraus folgt alles andere: Sie ist eine schlechte Ehefrau, sie ist unfähig, Mutter zu werden – man könnte von genetisch-moralischen Gründen sprechen –, quält ihre Stieftochter und versteigt sich am Ende sogar zu einem Mordanschlag. Bei alldem wird ihre Einstellung zum Besitz nie außer Acht gelassen.
Diese bösen Frauen verkörpern nicht einfach den Typ der Mondänen. Vielmehr geht es in allen Fällen um die Frau, die sich nicht unterwerfen will, ihrem eigenen Geschmack und Geltungsbedürfnis folgt – kurz, nach Unabhängigkeit sucht. Rudolf Herzog macht das am deutlichsten. Der Privatbesitz, den auch dieser Autor mit der Heimat gleichsetzt, ist hier nicht mehr deutscher Boden, sondern es sind deutsche Fabriken. Herzogs Helden werden vom Erfolgsethos bestimmt, und sie tun eigentlich ihr Leben lang nichts anderes, als ihren industriellen Privatbesitz zu erweitern. Diese Lebensaufgabe wird selbstverständlich stark überhöht und ins Ideal-Patriotische umfunktioniert. Ein Beispiel liefert der Roman Die Stoltenkamps und ihre Frauen, der von der Entwicklung der deutschen Stahlwerke im 19. und frühen 20. Jahrhundert handelt. Das Buch schließt mit der Rolle der Stahlwerke im Ersten Weltkrieg, d. h. mit der nationalen Rechtfertigung einer Privatindustrie. Wenn der Held demnach Besitzer und Verwalter der Heimat ist, so sind diejenigen, die sich weigern mitzumachen, Verräter am Vaterland und dürfen dementsprechend als Gesindel dargestellt werden.
In Herzogs Romanwelt ist der Held umgeben von treuen Frauen, treuen Freunden und treuen Arbeitern und Mitarbeitern. Er steht nicht nur im Mittelpunkt des Geschehens, sondern auch im Mittelpunkt dieser anderen Leben, die ihre Daseinsberechtigung nur durch ihre Bemühungen um ihn und sein Werk empfangen. Diese Entwertung aller Existenzen außer seiner eigenen wird bei den weiblichen Gestalten am weitesten getrieben und lässt sich durch die analoge Stellung von Frau und Arbeiter verdeutlichen.
Zwar behauptet Herzog, sich die Verherrlichung der Arbeit zum Thema gemacht zu haben, und schreibt Paradesätze wie: »›Ein andrer Adel kommt herauf. Der Adel der Arbeit‹«[11]; aber in Wirklichkeit schreibt er über die Machtverhältnisse in Fabrik und Familie. Die Unterwürfigkeit, die er von den Arbeitnehmern gegenüber ihren Arbeitgebern fordert, betont er schon dadurch, dass er letztere die »›Herrn‹«[12] nennt. Der gute Arbeiter ist wie ein gut trainiertes Pferd – ein Vergleich, der einem älteren Arbeiter in den Mund gelegt wird. Er scheint dazu berufen, dem jungen Stoltenkamp Reitstunden zu geben: »›Der Schenkeldruck muß sein, wegen Erzielung des Respektes.‹«[13] Wer sich diesem Schenkeldruck entzieht, sich etwa einer Gewerkschaft anschließt, ist von Eigensucht besessen. Revolutionen sind verpönt, sogar solche, die so weit in der Vergangenheit liegen, dass eine halbwegs positive Beurteilung der konservativen Grundhaltung nicht schaden könnte. Doch 1848 »unterbrach die Arbeit, drohte mit dem Verlust des Gewerbefleißes und der Schaffensfreude«[14].
Selbstverständlich geht derlei nicht ohne Widersprüche ab. Denn was schuldet der Herr dem Untergebenen? Hier ist die Antwort:
[D]ie ganze Kraft des Angestellten gehört dem Hause, dem er sich verpflichtet hatte. Das Haus aber […] hatte einen jeden Angestellten so zu stellen, daß der Wert seiner Arbeit in der Bemessung des Lohnes unbedingt seinen Ausdruck fand.[15]
Unbedingt? Laut Herzog kann der Wert der Arbeit gar nicht durch Geld ausgedrückt werden. Der gute Mensch arbeitet um der Sache, nicht um des Lohnes willen. Ausdrücklich führt Herzog die Gestalt Max Schlechtendahls ein, der einfach seinen materiellen Lebensstandard durch den Gewinn aus seiner Arbeit aufbessern will und dessen Motive daher minderwertig sind.[16] Der Arbeiter beweist seinen guten Charakter also einerseits dadurch, dass er in seinem – von ihm nicht mitbestimmten – Lohn das Äquivalent seiner Arbeit sieht, andererseits aber dadurch, dass er Lohn und Arbeit gar nicht aufeinander bezieht, sondern die Sache selbst, also vermutlich den Schenkeldruck des Fabrikherrn, genießt.
Soweit die Arbeiter; und nun die Frauen. Der alte Stoltenkamp stirbt mit den bezeichnenden Worten: »›Ich hatte die rechte Frau, die nicht fragte und immer nur glaubte. Das hat – so gut getan.‹«[17] Die Witwe ist jung; Fritz, ihr Ältester, ist sechzehn. Sie hat fortan kein weiteres Bedürfnis, als für ihn und die Firma zu leben. Ähnlich wie der oben zitierte Arbeiter hebt sie selbst ihre Unterwerfung hervor, die somit als gültig ausgewiesen wird. Zu ihrem halbwüchsigen Sohn sagt sie: »›Ich bin und bleibe deine Mutter, aber du wirst von heute an das Familienoberhaupt sein.‹«[18] Der Verfasser betont die freiwillige Wahl eines Daseins, das unbefangenen Lesern bedrückend erscheinen muss, indem er andeutet, aber nicht ausführt, dass die Mutter in den ersten Jahren ihrer Witwenschaft noch Heiratsmöglichkeiten hatte.[19] Gezeigt wird sie jedoch nur in ihrer totalen Hingabe an den Sohn und dessen Arbeit. Nicht etwa, dass sie sich einen Teil dieser Arbeit aneignete, also ein selbständiges Interesse daran gewänne. Die Entschädigung kommt ihr nur indirekt und stellvertretend durch Fritz, und sie verallgemeinert diese Zufriedenheit, wenn sie sagt:
›[E]in schöneres und freundlicheres Leben kannst du einer Frau gar nicht schaffen, als du es deiner Mutter schaffst. Teilnehmen können an den Sorgen und Mühen des Menschen, den man liebt, ihm davon abnehmen, ihn darüber hinwegbringen und sehen dürfen, wie es sich lohnt in den Erfolgen des geliebten Menschen.‹[20]
Der geliebte Mensch ist natürlich immer der Mann, während die Frau für die Hilfsaktion bestimmt ist.
Frau Stoltenkamp führt also die Geschäftsbücher für ihren Sohn; »›Denn wir Stoltenkampfrauen müssen für unsere Männer zu schaffen haben, um uns zur rechten Fröhlichkeit durchzuarbeiten.‹«[21] Aber nur sie, die Mutter, hat das Recht, als Priesterin im Allerheiligsten, nämlich beim deutschen Stahl, zu wachen. Ansonsten verwendet Herzog viel Tinte auf die Ausklammerung von Frauen aus dem männlichen Bereich. Zeigt etwa eine Schwester Interesse fürs Geschäft, so wird ihr bedeutet: »›Aber ein Stoltenkampmädchen hat in die Arbeit der Brüder nicht hineinzureden.‹«[22] Als sie es trotzdem tut, zahlt Fritz sie aus und geht dann »als alleiniger Herr und Meister«[23] durch das Stahlwerk.
Diese in kindischer Formulierung ausgedrückte Geschwisterrivalität macht stutzen; denn der Infantilismus ist hier mit Händen zu greifen. Man wird sich allmählich bewusst, dass die völlige Befriedigung durch ein Ersatzleben in der zweiten Generation bei Herzogs Müttergestalten auch in der Sprache des Wunschlebens kleiner Jungen ausgedrückt werden kann: ›Wozu braucht die Mutti einen Mann? Sie hat ja mich.‹ Bestürzend ist nur, dass solche Produkte einer unentwickelten männlichen Psyche sich als Idealgestalten der weiblichen Rolle in Gesellschaft und Familie anbieten.
Auf noch kindischerem Niveau ist die Titelgestalt in Herzogs Die Buben der Frau Opterberg (1921) konzipiert. Frau Opterberg begegnet uns zuerst an der Rheinquelle, wohin sie mit Sohn und Adoptivsohn gewandert ist. Der Vater ist zwar nicht tot, wie in den Stoltenkamps, aber er ist ein künstlerisch veranlagter Schwächling. Das erlaubt dem Verfasser, das Schwergewicht wieder auf die Mutter-Sohn-Beziehung zu verlagern. Mit symbolischem Nachdruck wird die Mutter öfter als »Quelle«[24] bezeichnet und mit dem Rhein identifiziert. Als Deutschlandfigur fließt sie über von patriotischen Lehren und Maximen, hat aber kein Eigenleben, ist selbst völlig konflikt- und anspruchslos, nur immer hilfsbereit den Kindern gegenüber und in ihrer überlegenen Heiterkeit immer im Recht. Da sie zugleich eine allegorische und eine realistische Gestalt sein soll, spricht sie eine Sprache, die das Amorphe und Infantile des Inhalts in einem ungrammatischen, alltagsfernen Idiom wiedergibt:
›Da seht! Da seht! Da springt der Rhein von der Mutterbrust. […] So sollt auch ihr jugendstürmisch springen und brausen […] und auch ab und an von der Bildfläche verschwinden, um eure Kräfte zu sammeln und als Mann hervorzutreten.‹[25]
Die Jungen sind die einzigen Kameraden, die diese Mutter braucht. Wenn der Sohn aber später heiratet, so ändert sich die Sache, und die Gattin hat sich ausschließlich um ihren Mann zu kümmern. Denn die richtige Gattin, nach Frau Christiane Opterberg, ist »›der getreue Kamerad in gleichem Schritt und Tritt‹« – wobei dahingestellt bleibt, wer dabei das Marschtempo angibt. Die ideale Mutter, die sich, wie gesagt, im Verlauf des Romans recht wenig um ihren Mann gekümmert hat, um dem unfreiwillig infantilen Geltungsbedürfnis ihres Sohnes zu genügen, fährt fort, die ideale Frau auszumalen:
›Aber das Herz muß sie auf dem rechten Fleck haben, besonders wenn’s der Mann gerad beansprucht […]. Und den Verstand muß sie an der rechten Stell’ haben, daß sie an allem ihren Anteil nehmen kann, was des Mannes Wesen und geistiges Leben ausmacht, ohne aber, daß sie nun gleich als die Belehrerin und Besserwisserin auftreten will, denn dann wär’ ja für den Mann die Freud’ des Starken dahin.‹[26]
Man mag einwenden, dass es eine recht gebrechliche Psyche ist, die solche Stärkung benötigt; auch fragt man sich umsonst, was denn geschehen soll, wenn die Frau nun wirklich etwas besser weiß als der Mann. In dieselbe Kategorie von Ansprüchen fällt die Forderung, dass die Frau zwar hübsch sein soll, aber nur für ihren Mann. Anweisungen, wie dies anzustellen ist, werden nicht gegeben.
Der Sucht, die Rolle der Frau immer neu zu fixieren, liegt meines Erachtens ein tiefgehendes Misstrauen gegen Frauen zugrunde, das der Männerangst in Agnes Günthers Roman, von der noch zu reden sein wird, entspricht. Bei Herzogs bösen Frauen offenbart sich dieses Misstrauen in der Furcht, sie könnten den Männern etwas wegnehmen und damit den Besitz, der ja für das männliche Ich dieser Romane so bedeutend ist, verringern und beschädigen. Daher führt ein schnurgerader Weg von der Verschwenderin zur Ehebrecherin. Für Männer, die Geld verschwenden, etwa leichtsinnige Brüder, wird dem Leser immer noch etwas Sympathie abgefordert. Denn bei ihnen ist es unwichtig, ob sie dienen oder nicht. Die sinnliche Frau dagegen ist eine Gefährdung des Helden, da sie ein selbständiges Gefühlsleben hat. Wenn sie nun noch obendrein das gemeinsame Eigentum als solches, nämlich als auch ihr gehörend betrachtet, so ist die Reiter-Pferd-Beziehung schwer gestört.
Die jüngere Frau Opterberg ist eine solche Frau, die nicht dienen will. Um das folgende Zitat richtig zu bewerten, muss man sich darüber klar sein, dass ihr Mann, ein Ingenieur, seine Lebensaufgabe in seinem Privatgeschäft sieht, das uns der Autor ohne einleuchtenden Grund als einen höheren Lebenszweck darstellt. Dies sind die Worte, die er zu seiner Frau Sabine sagt:
›Du aber tust, als ob die Bedeutung von Lebensaufgaben nur darin bestände, möglichst viel Geld für die eigene werte Persönlichkeit herauszuschlagen, komm’ nachher, was da wolle. Ich möchte dir als meiner Frau mehr Ernst für meine Angelegenheiten anempfehlen.‹
Ihr Vergehen besteht also in der Verweigerung von völliger Selbstaufgabe. Indem der Autor und sein Held ihr die Sklavennatur absprechen, sprechen sie ihr auch die Weiblichkeit ab:
›Ich hoffe ja noch immer, daß es nur der rechten Stunde bedarf, um dich zu deiner wahren Bestimmung hinzuleiten. Die seh’ ich aber nur in deiner Eigenschaft als Gattin und Mutter.‹[27]
In der ganzen Auseinandersetzung verwendet der Mann die Argumente und Ausdrücke des reinen Egoismus, um der Frau ebendiesen Vorwurf des Egoismus zu machen. Der Verfasser aber steht fest und ohne Ironie auf der Seite seines gerecht entrüsteten Helden. Sabine macht ihren Mann darauf aufmerksam, dass er ihr keine »›eheliche Untreu’‹« nachweisen könne. Darauf fängt der Mann zu brüllen an (was Herzog mit »donnern« bezeichnet, vermutlich, damit sich der Leser nicht auf die falsche, d. h. weibliche Seite schlägt). »›Sprich das Wort nicht aus!‹, donnert also Martin Opterberg. ›Pfui Teufel, wer gibt dir solche Marktweiberausdrücke in den Mund?‹«[28] Warum die Aufregung über das Wort »Untreue«, noch dazu in einem Buch, das nach dem Ersten Weltkrieg entstand? Kaum wegen der ja nicht vorhandenen Unanständigkeit; eher wohl deshalb, weil das Thema ›Erotik‹ gefährlich ist in dieser mutterbezogenen und doch frauenfeindlichen puerilen Welt.
Den Gipfel ihrer Bosheit und Unweiblichkeit erreicht Sabine, wenn sie Skepsis bei der Aussicht auf Mutterfreuden zeigt. Denn um das Maß des ehelichen Ungehorsams vollzumachen, äußert sie den Wunsch oder die Meinung, dass man die Sache noch aufschieben könne. Dabei drückt sie sich so aus, als hätte sie ein Recht zu einer solchen Entscheidung, und besiegelt damit endgültig ihr Schicksal im Roman. Sie sagt sich nämlich deutlich von der Sklavenrolle los: »›Ich denk gar nicht daran, meine Freiheit dranzugeben‹«[29]. Von Freiheit, besonders von deutscher Freiheit, wie auch von Männerfreiheit, ist bei Herzog oft die Rede. Aber eine Frau, die Freiheit beansprucht, hat dadurch von vornherein die Sympathien von Autor und gehorsamem Leser verwirkt. Der Held hat von nun an das Recht, sich scheiden zu lassen – was er auch wenige Seiten später tut, nachdem er die Frau als Ehebrecherin ertappt hat.
Die wahre Liebe kommt erst mit Martin Opterbergs zweiter Verlobung, bei der die Braut »Haltet aus im Sturmgebraus« zur Laute singt. Die Puerilität wird ins Nationalistische sublimiert: Die verpfuschte sinnliche Ehe ist wie der verlorene Krieg, die neue keusche Liebe ist die Wiedergeburt Deutschlands. »So feierte Martin Opterberg den Friedensvertrag von Versailles, der ein atemlos gewordenes Volk mitten ins Gesicht schlug.«[30] Bei dieser Feier »spürte er aus grauen, altgermanischen Tagen das Blut der Voreltern in sich wogen«[31]. Kein Wunder, dass in dieser jugendbewussten Welt die Sexualität von Erwachsenen keinen Platz hat. Die neue Frau Opterberg ist anspruchslos und steht unter dem Einfluss ihrer Schwiegermutter. Hier sei nebenbei bemerkt, dass Karl Mays Romane einerseits die Antithese der Familienromane darstellen, andererseits aber auch die Erfüllung der eben beschriebenen Tendenz: Sie bieten den Eskapismus in ein reines Männerreich, in dem die Helden ein von Frauen ungestörtes Junggesellenleben führen. Statt Familienbindungen gibt es in ihnen nur Freundschaft und Seelenbrüderschaft. Karl May ist Deutschlands Beitrag zum Traum von der frauenlosen Welt.
Das weibliche Gegenstück zum infantilen Wunschbild der mütterlichen Geliebten und unterwürfigen Frau bildet die Flucht in die erotisch unterbaute Innerlichkeit. Die Heilige und ihr Narr ist vor allem eine Verherrlichung von sexuellen Verdrängungen, sozusagen ein Hohelied der Repression. Auf Hunderten von Seiten geschieht erstaunlich wenig. Der ungeheure Erfolg des Romans ist daher nicht im Spannungsmoment zu suchen, sondern eher in der glanzbildartigen Erfüllung oder Verkörperung von recht komplexen Wunschträumen. Das Buch handelt von einer Prinzessin, Rosemarie von Brauneck, die wir zuerst als missverstandenes, stark introvertiertes Kind kennenlernen. Sie wird von ihrer Umgebung für schwachsinnig gehalten, leidet aber eigentlich nur an einer Art säkularisierter Heiligkeit (zweites Gesicht), an der Ausbeutung durch dickfellige Diener und an der Taktlosigkeit ihrer Verwandten. Von ihrem Verehrer und späteren Gatten, dem Grafen Harro von Thorstein, wird sie »Seelchen«[32] genannt; und fast der halbe Roman vergeht, bevor sie ihren richtigen Namen bekommt. Ihre literarischen Vorgängerinnen, auf die direkt und indirekt angespielt wird, sind unter anderem Mignon, Iphigenie, Ottilie. Als schöne Seele im Diminutiv entwickelt sie ihre Fähigkeit zum verklärten Leiden, ein Talent, das ohne Angst vor Konkurrenz mit der Männerwelt ausgeübt werden kann. Es ist kein geringes Kunststück, ein schönes, adliges, reiches und obendrein von einem edlen Grafen geliebtes Mädchen als Opfer darzustellen; aber es gelingt. Die Hauptvertreterin der feindlichen Welt, an der Rosemarie so konsequent leidet, ist die schon erwähnte Stiefmutter. Der Konflikt der beiden Frauen enthält unter anderem die Ablehnung des Industriezeitalters, das ja auch den Heimatromanen ihr Gepräge gibt. Rosemaries Vater hat das kostspielige Hobby, alte Schlösser zu restaurieren, was die Autorin immer billigt, während sie die Modernisierungsversuche seiner Frau als Verschwendung anprangert.
Im Zusammenhang mit dem Pochen auf traditionelles Blut-und-Bodentum bricht auch die reaktionäre Grundhaltung dieses scheinbar so unpolitischen Romans durch die humanitäre Oberfläche. Der verborgene Menschenhass, der in dieser ganzen Literatur sein Wesen treibt, platzt heraus:
›Es gibt in jedem Stand vornehme Seelen, – wobei ich allerdings sagen muß, daß mir unter der modernen Arbeiterbevölkerung, so wie sie sich jetzt in großen Städten herumtreibt, noch nie eine begegnet ist.‹[33]
Bei einem Besuch in Berlin denkt die sanfte Rosemarie über die Passanten auf der Straße: »›Das sind gar keine Menschen, das sind nur Schemen und Schatten.‹«[34] Bei einem Besuch in Italien kommt ein hungerndes italienisches Kind zu ihr, dem sie lächelnd zu essen gibt. Das Kind spricht »Kauderwelsch«[35], und als es ein deutsches Wort wiederholt, ist es, »fast als ob ein Tier zu reden anfinge«[36].
Nach ausgiebigem frühen Leiden heiraten Rosemarie und Harro. Harro hat aber seinem Schwiegervater versprochen, die Ehe noch nicht zu vollziehen, weil Rosemarie noch zu jung ist. Rosemarie und der Leser sind von diesem Arrangement leider nicht unterrichtet. Zur Hochzeitsnacht werden ein paar alte Tanten eingeladen, die die Braut zu Bett bringen, während der Bräutigam sich in sein Atelier – er ist unter anderem Maler – zurückzieht. Diese Szene ist komisches Zwischenspiel; man scherzt diskret über nackte Tanten. Obwohl Rosemarie ein erwachsener Mensch ist, merkt sie keineswegs, dass etwas nicht stimmt. Nachdem dann einige Zeit vergangen ist, erfolgt ein Auftritt, der einen raffiniert pornographischen Kitzel für die Höhere-Töchter-Mentalität enthält. Harro kommt nämlich nicht weiter mit dem Bild, an dem er arbeitet, weil ihm das richtige Modell fehlt. Um ihm auszuhelfen, opfert sich seine jungfräuliche Frau und dient ihm als Akt, sodass er sie als nackte Fee malen kann, neben dem heimatlichen, sagenumsponnenen Brunnen.[37] Die Situation erlaubt Rosemarie, zugleich schamlos und rein zu erscheinen. Wenn sich die Tochter aus gutem Hause nur mit schlechtem Gewissen in ein gefallenes Mädchen hineinzuträumen wagt, so darf sie es guten Gewissens bei dieser all ihre Reize bloßstellenden Prinzessin tun, besonders da es sich ja um einen symbolischen Vollzug der Ehe handelt. Die Symbolik hat den Vorteil, dass sie der Wirklichkeit des Geschlechtsaktes weiterhin ausweicht, sich also mit neurotisch-erotischen Mädchenträumen deckt. Und doch wird der Mann befriedigt, da seine Frau ihn selbstverständlich zu seinem besten Gemälde inspiriert.
Schließlich erfährt Seelchen aber doch, dass ihrer Ehe etwas abgeht. In ihre ahnungslose Reinheit fällt der Bericht einer Magd über ein uneheliches Kind, und nun kommt Rosemarie endlich auf den Gedanken, dass sie im landläufigen Sinne nicht verheiratet ist. Sie läuft zu ihrem Mann, und es entspinnt sich folgendes Gespräch:
›Du mußt keinen Schleier mehr darüber werfen, Harro. Sag mir, Harro, sag mir, warum bin ich nicht deine Frau? Ist etwas an mir, daß ich es nicht sein könnte?‹ Harro erschrak heftig: ›Du hast doch die Gedanken nicht schon lange mit dir herumgetragen! Ich bitte dich, das wäre mir furchtbar. Meine Rose, meine arme Rose! Nein, es ist alles so einfach! Du bist noch zu jung, du solltest noch geschont werden.‹[38]
Sie ist zwanzig.
Das Gegenstück zu Herzogs böser Frau, die noch keine Kinder haben will, ist Günthers gute Frau, die noch keine Kinder haben soll und von braven Männern geschont wird. Man sollte hier wohl auch an die begründete Angst unserer Großmütter vor dem Kindbett erinnern. Die Todesmöglichkeit, mit der sich damals noch jede schwangere Frau auseinandersetzen musste, spielt gewiss eine Rolle bei der Behandlung dieses Themas. Bei Agnes Günther wird die Angst in ein Mysterium umgedeutet, ist aber zumindest vorhanden, während Herzog die Gefahren der Schwangerschaft völlig ignoriert oder in einen Vorwurf gegen die Frau verwandelt.
Mit Infantilismus hängt es auch zusammen, wenn der eigentliche und einzige Konflikt des Buches unter Frauen stattfindet und darin besteht, dass die ältere Frau der jüngeren erotisch-symbolischen Schaden zufügt; so verbrennt sie ihr zum Beispiel am Hochzeitstag den Arm. Aggressive Männer gibt es in dem Buch nicht, aggressiv ist nur die böse Frau. Man darf das wohl als Verschiebung pueril-weiblicher Angstvorstellungen ansprechen. Wer sich vor Männern fürchtet, den wird ein solches Buch beruhigen; denn sowohl Vater wie Gatte wirken einerseits stereotyp maskulin, andererseits aber auch unvollständig, in ihrem Gefühlsleben gehemmt, unerwachsen. Die Männer sind kräftig, energisch und Tatmenschen: Harro ist nicht nur Künstler, sondern auch Offizier, Baumeister und ein Hüne von Gestalt, sein Schwiegervater ist »›Grand Seigneur, sehr sogar‹«[39]. Sie wirken also nicht kastriert, um einem Klischee vorzubeugen; sie können vielmehr durchaus Hingabe und Diensteifer von ihren Frauen erwarten. Eher ließe sich von einer Verharmlosung der aggressiven Potenz des Y-Chromosoms sprechen. Die Männer bedrohen die Leserinnen nicht, weder durch Kampflust unter sich – es kämpfen, wie gesagt, nur die Frauen – noch durch Zudringlichkeit dem anderen Geschlecht gegenüber, wie ja aus der soeben nacherzählten Hochzeitsgeschichte hervorgeht. Sie sind Beschützer, und besonders Harro wirkt manchmal wie ein gut abgerichteter Schäferhund. Bezeichnend ist auch, dass in dem langen ersten Teil des Romans das Verhältnis des Paares das eines Kindes zu einem Erwachsenen ist, sich also frei von erotischer Spannung abspielt, aber trotzdem bereits einer romantisch-innerlichen Verlobung gleichkommt.
Im Gegensatz zu Günther verbindet Herzog den männlichen Tätigkeitsdrang mit aggressivem Benehmen. Der Triumph der Stahlwerke am Ende der Stoltenkamps ist schon im ersten Satz des Romans vorbereitet: »Die Faust des Vierzehnjährigen saß dem scheltenden Mann mitten zwischen den Augen.«[40] Diese Handlung wird mit den schlichten Worten bewertet: »›Auf dich ist Verlaß, Fritz.‹«[41]
In der Verarbeitung des Aggressionsprinzips fällt demnach der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Autoren auf. Denn Agnes Günther steht nicht allein. Bei den anderen Autorinnen sind die Männer ebenfalls nicht sehr leidenschaftlich und, wenigstens in ihrem Verhalten zu anderen Menschen, auch nicht draufgängerisch oder abenteuerlustig; sie sind also eigentlich nicht als konventionelle Liebesobjekte für die Leserin konzipiert. Zwar erscheinen die Helden der Eschstruth als schneidige Offiziere und die der Courths-Mahler als energische Unternehmer im Sattel und am Steuer; aber sie sind nie Männer, die an die Phantasie oder gar an erotische Phantasie appellieren. Wenn dennoch ein leidenschaftlicher Mann auftritt, so ist er Ausländer mit Zigeunerallüren und mithin ein Mensch, vor dem man sich als Mädchen hüten muss.
Mir scheint, dass diese vorwiegend nicht-erotisch aktiven Helden Komplementärfiguren zu den Beschränkungen des Mädchenlebens darstellen. Sie ergänzen in ihrer Handlungsfreiheit die Armseligkeit des Frauendaseins, das seinerseits der Leserin nicht genug Spielraum zur Einfühlung vermittelt. Wie bei Hermann Hesse die Frauen oft als Ergänzung der Männerpsychen gemeint sind, nicht als eigenständig, sondern als Projektionen, so wird hier vielleicht umgekehrt den männlichen Gestalten eine Funktion der weiblichen Psyche zugewiesen. Je passiver die Frau wirkt, desto aktiver muss der Mann erscheinen, um einen Ausgleich zu schaffen und der Leserin denn doch zu bieten, was sie sich als Mensch, insbesondere als junger Mensch, wünscht, aber in den Frauengestalten nicht wünschen darf: nämlich Ehrgeiz, Freiheit, Mut und Bewegung.
Man kann das am Reitsport erläutern, der von jeher eine aristokratische Betätigung für beide Geschlechter gewesen ist. In Eschstruths Romanen spielt er daher eine große Rolle. Nun erhebt sich freilich die schwierige Frage: Wie gut darf ein Mädchen reiten? Offensichtlich nicht zu gut. Hier, wie anderswo, darf sie an Weiblichkeit nicht einbüßen, was sie an sonstigen Vorzügen gewinnt. Wer gut reitet, macht einen kräftigen, ja dominierenden Eindruck; Frauen aber haben schwach zu sein, wenn sie nicht gerade das Vermögen der Männer verwalten. In den Bären von Hohen-Esp muss am Anfang des Romans ein junges Mädchen zugleich stark und schwach wirken; denn sie wird später eine solche mütterliche Verwalterin, darf dabei aber nichts an Passivität, dem vorgeschriebenen Merkmal der Weiblichkeit, verlieren. So wird sie uns mit einem Pferd vorgestellt, und die Beschreibung lautet:
›Jenes kraftvoll schöne Mädchen, welches wie eine Walküre das scheuende Pferd bändigt, ist doch nur ein schwaches, liebendes, demütiges und unendlich sanftes Weib.‹[42]
Ein merkwürdiges Sowohl-Als auch. Vor allem muss die Frau aber ohne jeden sportlichen Ehrgeiz sein. Sie darf zwar gut reiten, soll es sogar, wie sie auch schön sein darf und soll; aber das eine wie das andere darf sie weder wissen noch wollen. Da die Leserin beides sowohl weiß als auch will, wird hier als exemplarisches Benehmen eine Heuchelei vorgeschlagen, für die sich Gegenbeispiele in der analogen Knaben- oder der hauptsächlich für Männer bestimmten Kriegsliteratur wohl schwerlich finden ließen.
Nun hatte aber gerade die Eschstruth einen guten Blick für exzentrische Frauen. In dem Roman Gänseliesel (1886) gibt es eine burschikose Prinzessin, die sich bequem anzieht und das Reiten und Jagen ernst nimmt, also männlich wirkt. Streckenweise ist sie sympathisch, in ihrer fast lesbisch wirkenden Beziehung zu einer der Hofdamen sogar erfrischend originell. Aber sowie diese Gestalt zu selbständig wird, biegt die Autorin ins Konventionelle ab, und die arme Sylvie muss entweder tun, was nicht zu ihr passt, zum Beispiel mit Herz Volkslieder zum Klavier singen; oder aber sie verliert den Beifall der Männer, weil sie sich vom Sport erhitzen lässt und beim Wettreiten gewinnen will. Es ist hart, aber Ehrgeiz ist eben für Herren, in der doppelten Bedeutung des Worts, und nicht für Sklaven und Frauen. Um das Thema ›Reitkunst und Wettreiten‹ doch noch zu vervollständigen, schildert Eschstruth im selben Rahmen die sportliche Leistung der Männer, die ihrerseits bis zur Tollkühnheit getrieben werden darf. So springt ein junger Offizier, während der Zug in hundert Meter Entfernung heranbraust, über einen Schlagbaum, der schon heruntergegangen ist – und das nur, um eine Wette zu gewinnen. Die Erwartungen der Leserin müssen sich also von den Leistungen der Frau auf die des Mannes verschieben.