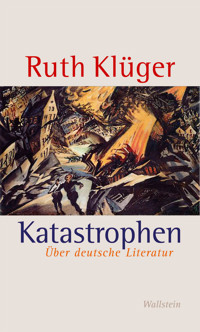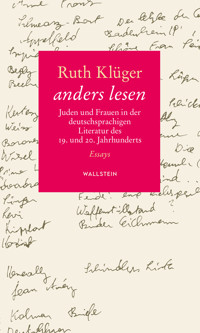Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Steht es dem Schriftsteller frei, einen historischen Stoff in einem literarischen Text nach eigenen Maßgaben zu verändern? Von Platon bis Philip Roth reicht das Spektrum der Texte, anhand derer Ruth Klüger dieser Fragestellung nachgeht. Was ist wahr? - Wie steht es um das Verhältnis des geschichtlichen Faktums zum Erzählen davon? - Ruth Klüger beschäftigen seit vielen Jahren die philosophischen, moralischen und nicht zuletzt ästhetischen Dimensionen dieses Problems. Warum hat der Dramatiker Schiller Jeanne d'Arc auf dem Schlachtfeld sterben lassen, wiewohl er es als Historiker besser wußte? Wieso können wir es leicht hinnehmen, daß er Maria Stuart so deutlich "verjüngt", fänden es aber unverzeihlich, hätte Tolstoi Napoleons Niederlage im Rußlandfeldzug unterschlagen? Warum wird ein und derselbe Text ganz neu gelesen, wenn man erfährt, daß sein Verfasser nicht eigene Erinnerungen aufgeschrieben hat, etwa als ein Überlebender der Lager, sondern eine Romanhandlung in Ich-Form erfunden hat? Warum findet man unter Umständen kitschig, wovon man vorher ergriffen war? "Die Autobiographie ist ein Werk, in dem Erzähler und Autor zusammenfallen, eins sind." Und so gewiß Ruth Klüger das Schreiben über die eigenen Erfahrungen in einem Grenzdorf zwischen Geschichte und Belletristik angesiedelt sieht, so sicher hält sie fest an der Identität eines Ich, das Zeugnis ablegen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ruth Klüger
Gelesene Wirklichkeit
Ruth Klüger
Gelesene Wirklichkeit
Fakten und Fiktionenin der Literatur
Maria Alter gewidmet,
für die vierzig Jahre Freundschaft, die gemeinsamen Streifzüge durch deutsche Bücher und amerikanische Filme und, nicht zuletzt, fürs magische Geheimwort »Fiala«.
Inhalt
Vorwort
Lanzmanns Shoah in New York
Von hoher und niedriger Literatur
I. Der Gartenzwerg und das Goldene Kalb
II. Mißbrauch der Erinnerung: KZ-Kitsch
Fakten und Fiktionen
Wien als Fluchtpunkt
Dankesrede zur Entgegennahmedes Bruno-Kreisky-Preises
Erlesenes Wien:wie seine Dichter es sahen und sehen
Der Dichter als Dieb?
Der Fall Littner – Koeppen
Wie wirklich ist das Mögliche?Das Spiel mit Weltgeschichte in der Literatur
Drei Essays zur literarischenBehandlung von Geschichte
I.Geschichten aus Geschichte machen:historische Romane und Erzählungen
II.›Bretter, die die Welt bedeuten‹:das historische Drama
III.Wider den Strom:Utopie/Dystopie
Nachweise
Impressum
Vorwort
Die vorliegenden Arbeiten sind zu verschiedenen Anlässen entstanden, doch sind sie alle dort angesiedelt, wo Lebens- und Leseerfahrung sich überschneiden. Das ist zwar eine weitverbreitete und vielgelesene Sparte der Literatur, aber keineswegs die einzige. Es gibt ja Esoterik, Mystik, Sprachexperimente, besonders in der Lyrik, wo es mehr um Form als um Inhalte geht, Phantasien, die aus der Wirklichkeit ausscheren wollen, Gedichte, die uns durch ihre Musikalität bezaubern und dann noch jede Menge erzählender Literatur, die mit Erotik und mit intimen Familienstrukturen zu tun hat.
Mit all dem beschäftige ich mich nicht auf den folgenden Seiten. Meine Frage war, was mit der Literatur geschieht, wenn sie sich der Wirklichkeit stellt und im besonderen sich mit Geschichte und Zeitgeschichte auseinandersetzt. Und meine Antwort war jedesmal, sie sucht die Deutung, die Interpretation, sie fragt, wie man Spreu vom Weizen scheidet, Ordnung in die widersprüchliche Welt bringt oder sich mit aufgerissenen Augen dem Chaos stellt. Durch die Deutung will sie über die Wirklichkeit hinaus zur Wahrheit werden.
Wer aber Wahrheit beansprucht, kann auch der Lüge überführt werden. Wie lügt man in der Literatur? Man kann die Wahrheit durch Kitsch entstellen, wie ich in den beiden Aufsätzen über hohe und niedrige Literatur zu beweisen suche. Man kann auch durch Fälschung und Aneignung der Schriften anderer lügen, wie in dem Aufsatz »Der Dichter als Dieb?«.
Mehrmals kommt auf diesen Seiten die Shoah zur Sprache, sie zieht sich sogar als roter Faden durch mehrere Aufsätze, denn der große Judenmord im zwanzigsten Jahrhundert ist ein Ereignis, das nicht aufgehört hat, uns auch literarisch zu beschäftigen. Darum steht am Anfang dieser Sammlung ein persönliches Denken über einen Dokumentarfilm, Lanzmanns »Shoah«. Hier trifft die künstlerische Darstellung auf die ungeschminkten historischen Fakten, wie ich sie in dem Essay »Fakten und Fiktionen« im allgemeineren zu umreißen suche.
Als mir in Wien ein Preis für politische Literatur verliehen wurde, hielt ich es für angebracht, eine kurze Rechtfertigung für diese unerwartete Ehre zu schreiben, die auch als Rechtfertigung für dieses Buch dienen möge. In Wien habe ich dann auch zur Eröffnung einer öffentlichen Bibliothek untersucht, wie sich das reale Wien zum literarischen Wien verhielt und verhält – ein recht schwankendes Verhältnis, wie sich bei der Arbeit an dem Essay »Erlesenes Wien« herausstellte.
Schließlich habe ich in den letzten drei Aufsätzen, als Poetikvorlesungen in Tübingen geplant, ein Stück Literaturgeschichte von der Gattung her aufgearbeitet, immer vom Standpunkt der künstlerischen Wahrheit, die der Wirklichkeit einen Sinn abgewinnen möchte.
Lanzmanns Shoah in New York
I.
Es ist 13 Uhr und ein Wochentag, man schreibt das Jahr 1985, zehn Dollar sind viel Geld für eine Kinokarte, noch dazu für den ersten Teil eines neunstündigen Dokumentarfilms, und doch ist das Kino am Broadway überfüllt. Das Publikum besteht zum Teil aus Überlebenden des Holocaust, aber es sind auch viele junge Leute gekommen, vor allem, aber nicht ausschließlich, Juden.
Shoah ist ein Gewirr von Sprachen, grammatisch und ungrammatisch und mit den verschiedensten Akzenten gesprochen.1 Da gibt es zunächst Deutsch und Englisch, das Französisch des Übersetzers, Polnisch, dann wieder gesungenes und gesprochenes Deutsch, dann Jiddisch, Hebräisch, nochmals Deutsch, ein bißchen Italienisch und wieder Englisch, und schließlich die letzten Worte des Films auf Hebräisch, gesprochen von einem Mann, der sich an die Stille erinnert, die auf die Evakuierung des Warschauer Ghettos folgte: »Ich bin der letzte Jude. Jetzt warte ich nur noch auf den Morgen und auf die Deutschen.«
Shoah ist Interviews, Gesichter und Stimmen der Opfer und der Schergen und der Mitläufer und Mitwisser, lautstarke Erinnerungen und Aufnahmen von Auschwitz und Treblinka und Chelmno (Kulmhof), wie diese Stätten jetzt sind, wenn nur noch Worte und keine Bilder sie so zeigen können, wie sie damals waren. Lanzmann filmt zum Beispiel vor der Kirche in Chelmno, in der man die Juden vor ihrem Tod zusammenpferchte. Die Kamera folgt einer bunten Prozession, die aus der Kirche kommt, mit knicksenden Mädchen in weißen Miniröckchen. Die Kamera nimmt sich Zeit. Das Ohr hört die Worte über den Massenmord wie von außen hallen, während das Auge seine gespenstisch unpassende Freude hat: eine malerische Kirche im heutigen Polen.
Renais’ Nacht und Nebel (1955), der bis Lanzmann berühmteste Film über die Judenvernichtung, hatte auch Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen lassen. Seine Botschaft war eine Ermahnung zur Erinnerung, um zukünftige Katastrophen zu verhindern. Ein schöner lyrischer Text von einem Überlebenden, der heute zu poetisch, zu eigenwillig klingt, begleitete die Aufnahmen. Für Lanzmann ist Erinnerung eine eiternde Wunde in den Köpfen der Überlebenden auf der Leinwand, ein Ritual der Teufelsaustreibung, ohne erkennbare Botschaft.
Ich glaube nicht, daß zurückkehren hilft. Lanzmann glaubt’s. Mir fehlt der Sinn für den spiritus loci, der die Grundlage der Museumskultur bildet, die im Umkreis der alten Konzentrationslager entstanden ist. Was dort verübt wurde, habe ich öfters behauptet, kann anderswo wiederholt werden, da es in menschlichen Gehirnen ausgebrütet und von Menschenhänden ausgeführt wurde, egal wo. Warum also die Orte aufsuchen, die heute wie irgendwelche aussehen? Ich gehe nicht dorthin, wo ich einmal war. Ich bin entkommen. Lanzmann kehrt dorthin zurück, wo er nie gewesen ist. Keine Landschaft, habe ich immer geglaubt, bewahrt die Erinnerung daran, was auf ihrem Boden geschah, denn die Steine reden nicht. Lanzmann glaubt, daß sie reden. Da steht der Filmemacher auf morastiger Bahn, wo die Toten und Sterbenden einst aus schlecht geschlossenen Mordwaggons fielen, und wenn die Auspuffgase sie noch nicht ganz erstickt hatten, so erschoß man sie, als sie im Schlamm wegzukriechen suchten, und Lanzmann überzeugt uns, daß, wer von solchen Dingen weiß, nicht wirklich entkam. Und wie die Stunden vergehen, wird auch das Publikum es wissen, und manche werden ihre Aufmerksamkeit wandern lassen. Die »Langeweile« dieses Films ist von einer ganz besonderen Sorte.
Wie alle Überlebenden weiß ich, daß Auschwitz, als die Nazis dort ihr Handwerk trieben, wie ein Mondkrater war, ein Ort, der nur zufällig und am Rande ein Nachbar von gewöhnlichen Menschenbehausungen war. Es ist dieses radikal Andersartige, diese Alterität, wie man wissenschaftlich verfremdend gerne sagt, die wir so schwer ausdrücken können. Doch als das Töten vorbei war, wurden die Lager wieder ein Stück unserer bewohnten Welt. Als ich als Kind im Sommer 1944 dort war, da hat uns ein Lehrer ein paar Grashalme gezeigt und tröstend gesagt: »Seht ihr, sogar in Auschwitz wächst etwas.« Er meinte es als eine lebensbejahende Aufmunterung, und so hatte ich es auch verstanden, und in meiner harten, kindischen Starre verachtete ich ihn dafür. Er war ein Zentraleuropäer, ein Humanist, er kam aus einem gemäßigteren zivilisatorischen Klima als ich, die unter Hitler aufgewachsen war und die letzten zwanzig Monate im hungernden, überfüllten Krankheitsherd Theresienstadt verbracht hatte. Ich war bitter und wütend, weil ein Erwachsener mich darauf aufmerksam machte, das Gras in Auschwitz würde mich überleben. Der Lehrer ist sehr wahrscheinlich in den folgenden Wochen vergast worden, zusammen mit den meisten Insassen des »Familienlagers« B II b, das im Film Shoah eine Rolle spielt. In Lanzmanns langen Aufnahmen der heutigen Lagerstätte ist jede Menge Gras zu sehen. Hinter der bunten Leinwand taucht in meinen Gedanken und in meinem Gedenken jener Mann mittleren Alters auf, der mir damals etwas sagen wollte über die Zähigkeit des Lebens im Ganzen, als ich erst Zwölfjährige Angst um mein besonderes, spezifisches Leben hatte. Und ich wünsche mir, ich könnte meine Ablehnung seiner Worte wiedergutmachen durch eine weniger verschwommene Erinnerung an ihn. Und so, nach sechs Stunden Kino, fange ich an zu verstehen, warum Lanzmann besessen ist von den Ortschaften des Bösen.
Jede Sprache im Film wird von jemandem im Saal verstanden. Die Leute reagieren, bevor die Untertitel erscheinen. Sie lachen, zischen, streiten flüsternd miteinander: Kurzum, sie nehmen an den Interviews teil. Sie weigern sich, passiv zu bleiben, als ob das Gewicht dieser kollektiven Erinnerung zu schwer wäre, als daß man es allein und ohne die anderen ertragen könnte. Ein Mann, der völlig schweigend dasaß, zahlt schließlich den Preis für seine Isolation, verläßt den Saal und murmelt vor sich hin, das sei ihm zuviel. Der Rest des Publikums verarbeitet die Spannung durch hörbares Mitreden. Ich bin mit einigen Studenten gekommen und halte mich, des professoralen Anstands wegen, zurück. Gelegentlich korrigiere ich einen Untertitel für meine Schüler oder mache sie auf ein Detail aufmerksam, das sie vielleicht nicht bemerkt haben. Am nächsten Tag komme ich ohne Gesellschaft für den zweiten Teil. Diesmal ist das Kino halbleer. Ich sitze allein, und niemand lenkt mich ab. Während der Pause beklagt sich eine Frau beim Manager, im Kino sei es so kalt. Das stimmt nicht: Der Film hat alle Wärme aus ihr gesaugt. Nach der Pause fange auch ich zu frieren an und rede auf die Leinwand ein, um mich aufzuwärmen.
Das war die Stelle, wo Rudolf Vrba, der im Jahre 1944 aus Auschwitz floh, vom Tod eines Mannes redete, den ich kannte. Fredy Hirsch war das Idol der Kinder in Theresienstadt, die in gleichaltrigen Gruppen in »Kinderheimen« wohnten. Fredy war dreißig Jahre alt (ich mische mich ein, weil er doch viel jünger aussah) und er hatte, sagt Vrba, »eine sehr enge Beziehung zu den Kindern«. Diesmal wende ich mich gleich an Lanzmann und erkläre ihm, warum und wie Fredy eine Ausstrahlung für Kinder, aber nicht für Erwachsene hatte. Vrba erinnert sich, daß Fredy einen Aufstand plante und daß er versagte, weil er sich zu sehr um die Kinder sorgte und am Ende Selbstmord beging. Diese Geschichte ähnelt der vom Selbstmord Adam Czerniakows vom Warschauer Judenrat, der sich – der Historiker Raul Hilberg hat das in Buch und Film erzählt – nicht dazu bringen konnte, die Waisenkinder des Ghettos aufzugeben. Aber Fredy war anders, er war kein starker Charakter, die Erwachsenen trauten ihm nicht, nur die Kinder verehrten ihn. Vrba weiß das nicht, und so muß ich diese zwei Männer, die da oben auf der Leinwand miteinander reden, darüber aufklären, als gäbe es keine Grenze mehr zwischen Darsteller und Zuschauer. Die Erinnerungsarbeit ist so gründlich, daß ich mich um den geplanten, geplatzten Aufstand kränke und um die verlorene Gelegenheit meiner kleinen Gemeinschaft, dem Fredy Hirsch zu zeigen, wie sehr wir hinter ihm standen und wie er einen Kinderkreuzzug hätte führen können, und alle Kinder von sechs Jahren an wären seinen Anordnungen gefolgt. Und ich will’s ihm sagen und möchte, daß er’s weiß.
Ein anderer Überlebender führt die Geschichte dieser beiden Transporte von Theresienstadt weiter. Sie waren im September und Dezember angekommen und wurden im März getötet, in vollem Bewußtsein dessen, was ihnen bevorstand. Filip Müller, dessen Hirn verurteilt ist, bis zum Lebensende das Sterben einiger meiner Kindheitsfreunde in allen Einzelheiten zu speichern, erzählt davon, auf deutsch, mit dem tschechischen Akzent, der mir von früh an vertraut ist. Ich sitze vornübergebeugt im Dunkeln und berichte seinem hellen Bild davon, wie ich selbst davongekommen bin – als sei das wesentlich.
Ich habe meine Reaktion so genau beschrieben, weil die Wirkung dieses Films davon abhängt, wie weit sich der Zuschauer auf Lanzmanns Unternehmen einläßt. Die Tendenz mitzumachen, zu kritisieren und zuzustimmen scheint weit verbreitet zu sein. Manche sagen und Rezensenten haben geschrieben, daß sie aufstehen und sich einmischen wollten, wenn Lanzmann seine Gesprächspartner zu sehr unter Druck setzte. Und obwohl Lanzmann sich dem Publikum nicht übermäßig aussetzt, sondern sich eher im Hintergrund hält, reagieren die Leute doch oft ganz persönlich auf ihn.
Shoah zieht uns mehr ins Dargestellte hinein, als das gedruckte Wort es vermag, und überwältigt uns weniger als Dokumentarfilme, die die Lager in ihrem ursprünglichen Zustand zeigen. Lanzmann zwingt uns geradezu, das, was er uns zeigt, zu beurteilen, einschließlich seiner eigenen hartnäckigen Interview-Methoden, und schafft dadurch eine Art interaktives Kino, oder zumindest die Illusion eines solchen. Zum Beispiel macht er kein Hehl aus der Tatsache, daß er Nazis ohne ihr Wissen filmt. Er überläßt es uns, den Betrug zu billigen oder zu verurteilen. Oder er drängt überlebende Zeugen trotz ihrer Erschütterung, weiterzuerzählen. Er hält nicht inne, wo das geringste Taktgefühl zumindest eine Pause erwarten würde. »Entscheidet selbst, ob das moralisch oder unmoralisch ist«, scheint er einem Publikum zuzurufen, das ihn völlig versteht und sich jeden Fall einzeln überlegt. Das mag nichts Neues sein: in gewissem Sinn hat jede Talkshow eine ähnliche Wirkung, und es gibt Vorläufer wie Marcel Ophüls Das Haus nebenan – Chronik einer französiscchen Stradt im Kriege. Doch Ophüls hat selbst über den Unterschied zwischen ihm und Lanzmann geschrieben: »Er versucht nie, sich beim Publikum einzuschmeicheln, versucht kaum zu bezaubern oder zu unterhalten … weil seine Aufgabe so einmalig ist.«2
Diese »Aufgabe« fordert von uns, sich dem Absoluten zu stellen, obwohl wir nur konkrete Einzelheiten zu sehen bekommen; und vermittelt uns eine andere Erfahrung als was wir von cinematographischen Werken gewohnt sind, einschließlich Dokumentar- und Avantgardefilme. Dieser Film will, daß wir ihm alles geben, und umgekehrt macht er es uns leicht, uns völlig zu verweigern. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen (allerdings immer noch nur eine Minderheit), die Shoah ablehnten, weil er langweilig sei, unfair und nur das wiederhole, was wir sowieso schon wüßten, und viel zu lang. Ein Beispiel ist die negative Rezension im »New Yorker« (30. Dezember 1985) von Pauline Kael, die für viel Entrüstung sorgte. Bei diesem Thema ist es kein Wunder, wenn manche Kinobesucher sich nicht konzentrieren wollen, während andere vielleicht gar nicht anders können, als nur halb zuzuhören, nur halb hinzuschauen. Eine Frau, die mir versicherte, der Film habe einen bleibenden Eindruck auf sie gemacht, ist trotzdem mehrmals eingeschlafen und ertappte sich einmal dabei, daß ihre Gedanken zu ihrer Garderobe abschweiften. Sie gab’s, über sich selbst erstaunt, zu. Und sogar wenn man intensiv mitmacht, bleibt immer noch Spielraum für triviale Vergleiche. Ein Kollege, Literaturprofessor in Princeton, meinte, bei seiner letzten Ferienreise sei das Flugzeug so vollgestopft gewesen, als sei man im Viehwaggon nach Treblinka. Er hatte gerade Shoah gesehen. Gerade weil dieser Film so sehr auf das Mitwirken der Zuschauer vertraut, wird er eine ganze Skala von Zustimmung und Abneigung hervorrufen.
Was hier zur Debatte steht, ist unser inneres Mobiliar. Es ist leicht für mich, die sich gut an diesen Maelstrom der Geschichte erinnert, jedem Detail fasziniert zu folgen. Ich bin am einen Ende des Spektrums, an dessen anderem Ende Pauline Kael auf ihrem Sitz wetzte und Ennui verspürte. Ich habe den Film zweimal gesehen, neunzehn Stunden alles in allem, und war keinen Augenblick schläfrig. Und während sich andere beschwerten, sie hätten nichts Neues erfahren, war ich erstaunt, wieviel ich nicht gewußt hatte. Auch der Generationenunterschied spielt eine Rolle: Junge Amerikaner, wie meine Studenten, die den Holocaust nur vom Hörensagen und ungenau kennen, sind eher bereit, Lanzmann bis an die äußersten Grenzen der Gewalttätigkeit zu folgen als ihre Elterngeneration, die während und nach dem Krieg nicht willens war, über und an die Juden und ihr Schicksal im Nazi-Europa zu denken. Einer meiner Studenten zischt plötzlich: »Das ist ja so absurd. Die ganze Sache ist absurd. Niemand hat etwas davon gehabt.« Ihm ist dank der scheinbar endlosen Zeugenaussagen ein blendendes und bleibendes Licht aufgegangen, wie der Holocaust letzten Endes jedermanns Selbstinteresse überstieg und hinter sich ließ.
Shoah handelt ausschließlich von Ausrottung. Es handelt nicht vom Leben in den KZs oder von Leiden, Überleben und Flucht. Es beschäftigt sich unbarmherzig mit nur einem Thema, nämlich dem Prozeß und den Details der Vernichtung. Nur wenn es wirklich nicht anders geht, erhalten wir spärliche Informationen über das Schicksal der Zeugen. Anders gesagt, der Brennpunkt ist immer das Eigentliche des Titels, indem er unerbittlich das erforscht, was die Ablenker und Mystifikatoren gern »das Unsagbare« nennen. Wenn man diese Voraussetzung einmal akzeptiert und nicht erwartet, daß der Film sich anderen, verwandten Themen zuwenden wird, sondern in seiner ganzen Länge alles ausgräbt, was über Massaker herauszufinden ist, dann sieht man, wie Lanzmann nicht einfach die Details anhäuft, sondern sein Material sorgfältig und wirkungsvoll durchorganisiert hat.
Da gibt’s die Steigerungen in der Technik des Massenmordes von den Lastwagen mit ihren Auspuffgasen in Kulmhof (ich verwende die deutschen Namen lieber als die polnischen, wo ein Ort durch Deutsche berüchtigt wurde) zu den frühen Gaskammern in Treblinka und zur späteren Perfektion der Methode in Auschwitz. Öfters beleuchtet Lanzmann die Geschichte eines Transports von mehr als einem Gesichtspunkt, indem verschiedene Berichterstatter den Faden aufnehmen. Dieselben Zeugen treten ab und kehren zurück, wie die Zusammenhänge es benötigen. Am Ende fragt Lanzmann nach Widerstand, geplantem oder ausgeführtem, und so ist es passend, daß die Überlebenden des Warschauer Ghettos das letzte Wort haben. Zuschauer, die von der Darstellung der Einzelheiten des Genozids überwältigt sind, verlieren leicht diesen Aufbau aus dem Auge und fragen sich, warum der nächste Zeuge gerade zu diesem gewissen Zeitpunkt auf der Bildfläche erscheint. Ich stieß in Gesprächen und sogar in Rezensionen auf die gröbsten Fehler, weil der Film nicht als Ganzes wahrgenommen wurde und einzelne Scheußlichkeiten sich im Hirn der Zuschauer selbständig gemacht hatten. Doch Shoah ist wie ein Hund, der Blut gerochen hat und jeder Mordspur folgt.
Vielleicht ist der Einwand nicht unberechtigt, Lanzmann übertreibe die wiederholten Szenen von Eisenbahnzügen, die Juden in die Lager befördern, und daß die Szenen, in denen er einen Übersetzer braucht, ungeschickt in die Länge gezogen sind. Andererseits ist diese Langsamkeit auch Teil einer Methode, die uns weniger betäubt, als wir’s vom Kino gewohnt sind. Wenn wir das Manöver zwischen den Sprachen hören, kommen wir dem Kommunikations-Babel der Lager und ihrer entwurzelten paneuropäischen Bevölkerung ein wenig näher. Und die Züge gewähren uns eine Denkpause, die uns das Kino, das uns sonst so leicht in einen Zustand kulinarischer Passivität versetzt, nur selten bietet. Shoah wirkt, wenn wir unsere Erinnerungen und eben auch unseren Widerstand ins Spiel bringen. Für Information und Aufklärung sind Bücher eine bessere Quelle. Denn die Kritiker, die hier »nichts Neues« finden, haben gewissermaßen recht. Auch wenn wir keine Historiker sind und von diesem Film, wie ich, noch manches erfahren haben, so sind die Fakten doch verbucht und leicht greifbar. Die Zeugen erzählen ihre Geschichte nicht zum ersten Mal. Vrbas Aussagen über die Transporte von 1943 und sogar über Fredy Hirsch kannte ich, wenn auch nicht in denselben Worten, von H. G. Adlers Buch über Theresienstadt.3 Doch diese Fakten und Daten habe ich damals in dem umnebelten Gemütszustand, in dem wir uns nach dem Krieg befanden, aufgenommen und unverdaut gelassen. Mein Schüler, dem plötzlich die »Absurdität« des Genozids mit aller Wucht aufging, war schon vorher gut informiert über die wirtschaftliche Basis des Holocaust, doch erst der Film traf ihn ins Mark, dort wo man, wie der Dichter W. B. Yeats meinte, die bleibenden Gedanken denkt.4
Sogar Raul Hilberg, der die objektive historische Perspektive vertritt, sieht aus wie ein Engel des Jüngsten Gerichts, der über den Verdammten waltet. Lanzmann fragt ihn, warum ein getippter Fahrplan ihn so fasziniert, und er antwortet: »Also, wenn ich ein Dokument in der Hand halte, besonders wenn es ein Originaldokument ist, so halte ich ja etwas, was der ursprüngliche Beamte in der Hand gehabt hat. Es ist ein Gedenkstück. Ein Überbleibsel. Es ist das einzige Überbleibsel, das es gibt.« Diese recht prosaischen Worte, spontan und nicht eingeübt, klingen hier wie hohe tragische Dichtung. Ich kannte natürlich Hilbergs maßgebliches Werk über die Judenvernichtung5 und hatte auch Vorträge von ihm gehört, aber neu waren die leidenschaftliche Anteilnahme und der Zorn. Ob Hilberg über die eiserne Präzision spricht, mit der die Transporte abfuhren und ankamen, was ja bedeutet, daß die Bahnbeamten eifrig mitmachten, oder ob er sich elegisch mit Adam Czerniakow, dem Präsidenten des Warschauer Judenrats, fast identifiziert, die Kamera filmt den Historiker, als sei er ein Racheengel, der die Welt, oder vielleicht Gott, zur Rechenschaft zieht, in der Hand das Belegmaterial für das Böse schlechthin, in Form von getippten Bürodokumenten.
II.
Lanzmann spricht fließendes Deutsch, mit völliger Mißachtung sämtlicher grammatischer Regeln, als ob die Sprache der Mörder nur Verachtung verdiente. In Shoah wird viel Deutsch gesprochen, doch muttersprachlich nur von den Nazis, die alle eine Eigenschaft gemeinsam haben: Abstand, Gleichgültigkeit. Davon berichten auch die Zeugen. Filip Müller beschreibt, wie die Opfer, kurz bevor sie vergast wurden, die SS anflehten, sie leben und Sklavenarbeit verrichten zu lassen, wie man es ihnen versprochen hatte. Doch die SS-Leute, sagt Müller, »waren wenig beteiligt«. Das ist die durchgehende Haltung der Deutschen in diesem Film über das größte deutsche Verbrechen: »wenig beteiligt«, die abgefeimten Täter. Während die Überlebenden mit obsessiver Genauigkeit von Menschen, die sterben, reden, verwenden die Deutschen im Interview ein technisches Vokabular, um die Mordaktion zu beschreiben, oder sie schütteln die Köpfe und seufzen ein abgedroschenes und allgemeines: »schrecklich, schrecklich«.
Der zweite Teil des Films beginnt auf einer sauberen Straße in einer deutschen Stadt. Lanzmanns Team sitzt im Wagen und macht sich mit den Aufnahmen einer versteckten Kamera zu schaffen, die ein Interview mit Herrn Suchomel festhält. Herr Suchomel war ein SS-Unterscharführer in Treblinka. Nicht nur hat er keine Ahnung, daß er gefilmt wird, er hat ausdrücklich den Wunsch geäußert, nicht gefilmt zu werden. Bevor wir ihn zu sehen bekommen, hören wir seine Stimme, wie er eine scheußliche Variante des berühmten Buchenwaldlieds singt. In Treblinka hatte die SS einen lyrisch-musikalischen Ehrgeiz und zwang die neuen Ankömmlinge, dieses »Treblinkalied« zu lernen, das großtut mit Pflicht und Gehorsam. Lanzmann bittet sein Gegenüber, es zum zweiten Mal zu singen, und Suchomel freut sich. Dann seufzt er und sagt, wie traurig das alles doch sei, und hier sitzen wir und lachen. Darauf Lanzmann, sehr ernst: »Niemand lacht.« Er hat natürlich recht, keiner der beiden hat gelacht. Suchomel will wohl ausdrücken, daß er gerne an die guten alten Zeiten zurückdenkt und sich doch nicht ganz wohlfühlt dabei. Plagen ihn winzige Gewissensbisse oder denkt er nur, daß es sich gehört, »schrecklich« zu sagen? Aber schließlich gebe er das Interview ja um der geschichtlichen Wahrheit willen, also muß es in Ordnung sein. Dieses Lied, versichert er Lanzmann stolz, ist ein Unikum, denn es gibt keinen lebenden Juden mehr, der es noch kann. Lanzmann gibt sich beeindruckt. Suchomel merkt nicht, daß sein eigentlicher Beitrag zur Geschichtswissenschaft, abgesehen von seiner intimen Kenntnis des Lagers Treblinka, weniger sein erinnertes Lied als die Bloßstellung seines verrotteten Innenlebens ist.
Suchomel beschreibt nackte Frauen in Treblinka, wie sie in der Winterkälte auf ihre Vergasung warteten. Sie wußten, was ihnen bevorstand und verloren die Kontrolle über die Notdurft. Hausfrauen waren das, denke ich, Mütter, die putzten und kochten und ihre Kinder erzogen. Ich stelle sie mir vor, während er spricht; das ist leicht, denn ich habe Zwangsarbeit mit solchen Frauen verrichtet und weiß, wie freundlich sie zu einem Kind wie mir waren, auch wenn sie hungerten und froren und sich fürchteten. Nie sind sie für die Aufseherinnen, soviel diese auch herumschrieen, im Schritt marschiert. Aus Unvermögen oder aus Ungehorsam? Jedenfalls zu meinem großen Vergnügen. Und hier auf der Leinwand ruft dieser kleine Kitschmensch, wie Hermann Broch sagen würde, mit seinem schlechten österreichischen Deutsch sie ins Gedächtnis, sie oder ihresgleichen, in einer Szene, die das Äußerste an Verneinung menschlicher Zusammengehörigkeit darstellte: Frauen, denen weiblicher Anstand, wie sie ihn verstanden, eine Selbstverständlichkeit war, erzogen zur Häuslichkeit, deren ärgster »Gewaltakt« vielleicht ein gelegentlicher Anfall von Ärger oder Frust gewesen war, und die nun dastanden in Fünferreihen, ihrer eigenen Gedärme nicht mehr mächtig, und dem würdelosesten Tod entgegengingen. Man weiß so viel und doch nie genug.
Suchomel ist ein Paradebeispiel für Hannah Arendts Diktum über die Banalität der Täter des Bösen. Suchomel ist geistig zu beschränkt, zu seicht, um Reue zu verspüren, und daher besteht ein unüberbrückbarer Abgrund zwischen dem Täter und der Tat, dem Übermaß des Verbrechens und der Kleinlichkeit des Verbrechers. Nachdem er den Tod dieser Frauen im Detail beschrieben hat, normalisiert Suchomel seinen Bericht mit einer »medizinischen« Überlegung über die Auswirkung von Angst auf die Körperfunktionen und bringt seine eigene Mutter, die ganz normal zu Hause im Bett starb, in die Diskussion ein. Er hat von der horrenden Szene des Massenmords der Frauen in Treblinka geschickt abgelenkt wie einer, der gewohnt ist, sich mit dem Schirm von Trivialitäten gegen die argen Erinnerungen zu schützen.
Das ist das Geheimnis aller Nazis, die Lanzmann interviewte: Sie normalisieren, sie trivialisieren, sie halten sich das Geschehene vom Leib und von der Seele. Sie behaupten, nichts gewußt zu haben, sogar wenn sie dabeiwaren, sie sind Meister der Verdrängung, und wenn nichts anderes übrigbleibt, so zahlen sie mit dem Kleingeld konventionellen Bedauerns darüber, daß so Schreckliches stattfand. Man denkt an die Frankfurter Auschwitz-Verhöre, wo die Angeklagten lachten und die Überlebenden weinten, ein Phänomen, das Peter Weiss wirkungsvoll in seinem Stück Die Ermittlung verarbeitete. Die Täter ordnen die Vergangenheit anders an als die Opfer. Sie sind auf eine andere Wellenlänge eingestellt. Es war alles traurig und schrecklich, und man sollte nicht darüber lachen. (Aber man möchte, denn es hat doch auch Spaß gemacht.) Nicht ein antisemitisches Wort kommt über ihre Lippen.
Gewiß, der Interviewer betrügt die Befragten mit seiner verborgenen Kamera, aber ihre Antworten manipuliert er nicht. Sie schockieren uns alle auf die gleiche Weise, in ihrer Haltung von »Arbeit ist halt Arbeit«, »Geschäft ist Geschäft«, »Befehl ist Befehl«. Der Sinn für Horror, für Alpdruck fehlt ihnen so sehr, daß man ihnen beinahe glaubt, wenn sie behaupten, sie hätten nichts gewußt. Eigentlich glaubt man es nicht, und Lanzmann glaubt es offensichtlich auch nicht. Aber es ist möglich, wenn auch höchst unwahrscheinlich, daß Bürokraten wie Dr. Grassler von der Warschauer Ghettoverwaltung sich den »Gerüchten« über das Ziel der Verschickungen verschlossen. Und was immer er damals glaubte oder wußte, so hat er sich vielleicht seither »ganz ehrlich« vorgemacht, daß er immer nur das Beste für das Ghetto im Sinn hatte.
Walter Stier, der Mann, dem bei der Reichsbahn die Verantwortung für die Züge in Richtung Osten oblag und der die Menschenfracht organisierte, hat tatsächlich Schwierigkeiten, sich an den Namen Auschwitz zu erinnern. »Dieses Lager«, sagt er, »wie hieß es doch? Es war im Kreis Oppeln.« Nach einer Weile kommt er doch auf den Namen, der seit Jahrzehnten stellvertretend für Völkermord steht. Lanzmann bestätigt das Wort mit nur einer Spur Ironie in der Stimme. Solche Szenen gewähren uns einen weitaus intimeren Einblick in die Innenwelt der Schuldigen, als das gedruckte Wort es vermittelt. Ich beneide sie fast, diese Leute, wie die Frau Michelsohn von Kulmhof, die 400 000 Mordopfer in ihrer allernächsten Umgebung mit 40 000 verwechselt. (Ja, eine Vier war drin, da ist sie sicher.) Im Grunde entschleiern die Interviews mit den früheren Nazis friedliche und schuldfreie Gemüter. Sie sind vorurteilsfrei und haben keine Ressentiments. Sie reden mit einem Juden, der kein richtiges Deutsch kann. Sie sind ihm überlegen: »Wir drehen uns im Kreis, Herr Lanzmann.« Sie korrigieren ihn: »Glauben Sie mir, Herr Lanzmann, 18 000 [Mordopfer] am Tag ist übertrieben, höchstens 15 000.«
Nur die Juden sind die Verdammten. Auch sie geben mehr preis, als aus ihren Aussagen hervorgeht. Der Friseur Abraham Bomba, der zuerst in sorgfältigem Englisch beschrieben hat, wie er den Jüdinnen vor ihrer Vergasung das Haar abschnitt, bricht plötzlich in Tränen aus, und Lanzmann filmt rücksichtslos weiter, während Bomba ein paar verzweifelte Sätze auf Jiddisch spricht. Da merken wir, wie notwendig für ihn die Fremdsprache war – ein Schild gegen den Andrang der Erinnerung. »Könntest du mein Herz mit der Zunge berühren, es würde dich vergiften«, sagt ein Überlebender von Warschau. Die Deutschen hingegen distanzieren sich ohne weiteres. Wir Juden haben immer gewußt, daß der Holocaust unser Alptraum war, nicht ihrer, doch in diesem Film wird der Unterschied zwischen Schuld und Schuldgefühlen besonders deutlich. Die Täter haben ein schuldfreies Gewissen und sind gern an der frischen Luft; die Opfer sprechen von ihren giftigen (nicht »vergifteten«!) Herzen. Die früheren Nazis tun so, als hätten sie einmal in einer Schlächterei gearbeitet, nicht mehr als das. Traurig und schrecklich, gewiß, gewiß, aber was hätte man denn tun sollen, ich bitte Sie?
Der Frau Michelsohn könnte ich ja unter Umständen verzeihen, daß Zahlen ein Problem für sie sind. Wer hat nicht schon seine liebe Not mit der Statistik gehabt? Wenn’s um Tote in den Zehntausenden geht, machen auch Reporter und Historiker Fehler. Doch Frau Michelsohn meinte, dieses ganze Unternehmen, nämlich der Judenmord, hätte ihr nicht passieren sollen, sie hätte nicht Zeugin sein dürfen. Es war, sagt sie buchstäblich, »eine Zumutung«. Sie verwechselt auch Polen und Juden, und nachdem es ihr mit Lanzmanns Hilfe gelungen ist, sie auseinanderzuhalten, erklärt sie ihm und uns, daß die Polen und die Juden einander nicht mochten. Auch nicht die leiseste Andeutung, daß sie selbst in jenen Tagen die Juden vielleicht nicht besonders mochte. Dieses zivilisierte, verlogene Gebaren sagt so viel aus über den Ursprung des Holocaust.
Die Polen sind wieder anders. In ihren Berichten macht sich die Schadenfreude breit. Alle, die Shoah gesehen haben, sind schockiert von dem offenen, fröhlichen und ohne Milderung zur Schau gestellten Antisemitismus der polnischen Bevölkerung. Aber das wäre nichts Neues, besonders nicht auf dem Land und unter den Ungebildeten. (In den Städten haben polnische Christen oft ihren jüdischen Nachbarn geholfen und sie auch langfristig versteckt.) Was mich mehr erstaunte, war die frappante Fähigkeit, Legenden zu erfinden. Mit den toten Juden noch frisch im Gedächtnis, gelang es diesen guten Katholiken, sie zu Karikaturen zu verwandeln und die unwahrscheinlichsten Lügen über sie zu erfinden. Die Juden hätten in ihrer Todesstunde Jesus und Maria angerufen, ein Rabbiner hätte seine Gemeinde ermahnt, den Tod als Buße für die Kreuzigung zu begrüßen. Das Evangelium wurde in den Mündern dieser Gläubigen ein Instrument des Hasses. Da waren auch die unvermeidlichen schönen Jüdinnen, die so schön waren, weil sie nicht arbeiteten und Liebesverhältnisse mit christlichen Polen unterhielten, wohingegen die jüdischen Männer häßlich waren und gestunken haben. Und wie die Juden zu ihrem Tod transportiert wurden in Luxuszügen mit Speisewagen. Und waren ja alle so reich, bis sie vom Durst gequält alle ihre Juwelen für einen Trunk Wasser hergaben. So erstaunlich es ist, daß in einem Land mit so wenigen Juden ein derartiger Antijudaismus herrscht, ist doch diese Mischung von Tatsachen und Phantasien noch erstaunlicher. Egal was Juden tun oder was ihnen zustößt, nichts berührt die uralten Vorurteile und Vorstellungen über sie. Wir sind die Requisiten in einem Stück, das wir nicht geschrieben haben. Dabei waren diese Polen keineswegs konsequent. Einerseits zitierten sie das Neue Testament, um zu beweisen, daß Juden kein Recht auf Leben haben, andererseits freuten sie sich kindisch, mit einem jüdischen Überlebenden aus ihrer Gegend, der zurückgekommen war, fotografiert zu werden. Sie erinnerten sich freundlich, daß er Ketten an den Beinen tragen mußte und eine wunderschöne Stimme hatte.
Ich verlasse das Kino ein wenig unterkühlt, nicht eigentlich fröstelnd. Der hell beleuchtete Broadway schiebt sich vor den polnischen Bildschirm. Ich steige in ein warmes Taxi.