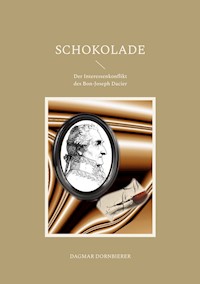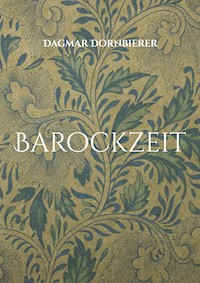Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Frauen mittendrin
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch handelt von Mittendrinkrisen. Die Geschichten erzählen von Frauen – und den dazugehörenden Männern und Kindern – die alle mittendrin im Leben stehen – und somit mittendrin in der Krise. Es wird erzählt von Leuten des mittleren Alters, und der mittleren Einkommensebene – Leuten, denen mittendrin bewusst wird, dass es noch Träume gibt. Eliane, Mitte Vierzig und frisch geschieden, stürzt sich in neue Erfahrungen, die manchmal nur mit viel Glück glimpflich ablaufen. Die Tücken des online-Datings und der erträumten Freiheit, die nicht immer traumhaft ist. Rückblicke und Aktuelles. Die „Mittendrin-Krisen“ des Schweizer Mittelstandes, Beziehungsknatsch, Generationenwechsel, Un- und Missverständnisse. Die Eigenheiten der Schweizer Sprache, die Schrulligkeit mancher Charaktere, und einige verborgene Eigenschaften des mittelständischen Lebens, garantieren den Schmunzelfaktor und unterhaltsam Einblicke in ein Land „mittendrin“.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dies ist ein Werk der Fiktion. Sofern sich die Erzählungen in diesem Buch nicht auf Dinge des öffentlichen Interesses beziehen, wie: Presseberichte, allgemein bekannte, nachschlagbare historische Sachverhalte, generelle Lebensgewohnheiten, Inhalte der Allgemeinbildung oder Kunst (zitierte Filmszenen, Musikkompositionen u.ä.), sind sie frei nach Eingebung der Fantasie fabuliert.
VON DER AUTORIN SIND AUSSERDEM ERSCHIENEN:
Jan Hus – Der Wahrheit Willen
(2015) ISBN-9783734754517
Das Buch der gespiegelten Zeit – Inspirierte Erzählungen
(2016) ISBN-9783837044881
Impressionen
Poesie aus vier Jahrzehnten und in drei Sprachen
(2016) ISBN-9783837045017
IN VORBEREITUNG: (2016-2018)
Frauen mittendrin Teil II. – Marcelas stille Integration
Gegenwartsliteratur, Vergnügliches aus der Schweiz
ISBN-9783837045215
Maria Mancini Fürstin Colonna
Eine Romanbiographie aus dem 17. Jahrhundert
Capitor, Malerin des Bastarden
Historischer Roman aus dem 17. Jahrhundert
Die Handschrift
Historischer Roman aus dem 15. Jahrhundert
Die Autorin
Dagmar Dornbierer ist in verschiedenen Sparten, Kulturen und Sprachen zu Hause. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie unter anderem auch als Übersetzerin und Dolmetscherin. Sprachen sind ihre Instrumente und Werkzeuge – fünf davon beherrscht sie fliessend und in vier weiteren findet sie sich gut zurecht. Sie verwebt Fakten und Fiktion, Biographien und Fantasien zu intelligentem Lesevergnügen. Dagmar Dornbierer hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Menschen in der Vielfalt des Lebens in ihren Geschichten auftreten und sprechen zu lassen.
Mit ihren „Frauen mittendrin“ beschreibt die Autorin die „Mittendrinkrisen“ des ganz normalen Schweizer Alltags, aus dem jedoch ihre Protagonistinnen ausbrechen wollen. Mittendrin steht Eliane, eine lebenslustige Mitvierzigerin, die sich in ihrer neugewonnenen Freiheit zurecht zu finden versucht. Die Tücken des Online-Datings, Traumprinzen und Frösche, Un- und Missverständnisse, Beziehungsknatsch und Generationenwechsel begleiten sie. Die Heldinnen der „GeschiCHten“ und Eliane selbst stehen mittendrin im Leben. Elianes Weg säumen sowohl Erfolgserlebnisse als auch Reinfälle und oft unfreiwillig komische Situationen – ganz nach ihrem Motto: „Wer in viele Fettnäpfchen tritt, hat wenigstens immer gut eingecremte Füsse…“
Inhaltsverzeichnis
Prolog — Mittendrinkrise
Frauen und die dazugehörenden Männer und Kinder – Mittendrin im Leben, und somit mittendrin in der Krise – Das mittlere Alter, und die mittleren Einkommensebenen – Menschen, denen mittendrin bewusst wird, dass es noch Träume gibt.
1. Kapitel — GeschiCHten
Helvetische Elegie
Der ganz normale Alltag der Familie Nägeli-Hotz – Schweizer Namensgebung – Die wahrgewordenen und die untergegangenen Träume – Anna-Regula Nägeli-Hotz, Ehemann Erwin, Söhne Alex und Kevin.
2. Kapitel — GeschiCHten
Schweizer Wortmonster und Monsterwörter
Eigenheiten der Schweizer Sprache – Cervelat-Notstand und Wortkannibalismus – Immer wieder Ruccola: Von Unkraut und südeuropäischen Mehlprodukten – Das „Hörnli“, womit nicht der gleichnamige Berg gemeint ist – Schweizer Essgewohnheiten – In einen kleinen Land gibt es nicht genug Platz für grosse Wörter – Das „Eingeklemmte“ und die „Serviertochter“.
3. Kapitel
Eliane und der Mann unter ihrer Dusche
Das erste Date nach der Scheidung – Die Logistik eines Rendezvous – Nahrungsaufnahme vor dem Paarungsritual – Der sportliche Mann und die Einrichtung aus dem Versandhauskatalog.
4. Kapitel
Elianes Leben vor der Freiheit
Enttäuschungen einer Ehe – Die helfenden Ehegattinnen – Mittendrin in Haus und Familie – Meine Träume und deine Träume sind nicht unserer Träume – Elianes Rebellionen – Der Schweizer Mittelstand.
5. Kapitel
Eliane und Berührungen
Die Auffahrkollision und das verpatzte Wochenende – Kevin und der Z3 – Eliane und Kevin.
6. Kapitel — GeschiCHten
Generation X und das Tetrapack
Erinnerungen an die Achtziger: Als das Tetrapack noch Feindbild war – Unterhaltung zweier Frauen mittendrin – Öko-Wahn, Vegetarismus, Baby-Tragetücher und selbstgenähte bunte Hosen – Vom Anrecht auf berufliche Aufstiegschancen junger Frauen – Wechselnde Milchverpackungen.
7. Kapitel
Eliane und Fabienne
Mutter und Tochter im Gespräch ….. irgendwie….
8. Kapitel
Eliane und die Privatsphäre
Vom Heranwachsen in den Siebzigern – Die „Lättlicouch“, die Tupperparty und die Pril-Blümchen – Elianes Wünsche Tänzerin zu werden – Eliane und die Musik – Eliane und die Bücher – Eliane und die Unmöglichkeit der Selbstbestimmung.
9. Kapitel
Eliane und die Schweizer Tierwelt – Bestiarium helveticum
Schweizer Bezeichnungen für viele Arten von Zeitgenossen – Der Tanzabend – Kleine Tänzertypologie – Die nicht immer gewollte kulturelle Bereicherung – Eine „ganze Volière voll glatter Vögel“.
10. Kapitel
Eliane und mit Büromäusen tanzende Bürowölfe
Fortgesetzte Tänzertypologie – Effizienz und Assistenz auf dem Tanzparkett – „Schatz, kommst du?“
11. Kapitel — GeschiCHten
Der „Schweizerische Beobachter“
Ein Presse-Erzeugnis als Ratgeber in allen (schweizerischen) Lebenslagen – Die Durchschnitts-Schweizer Stefan und Nicole Müller – Beliebteste Einrichtungsgegenstände, beliebteste Beschäftigungen, beliebteste Familienkrisen.
12. Kapitel — GeschiCHten
Brüche
Gedanken einer Psychologin und Eheberaterin am Abend nach Praxisschluss.
13. Kapitel
Eliane und die Glückwünsche zum Kind
Die neuen Namen der neuen Generation – Nichts ist mehr wie es war.
14. Kapitel
Eliane und die Erfindung des Rads
Von kulturellen Unterschieden und wie sie sich an einem Parkplatz im Wohnquartier äussern – Was Autoaufkleber verraten – Homers „illyrische Jünglinge“ und ihre fahrbaren Untersätze – Das Rad bestimmt das Leben – „Radikal“ kommt von „Radfahrer“.
15. Kapitel — GeschiCHten
Februar 2007 – Eine Winterreise
„Eine Winterreise“: Dokumentarfilm über die erste Frau im Schweizer Bundesrat – Frauen in Politik und Öffentlichkeit und der weite Weg dahin – Der Weg zum Wohlstand einer Fabrikarbeiterfamilie – Reise in die Vergangenheit einer Generation.
16. Kapitel
Eliane und der Chat – Spüren schreibt man ohne H
Erinnerungen einer Chat-Queen – Wie Schreibfehler die erotische Anziehungskraft untergraben können – Der Chat: Vergnügungsquelle und Intelligenztest.
17. Kapitel — GeschiCHten
Medien- und Körperwahn
Der Sinn und Wahnsinn der plastischen Chirurgie – Von entfernten Körperteilen eines Filmstars – Der „Vierziger Service“ und andere, drastische Sprachgewohnheiten.
18. Kapitel — Eliane und der falsche Film
Von Szenen, die nur in schlechten Fernsehserien passieren – Die Erkenntnis, dass die Szenen zwar schlecht, jedoch real sind – Ein Tanzabend vor Weihnachten – Der Mann im Bett und der Mann an der Tür – Der Wiedergänger.
19. Kapitel
Eliane und die Schweizer Italianità
Von mediterraner Küche und dem Gift der Borgia – Schon wieder Ruccola – Ruccola und Pasta – Ruccola mit Pasta – Weitere kulinarische Verbrechen an der Menschheit.
20. Kapitel — GeschiCHten
Netzwerke
Auch eine Spinne denkt vernetzt – Von der Pflege der Kontakte – Warum nicht nachsehen wer geschrieben hat, anstatt „die Mails zu checken“ – Intel inside …
21. Kapitel
Eliane und die temporäre Verblendung
Der Klingelton des Schicksals – Der Gelehrte – Die Korrespondenz der Madame de La Fayette mit Monsieur de La Rochefoucauld – Ein Mann mit Grundsätzen und Prinzipien – „Nouvelle Vague“ in der Badewanne – Oh, du gefährliche Weihnachtszeit.
22. Kapitel
Eliane und Paralleluniversen
Der Online-Chat – Nebeneinander leben – Beziehungen, Familien, Generationen: Fremde Welten, die sich nur selten berühren – Von Traumtänzern, Prinzen und einigen Fröschen – Elianes Fazit.
23. Kapitel — GeschiCHten
Die alten Damen vom Dorf
Grossmütter sind entspannt – Bei „Grosi“ macht Kindern das Aufräumen Spass – Die Ratlosigkeit der Mütter darüber – Rückblicke und Lebensgeschichten – Geschichten aus anderen Zeiten und anderen Welten.
Epilog
Die Enden der Mittendrinkrisen
Das Leben ist komplexer als eine Erzählung – Über Erinnerungen und verstrickte Tatsachen – Das Gute an Mittendrinkrisen: „Am Ende haben wir alle etwas zu erzählen“.
Prolog
Mittendrinkrise
Frauen und die dazugehörenden Männer und Kinder – Mittendrin im Leben, und somit mittendrin in der Krise – Das mittlere Alter, und die mittleren Einkommensebenen – Menschen, denen mittendrin bewusst wird, dass es noch Träume gibt.
Dieses Buch handelt von Mittendrinkrisen. Die Geschichten erzählen von Frauen – und den dazugehörenden Männern und Kindern – die alle mittendrin im Leben stehen und somit mittendrin in der Krise. Es wird erzählt von Leuten des mittleren Alters, und der mittleren Einkommensebenen – Leuten, denen mittendrin bewusst wird, dass es noch Träume gibt. Sie reagieren darauf wie die meisten Menschen – das heisst verstört, panikartig, fluchtbereit. Aus den Krisen entwickeln sich Erfahrungen, aus den Erfahrungen Erlebnisse, aus den Erlebnissen Situationen, die oft komisch sind, aber noch öfter heillos verworren scheinen. Frauen – und die dazugehörenden Männer und Kinder – auf der Suche nach einem Kick, einem Sinn, einem Wendepunkt. Mittendrin im Leben und inmitten der Mittendrinkrise.
Krisen treffen immer mittendrin. Mittendrin im Leben. Mittendrin in der Arbeit, in Beziehungen, in der Familie. Eine Krise erwischt einen immer mittendrin in etwas. Nie zu Beginn, denn da herrscht Begeisterung. Selten am Ende, denn da breitet sich schon Müdigkeit aus. Eine Krise kommt, wenn man sich schon ein wenig eingewöhnt hat, sich ein bisschen seine Komfortzonen geschaffen hat, wenn man nicht mehr so aufmerksam ist.
Krisen beginnen schon ganz früh im Leben und die klassische Krise packt einen am Wickel schon als Wickelkind. Dann geht es weiter im Kindergarten, wenn die Mutter plötzlich weggeht. Am schlimmsten ist es während eines Schulklassenlagers, egal in welcher Klasse. Die Krise kommt mittendrin – meistens am Mittwoch.
Mitte der Woche. Mittendrin. Im Klassenlager. Wenn man genauer darüber nachdenkt, wird es sonnenklar: Am einem Samstag reisen aufgeregte und freudig begeisterte Schüler zusammen mit Lehrkräften und Aufsichtspersonen an den Lagerort. Irgendwo naturnah. Die Kinder sollen eine Woche in der Natur und frischer Luft mit körperlicher Bewegung zubringen. Das ist gesund. Das stärkt den Zusammenhalt. Das meinen die Lehrer und die Aufsichtspersonen. Die Kinder allerdings, erleben diese pädagogisch wertvoll geplanten Tage meist anders. Nach der Anreise muss man sich erst einmal an den neuen Ort gewöhnen, ans Haus oder an ein Zeltlager. Am Montag lernt man die Hausordnung, man motzt über das Handyverbot und man gewöhnt sich an die Mahlzeiten – kulinarisch und zeittechnisch. Dann erkundet man die nähere Umgebung. Am Dienstag hat man vielleicht schon die erste längere Wanderung hinter sich, und ganz sicher hat man mindestens zwei Nächte lang nur sehr kurz geschlafen, man will schliesslich die Streiche der Mitschüler, die Kissenschlacht und die dadurch ausgelöste Aufregung der Aufsichtspersonen nicht verpassen. Am Mittwoch gibt es dann noch eine längere Wanderung, die bereits Erschöpfungsanzeichen mit sich bringt, und am Abend heult sicher schon das erste Kind in die Erbsensuppe weil irgendjemand angefangen hat von zu Hause zu sprechen, oder von der Familie – oder ganz gefährlich: von der Mutter. Nun tropfen vielleicht schon weitere Tränen ins Kartoffelpüree und ins Dessert, und im Schlafsaal wird es dann ganz schlimm. Diese Nacht fehlt der Schlaf sicher sowohl den Schülern als auch Lehrern und Aufsichtspersonen. Die Mittendrinkrise ist da.
Eine solche Mittendrinkrise ist das sichere Anzeichen, dass man zumindest einmal tief durchatmen und eine Standortbestimmung anstreben müsste. Wo bin ich? Wie soll es weitergehen? Zugegeben, in einem Klassenlager ist das ziemlich einfach, denn am Samstag geht es ja wieder zurück nach Hause, zum ersehnten Wohnort, zu den verklärten Geschwistern und den fast schon heilig gesprochenen Eltern.
Doch was, wenn man kein Kind mehr ist? Wenn man keine Lehrer und keine Aufsichtspersonen mehr hat, die helfen? Was ist, wenn man nun selbst eine Aufsichtsperson ist? Was geschieht dann, wenn einen die Krise mitten im Leben packt und kräftig schüttelt?
Kluge Köpfe sagen, dass die Krise nur eintrifft, um uns eine Gelegenheit zu geben weitere Lebensperspektiven zu überdenken. Um dem Leben eine Wendung zu geben. Um zu sortieren und auszumisten, was verbraucht und unnütz geworden ist. Um neue Hoffnungen und neue Wege zu suchen und zu finden. Aha. Aber warum ist dazu überhaupt eine „Krise“ notwendig? Und: muss denn unbedingt immer alles verändert werden, wenn man sich in einer Krise wähnt?
Es könnte doch auch ein Fingerzeig sein, um durchzuhalten. Das Kind im Klassenlager soll lernen durchzuhalten und nicht aufzugeben. Meistens findet es am nächsten Morgen nach dem Frühstück die Welt wieder halbwegs in Ordnung und möchte sich wieder an den Aktivitäten der anderen beteiligen, die nicht so unter Heimweh leiden, und die sogar froh sind einmal der häuslichen Familienenge zu entrinnen.
Durchhalten. Wenn eine Krise mittendrin ins Leben platzt … durchhalten… Und wann ist mitten im Leben? Mit zwanzig, mit dreissig, mit vierzig, mit fünfzig Jahren? Erstaunlich. Im aktuellen Sprachgebrauch findet sich die früher so oft zitierte „Midlife Crisis“ nicht mehr. Wurde sie durch den „Burnout“ verdrängt? Es scheint so. Schliesslich steckte hinter einer „Midlife Crisis“ meist ein hirnloser Kurzschluss, eine Schnapsidee, verursacht durch das Entdecken der ersten grauen Haare oder Augenfältchen. Der „Burnout“ jedoch, hat etwas heldenartig märtyrerhaftes an sich. Einen „Burnout“ umweht der Nimbus des Opfers zum Wohle der Gemeinschaft, das restlose Aufbrauchen der Arbeitskraft für Betrieb und Familie. Das gibt den Lorbeerkranz aufs Leidenshaupt und sichert einem das Mitgefühl von anderen Stressgeplagten. „Burnout“ als sichere Folgeerscheinung des schonungslosen „ich schaffe das“. Doch ob nun „Midlife Crisis“ oder „Burnout“, das Vokabular und die Sprachen mögen sich ändern – die Geschehnisse hinter den Begriffen ändern sich selten.
Was löst eigentlich Krisen aus? Vielleicht ist das Klassenlager der Schüler eine Metapher fürs Leben? Zu Beginn ist man aufgeregt und begeistert, man freut sich auf alles Neue, man erkundet und erforscht. Doch dann setzt allmählich der Gewöhnungseffekt ein, die Komfortzone, der Alltag. Man arbeitet und möchte etwas erreichen, man möchte Anerkennung und will seine Fähigkeiten beweisen. Die Jahre vergehen, und vielleicht gelingt vieles von den Plänen, Vorhaben und Projekten. Doch was dann? Man hat gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist, wie man sich vielleicht aneinander aufgerieben hat, wie müde man geworden ist. Dann trifft die Mittendrinkrise mittendrin im Leben. Plötzlich wird bewusst wie knapp die verbleibende Zeit noch ist. Möglicherweise lassen sich einige Pläne nicht mehr verwirklichen. Möglicherweise ist es für einige erträumte Dinge einfach zu spät. Krise. Mittendrin. Erster Schritt. Was danach folgt ist schlimmstenfalls Resignation. Man dümpelt vor sich hin und es vergehen nochmals fünf, zehn, fünfzehn Jahre. Im besten Fall wird man in der Lage sein den eigenen Lebensweg gründlich zu überdenken, die verwirklichbaren Träume von den verlorenen zu trennen und dementsprechend zu handeln. Wohl den Glücklichen, die klare Sicht behalten.
Der Grossteil der Menschheit sieht sich jedoch hin und hergerissen zwischen Fluchtgedanken und Pflichterfüllung. Vielleicht wird man sogar wütend, doch es nützt auch nichts nur beim Ärger zu verweilen. Eine Mittendrinkrise kann zur Erkenntnis verhelfen, dass das Leben gelebt werden will und dass man schon die Hälfte davon verbraucht hat, nur um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Die Mittendrinkrise kann ganz schön an einem rütteln. Wo ist nun die erträumte Selbständigkeit und Unabhängigkeit? Was ist mit der viel beschworenen Individualität und Selbstverwirklichung passiert? Was blieb unter dem Strich von der ganzen Pflichterfüllung und dem Angepasstsein – und wo wurde beides übertrieben?
Dann die Erleuchtung: Wo habe ich Träume anderer Leute einfach übernommen? Wo habe ich mich verleiten lassen Ideale und Ziele anzunehmen, die nicht zu mir passten? Wo habe ich mich einspannen lassen? Wo war ich nicht mutig genug gewesen? Danach die Erkenntnis: Falsch gemacht habe ich eigentlich nichts und doch alles. Das ist Mittendrinkrise auf dem Höhepunkt.
1. Kapitel
Helvetische Elegie
Der ganz normale Alltag der Familie Nägeli-Hotz – Schweizer Namensgebung – Die wahrgewordenen und die untergegangenen Träume – Anna-Regula Nägeli-Hotz, Ehemann Erwin, Söhne Alex und Kevin.
Sie hiess Anna-Regula Nägeli-Hotz, war 45 Jahre alt und hasste ihren Namen. Schweizer Durchschnitt. So durchschnittlich, dass nicht einmal die Deutschen darüber lachten. Durchschnittlichster Durchschnitt, unbeachtet. Wurde man in den sechziger Jahren in der Schweiz geboren, lief man eben Gefahr solche Namen zu tragen. All die Sandras, Sabrinas, Leas und Lauras waren noch eine Generation weit entfernt. Schon Andrea, Daniela oder Edith wären besser gewesen oder Irène. Doch wenn Anna-Regula an ihre Mitschülerin Iréne Meier aus der Sekundarschule dachte, erschien Irène doch kein dermassen erstrebenswerter Vorname. Es hätte allerdings auch schlimmer kommen können: Annerös, Käthi, oder Marianne – ausgesprochen ohne E am Schluss, und betont auf der ersten Silbe. Wie um Anlauf zu holen, um über R und I zu springen, um schliesslich auf die beiden N zu plumpsen, wobei das zweite der beiden A dunkel und schwerfällig in der Tiefe lauerte. Anna-Regula war auch immer noch besser als Brigitte – mit G in der Mitte, und ohne E am Schluss. Igitt – Brigitt, hörte sie einmal jemanden über eine frühere Klassenkameradin lästern. Schlimm, diese Schweizer Variante. Bar jeglichen Wundercharmes der französischen Brigitte – ohne die erdenhafte Verbundenheit einer irischen Bridget, welche selbst Engländer bezaubern kann, und ohne die präzise Akkuratesse einer deutsch organisierten Brigitte – bitte, MIT E am Schluss.
Dazu diese schrecklichen Übernamen, die sie sich in der Schule gegeben hatten – als Kosewörter konnte man das wohl kaum bezeichnen: d’Vrene, d’Ursle, d’Gritle, d’Lise – alles auf der ersten Silbe betont und mit kurzen Vokalen – kantig, unelegant, sperrig, zürcherisch. Verena, Ursula, Margrit, Elisabeth. Die Jungs – doch die nannte man damals noch Buben – das waren: de Fix, de Khüde, de Dschäge, de Kenzgi, de Peschä, (das sch zu einem unschreibbaren, französisch anmutendem Laut mutiert …): Felix, Kurt, Jakob, Karl, Peter. Immer schön mit dem vorangestellten Artikel. Wobei Jakob – der arme Kerl – nach seinem Vater hiess, den es aus den Höhen des Appenzells in den Kanton Zürich verschlagen hatte, und Karl als Name an sich schon ungewöhnlich war. In Zürich hiess man nur selten Karl – weder in der Stadt noch auf dem Land. Und schon gar nicht Hebeisen zum Nachnamen. Warum wohl, sinniert Anna-Regula auch heute noch, hiess Karls ältere Schwester: Aurora?
Jack, Jacky, Dschägg, Dschäge – so verlief die Entwicklung des damals schon antiquierten Namens Jakob. Der Namensträger hatte sich wohlweislich nach der Schulzeit in die Innenstadt von Bern abgesetzt, wo er sich als begnadeter Starcoiffeur niederliess und sich von da an Jacques nannte…
Anna-Regula Hotz, Anne-Rägeli, s’Hotze Anne-Rägeli, DAS Anne-Rägeli. Das Mädchen – Substantiv, sächlich. Alle wurden sie damals so genannt und mit abgestuften Verkleinerungen bis ins Erwachsenenalter bedacht: s’Vreneli – s’Vreni, s’Anneli – s’Anni. Es wurde auch nicht besser, als Anna-Regula Erwin Nägeli heiratete. Das reime sich, konstatierte ein maliziöser Cousin: Anne-Rägeli Nägeli – s’Nägeli-Rägeli…. Am liebsten hätte sie ihm damals einen Tritt verpasst, doch sie beherrschte sich damenhaft, und bedachte den Cousin nur im Geist mit zürcherisch-scharfkantig unflätigen Ausdrücken, die jeglicher Übersetzung trotzen. Der Cousin, Beat Vollenweider, (immer schön auf der ersten Silbe betonen, das N bei Vollen- weglassen und das EI zu einem AI dehnen, vielleicht noch besser zu einem AÄI…) hatte keinen, überhaupt und absolut keinen, Grund sich über die Namen seiner Cousine zu belustigen. Beat Vollenweider, der Sohn von Ruth und Urs Vollenweider-Aeby. Welch ein Name! Ein plumphüftiges Ä zu einem AE exotisch aufgemotzt und ein geheimnisvolles Ypsilon am Namensende, als käme man nicht aus dem Tösstal sondern aus dem Welschland! Pardon! Aus der „französischsprachigen Schweiz … der „Romandie“!
Beat und Urs – schweizerischer ging es wohl nicht mehr – Beat und Urs – Namen, die in dieser männlichen Form wohl nie die Schweizer Landesgrenzen überschritten hatten. Ursula, Uschi, Ursel, Ulla hatten sich oft im deutschsprachigen Raum umgesehen. Beatrice, Beatrix, Béatrice oder gar Béa – konnte man eine gewisse weltläufige Koketterie nicht absprechen – Beate jedoch, hiess man nie in der Schweiz. War man als katholisches Mädchen in einem Innerschweizer Kanton zur Welt gekommen, konnte es aber durchaus sein, dass man als Vornamen Beata erhielt.
Und was war mit Felix und Regula – den Stadtzürcher Märtyrer-Patronen, die sogar die Reformation eines Huldrych Zwingli überlebt hatten? Felix, Regula und Exuperantius. Der letzte ging wohlweislich vergessen, doch die beiden ersten lieferten jahrhundertelang Modenamen für sämtliche Gesellschaftsschichten des Kantons. Sogar in die streng reformierten, papiertrockenen, Zürcher Amtsstuben hinein hatten es jene Märtyrer geschafft, wo sie bis heute zu dritt auf dem Amtstempel – ein jeder seinen dazumal abgeschlagenen Kopf in den Händen tragend – Beglaubigungen der Staatskanzlei zieren. „Eine etwas kopflose Gesellschaft, diese Zürcher Stadtpatrone“, hatte Anna-Regula jedes Mal beim Betrachten des Behördenstempels in ihrem Pass gedacht. Doch auch das war bereits Vergangenheit und der neue Schweizer Pass erstrahlte – elektronisch einlesbar – im neuen, gesamtschweizerisch uniformen Design. Die Märtyrer hatten zwar die Reformation überlebt, mussten jedoch der Reform weichen.
Aus dem Wunsch heraus sich zu verändern, den elterlichen Namenszwang zu umgehen, nannte sie sich fortan nur Regula. Ein fataler Irrtum, wie sie feststellen musste, als sie nach der Sekundarschule ihre Banklehre begann und auf Internationalität stiess. Die angelsächsische Welt verballhornte mit freudigem Genuss den so südländisch aussergewöhnlich klingenden Namen. Von da an wurde aus Regula die Weltbürgerin Anna R. Hotz. Das machte sich gut, das zahlte sich aus, und die Lehre wurde mit Erfolg abgeschlossen.
Was, zum Teufel, hatte sie wohl bewogen anfangs der Achtziger ihren älteren Bruder in einem israelischen Kibuzz zu besuchen? Eigentlich hatte sie sich um den Job in New York bewerben wollen. Zumindest ein Praktikum bei ihrer Bank hätte sie dort absolvieren können. Doch stattdessen trafen ständig begeisterte Briefe ihres Bruders zu Hause ein, der sich für ein Jahr zur Arbeit in einem Kibuzz verpflichtet hatte. Es war sehr im Trend gewesen – damals. Wer seine sozialpolitische Gesinnung zeigen wollte, ging in einen Kibuzz. Der vergessene Schweizer Trend. Anna-Regula hatte kurzerhand den Flug gebucht und war zu Besuch gereist.
„Bei den Schweizern hängt immer die gewaschene Wäsche vor den Unterkünften“, spöttelte der junge Mann, der sie nach ihrer Ankunft im Kibuzz zur Wohnung ihres Bruders führte. Reine Wahrheit: In jeder Behausung – vor der sich fein säuberlich gewaschene und sorgfältigst zum Trocknen befestigte Wäsche im Abendwind bewegte – wohnten Schweizer.
Irgendwann kehrte sie zurück und musste feststellen, dass ihr damaliger Freund keinesfalls ihrer Ankunft entgegen gefiebert hatte, sondern sich mit einer Maja Bosshard getröstet hatte, die zu ihren hellblonden Haaren auch noch eine beachtliche Oberweite aufwies. Anna-Regula war über diese Entwicklung nicht weiter traurig gewesen. Nach all den Kibuzzim, die sie kennen gelernt hatte, und von denen einige sehr anziehend auf sie gewirkt hatten, war sie bereit Walter „Walti“ Rüegsegger den Laufpass zu geben. Dann lernte sie Erwin Nägeli kennen. Gross, sportlich, ehrgeizig. Versicherungskaufmann. Einmal die eigene Agentur leiten – darauf arbeitete Erwin hin, und dazu gehörte auch eine Ehefrau, das Reihenhäuschen in der Agglomeration und wenn möglich zwei Kinder – am liebsten ein Mädchen und ein Junge – in dieser Reihenfolge. Klassisch. Schweizerisch. Erfolgreich tüchtig.
Anna-Regula liess sich von der Aussicht auf die Idylle verführen. Sie liess sich auch von Erwin Nägeli verführen. Erwin, 185, schlank, dunkelblond, blaue Augen, Hobbyfussballer. Nach dem Fussball kam das Tennis und die beiden Söhne, Alex und Kevin. Die neue Generation, mit neuen dynamisch-internationalen Namen ausgestattet und im klassischen Altersabstand von zwei Jahren geboren – spielte schon bald nach dem Kindergarten Fussball bei den Junioren der lokalen Mannschaft, und schmetterte voller Freude Tennisbälle übers Netz des Clubs, in dem der Vater Mitglied war.
Die perfekte Familie. Fernsehserienreif. Familie in Serie. Nur das obligate Haustier fehlte noch. Damit die Kinder schon früh Verantwortung lernten. Ein lebendes Geschöpf braucht Fürsorge und Pflege. Alles im Sinne einer modernen Kindererziehung. Am Haustier können Kinder diese Fürsorge und Pflege am besten erlernen. Jene Fürsorge und Pflege, welche nach den ersten haustierbegeisterten Monaten stillschweigend auf die Mütter übergeht, weil diese es satt haben, vom Hund begangene Verwüstungen im Vorgarten zu beheben, Hundehaare und Pfotenspuren im ganzen Haus wegzuputzen, und ihren sonstigen tausendundeins Ermahnungen an den Nachwuchs noch weitere hinzuzufügen. Glücklicherweise wurde Anna-Regula durch ihre Tierhaarallergie vor dem üblichen Familienhund gerettet. Ein Golden Retriever hätte es nach Erwins Vorstellungen werden sollen, oder sogar ein Mischling – Hauptsache Familienhund. Im Stillen segnet Anna-Regula ihre Allergie. So blieb das Reihenhaus von Tieremanationen verschont und sie selbst vor regelmässigen Spaziergängen mit dem Vierbeiner.
Das Reihenhäuschen ist der Stolz der Familie. Erwin war erfolgreich im Beruf. Erwin konnte es sich leisten seiner Familie ein Heim zu bieten. Insgeheim beneidete Erwin die Nachbarn um ihre freistehenden, grösseren, und richtigen Wohlstand signalisierenden Häuser, umgeben von Gärten und Sitzplätzen, inklusive Swimmingpool. Eine überdachte Terrasse wäre auch schön gewesen. Manchmal mischte sich in Erwins Besitzerstolz der bittere Gedanke, es nicht geschafft zu haben. Der Traum von den eigenen vier Wänden hatte sich nicht nach seinen Erwartungen erfüllt. Es ist nur ein Reihenhäuschen geworden – vier Zimmer, Garage, Keller. Im Sommer musste das aufblasbare Planschbecken genügen und vor dem Hauseingang begannen sich Fahrräder zu sammeln. Waschküche und Bastelraum im Keller. Bastelkeller. Das Refugium, welches nicht aufgeräumt zu werden braucht. Doch das Wort ist zu abgegriffen. Es heisst jetzt Hobbyraum. Das deutet zumindest auf sinnvolle, erzieherisch wertvolle Freizeitbeschäftigung hin. Im Laufe der Zeit wurde aus dem Hobbyraum „das Büro“. Wer hatte denn in dieser Familie schon ein „Hobby“, das im Keller ausgeübt wurde? Der Hobbyraum musste dem praktischen Zweck weichen und Anna-Regula, die Bankangestellte, konnte endlich der administrativen Seite der Haushaltführung all ihre Aufmerksamkeit eines unterdrückten Berufswunsches widmen. „Das Büro“ als Ventil der jahrelang verdrängten Sehnsucht nach ergänzender, entlohnter und Anerkennung bietender Tätigkeit.
Das Reihenhäuschen – zwar ohne Terrasse, doch mit französischem Fenster im Elternschlafzimmer – ist blitzblank. Jederzeit kann unerwarteter Besuch mit ruhigem Gewissen empfangen werden. Das Reihenhäuschen ist zum Mittelpunkt von Anna-Regulas zielgerichteter Arbeitseffizienz und ihres unterschwelligen Ehrgeizes geworden. Ehemann und Söhne fanden immer saubere Wäsche in ihren Schränken vor, die Sportsachen waren aufgeräumt, die zwei kleinen Gemüse- und Beerenbeete im Vorgarten wurden aufs Innigste gepflegt. Der Haushaltmaschinenpark für Geschirr, Wäsche und Kaffee: immer entkalkt und einsatzbereit. Jeweils im Februar ging man eine Woche lang Skifahren und im Sommer fuhr man ins Tessin – oder irgendwo ans Meer, wo es kinderfreundlich war. Die Söhne machten eine nicht allzu schlechte Figur in der Schule und zum Sekundarschulabschluss reichte es alleweil. Doch was dann? Eine Banklehre für Alex? Ein Handwerk für Kevin?
Anna-Regula mag nicht nachdenken, denn wenn sie nachdenkt, dann beginnt ein Bild aus den Nebeln eines nicht wahrgenommenen Unterbewusstseins aufzusteigen: Der Kibuzz damals, die Pläne, die Arbeitsstelle, die Ideale, die Hoffnungen! Sprachen wollte sie lernen, reisen, Kulturen kennen lernen, ihren Kindern später davon erzählen, sie zum besseren Verständnis, zur interkulturellen Offenheit führen! Was hatte sie erreicht? Wenn das Aromat zum Gurkensalat fehlte, gab es Zoff am Mittagstisch. Aromat. Das allerschweizerischste an der Schweiz!. Fast noch schweizerischer als die Namen Beat und Urs. Maggi, ja, das hat den Sprung auf den internationalen Markt geschafft, Maggi ist ein Begriff – aber Aromat? Aromat von Knorr? Mit dem Knorrli-Männchen als Werbefigur? Zürcher Rahm-geschnetzeltes mit Aromat. Dazu Röschti oder Teigwaren. Zugegeben, es schmeckt fantastisch. Es gaukelt eine Welt voll von mütterlicher Fürsorge vor. Eine Welt, in der alles geregelt, alles sauber, alles gewaschen und geflickt ist. Einer Welt, in der für die Familie gesorgt wird, in der alles für das Kind getan wird. Einer Welt, in der man sich um die Hausaufgaben des Nachwuchses kümmert, einer Welt in der man spielt, bastelt, Weihnachten mit den Grosseltern feiert und regelmässig den Hund (mit dem unvermeidlichen braunen Plastikbeutel am Halsband….) spazieren führt….
Wo kommen aber plötzlich all die gewalttätigen Jugendlichen her, die Aufsässigen, die rücksichtslosen und verwöhnten Gören? All die – wie nennt man sie jetzt? das im Keller ausgeübt wurde junge Erwachsene… Jugendlich, die Probleme mit Alkohol oder Drogen haben, oder mit beidem, und mit anderen Dingen noch dazu? Rauchen auf dem Pausenplatz während der Schulzeiten – und die Schulleitung stellt sogar „Raucherhäuschen“ am Rande der Plätze auf, damit man die renitenten Schüler wenigstens ein bisschen unter Aufsicht hat. Dann – die überall anschwellende Aggression der Jugendlichen, mit der sie lautstark und egoistisch Forderungen stellen. Dazu der entsprechende Sprachwandel, der diese Aggressivität auch verbal zum Ausdruck bringt und sogar die Sprachmelodie und den Akzent ins Gutturale verwandelt. Ist dies allein mit „Pubertät“ und Freiheitsdrang zu erklären? Was ist überhaupt „Freiheit“?
Anna-Regula Nägeli-Hotz betrachtet sich nachdenklich im Spiegel im Schlafzimmer ihres Reihenhäuschens. Sie denkt über die Freiheit in Familienbeziehungen nach. Was war schief gelaufen, und wann? Hatte sie etwas falsch gemacht? Hatte ihr Mann etwas falsch gemacht? Der Mann ist seit Monaten verschwunden – er wird auch nicht wiederkommen. Nach den geltenden Regeln der Gesellschaftsethik – der Schweizer Gesellschaftsethik – geht jeder Fehler zu seinen Lasten. Doch Anna-Regula will sich da nicht so sicher sein. Ihr Erwin ist in Brasilien. Ihr Erwin hat die Scheidung eingereicht. Hatte ihr damals Erwin bei der Hochzeitszeremonie nicht versprochen, sie gut zu versorgen? Versorgen – auch so ein Wort von schweizerisch tüchtig vorsorglich umsorgender Fürsorge. Doch das Wort versorgen hat noch eine andere Bedeutung: wenn man etwas versorgt, dann räumt man es weg, schiebt es in die richtige Schublade, ordnet es, etikettiert es, legt es ab – für immer und ewig. Anna-Regulas Ehemann ist in Brasilien. Er ist nicht allein. Erwin Nägeli-Hotz hat zum ersten Mal in seinem Leben gegen die Vernunft gehandelt – und er geniesst es. Der Grund des unvernünftigen Handelns heisst: Serafina Amandinha Soares-da Silva Carvalho. Der Name klingt wie Musik, wie sanfte Samba an der Copa Cabana. Serafina Amandinha verheisst Sonne, Sandstrand und schäumende Meeresbrandung. Laue Abende auf der Veranda mit Caipirinhas und Pinha Coladas nach tropisch schwülen Tagen.
Anna-Regula Nägeli-Hotz betrachtet sich im Spiegel und kann ihrem Mann nicht böse sein. Sie ist schliesslich „versorgt“. Der Versicherungskaufmann Erwin Nägeli hat Wort gehalten. Auf seine Art.
Und die Söhne? Wie sieht deren Zukunft aus? Sohn Nummer 1, Alex, hat den Traum der Mutter verwirklicht und hat sich nach der Banklehre um einen Auslandjob beworben. Er ist jetzt in New York. In jener Stadt, von der sie einmal geträumt hatte. Sohn Nummer 1, Alex, bewohnt zwar ein winziges Kämmerchen, das er Appartement nennt und er bringt am Wochenende seine Wäsche in die Wäscherei, wo er dann, stundenlang vor der laufenden Waschmaschine sitzend, für die Karriere büffelt. Seine Sportsachen räumt er nun selbst sorgfältig akkurat weg. Sohn Nummer 1, Alex, ist sehr ehrgeizig. Er wird es zu etwas bringen, vielleicht wird er sogar ein Mädchen aus guter Familie heiraten – eine amerikanische „Ausland-Schweizerin“, davon gibt es schliesslich genug. Dann wird er eine Familie gründen und mit knapp fünfzig Jahren panikartig jene Freuden des Lebens zu finden suchen, die er seinem Ehrgeiz geopfert haben wird.
Anna-Regula Nägeli-Hotz betrachtet sich im Spiegel und fühlt keinerlei Mitleid mit ihrem Sohn Nummer 1, Alex. Er soll seine Fehler selbst machen. Er soll eigene Entscheidungen treffen und ihre Kraft zu spüren bekommen. Sohn Nummer 1, Alex, wird sein eigenes Leben leben, und seine Mutter, die Bankangestellte Anna-Regula Nägeli-Hotz, wird sich hüten, sich darin einzumischen,
Etwas anderes ist Sohn Nummer 2, Kevin. Als wäre dieser Modename der buchstäbliche neue Wein in den alten Schläuchen gewesen, dessen unerwartet neue Lebendigkeit sie zum Bersten brachte. Kevin hat sich für den Beruf des Elektrikers entschieden. Kevin will es knistern hören, will es funkeln sehen. Kevin, der charmante Herzensbrecher aller Sandras, Sabrinas, Leas und Lauras aus der Sekundarschule. Doch Kevin entwickelt neuerdings intensiv einen Sinn für interkulturelle Beziehungen – sie heissen Mirjana, Özlen oder Domenica, haben schwarze Haare, glühende Augen und Rundungen, die beim angehenden Elektriker bald einmal Kurzschlüsse verursachen werden.
Anna-Regula Nägeli-Hotz betrachtet sich im Spiegel und fühlt sich im Geiste ihrem Sohn Nummer 2, Kevin, verbunden. Vielleicht wird es endlich Zeit, dass sie selbst sich nach einem Mann umsieht, bei dem sie zum Spass ein elektrisierendes Knistern herbeiführen kann. Ihre eigenen Rundungen sind dazu immer noch imstande. Kleidergrösse 38, Körpergrösse 164, Schuhgrösse 37. Zugegeben, das ist ein kleines bisschen mollig, doch gerade das finden die meisten Männer nett, sehr nett. Das ist schön gerundet und gut gefüllt, vor allem oben herum, ohne zu viel zu sein. Ein bisschen Disziplin muss man schon walten lassen bei den vielen guten Sachen die es überall zum Essen gibt, aber der Erfolg lohnt diese Opfer. Aus dem dunkelblonden Haar lässt sich noch allerhand machen, und werden einzelne Strähnchen aufgehellt, so verschwindet auch das beginnende lästige Grau. Einen neuen Lebensabschnitt muss frau schliesslich mit einem neuen Haarschnitt beginnen. Lippenstift, Puder, Wimperntusche, das genügt, schliesslich hat sie Charakter genug. Schickes Kostüm, ein Rock, der über dem Knie endet, ein paar schicke Pumps – was will man mehr?
Anna-Regula Nägeli-Hotz betrachtet sich im Spiegel und denkt, dass es viele Arten von Musik gäbe. Vielerlei Rhythmen, zu denen man tanzen kann. Wenn Serafina Amandinha nach Samba klingt, wonach klingt Anna-Regula? Nach Disco-Swing? Foxtrott? – oder sogar Tango?
Anna-Regula Nägeli-Hotz betrachtet sich im Spiegel, lächelt und beschliesst ihre Namen als ihr eigenes Markenzeichen vor sich her zu tragen. Jene Namen, die sie seit ihrer Geburt trägt und auch jenen Namen, der ihr ein Vierteljahrhundert zuvor als zweite Identität überstülpt wurde – zumindest bis zum Scheidungsurteil... Sie lächelt noch einmal ihrem Spiegelbild zu und holt das Zeitungsinserat der Migros-Klubschule hervor, um sich für den nächsten Tanzkurs anzumelden und Französischunterricht zu nehmen.
2. Kapitel
Schweizer Wortmonster und Monsterwörter…
Eigenheiten der Schweizer Sprache – Cervelat-Notstand und Wortkannibalismus – Immer wieder Ruccola: Von Unkraut und südeuropäischen Mehlprodukten – Das „Hörnli“, womit nicht der gleichnamige Berg gemeint ist – Schweizer Essgewohnheiten – In einen kleinen Land gibt es nicht genug Platz für grosse Wörter – Das „Eingeklemmte“ und die „Serviertochter“.
… es gibt so viele davon im Schweizerdeutschen. Doch Schweizerdeutsch ist nicht gleich Schweizerdeutsch. Natürlich – alles in der Schweiz ist von Kanton zu Kanton verschieden – ein uralter Schweizer Witz über den niemand mehr lacht. Dennoch, der Witz entspricht durchaus der Wahrheit: Die Schweizer beweisen immer wieder, dass man auch auf kleinem Raum sehr unterschiedliche Lebensweisen führen kann. Unterschiedlich manchmal von Ort zu Ort. Doch eines haben alle Deutschschweizer gemeinsam: Eine monströse Vorliebe für Verkleinerungen. Kleine, süsse Wortmonster.
Ein Lastwagen fährt vorbei. Auf den grossen Werbeflächen, die die Seitenwände des Laderaumes darstellen, prangt in gut lesbaren, reklamefähigen Lettern: „Bodenbeläge & Plättli“. Dieser Lastwagen verlässt wohl kaum je die schweizerischen Landesgrenzen. Plättli… Der Schweizerdeutsche Volksmund entwickelte eine geniale Sprachfähigkeit, um Begriffe auf das Wesentliche zu verdichten. Verkleinerungen sind dabei unumgänglich. Wortkondensate mit Charakter auf den Punkt gebracht. Plättli… Plättli sind Fliesen, sind geflieste Flächen, aber das klingt viel zu gestelzt. Kacheln, schon besser, aber zu Missverständnissen neigend. Aus Kacheln bestehen auch Kachelöfen, und eine echt schweizerische Kachel – „das Kacheli“ – ist eine Trinkschale für den Milchkaffe oder den Kakao zum Frühstück. Plättli… Keramische Beläge, Wand- und Bodenbeläge aus Keramik – das klingt viel zu technisch, zu umständlich. Plättli…. Das sagt alles.
Doch, was soll man von Wortbildungen wie „Käseplättli“ oder gar“ Fleischplättli“ denken? Statten die Schweizer die Nasszellen ihrer Häuser mit dem patriotischen Milchprodukt aus – oder gar à la Kannibale Hannibal? Und was, um Gotteswillen, ist ein „Zvieriplättli“? Bitte, das „i-e“ getrennt aussprechen, sonst geht der Geschmack sowohl des Wortes als auch des „Zvieriplättlis“ verloren. Ein „Zvieriplättli“ isst man als Zwischenmahlzeit um vier Uhr. Natürlich nicht das Plättli – versteht sich, denn das besteht meistens aus Holz, oder es ist ein ganz gewöhnlicher Teller. Gegessen wird logischerweise nur das, was drauf ist: Käse mit Brot, oder ein Cervelat. Oder ein Landjäger.
Da – schon wieder der schweizerische Hang zum Wortkannibalismus. Natürlich werden keine Polizisten aus ländlichen Gebieten gegessen, (was die Landjäger früher einmal waren), sondern eine akkurat in kantige Stangenform gepresste Trockenwurst. Ob sich die früheren Landjäger im 19. Jahrhundert solche Würste für ihre eigenen „Zvieriplättli“ leisten konnten, sei dahingestellt. Ein Landjäger schmeckt auf alle Fälle gut.
Cervelat-Notstand und Wortkannibalismus
Und der Cervelat? Keine Abhandlung über Schweizer Esskultur wäre vollständig ohne dieses äusserst anpassungsfähige Schweinefleischerzeugnis. Ein Cervelat ist nicht nur einfach Wurst – ein Cervelat ist Schweizer Alltagskultur. Ist Kult per se – und mit der Qualität der Kultur im Allgemeinen, steigt oder fällt die Qualität des Cervelats. Der Cervelat als Kulturbarometer – in der Schweiz durchaus möglich. Ein Cervelat ist genormt nach Gewicht, Mass und Krümmung. Das Rezept ist natürlich auch genormt – alles ist eidgenössisch vorgeschrieben. Keine Abweichungen, sonst ist es kein Cervelat, sondern irgendeine Wurst – im schlimmsten Fall ein Lyoner. Im Jahr 2007 plötzlich der Schock: Die Cervelat-Krise war ausgebrochen. Die angesehene Neue Zürcher Zeitung titelte im Juni desselben Jahres: „Es droht eine Cervelat-Knappheit“!! In den folgenden zwei Jahren erschienen dann regelmässig Artikel in allen Presseorganen, welche die Bürger über den „Cervelat-Notstand“ unterrichteten und über die „Task Force“ informierten, die aus führenden Wirtschaftsfachkräften gebildet, dem Debakel begegnen sollte. Es ging um das Überleben der Schweizer Nationalwurst. Das leicht beschämende Detail dabei war, dass es sich beim Auslöser dieser Krise von landesweitem Ausmass ausgerechnet um brasilianische Rinderdärme handelte. Ein Schock gleichermassen sowohl für alle vier Sprachregionen der Schweiz, als auch für den Schweizer Nationalstolz: Die Wursthaut für die Cervelats lieferten brasilianische Zebu-Rinder! Ausserdem waren die Tiere auch noch vom Rinderwahnsinn bedroht! Was tun? Ohne Wursthaut keine Wurst – und an die Haut der Cervelats werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Die Cervelat-Haut soll elastisch sein, sie muss sich leicht abschälen lassen, sie muss sich für Grill und Lagerfeuer eignen. Kein Pfadfinder-Lagerfeuer ohne Cervelat am Holzstecken, die Wurst an beiden Enden kreuzweise eingeschnitten, damit sich das Fleisch auch appetitanregend krümmt und eine Kruste bildet. Kein Männerabend ohne Cervelatsalat mit herzhaft viel Zwiebel, Essiggurken und Emmentaler Käse, an einer Sauce aus Senf, Mayonnaise und Essig. Dazu ein „Bürli“…
… und wiederum steht man ratlos vor einem dieser an Menschenfresser erinnernden Wortmonster, denn was ist ein „Bürli“ anderes als ein „kleiner Bauer“, ein „Bäuerchen“. Ein richtiges „Bürli“ kommt vom Bäcker – oft aus einem richtigen, holzbeheizten Backofen. Es hat aussen eine braune, knusprige, währschafte Kruste und innen locker ausgebackenen Teig. Um mit Lust die Kruste eines „Bürlis“ durchzubeissen, braucht es kräftige Zähne. Vielleicht liegt hier die Symbolik der Schweizer Bevölkerung. Aussen hart, doch innen – wenn man den Zugang gefunden hat – angenehm, mit weichem Kern. Ein „Bürli“ hat Charakter. Es ist kein trockenes, schwammiges, identitätsloses Weggli – dessen zwei „g“ als stimmloses „k“ auszusprechen sind. Es ist auch kein hierarchisch ehrgeiziges, aber doch dickbauchiges Semmeli, das unter seiner zarten und goldenen Knusperkruste davon träumt eine schlanke Pariser Baguette zu sein.
In jedem Fall: Das „Bürli“ gehört zum Cervelat-Salat wie die Cervelat-Prominenz in die Schweizer Illustrierten. Cervelat-Prominenz… Leute mit äusserst hoch ausgeprägtem Selbstwertgefühl – so hoch, dass sie aus dieser Höhe ihre Mitmenschen nicht mehr wahrnehmen, und schon gar nicht den eigenen, sehr eng bemessenen Aktionsradius. Ausserhalb der Landesgrenzen stolpert man kaum über diese Möchtegern-Promis – denn, sollten sie ihren Bekanntheitsgrad derart ausdehnen, dann können sie, technisch gesehen, nicht mehr zur Schweizer Cervelat-Prominenz gezählt werden.
Dass die traditionsreiche Wurst, nicht ins Speiserepertoire solcher Zeitgenossen gehört – versteht sich von selbst. Der Cervelat (mit männlichem Artikel) war schon immer das „Kottelet des kleinen Mannes“. Cervelats gehörten früher auf den Tisch der Arbeiterfamilien, wenn es die Woche vor der Lohnauszahlung, dem Zahltag, zu überbrücken galt. Diese Aufgabe erfüllt der Cervelat gut und gerne auch heute. Die Cervelat-Prominenz dagegen, hält sich eher an Kottelets vom Berglamm an Balsamico-Sauce mit frischem Thymian, begleitet von getrüffeltem Champagner-Risotto. Zur Vorspeise die marktfrische „Salat-Création“ von Ruccola mit hauchdünnen Parmesanspänen und zartem San Daniele Schinken. Am Vortag hat man die handgefertigte „Pasta“ probiert in der kleinen italienischen Trattoria, dazu Lachs-Streifen an Safran-Schaumsauce; zur Vorspeise diesen wunderbar butterzarten, auf der Zunge zergehenden, den Gaumen kaum berührenden, exorbitant teuren Mozzarella burrata auf einem Bett von Ruccolablättern, beträufelt mit kaltgepresstem, jungfräulichem Olivenöl von den toskanischen, nach Rosmarin duftenden Hängen. Oder diese delikaten hausgemachten Ravioli mit einer Füllung aus Ricotta, Pinienkernen und Ruccola, begleitet von grünem und weissem Spargel an wunderbar sämigem Balsamico di Modena...
Von Unkraut und südeuropäischen Mehlprodukten
Warum immer wieder Ruccola? Woher kommt dieser unglaubliche kulinarische Siegeszug einer Grünpflanze, die nicht nur nach Unkraut aussieht sondern auch nach Unkraut schmeckt? Ruccola. Zu Deutsch Rauke. Französisch Roquette. Unausrottbar. Seit den neunziger Jahren hält sich dieses bittere Zeug unerschütterlich auf den Tellern aller, die ihrerseits etwas auf sich halten. Die Macher der landesweiten, orakelhaft trendbestimmenden Küchenbibel – „…immer mit Gelinggarantie“ – haben das Vorbild geliefert. Sie wissen, was in den tonangebenden, italienischen – pardon, mediterranen – Restaurants aufgetischt wird: Ruccola. Ruccola in mindestens drei Vorspeisevarianten, Ruccola als Beilage, Ruccola als Dekoration, Ruccola über, unter und neben Fleisch, Fisch, Gemüse, Teigwaren.
Ach, ja – Pasta. „Teigwaren“ sind out als Wort. „Teigwaren“ sind tot – es lebe „die Pasta“! Ein gehobenes Wort der gehobenen Esskultur für Schweizer Mittelständler. Dort wo noch Teigwaren gegessen werden, ist entweder das Lohnniveau bedeutend niedriger – oder man gehört zur unbelehrbar politisch-konservativen Wählerschicht. Diese lebt zumeist auf dem Land, hat Zugang zu qualitativ besseren Frischprodukten und keine Zeit für Schnickschnack auf dem Teller. Keine Zeit für „urbane Genusskultur“ wie es im Jargon der „Food-Blogger“ heisst, jener schreibenden Individuen aus der Schicht der städtischen Trendsetter. Deren Küchen-Latein weicht auch schon mal den trockenen Anglizismen. Es gibt allerdings nichts, das den Appetit mehr hemmen würde als eine auf Englisch geschriebene Speisekarte: „Tossed pasta with red chili pepper flakes, garlic, herbes and olive oil“… Es hört sich ungeniessbar an – so wie es eben in Öl ertränkte Teigwaren mit scharfem Chili und Knoblauch sind, da können auch die paar Kräuter daran nichts mehr retten. Doch die amerikanische Foodbloggerin, auf deren Website es vor ähnlichen Attacken auf den unschuldigen Magen nur so wimmelt, ist höchst begeistert. Sie schreibt auch, dass zu Hause kochen „awsome“ sei (so etwas wie „fantaaastisch!“…), weil man da verschiedene „Stile“ kombinieren könne. Ihr Foodblog in allen Ehren, aber gewisse Kombinationen lesen sich nach all dem „Stilmix“ wie Rezepte aus der Küche einer Hexe aus Grimms grimmigen Märchen.
Englisch als Küchen-Sprache ist einfach nicht anregend genug. Es vermittelt weder Sinnlichkeit noch Genuss – und es fördert Missverständnisse: In einem Zürcher Fünfsternhotel verlangte einst die magengeschädigte Führungskraft eines weltweiten Konzern eine „broth“ zur Beruhigung des gestressten Organs. Das Wort war dem Personal unbekannt, es dachte erst an Haferbrei, dann wurde „Brühe“ vorgeschlagen. Die Führungskraft erhielt daraufhin eine Tomatenbrühe, die das Magensausen auch nicht besser machte. Hätte man stattdessen eine „Bouillon“ verlangt – ja, dann – dann wäre die Sache klar gewesen – auch die Bouillon….
Obwohl, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die früher inflationär gebrauchten französischen Fachausdrücke aus den Kochbüchern verschwunden sind, da viel zu unverständlich. „Poëllierte escalopes à la nature, umgeben mit sautierter, kurz blanchierter Brunoise, begleitet von tomates concassèes oder einem cremigen Purree“…
Es ist gut, dass die Rezepte verständlicher geworden sind. So gesehen, kann „Pasta“ auch zur Verständigung zwischen der alten und der neuen Welt beitragen – wenn auch das „Püree“ aus Kartoffeln immer noch der „Kartoffelstock“ bleiben wird, zumindest in der Schweiz. Dabei gibt es zwei konträre Glaubensrichtungen: Mit einem „Seeli“ aus Sauce mittendrin oder gänzlich ohne den kleinen See… So wie „Teigwaren mit Fleischsauce“ eben auch ein ganz anderes Gefühl wachrufen, als „Pasta asciutta“. Vielleicht sollte eine Studie in Auftrag gegeben werden, um herauszufinden welche Schweizer Gesellschafts-schichten das Wort „Pasta“ und welche den Begriff „Teigwaren“ im Alltag verwenden. Möglicherweise würden dann politische Wahlen eine unterhaltsame Wendung erfahren. Zum sprachlichen „Röschti-Graben“, der die deutsch und französisch sprechende Bevölkerung mitsamt ihren politischen Präferenzen trennt, würde sich die „Pasta-Teigwaren-Schlucht“ nahtlos anfügen.
Das Wort Teigwaren verkam zu einem Begriff, der höchstens noch etwas für Kinder ist, die sprechen lernen, doch kaum haben sie es gelernt, gibt es „Pasta“ – und basta. Nudeln? Nein. Nudeln gibt es beim Chinesen oder im Thai-Bistro – und natürlich in Deutschland….
Das „Hörnli“ – womit nicht der gleichnamige Schweizer Berg gemeint ist
Wer betonen möchte, dass man durchaus noch die Schweizer Tradition in der Küche schätzt, der erweckt lieb gewordene Kindheitserinnerungen zum Leben und kocht „Hörnli und G’hackets“.
„Hörnli“ sind Teigwaren, sind gewiss keine „Pasta“. „Hörnli“ stehen manchmal auch als „Hörndli“ auf Kantinenspeisekarten, die von rechtschreibeunsicheren Köchen verfasst werden. Doch welche Rechtschreibung gilt bei einem Wort wie „Hörnli“? Hörnli sind währschaft, nahrhaft und sparsam. Hörnli kann man ausser zu Hackfleisch an Sauce auch schon mal zum Cervelat reichen, oder vollgesogen mit Salatdressing als beliebte Grillbeilage. Hörnli essen macht Spass. Hörnli gibt es in verschiedenen Grössen, doch die Proportionen entsprechen immer etwa einem Drittel des Kreisumfangs der jeweiligen Grösse. So muss es sein, denn so wurde es amtlich festgelegt und beglaubigt. Die Form des „Hörnlis“ ist Gesetz. Hörnli gibt es glatt oder gerillt. Hörnli kann man zwischen den Zähnen halten und versuchen, damit die Sauce zu schlürfen, wenn Erziehungsberechtigte nicht hinschauen. Man kann auch – vor allem wenn man etwa sieben Jahre alt ist und eine entsprechende Zahnlücke aufweist – ein Hörnli in dieser Zahnlücke festklemmen, etwas Flüssigkeit damit aufsaugen und die ganze Sauce durch das Hörnli einem ahnungslosen Geschwister ins Gesicht zu pusten. Man muss nur genug üben. Danach gibt es vielleicht nicht mehr so oft Hörnli zum Essen, aber immer ein aufregendes Schauspiel seitens der erwachsenen Personen am Tisch. Da riskiert man gerne mal eine Ohrfeige, die Show ist das wert: Losbrüllendes Geschwister – meist jünger, klar, denn ein älteres würde sich effizient wehren, aufspringende Mutter – (die Anwesenheit des Vaters wird nicht empfohlen) – umstürzende Gläser, sich auf den Boden ergiessender Sirup, aus den Schüsseln rutschende Schöpflöffel voller Sauce, herumfliegende Speiseteile. Der mütterlichen Drohung, dass der Verursacher die ganze Schweinerei aufzuputzen hätte, begegnet man mit Gleichmut und entfernt sich erst einmal Richtung Toilette, um die Sache auszusitzen. Die elterliche Aufmerksamkeit wendet sich nun sowieso dem jüngeren Geschwister zu, dass jetzt nicht mehr essen mag, oder dem Baby, das sich im Kinderstühlchen diebisch an dem Spektakel amüsiert und voll Freude sein Plastiklöffelchen in den Möhrenbrei patscht.
Kindheitserinnerungen. Aus diesem Grund werden Hörnli immer Hörnli bleiben und sich nie in „Pasta“ verwandeln. „Pasta“ essen macht nicht immer Spass, denn zu „Pasta“ gibt es viel zu oft Ruccola. Oder anderes ungeniessbares Zeug, das wie Maden und Schnecken aussieht, nach Fisch riecht, und auf das die Erwachsenen aus unbegreiflichen Gründen so scharf sind.
In einem kleinen Land gibt es eben nicht genug Platz für grosse Wörter …
Zu Hörnli gibt es meistens „Erbsli und Rüebli“. Hörnli, Erbsli, Rüebli. Mit Cervelat- oder Bratwurst-Rädli. Abends ein Chäs-Chüechli, morgens ein Birchermüesli und zwischendurch ein Gipfeli. Zu Weihnachten das Schinkli im Teig, gefolgt von süssen „Guetzli“. Am Silvester dann „Häppli“ oder belegte „Brötli“. Sonntags zum Dessert ein Caramel-Chöpfli, dem ein „Plätzli“ an Rahmsauce mit „Chnöpfli“ oder „Spätzli“ voran gegangen war. In der Sauce schwammen „Pilzli“, die sich in den achtziger und neunziger Jahren einer derart expandierten Beliebtheit erfreuten, dass dieser Umstand einem damals erfolgreichen Comedian eine eigene Nummer wert war. Leider wird das „Käffeli“ nach dem Essen vom „Espresso“ aus der Kapselmaschine verdrängt. Doch was wäre die Schweizer Küche ohne ihre liebgewonnenen Speisen, die in ihrer grammatischen Verkleinerungsform den Appetit darauf noch mehr anregen? Ausserdem – wenn das Essen in derart verbal verkleinerter Form daherkommt, dann kann der Kaloriengehalt auch nicht so gross sein….
Allerdings – man kann es auf die Spitze treiben mit den Verkleinerungen – auch im gastronomischen Bereich. Gasthäuser zum „Rössli“ gibt es zuhauf, und sie hiessen schon immer so. Doch die Restaurants zur Post und beim Bahnhof deklarierte der Volksmund einfachhalber zum „Pöschtli“ oder „Bahnhöfli“. Weisen nun die „Rösslis“ landauf landab jegliche Bandbreite des kulinarischen Repertoires bis zur Haute Cuisine auf, so sind die „Pöschtlis“ und „Bahnhöflis“ eher in der Schicht der „Beizen“ oder gar „Stammbeizen“ angesiedelt. Die „Beiz“ – und noch viel mehr eine „Stammbeiz“ – ist ein Hort jener nicht mehr zeitgemässen Männergemütlichkeit, deren olfaktorische Emissionen nach Rauch, Bier, Essensdunst und Frittieröl vor den jeweils betroffenen Ehegattinnen keinerlei Wertschätzung finden. Ein „Pöschtli“ oder ein „Bahnhöfli“ gibt es noch allerorten. Auch das dazugehörende kulinarische