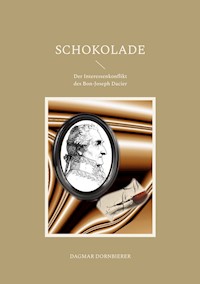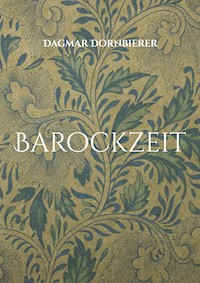Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Integration und Migration sind ein aktuelle Themen. Doch wer erinnert sich schon an eine Integration, die still und unspektakulär 1968 vonstattenging, als sich Zehntausende tschechische, politische Flüchtlinge über die ganze Welt verstreuten? Auf den damaligen Tatsachen basiert die Geschichte der fiktiven Heldin dieser Erzählung. Marcela kommt mit neun Jahren in die Schweiz, in eine fremde Umgebung, mit fremder Sprache und unterschiedlichen Lebensgewohnheiten. Im Laufe der Jahre überwindet Marcela einige "Mittendrinkrisen" und findet zu neuem Selbstbewusstsein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VON DER AUTORIN SIND AUSSERDEM ERSCHIENEN:
Spätlese
Geschichten über Geschichten
(2018) ISBN 9783752839555
Frauen mittendrin Teil I. – Eliane und ihre GeschiCHten
Gegenwartsliteratur, Vergnügliches aus der Schweiz
(2016) ISBN-9783837044799
Das Buch der gespiegelten Zeit – Inspirierte Erzählungen
(2016) ISBN-9783837044881
Impressionen
Poesie aus vier Jahrzehnten und in drei Sprachen
(2016) ISBN-9783837045017
Jan Hus – Der Wahrheit Willen
(2015) ISBN-9783734754517
IN VORBEREITUNG
Die Handschrift
Teil I – Das Zeitalter des Eisvogels
Teil II – Das Zeitalter des Drachen
Historischer Roman aus dem 14. und 15. Jahrhundert
Maria Mancini – Die Freiheit der Fürstin Colonna
Eine Romanbiographie aus dem 17. Jahrhundert
Capitor, Malerin des Bastarden
Historischer Roman aus dem 17. Jahrhundert
Die folgende Geschichte ist ein Roman, eine Erzählung in einem realen chronologischen, geographischen und kulturellen Rahmen. Ebenso real sind die allgemein gehaltenen Rückblenden über die tschechoslowakische Emigration in die deutsch-sprachige Schweiz seit dem Jahr 1968. Die handelnden Personen des Romans sind teils real, teils fiktiv, teils verändert, ihre Handlungsweise gründet aber in jedem Fall auf Beobachtungen der Wirklichkeit, auf gründlicher Recherche und persönlichen Erlebnissen. Vor allem das letzte Kapitel und der Epilog beschreiben grösstenteils tatsächliche Geschehnisse.
Um mit den Worten des Schweizer Schriftstellers Hermann Burger zu sprechen: „Die Realität wurde verfremdet bis zur Kenntlichkeit.“
Für interessierte Leser:
Zum Gedenken an die Besetzung der Tschechoslowakei und die nachfolgende, verzweifelte Tat des Studenten Jan Palach, erschien von Dagmar Dornbierer die Neuauflage einer Lesung, die von der Autorin 2005 im Zürcher Lavaterhaus gegeben wurde, unter dem Titel:
„Lieber Jan… Milý Jane…“
Ein fiktiver Brief an Jan Palach – 2005/2017
Deutsch und Tschechisch, ergänzt mit Vorwort und Erklärungen
ISBN 9783743166301
Die Autorin
Dagmar Dornbierer ist in verschiedenen Sparten, Kulturen und Sprachen zu Hause. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie unter anderem auch als Übersetzerin und Dolmetscherin. Sprachen sind ihre Instrumente und Werkzeuge – fünf davon beherrscht sie fliessend und in vier weiteren findet sie sich gut zurecht. Sie verwebt Fakten und Fiktion, Biographien und Fantasien zu intelligentem Lese-vergnügen. Dagmar Dornbierer hat es sich zur Aufgabe gesetzt, in ihren Erzählungen Menschen in der Vielfalt des Lebens auftreten und sprechen zu lassen.
Das Buch mit „Migrationshintergrund“
Mit dem zweiten Teil der „Frauen mittendrin“ beschreibt die Autorin weitere „Mittendrinkrisen“ des Alltags. Dieses Mal jedoch aus der Perspektive von Marcela, einer tschechischen Emigrantin, die, nach dem „Prager Frühling“ von 1968 als Kind in die Schweiz gekommen war. Das Thema „Marcelas stille Integration“ umfasst die Integration der damaligen tschechischen, politischen Flüchtlinge, Marcelas persönliche Integration in ihre Schweizer Familie und ihre Eingliederung in die Arbeitswelt einer schillernden Anwaltskanzlei und eines grosstuerischen Chefs. Dazu verteidigt Marcela ihren Platz als Sängerin eines Chorensembles und versucht tapfer, sich nicht von einer befehlsgewohnten Chorleiterin, frechen Kindern oder rüpelhaften Nachbarn unterkriegen zu lassen. Die Erzählung beschreibt mit bissigem Humor alle möglichen Stolpersteine, die Marcela zu bewältigen hat, und schildert auch die unerfreuliche Geschichte der letzten Lebensjahre ihres Vaters.
Marcelas stille Integration – Frauen mittendrin Teil 2
Prolog – Die Integration
Das Buch mit Migrationshintergrund – Die stille Integration – Tschechoslowakei, Schweiz und die „68er“ – Okkupation, Emigration und Flüchtlingswelle – Wie definiert man „Integration“?
1.Kapitel – 1968
Ende oder neuer Beginn?
„Rückblenden begleiten dieses Buch – Rückblenden begleiten das Leben.“ – 21. August 1968 – Aus der Sicht eines Kindes – Urlaubsreise ohne Rückkehr
2. Kapitel - 2006
Marcelas Neuanfang
Die neue Wohnung – Die neue Selbständigkeit – Erinnerungen – Böhmen versus Mähren – Die Sache mit den Namen – Identitätskrisen – Nähren und Helfen – Familienalltag – Familiengefahren – Kein Fernseher im Haus.
3. Kapitel – 2008
Marcelas Mittendrinkrise
Ausbildungen, Berufe und Jobs – Der Wiedereinstieg – Die Kanzlei – Chefs und Sekretärinnen – Das Image eines Anwalts – Heimliches und Unheimliches.
4. Kapitel – 2009 - 2010
Marcelas Musik
Ohne Musik geht gar nichts – Der Chor – Die neue Leiterin – Der Auftritt – Marcelas Aufstieg in den ersten Stock – Terror im Quartier – Das Weihnachtskonzert – Ein kommunistisches Konzert und Schweizer Büezer – Kommunikation – Der Auftritt
5. Kapitel
Marcelas Betrachtungen über Kinder und Familien
Kinder, Anwälte, Familien und die Schuldfrage – Der „Mutter-Job“ – Internationale Kommunikation verbal und non-verbal, Hauptsache laut.
6. Kapitel
Marcelas Kampfansage
Nicht mit mir! – Von nicht-integrierbaren Mitmenschen und anderen unangenehmen Zeitgenossen – Der Umzug – Ein neuer Job muss her.
7. Kapitel – 2010 - 2011
Marcelas Vaters Freunde
Unverständliches bei Immoverwaltungen – Das Leben des Vaters – Erinnerungen – Zukunftsaussichten – Die lieben und netten Freunde – Verwirrung – Die Krankheit – Die Entführung.
Epilog – Ein geheimnisvoller Ring
Ein Familiengeheimnis
Prolog – Die Integration
Das Buch mit Migrationshintergrund – Die stille Integration – Tschechoslowakei, Schweiz und die „68er“ – Okkupation, Emigration und Flüchtlingswelle – Wie definiert man „Integration“?
„Stille Integrationen“ kommen vor. Durchaus. Obwohl gegenwärtig im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sehr laut über alle möglichen Arten von Integration berichtet wird. Die Integrationen selbst spielen sich ebenfalls laut ab – ansonsten es sich nicht lohnen würde darüber zu berichten. Laut über Lautes zu berichten – damit es jeder hören kann.
Dem war nicht immer so, doch über still und leise verlaufende Integrationen lohnt es sich nicht zu berichten. Was ist nun eine Integration? Wie definiert man den Begriff? Worauf einigt man sich, um ihn zu verstehen? Mathematiker werden keine Mühe mit dem Begriff haben, deshalb sind sie Mathematiker geworden. Für alle anderen – mathematisch weniger bis gar nicht Begabten – hat Integration mit Eingliederung zu tun. Mit Verbindung oder Verschmelzung verschiedener Elemente zu einer Einheit. Mit Einbeziehung in ein grösseres Ganzes. Die Betonung liegt hier zweifellos auf den Worten „grösseres“ und „Ganzes“. Es ergibt viel Sinn, wenn kleinere Gefüge in grösseren Systemen aufgehen – andersrum bedeutet es meist Zwang, Unterwerfung oder Eroberung. Ist die Verschmelzung einmal vollzogen, so bleibt zu hoffen, dass jenes nun grössere Ganze nicht nur die Summe seiner Teile bleibt, sondern zu einem neuen und neuartigen Wesen findet. Hier liegt nun die Betonung ganz klar auf dem Wort „hoffen“… Meist sind die sogenannt bereichernden Momente nur vereinzelt zu finden: In zwischenmenschlichen und nahen Kontakten. Je stiller eine Integration verläuft, umso mehr Chancen gibt es, dass tatsächlich etwas ganz Neues entsteht.
Dies war der Fall mit der Integration tschechischer Emigranten in der Schweiz im unruhigen 20. Jahrhundert. Es begann schon sehr früh. Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts liessen sich tschechische Auswanderer in der Schweiz nieder. Es entstanden Vereine, die den Leuten halfen ein wenig Heimwehkultur zu pflegen. Nach dem 1. Weltkrieg keimte Hoffnung, als 1918 die Erste Tschechoslowakische Republik entstand, und als die mehr als vierhundertjährige Fremdherrschaft mit aufgezwungener deutscher Amtssprache ein Ende hatte. Die diplomatische Botschaft des jungen Staates bezog im schweizerischen Bern eine schöne würdevolle Villa, umgeben von einem gepflegten Park. Das Botschaftsgebäude hatte im Laufe des Jahrhunderts alle Stürme überstanden, denen die tschechischen und slowakischen Länder ausgesetzt waren – auch die Teilung. Das Botschaftsgebäude der nun alleinigen Tschechischen Republik steht weiterhin solide in der Stadt Bern und bildet einen bekannten Ankerpunkt für Tschechen in der Schweiz…
Dann kam die grosse Zäsur des Zweiten Weltkriegs, und die Kriegsjahre spülten Wellen von tschechischen Flüchtlingen in die Schweiz. Waren diese Menschen zuerst auf der Flucht vor dem Hitler-Regime, so flüchteten sie im Jahre 1948 vor dem sowjetischen Kommunismus. Zwanzig Jahre später war es noch einmal der Kommunismus, wegen dem viele Bewohner der Tschechoslowakei ihrer Heimat den Rücken kehrten. Der Ostblock und die Vormachtstellung der Sowjetunion war eine gänzlich misslungene Integration. Folgerichtig sprachen die Tschechoslowaken des Jahres 1968 von einer „Okkupation“ ihres Landes. Aus der Tschechoslowakei verstreuten sich die Menschen über den gesamten Erdball. Einige davon – zu Beginn etwa fünfzehntausend – landeten in der Schweiz. Nun begann für sie die freiwillige „Integration“. Manchmal gelang sie, manchmal nicht. Integration lässt sich nicht herbei wünschen. Sie lässt sich ebenso wenig von Hochschulabsolventen im Fach Soziologie herbei reden. Sie geschieht früher oder später – eher später. Vor allem geschieht sie erst in zweiter oder dritter Generation. Die erste Generation hat genug zu tun mit dem Verarbeiten ihrer verschiedensten Traumata, die eine solche unfreiwillige Entwurzelung nach sich zieht.
Mittlerweile, rund fünfzig Jahre nach 1968 hat man schon fast vergessen, dass es in der Schweiz je eine „tschechische Flüchtlingswelle“ gegeben hat. Die Integration in die Schweizer Gesellschaft verlief ohne grosse Probleme. Diejenigen, die damals Probleme bereiteten, hatte man des Landes verwiesen – sie suchten sich andere Lebensräume. Im Jahr 1968 waren viele Dinge noch anders auf dieser Welt…
Je mehr sich zwei Kulturen gleichen, umso unverständlicher werden manchmal die Handlungen einer „integrierten“ Einzelperson, denn man vergisst, dass hier immer noch zwei Kulturen in einem Individuum wirken. Die Geschichten, die sich daraus ergeben, sind zuweilen vergnüglich. Kleine Peinlichkeiten des Alltags, kleine Patzer und Fettnäpfchen, in die der eine oder andere tritt. Die weniger vergnüglichen Szenen zeigen dann auf, dass es eine vollständige Integration in kurzer Zeit nicht geben kann…. und dass sich Entwicklung nicht beschleunigen lässt.
Von all dem handelt dieses Buch. Sowohl von den amüsanten Seiten, als auch von den Hindernissen auf dem Weg zum gegenseitigen Verstehen. Es handelt auch von den Fragen, ob Integration jemals abgeschlossen sein kann, denn wenn sie abgeschlossen ist, könnte man sie vergessen. Darf man Integration vergessen? Oder begeht man Verrat an Integration, wenn man die Erinnerung daran behält? Alles Fragen, die sich nicht nur die Titelheldin diese Buchs stellt, sondern auch viele andere ihrer 1968-er Zeitgenossen. Ein „Achtundsechziger“ zu sein hat eben verschiedene Bedeutungen…
Integration bedeutet „Eingliederung“. „Eingliedern“ kann man sich aber auch in eine Warteschlange. In einer Warteschlange haben alle das gleiche Ziel, nämlich vorwärtskommen. In einer Warteschlange stehen individuelle Menschen mit individuellen Hintergründen, Plänen und Wünschen. Dasjenige, was sie eint, ist die Warteschlange und das gegenseitige Einverständnis, dass alle sich einreihen – einer nach dem anderen. In einer Warteschlange gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, in einer Warteschlange haben alle die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. In einer Warteschlange spielen weder Geschlecht noch Hautfarbe eine Rolle, weder Religion noch Bildungsstand, weder Nationalität noch Zugehörigkeiten zu anderen menschlichen Gruppierungen. Eine Warteschlange ist unbestechlich und gerecht. Wer sich vordrängelt kriegt Zoff mit den Nachbarn – man kann aber auch aus Mitgefühl jemandem den Vortritt lassen, freiwillig. Manchmal wäre es schön, wenn die Welt eine Warteschlange wäre…
1. Kapitel - 1968
Ende oder neuer Beginn?
„Rückblenden begleiten dieses Buch – Rückblenden begleiten das Leben.“
21. August 1968 – Aus der Sicht eines Kindes – Urlaubsreise ohne Rückkehr
21. August 1968
„Marcelka, es ist Zeit aufzustehen.“
Die Stimme der Mutter klingt sanft. Sie steht im Türrahmen als wollte sie so früh am Morgen nicht zu brüsk das Kinderzimmer betreten, in welchem ihre neunjährige Tochter unter der Bettdecke gekuschelt liegt. Doch das Mädchen schläft nicht mehr. Es träumt vor sich hin und mag das Bett noch nicht verlassen. Es freut sich. Heute wird die ganze Familie in den Sommerurlaub fahren. Heute wird die neunjährige Marcela zum ersten Mal ins Ausland fahren. Sie wird zum ersten Mal das Meer sehen. Heute wird der Vater das vollbepackte Auto aus der Garage fahren, dann werden die Eltern noch einmal überprüfen, ob das Haus gut verschlossen ist, und dann wird es losgehen. Die neunjährige Marcela fährt gerne Auto. Wenn die Familie jeweils zu den Grosseltern fährt, dann hat Marcela den ganzen Rücksitz im hellbraunen Škoda Oktavia für sich selbst zur Verfügung. Dort kann sie sich quer über den Sitz legen, ein Buch öffnen und die Welt um sich vergessen, solange bis man nach einer Stunde Fahrzeit das Ziel erreicht.
Die Fahrt, die sie heute antreten werden, wird länger dauern. Marcela und ihre Eltern werden durch Österreich nach Slowenien und von dort aus nach Kroatien fahren. Dort wird man in der Stadt Zadar das Auto zurücklassen und mit einer Fähre zur Insel Dugi Otok in die Bucht von Sali übersetzen, wo eine kleine Pension wartet. Sie gehört dem staatseigenen Betrieb, in dem der Vater als Ingenieur arbeitet. Die Pension auf der kroatischen Insel dient während der Sommermonate den Mitarbeitern jenes tschechischen staatseigenen Betriebes als Feriendomizil. Ferien auf der Insel.
Marcela lacht und springt aus dem Bett. Die Mutter streicht ihr über die braunen, wilden Locken und lächelt. Die Mutter freut sich ebenfalls auf die Reise. Sie freut sich auf faule Tage am Strand, auf die Erkundung der Insel, auf die jugoslawische Küche. Vorher wird man noch einen Abstecher ins slowenische Ljubljana machen. Ein Familientreffen steht auf dem Plan, das in seiner Art einmalig ist. In Ljubljana wohnt ein ehemaliger Mitschüler des Grossvaters. Die beiden alten Herren hatten sich eine lebenslange Freundschaft erhalten. Der Grossvater, ein Böhme, den es nach Mähren verschlagen hatte, sein Mitschüler, ein Slowene, der zur Ausbildung in die Tschechoslowakei gekommen war. Beide hatten zusammen die Fachhochschule für Keramische Produktion besucht. Im Lauf der Jahre hatten sich sogar ihre Nachkommen angefreundet. Marcelas Onkel, der Bruder ihres Vaters, verbringt mit seiner Familie oft die Urlaubstage bei den Bekannten in Slowenien. Nun wird also ein Treffen stattfinden, bei dem drei Generationen von Verwandten der slowenischen Gastgeber anwesend sein werden, dazu die tschechischen Gäste – Rudolf Hašek mit Ehefrau und Tochter, sein Bruder und dessen Familie, und ein befreundetes Ehepaar, welches zusammen mit den Hašeks in den Urlaub auf die kroatische Insel fährt. Eine stattliche Zusammenkunft.
Marcela ist bald bereit. Frisch gewaschen, die Haarmähne gezähmt, die Zähne geputzt, hüpft sie die Treppe hinunter in die Küche, wo ein Frühstück auf sie wartet.
„Papa ist noch schnell in die Stadt gefahren. Er hat das Tram genommen, doch er müsste jeden Augenblick wieder da sein. Sobald er kommt geht’s los!“ verkündet die Mutter und schaut aus der geöffneten Küchenbalkontür hinaus, ob sie ihren Mann schon auf der Strasse erblicken kann. Draussen ist ein schöner Sommermorgen, es verspricht ein strahlender Tag zu werden. Da der Vater noch nicht kommt, trägt die Mutter Marcela auf, sich noch einmal zu vergewissern, ob sie auch alles eingepackt habe, das sie mitnehmen will.
„….und vergiss deine Bücher nicht! In Jugoslawien wird es nichts auf Tschechisch zu lesen geben“, ruft die Mutter der Tochter nach. Sie kennt den Lesehunger des Mädchens. Marcela soll nur genug Bücher und Schülerzeitschriften mitnehmen. Wie schön ein Kind zu haben, das mit Büchern glücklich ist. Oder mit Tieren, wenn es bei den Grosseltern mit dem Hund über die Felder rennen, den Ziegen im grossväterlichen Stall die Hälse streicheln, oder mit den Katzen herumtollen kann. Hier in ihrem neuen Haus in einem angenehmen Stadtviertel von Brno haben sie eine graugetigerte Katze, die sich manchmal auf eine hohe Tanne im Nachbarsgarten verirrt, von wo man sie in spektakulären Rettungsaktionen wieder herunter befördern muss. Die Eltern der Mutter werden während des Urlaubs das Haus und die Katze hüten. Die Eltern der Mutter bewohnen eine kleine Einliegerwohnung im gleichen Haus. Doch zurzeit sind sie selbst noch unterwegs und werden erst nach der Abreise der Hašeks wieder zurückkehren, gerade noch rechtzeitig, um die Katze zu füttern.
Marcela rennt die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Sie rollt die Bettdecke ordentlich auf und zieht daraufhin aus dem Regal einige Bücher, die sie unbedingt mitnehmen will. Dabei hört sie wie unten in der Eingangshalle die Haustür geöffnet wird. Der Vater ist zurückgekommen. Marcela schaut sich noch einmal in ihrem Kinderzimmer um. Sie hört von unten die Eltern sprechen.
„…du machst Witze“, sagt die Mutter, „das ist doch Unsinn…“
„Nein, nein, es ist kein Unsinn“, antwortet der Vater, „komm, schnell, schalt den Fernseher ein…“
Die Stimmen verlieren sich, als beide Eltern von der Eingangshalle ins grosse Wohn- und Esszimmer gehen. Marcela wird neugierig. Die Stimme des Vaters klang aufgeregt. Was ist los? Der Vater ist sonst nie aufgeregt. Marcela packt ihre Bücher unter den Arm und läuft die Treppe herunter. Sie findet die Eltern im Wohnzimmer vor dem laufenden Fernsehgerät stehen. Der Bildschirm flackert unruhig. Das Bild ist verzerrt. Ein Nachrichtensprecher ist zu sehen, aber etwas stimmt hier nicht, denn der Nachrichtensprecher trägt keinen Anzug. Er trägt auch keine Krawatte. Sein weisses Hemd ist am Hals geöffnet, der Mann sieht aus, als hätte er sich nicht rasiert, dabei rasieren sich doch alle Männer jeden Tag – das weiss Marcela, denn sie sieht ihrem Vater oft beim Rasieren zu. Das ist dann komisch, wie er mit einem Pinsel weissen Schaum ums Kinn schmiert, und wie er dann Grimassen zieht, damit er sich mit der scharfen Rasierklinge nicht verletzt. Doch der Mann im Fernsehen hat sich bestimmt heute Morgen nicht rasiert, das sieht Marcela ganz genau. Der Mann erzählt etwas von Soldaten, von Panzern, von Grenzen und immer wieder hört Marcela das Wort „Sowjetunion“. Doch die Eltern sagen: „Russland“.
„Glaubst du mir jetzt, dass die Russen gekommen sind?“ hört Marcela ihren Vater sagen. Die Mutter nickt. Sie ist ganz ernst geworden, erschrocken, beinahe traurig. Da ist nichts mehr in ihrem Gesicht, das noch vorher die Freude über die bevorstehende Ferienreise angekündigt hat. Die Eltern sprechen weiter miteinander und allmählich beginnt Marcela zu verstehen. Die Eltern sprechen von russischen Panzern. Die kennt sie gut. In der Schule hatten sie gelernt, dass zwanzig Jahre zuvor russische Panzer die Tschechoslowakei befreiten. Die Lehrerin hatte lange von der Befreiungsarmee erzählt, von den russischen Soldaten, welche die Tschechoslowakei gerettet hatten, damals im Krieg. Noch kurz vor den Sommerferien hatte Marcelas Klasse im Zeichenunterricht die Aufgabe erhalten den ersten dieser russischen Befreiungspanzer zu zeichnen. Den Kindern wurden Bilder des Denkmals gezeigt, das zu Ehren dieses Panzers und seiner Besatzung erstellt worden war. Marcelas Panzer prangte dann auch als Denkmal stolz auf einem Steinsockel, und der rote, fünfzackige Stern leuchtete, schön regelmässig ausgemalt. Sämtliche Bilder der Schüler wurden im Klassenzimmer an der hinteren Wand aufgehängt – eine Wand in der 3. Klasse der Grundschule von Brno-Pisárky, eine Wand voll mit Panzerbildern – gezeichnet von Kinderhänden. Der Befreiungspanzer. Marcela war damals nicht ganz klar gewesen, wovon dieser Panzer die tschechischen Bürger befreit haben sollte. Anscheinend von Deutschen. Damals war Deutschland der Feind. Doch die Russen waren irgendwie auch Feinde. Zumindest jetzt, zumindest für Marcelas Familie, für ihre Grosseltern, ihre Verwandten – und für viele andere auch. Doch damals, als der Befreiungspanzer kam, waren die Russen anscheinend keine Feinde. Oder doch? Vielleicht für manche Leute, nicht für alle. Auf jeden Fall hatte das Zeichnen des Panzers Marcela nicht so viel Spass gemacht wie das Zeichnen eines Pudels, welches die Aufgabe zuvor gewesen war.
„Damals im Krieg“ – diese Worte hörte sie oft von den Grosseltern, wenn sie aus ihrem Leben erzählten. „Damals im Krieg“, da war Marcelas Mutter noch ein kleines Kind gewesen. „Damals im Krieg“ hatten die Grosseltern sehr viel Angst vor „den Deutschen“ gehabt. Die Grosseltern schimpften über die Deutschen genauso viel wie die Eltern über die Russen.
Doch nun waren anscheinend russische Panzer in der Stadt. Wie war das nun mit den Russen? In Marcelas Klasse gab es einen russischen Jungen, Aljoscha. Seine Mutter kam jeweils nachmittags in den Hort, um Aljoscha abzuholen. Sie war laut und unhöflich und sprach nur russisch. Im Hort schrie sie immer laut Aljoschas Namen schon von der Eingangstür her. Aljoscha kam dann sofort angerannt, die Mutter packte ihn bei der Hand und zog ihn mit sich, ohne sich um die anderen Kinder oder die Betreuerinnen zu kümmern. Anderseits, die Betreuerinnen kümmerten sich auch nicht um Aljoschas Mutter. Die Kinder verdrückten sich lieber. Marcela waren diese Szenen peinlich. Marcela hielt sich von Aljoscha fern. Eigentlich hielt sich die ganze Klasse von Aljoscha fern. Eigentlich war es nicht wegen Aljoscha, einige Jungs spielten mit ihm auf dem Pausenplatz, doch alle Kinder hatten Angst vor Aljoschas Mutter.
Nach den Sommerferien, in der vierten Klasse, würde der Russischunterricht beginnen. Auf die Sprache war Marcela neugierig. Sie freute sich darauf etwas Neues zu lernen. Alle Kinder lernten Russisch ab der vierten Klasse Grundschule. Ausserdem waren Sprachen interessant – egal ob die Menschen, die sie sprachen sympathisch waren oder nicht. Im Freundeskreis der Hašeks gab es Leute, die sich in allen möglichen Sprachen verständigen konnten. Marcela hatte sogar schon begonnen anhand des Russisch-Lehrbuchs die kyrillische Schrift zu üben, die „Azbuka“, und sie lernte ein Kindergedicht auswendig. Sie verstand auch einige wenige deutsche Wörter, die sie im Kinderkurs gelernt hatte, allerdings, weit würde sie damit nicht kommen. Sie konnte ebenfalls einen deutschen Reimspruch auswendig und sie kannte sogar englische Wörter und Zahlen. Die hatte sie sich selbst beigebracht aus einem Buch, welches den Kindern in der Bibliothek vorgestellt worden war: „Sally, meine Freundin aus England“. Die Geschichte von Sally war spannend und sie war mit witzigen Zeichnungen versehen. Am Ende des Buches gab es Zeichnungen zu englischen Wörtern. Marcela liebte das Buch. „Sally“ würde mit Marcela nach Jugoslawien fahren. Marcela war begeistert. Sie wollte viele Sprachen lernen. So viele Sprachen, wie die Freunde ihrer Eltern, die weiter unten in der Strasse wohnten, und bei denen Marcela ein und ausgehen konnte, wie es ihr gefiel. Das kinderlose Akademiker-Ehepaar hatte Freude an dem aufgeweckten Mädchen, das jeweils mit strahlenden Augen vor dem grossen Bücherregal in ihrem Wohnzimmer stand und glücklich war, wenn es sich mit einem der Bücher in einen weichen Ohrensessel fläzen konnte. Dort vergass Marcela regelmässig die Zeit. Sie nannte die Freunde ihrer Eltern „Tante“ und „Onkel“ und verbrachte in deren Haus fast mehr Zeit als zu Hause.
Doch jetzt gerade schien es, als wäre etwas wahr geworden, wovor Marcelas Eltern immer wieder Angst hatten: „Die Russen waren gekommen“… Marcela hörte die Eltern, wie sie sich berieten. Was sollten sie tun? Doch noch auf die Ferienreise gehen? Zu Hause bleiben und abwarten? Vielleicht später reisen? Obwohl sie alle Papiere hatten, die zu einer Ausreise aus dem Land schon Monate zuvor mühsam besorgt werden mussten, waren sie sich nicht sicher, ob die Grenzen unter diesen Umständen offen standen. Oder war die ganze Sache vielleicht nur eine russische Truppenübung, mit der man den Tschechen zeigen wollte, dass die Sowjets das Sagen hatten? Immer wieder fiel der Name Dubček, Alexander Dubček. Marcela kannte den Mann aus den Fernsehnachrichten. Der Mann mit der markanten Stirn. Ein Politiker. Ein wichtiger Politiker, der irgendwie besonders bedeutsam war. Das hatte sich Marcela selbst aus den Nachrichten zusammen gereimt. Die Eltern hatten ihr hin und wieder einfache Erklärungen gegeben, was man eben einem Schulkind an Politik erklären kann. Marcela kannte auch den Staatspräsidenten Svoboda aus dem Fernsehen, das war der „höchste“ Mann im Staat, wobei die anderen Politiker auch irgendwie „hoch“ waren – aber warum sie das waren, das verstand Marcela nicht. Diese Männer regierten, soviel war ihr klar. Obwohl – so ganz nach ihrem Willen konnten sie anscheinend nicht regieren, denn da war immer wieder von der Sowjetunion die Rede. Die Sowjetunion war überall. Es verging kein Tag, an dem das Wort nicht aus Radio oder Fernseher zu hören war, kein Tag, ohne dass die Eltern von der Sowjetunion sprachen, kein Tag an dem es nicht in den Zeitungen geschrieben stand. Die Zeitungen, das waren das „Rudé Právo“ – das „Rote Recht“ – und ... ja, was sonst noch? Es musste noch andere geben, denn die Eltern lasen das „Rote Recht“ niemals. Das „Rote Recht“ war aber überall in der Stadt an den Zeitungskiosken, in den Cafés, in den Zuckerbäckereien und Milchbars, in die Marcelas Mutter ihre Tochter manchmal mitnahm. Marcela erinnerte sich nicht an die Namen der anderen Zeitungen. Sowieso waren Zeitungen nur dazu da, dass man in ihnen las, wenn es sonst weit und breit nichts anderes zu lesen gab – zumindest nicht für die neunjährige Marcela.
„Heute fahren wir nirgendwo hin“, entscheiden die Eltern, während über den schwarzweissen Fernsehbildschirm immer wieder Panzer rollen, als Kameraaufnahmen plötzlich Rauch und Flammen zeigen und schreiende Menschen – und immer wieder diese Panzer. Das sei in Prag, erklärten die Eltern ihrer Tochter, das würde sich in Prag abspielen. Marcela spürt, wie die Eltern ängstlich werden. Würden die Panzer auch in Brno auftauchen? Es scheint, als wären die Panzer plötzlich aus allen Richtungen aufgetaucht. Der unrasierte Fernsehsprecher mit den müden Augen, sagt immer wieder, dass die Panzer in einer abgesprochenen und geheim gehaltenen Aktion die Grenzen in der Nacht überschritten hatten, und dass sie früh morgens in den grenznahen Städten eingetroffen waren – vor allem aber in Prag. „Die Situation ist ernst“, betont der Sprecher eindringlich, „das ist keine Übung – das ist keine Übung!“
Marcela beobachtet nun, wie die Eltern alle Türen des Hauses abschliessen, wie sie telefonieren, wie sie den Fernseher und das Radio gleichzeitig laufen lassen, wie der Vater davon berichtet, dass bereits auf seinem Weg in die Stadt die Leute im Tram sehr besorgt blickten und einige sogar im Tram und auf der Strasse Transistorradios ans Ohr hielten. Der Vater spricht davon, wie er doch nur schnell seinen Arbeitskollegen treffen wollte, bevor man zusammen in den Urlaub reisen würde – doch dann – dann die Gewissheit. Die sowjetischen Truppen waren tatsächlich am frühen Morgen in der Tschechoslowakei eingefallen. Im ganzen Land herrscht nun Panik und Wut, es brennen die ersten Häuser und es wird geschossen. Die ersten Menschen sterben. Schon bald wird sich in Brno eine riesige Menschenmenge um den Hauptbahnhof versammeln und man wird berichten, dass die russischen Panzerführer in die Luft schiessen, um die Leute zu vertreiben. Wenigstens nur in die Luft… Andere russische Soldaten schiessen gezielt… Am 21. August 1968 rollen die Panzer durch die Tschechoslowakei – niemand tritt an diesem Tag eine Reise an. Schon gar keine Urlaubsreise ans Meer…
Der 22. und 23. August vergingen irgendwie. Das vollgepackte Auto blieb in der Garage stehen, die Mutter holte lediglich einige verderbliche Lebensmittel wieder hervor, die man verzehrte. Die Hašeks gingen abends schlafen und standen am anderen Morgen auf, um sich während des Erwachens ein wenig über die seltsam bedrückende Stimmung wundern, bis sie sich erneut bewusstmachten, dass da draussen eine militärische Landesbesetzung vor sich ging – dass da draussen der Feind war. Marcelas Mutter wagte sich einmal in die Stadt an ihren Arbeitsort, um zu sondieren, um mit Arbeitskollegen zu sprechen, um herauszufinden, ob andere vielleicht besser Bescheid wussten. Die Panzer wären jetzt in der Stadt, erzählte sie, als sie zurückkam. Zwar schien das Leben einigermassen weiterzugehen, die Trams fuhren sogar fahrplanmässig, einige Geschäfte waren geöffnet, die Leute gingen zur Arbeit. Doch es war bereits von Todesopfern die Rede Die Mutter erzählte von den verschiedensten Theorien, welche sie gehört hatte, und dass die Grenzen angeblich immer noch offen seien. Dann war von draussen ein ohrenbetäubendes Gedröhn zu hören und plötzlich rollten die Panzer auch durch das ruhige Wohnquartier. Eine ganze Kolonne schlängelte sich die steile Strasse hinauf zwischen Häusern und Villen hindurch, die in vielen Fällen hohen kommunistischen Funktionären gehörten. Seltsam genug, dass die Panzer durch dieses beschauliche, von vermögenden Familien bewohnte Quartier fuhren, an dessen unterem Ende die Tramstation und das Ausstellungsgelände der Internationalen Technik- und Maschinenmesse lag. Die Panzer donnerten und dröhnten. Marcelas Mutter rief ihre Tochter vom Fenster weg. In anderen Städten hatten unvorsichtige Panzerführer Gebäude beschädigt und es war in der Folge zu Gasexplosionen und Bränden gekommen. Man wusste auch nicht, wozu die Soldaten sonst noch fähig waren, sagte Marcelas Mutter, es hiess, dass sie sich ständig betranken, dass sie selbst Angst hatten – wovor denn? – und dann auf die Fensterscheiben der Häuser zielten und sogar direkt auf Menschen schossen.
Endlich war der angstmachende Lärm vorbei. Die Panzer waren vorbeigerollt und verschwunden. Die Eltern atmeten auf.
Am Morgen des 24. Augusts sagte die Mutter während des Frühstücks, dass sich Marcela bereit machen sollte, die Familie würde zur Grossmutter aufs Land nach Südmähren fahren. Dort wäre es sicher ruhiger und man konnte einen Teil der Ferien auch dort verbringen, für Marcela sei es gewiss besser, denn da könne sie auch wieder nach draussen an die frische Luft. Etwa eine Stunde später sass die Familie im immer noch vollbepackten Auto, das Haus war abgeschlossen, und man fuhr los. Marcela machte es sich auf dem Rücksitz gemütlich und freute sich auf die Grosseltern, auf das Dorfleben und auf die grosselterlichen Tiere. Es war zwar keine Auslandreise, sie würde nun das Meer doch nicht sehen, sie würde nach den Ferien nicht von interessanten Erlebnissen berichten können, das war sicher schade – aber im Grunde genommen war es egal.
Sie mochten ungefähr eine Viertelsunde unterwegs gewesen sein, als Marcela auffiel, dass der Vater einen anderen Weg einschlug. Sie sagte nichts. Die Eltern schienen angespannt. Sie schwiegen, also schwieg auch Marcela. Aus dem Autofenster beobachtete sie die Stadt. Dann lichteten sich die Häuser, man passierte die Stadtgrenze und fuhr auf der Landstrasse – doch wohin auch immer diese Landstrasse führen mochte, sie führte gewiss nicht an den Ort, wo die Grosseltern wohnten. Durch diese Gegend war Marcela noch nie gefahren. Sie schwieg weiterhin. Schwieg, als der Vater das Auto anhielt, vor einer Art Wachhäuschen, vor dem uniformierte Polizisten standen. Es gab auch plötzlich eine grosse Menge anderer Autos, und aufeinmal war das Auto des befreundeten Ehepaares da, die mit den Hašeks zusammen in die Ferien wollten! Marcela wagte nicht zu piepsen. Sie drückte sich in eine Ecke des Rücksitzes, gleich hinter dem Sitz des Vaters. Sie hörte die Eltern sprechen, sie sah den Vater aussteigen, mit dem Uniformierten vor dem Wachhäuschen sprechen, wieder einsteigen und losfahren. Sie fuhren an dem Wachhäuschen vorbei. Andere Uniformierte wiesen alle anderen Autos ebenfalls an weiter zu fahren.
„Fahren Sie, bitte! Fahren Sie! Wir haben keine Instruktionen. Bitte, passieren Sie! Fahren Sie!“ hörte Marcela die Uniformierten rufen. Die Autos fuhren.
Als hätten die Eltern die Anwesenheit ihrer Tochter vergessen. Weder die Mutter noch der Vater hatten sich zu ihr gedreht. Sie sprachen in kurzen, abgehackten Sätzen. Marcela verstand nicht, was um sie herum geschah. Wo kamen denn plötzlich all die Menschen in ihren Autos her? Was und wohin wollten die? Und warum standen da diese Wachhäuschen? Marcela wusste, dass ein Grenzübergang genau so aussehen musste, doch woher sie das wusste, hätte sie nicht sagen können. Das war die Grenze! Das war bestimmt nicht der Weg zur Grossmutter – das hier war die Landesgrenze.
Irgendwann mussten sie auch den österreichischen Grenzposten passiert haben. Marcela erinnerte sich nicht. Irgendwann hielten sie neben der Landstrasse. Die Eltern stiegen aus. Das befreundete Ehepaar stieg aus. Marcela stieg aus.
„Jesusmaria, Marcelka!“ rief plötzlich die Mutter. „Mädchen, wo sind deine Schuhe?“ Marcela blickte auf die dunkelblauen Kordsamtpantoffeln an ihren Füssen. Dann sah sie zur Mutter: „…aber ihr habt doch gesagt, wir fahren zu Grossmutter… und da ziehe ich doch nie Schuhe an.“
Der Vater lachte. Das befreundete Ehepaar lachte. Die Mutter öffnete die Autotür, den Kofferraum, suchte Kinderschuhe.
„Sie hat keine Schuhe mitgenommen“, stellte sie fest. „Meine Tochter hat zum ersten Mal in ihrem Leben die Landesgrenze überschritten – und das in Pantoffeln….“ Nun lachte auch sie. Marcela lachte nur widerwillig mit.
„Ihr hättet mir ja sagen können, dass wir doch noch in die Ferien fahren und nicht zu Grossmutter“, schmollte trotzig.
„Wir hatten Angst, dass du dich verplappern und uns verraten würdest, Marcelka“, erklärte die Mutter, „wir wussten ja nicht, ob wir überhaupt über die Grenze kommen.“
„Ja, schon… Aber ich bin doch nicht dumm…“
Marcelas schwacher Protest verhallte. Man würde sowieso nach Wien fahren, da müsste man eben zuerst Schuhe für Marcela besorgen. Das würde sicher teuer werden, aber es liess sich jetzt nichts mehr machen. Man fuhr also nach Wien und kaufte Kinderschuhe. Marcela sah zum ersten Mal in ihrem Leben eine Rolltreppe. Irgendwo wurde übernachtet, dann ging es weiter in Richtung Slowenien. In Ljubljana traf man sich mit den Verwandten und mit Grossvaters Freunden. Das Hauptthema der Gespräche drehte sich um die neueste Situation in der Tschechoslowakei. Alle hatten besorgt die Ereignisse in Radio und Fernsehen verfolgt. Man verständigte sich hauptsächlich auf Tschechisch. Zum ersten Mal tauchte die Frage nach der Rückkehr in die Tschechoslowakei auf. Rudolf Hašek erklärte, dass er, seine Frau und die Tochter erst einmal die Ferienreise machen wollten, daran hätte sich nichts geändert, und der Aufenthalt war gebucht. Danach würden sie weitersehen wie sich die Situation entwickelte. Für den Bruder von Marcelas Vater machte alles keinen Unterschied. Er und seine Frau hatten die Berichte den Truppeneinmarsch in Slowenien im Fernsehen gesehen, doch für sie war klar, dass sie nach Hause fahren würden, und dass sie ihr normales Leben nach dem Urlaub fortzusetzen gedachten, als wäre nichts geschehen. Was sollte die ganze Aufregung auch? Die Sowjets konnten es sich nicht leisten, die gesamte Tschechoslowakei dicht zu machen, schliesslich war man nicht im Krieg. Es würde keinen offenen Krieg geben. Wozu auch? Den Westmächten war das Schicksal der Tschechoslowakei doch gleichgültig – das hatten sie ja im letzten Krieg – und zuvor! – doch bestens bewiesen. Man musste sich eben ein bisschen anpassen, so schlecht ging es ihnen allen ja nicht, oder? Die Diskussionen wurden manchmal hitzig geführt und Marcela verstand nicht immer, worum es ging. Es gab auch niemanden in der grossen Runde, mit dem sie hätte sprechen oder spielen können, ausser der etwa gleichaltrigen Zora. Die Verständigung der beiden Mädchen beschränkte sich aufs Allereinfachste. Zora zeigte Marcela das Haus, den Garten und die Wiese, die zu einem Fluss führte. Es regnete ein wenig, es war kalt und die Wiese war voll von grossen, fetten, orangefarbenen Nacktschnecken – zum Fluss würde Marcela keinen Schritt wagen.
Wieder wurde irgendwo übernachtet, und wieder fuhr man einen oder zwei Tage weiter. Wenn man schon in Jugoslawien war, dann musste die Gelegenheit genutzt werden, um sich das Land anzusehen. Wer wusste denn, ob sich so eine Möglichkeit wieder bieten mochte? Die Hašeks und ihre Freunde sahen sich die berühmten Pferde von Lipiza an, trutzige Burgen aus dem Mittelalter und die Berge um Maribor. Sie fuhren in den Nationalpark an den Plitvitzer Seen und verbrachten eine Nacht auf einem Campingplatz in Holzhütten. Die Gegend war atemberaubend schön und als Marcela erfuhr, dass die Winnetou-Filme, die sie so begeistert im Kino gesehen hatte, in jener Gegend gedreht worden waren, gefiel ihr die Karstlandschaft umso mehr. Danach fuhr man weiter und erreichte die kroatische Küste. Endlich – das Meer! Die Fähre brachte Hašeks und ihre Freunde von Zadar nach Sali, wo sie die Zimmer in der Pension bezogen. Bald schon konnte Marcela zum ersten Mal im Leben im Meer schwimmen. Es war herrlich!
Dazwischen immer wieder die Sorge um die politische Lage zu Hause. Immer wieder Radionachrichten, Zeitungen und Gespräche mit interessierten Menschen. Einige Male hörte Marcela, wie die Mutter nachts weinte, wie der Vater sie tröstete. Immer wieder die Frage: Wie wird es weiter gehen? Was sollen wir tun? Konnte man nicht irgendwo hier draussen bleiben und abwarten? Noch war man im Urlaub. Noch war der Auslandaufenthalt der Hašeks in bewilligter und vom Staat beglaubigter Ordnung. Doch was dann?
Irgendwann gingen die Ferien auf der kroatischen Insel zu Ende. Die Rückkehr nach Wien ging schweigsam vor sich. Als die Hašeks und ihre Freunde wieder Wien erreichten, waren in der ganzen Stadt Proteste und Demonstrationen gegen die Besetzung der Tschechoslowakei im Gange. Eine unglaublich grosse Menschenmenge flutete die Plätze Wiens. Auf den Strassen wurden Flugblätter verteilt, die eine Messe im Stephansdom ankündigten, welche für die Tschechoslowakei zelebriert werden sollte. Familie Hašek und ihre Freunde nahmen an jener Messe teil. Marcela erschien alles riesig. Der gotische Dom, der voll von Menschen war, die Stadt, die vielen Autos, die vielen Leute.
Die Österreicher zeigten sich solidarisch. Sie halfen den vielen in Wien gestrandeten Tschechoslowaken, wo sie nur konnten. Die Hašeks, ihre Freunde, und ein neu dazugekommenes Ehepaar fanden einmal Unterkunft in einem Nonnenkloster und einmal in einer Kaserne mit dreifachen Etagenbetten. Insgesamt drei Tage dauerte der Aufenthalt in Wien. Die Hašeks orientierten sich rasch, suchten Botschaften auf, sprachen mit verschiedenen Menschen und suchten nach Möglichkeiten, welche Länder als eventuelle Emigrationsziele in Frage kamen – sollte man sich vielleicht doch noch dazu entschliessen im Ausland zu bleiben. Doch die schwedische Botschaft, die sie als erste aufsuchten, war geschlossen und vor der kanadischen staute sich eine grosse Menschenschlange. In Österreich zu bleiben schien aus irgendeinem Grund nicht möglich. Dazwischen immer die Frage: Wollen wir nicht ganz einfach wieder zurückkehren? Das ganz normale Leben wieder aufnehmen? Das normale Leben mit der Angst, der Unsicherheit, mit der allgegenwärtig lauernden Befürchtung einmal etwas falsch zu machen, das im besten Fall beträchtliche Einbussen bringen konnte – im schlimmsten Fall Verhöre und sogar Freiheitsentzug. Ausserdem – wie hätten die Hašeks begründen sollen, dass ihr offiziell festgesetztes Rückkehrdatum bereits um mehrere Tage überschritten war? Und – wenn sie schon zurückkehrten, würde man ihnen jemals wieder erlauben auszureisen? Wie sollten sie sich entscheiden, wenn es keine greifbare Möglichkeit gab? Die Entscheidung hiess, entweder zurückkehren und sich auf Repressalien und Denunziation gefasst zu machen, oder irgendwo hinzugehen, wo man nicht wusste, was einen erwartete. Aber wohin? Welche Möglichkeiten hatte man, um innerhalb von drei Tagen über das zukünftige Leben zu entscheiden? Allmählich wurde auch das Geld knapp, und den Hašek wurde bewusst, dass ihr Auto, ihre Campingausrüstung, einige Lebensmittelkonserven und die wenigen Sommerkleider, ihren gesamten Besitz darstellten.
Am dritten Tag des Aufenthaltes in Wien, am späteren Nachmittag, stand ein Grüppchen Tschechoslowaken irgendwo in der Stadt Wien auf irgendeinem Gehsteig und beriet sich. Es waren Marcelas Eltern mit ihrer Tochter, ihre beiden Freunde und das neu dazugekommene Ehepaar, welches man in Wien kennen gelernt hatte. Die Frage, was zu tun sei, wurde immer dringlicher, man hatte noch nicht einmal ein Nachtquartier für die bald schon anbrechende Nacht. Marcela hörte den Erwachsenen zu und beobachtete gleichzeitig das Geschehen auf der Strasse. Sie sah, wie sich ein Mann lächelnd ihrer Gruppe näherte, sie hörte, wie er ihre Eltern ansprach.
„Verzeihen Sie, dass ich sie störe, ich hörte Sie Tschechisch sprechen“, sagte der Mann, und als sich alle nach ihm umdrehten fuhr er fort sich vorzustellen. Er heisse Novotný, sagte er und fügte gleich im Scherz hinzu, dass er nicht mit dem ehemaligen Staatspräsidenten der Tschechoslowakei verwandt sei. Er hätte gehört, dass sich die Herrschaften über die gegenwärtige Situation beraten hätten, und er würde ihnen gerne ein Angebot machen. Er sprach sehr höflich. Er entschuldigte sich noch einmal für sein überfallartiges Verhalten und versicherte immer wieder, dass sie keine Angst vor ihm zu haben brauchten. Er wäre ein ehemaliger tschechischer Flüchtling aus dem Jahre 1948, und er würde in der Schweiz leben. Die Schweiz nehme zwar noch keine Tschechoslowaken als Flüchtlinge auf, es gäbe jedoch private, humanitäre Initiativen. Eine davon sei die Hilfe, welche die Schweizer Firma Scintilla in Solothurn stellte und er, Herr Novotný, hätte die Bewilligung und die Mittel dazu erhalten, um fünfzig Tschechoslowaken Soforthilfe in der Schweiz anzubieten. Es gäbe noch freie Plätze, deshalb hätte er sich getraut das Grüppchen anzusprechen. Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten seien gesichert – auch wenn die Arbeit eine bescheidene wäre, so liesse sich anfangs etwas verdienen. Die Firma, Scintilla, stellte diese Arbeitsplätze zur Verfügung und auch die Wohnungen. Ein Bus stehe bereit, der heute noch um fünf Uhr Nachmittags von Wien in Richtung Schweiz abfahren würde – die Herrschaften können sich es ja gerne überlegen…
Auf seine Rede folgte erst Schweigen, dann ein schüchterner Dank, dann die Bemerkung, dass man mit Autos hier wäre.
„Kein Problem“, meinte Herr Novotný, „dann fahren Sie eben mit ihren Autos hinter dem Bus her. – Nun denn, wenn ich Sie um fünf Uhr beim Busparkplatz treffe, dann ist alles in Ordnung und Sie können mitkommen. Alles andere wird für Sie erledigt. Halten Sie bitte Ihre Pässe bereit, und wenn Sie die Autos auftanken müssen, dann nutzen Sie dazu vorher noch die Gelegenheit – wir werden über den Grossglockner fahren, da wir mit Ihren Reisedokumenten nicht über deutsches Gebiet können. – Tja, und wenn ich Sie nicht beim Bus sehe, dann haben Sie sich eben anders entschieden. Es ist mir bewusst, dass dies alles sehr, sehr kurzfristig ist.“
Herr Novotný verabschiedete sich daraufhin und überreichte seine Visitenkarten, auf die er eine Adresse aufschrieb, wo man sich gegen fünf Uhr einzufinden hatte, dann ging er schnellen Schrittes davon. Er liess sechs Erwachsene und ein Kind zurück, denen allmählich aufging, dass die Entscheidung gefallen war.
„Wir fahren also in die Schweiz“, fasste Marcelas Mutter zusammen.
„Ja, dann fahren wir eben in die Schweiz“, wiederholte jemand aus der Gruppe. Dann sprachen plötzlich alle durcheinander, und danach eilte man zu den Autos, um sie aufzutanken und um sich rechtzeitig bei jenem Bus einzufinden, der für sie den Weg von Wien aus in die Schweiz bahnen würde.
Im Nachhinein erinnerte sich Marcela nicht mehr, ob sie irgendwo während der Nacht angehalten hatten, um ein wenig Schlaf zu finden. Vielleicht waren sie sogar die ganze Nacht hindurch gefahren. Irgendwann wurde sogar eine Kleinigkeit gegessen. Doch den Eltern war keine Müdigkeit anzumerken. Marcela hatte bequem auf dem Rücksitz geschlafen. Am frühen Morgen hatten der Bus und die ihm folgenden Autos Liechtenstein erreicht und im Laufe des Nachmittags war man im solothurnischen Bellach eingetroffen, wo die Ankömmlinge aus Wien mit weiteren geflüchteten Tschechoslowaken in der Neubausiedlung Grederhof untergebracht wurden.
Man war nun in der Schweiz. Man war in Sicherheit. Alles andere würde sich zeigen…
Der geheimnisvolle Herr Novotný hatte recht gehabt, als er von einer „sehr kurzfristigen“ Entscheidung gesprochen hatte.
Es war Herbst des Jahres 1968. Der Einreisestempel im Pass von Marcelas Vater zeigte den 27. September.
2. Kapitel - 2006
Marcelas Neuanfang
Die neue Wohnung – Die neue Selbständigkeit – Erinnerungen – Böhmen versus Mähren – Die Sache mit den Namen – Identitätskrisen – Nähren und Helfen – Familienalltag – Familiengefahren – Kein Fernseher im Haus.
November 2006
Marcela Märwiler überblickte den Haufen Kartons, Körbe und Kunststoffboxen, die sich zu einem launischen Stillleben auf dem Parkettboden ihres neuen Wohnzimmers gruppierten. Ihres eigenen Wohnzimmers. Des Wohnzimmers ihrer eigenen Wohnung. Der Wohnung, die sie aus eigenem Antrieb und eigener Kraft organisiert hatte, und die sie aus eigenen Mitteln bezahlte. Eigene Mittel eigens zum Zweck der eigenen Freiheit. Endlich. Jahrzehnte später, aber endlich. Marcela war zufrieden. Dieses Gefühl war eine ruhige, besänftigende Zufriedenheit, kein euphorisches Feuerwerk des Glücks – dazu reichte ihre Kraft am Abend dieses Umzugstags nicht mehr. Doch sie wusste, dass sich diese Glücksgefühle einstellen würden – und dann würden die Champagnerkorken knallen. Zumindest einer. Ein Korken, einer Flasche, die sie für sich selbst aufmachen würde. Davon würde sie einen Teil in ein einzelnes Glas einschenken und dazu auf einem einzigen Teller, nur für sich selbst einige Häppchen servieren von Speisen, die nur sie alleine gerne ass. Das Glücksgefühl wärmte angenehm, als sich Marcela weitere Szenen ihres neuen, individuellen Lebens ausmalte. Eines Lebens weit weg von ständigen Ansammlungen von Leuten – seien es nun Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder Bekannte. In Marcelas Leben hatte es bisher nur so von Leuten gewimmelt, die ständig anwesend waren, die ständig auf sich aufmerksam machten, die ständig etwas wollten oder forderten und die alle auf irgendeine Art bedient werden wollten. Bedient von Marcela. Nun würde Marcela sich selber bedienen – und nur sich selbst. Der Ein-Frau-Dienstleistungs-Gratis-Betrieb-MM-für-Alle hatte endlich aufgehört zu existieren. Jemanden zu bedienen gab es jetzt nur noch im Job, der ihre lebensnotwendigen Finanzen sicherte, und im Job wurde ihre Dienstleistung bezahlt, das war etwas anderes. Ausserdem hatte sie diesen Job aus eigener Kraft und wegen ihrer eigenen Fähigkeiten bekommen. Es war ein guter Job. Ein solider Job für Wiedereinsteigerinnen, den sie trotz der Unkenrufe ihrer Familienangehörigen erhalten hatte, die nicht glauben wollten, dass Marcela je eine gutbezahlte Stelle finden könnte. Ganz anders dachten ihre engen Bekannten und vor allem ihre Freunde. Marcela hatte nur sehr wenige, wirkliche Freunde. Ein Freund ist jemand, den man auch um drei Uhr morgens anrufen kann, wenn es einem schlecht geht – so hatte sie es oft gehört und in einschlägigen Ratgebern einschlägiger Zeitschriften gelesen. Marcela las einschlägige Zeitschriften nur beim Friseur, weshalb sie über die einschlägigen Ratschläge nur müde lächeln konnte. Sie würde sich nie trauen jemanden um drei Uhr morgens anzurufen, auch im absoluten Notfall nicht. Für derlei Aktionen hatte sie sich während der ganzen Spanne ihres Lebens eine unüberwindbare Schranke aufgebaut. Allerdings wäre Marcela die Erste gewesen, die einer um drei Uhr morgens anrufenden Person alle mögliche Hilfe – sofort, und sogar mit Begeisterung – angeboten hätte. Tatsächlich war sie schon mehrmals zu ähnlichen Hilfsaktionen gerufen worden und hatte mit Eifer Hilfe gespendet und Hand angelegt. In der Tat hatte sie schon viele Male nächtliche Anrufe von Menschen entgegen genommen, die sich auf die eine oder andere Weise unverstanden und deprimiert fühlten. Diese hatten sich dann stundenlang bei Marcela ausgesprochen, und als später die beiderseits heiss angelaufenen Telefonhörer aufgelegt wurden, fühlten sich die Rat- und Trostsuchenden besser.
Marcela riss sich aus ihren Gedanken, trank den letzten Schluck des bereits lauwarmen Wassers aus der Petflasche und streifte die Schuhe ab. Barfuss laufen war Balsam für die Füsse. Barfuss fühlte man sich mit dem Erdboden verbunden, und wenn man in der Wohnung barfuss lief wurde man ständig daran erinnert die Fussböden sauber zu halten. Marcela entledigte sich deshalb auch der Socken, rollte die Hosenbeine der viel zu langen Jeans hoch und holte entschlossen Luft.
„So, Mädchen, an die Arbeit!“
Sie pflegte hin und wieder Selbstgespräche zu führen und sich dabei als „Mädchen“ zu titulieren. Mit ihren sechsundvierzig Jahren war sie zwar kein Mädchen mehr, doch die Gewohnheit sich so zu nennen war die Schuld ihrer tschechischen, genauer gesagt mährischen, und noch genauer gesagt süd-mährischen Vorfahren. Manchmal waren die Gene eben stärker – auch nach vierzig Jahren in der Schweiz. Ihre weiblichen Bekannten aus böhmischen Kreisen, vor allem Pragerinnen, nannten sich selbst nie „Mädchen“ – in welcher Sprache auch immer. Sie redeten dafür von der eigenen Person in der Mehrzahl. Marcela verdächtige sie insgeheim eines bewussten und politisch motivierten Gebrauchs des Pluralis majestatis – doch sie behielt das für sich. Es war ein privater Spass, den ihre Schweizer Freunde und Familienangehörige nicht verstanden hätten. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass die Mentalitätsunterschiede zwischen den Bewohnern Böhmens und Mährens gross waren – auch wenn man sich ausserhalb der tschechischen Grenzen keinen Deut um derlei Differenzen scherte, und im westlich geprägten Europa sogar die Existenz von Böhmen und Mähren völlig ignoriert wurde. Man lebte in der Schweiz glücklich auch ohne solche Kenntnisse und man nahm sie auch nach der tschechoslowakischen Flüchtlingswelle des Jahres 1968 nicht wahr. Damals waren Manche froh gewesen den Staat Tschechoslowakei überhaupt lokalisieren zu können, geschweige denn sich mit irgendwelchen innertschechischen Unterschieden auseinanderzusetzen. Erstaunlicherweise genoss die Stadt Prag weit grössere Bekanntheit als das Land, in dem es lag. Und wer kannte schon Brno? Br ….. wie? Höchstens einige Kunstradfahrer erinnerten sich an „Brünn“. Brünn… wie? Aha, Brno! Das kann man nicht aussprechen, sagten die Schweizer. Doch, das geht ganz gut, sagten die Tschechen, viel besser als das deutsche Wort. Dann sagten sie: „Briienn“. Und während die Tschechen mit den Umlauten ö, ä, ü, kämpften, versuchten die Schweizer schon gar nicht Vornamen wie Jiří, Přemysl, Břetislav, Oldřich oder Ondřej auszusprechen, aus Angst sie könnten sich die Zunge ausrenken. „Ř“ – dieser einzigartige Laut, den es weltweit nur in vier Sprachen gibt. Eine davon ist Tschechisch, die anderen drei sind Dialekte in Indien und irgendwo in Patagonien – oder ähnlich zentral gelegenen Ländern… Dieser unaussprechliche Laut stellte vor allem die Mitarbeiter der Schweizer Behörden manchmal vor unlösbare Probleme. So deutschte sich aus freiem Willen Jiří in Georg, Oldřich in Ulrich und Ondřej in Andreas ein – doch am liebsten wurden sie bei ihren tschechischen Kurzformen genannt: Jirka, Olda und Ondra. Lediglich Jirka hatte damit zu kämpfen, dass man aus seinem „J“ kein „Dsch“ machte. Sein weiblicher Gegenpart, Jiřina, gab irgendwann mal den Kampf gegen die einfachere aber damals den Tschechen verhasste russische Irina resigniert auf. Bei Miloš leuchteten die Augen auf, zumindest seit Mitte der Siebziger, als der prominente Träger dieses Vornamens, Miloš Forman, Berühmtheit erlangte. Andere wiederum versuchten die Unterschiede zwischen tschechischen und anderen slawischen Namen zu erklären: Zdeněk sei eben nicht Zdenko, das sei nicht tschechisch, und den Miroslav kann man gerne Mirek nennen, aber bitte nicht Mirko. Aber dem Juraj durfte man doch auch Jurko sagen, wo war da der Unterschied? – fragten die Schweizer. Ganz einfach: Juraj sei Slowake. Tschecho-Slowakei – zwei Landessprachen – wie in der Schweiz, da wären es sogar vier – und ein Jürg oder ein Giorgio wäre doch auch nicht ein und derselbe Name, nicht wahr? Aha…..
Den Frauen erging es nicht besser. Wenn jede Jana, Dagmar, Lenka, Marie, Helena, Hana, Dana oder sogar noch Ludmila es noch einfach hatten, wehrte sich bereits eine Eva gegen die Aussprache „Eefa“, und eine Drahomíra wollte nicht zur jugoslawischen Dragomira werden. Jaroslava kam mit der Kurzform Jarka gut über die Runden, doch schon Zdenka erklärte jeweils zähneknirschend, dass das „Z“ in ihrem Namen stimmlos sei wie ein deutsches „S“. Der zerbrechlich anmutigen Jitka erging es mit ihrem „J“ nicht besser. Milena, Alena und Ivana protestierten anfangs gegen die italienische Betonung ihrer Namen – was war denn so schwierig daran die erste Silbe zu betonen? – doch dann gewöhnten sie sich daran. Miluše und Libuše bestanden kategorisch auf ihren Kurzformen Míla und Liba, um der peinlich falschen Aussprache zu entrinnen. Am härtesten traf es wohl die Trägerinnen von patriotischen altslawisch-mythologischen Namen wie Vlasta und Šárka. Vor allem die Letztere hatte immer wieder zu erklären, dass ihr Name nichts, aber auch gar nichts, mit dem englischen Wort „shark“ zu tun hatte….
Das plötzliche Herausgerissenwerden aus der vertrauten Umgebung der Tschechoslowakei in die fremde Welt der Schweiz, hatte auch Marcela anfängliche Sprachprobleme beschert und ständige Bemerkungen zur richtigen Aussprache ihres Namens. Sie ging in die dritte Klasse der Primarschule. Ihre Eltern und tschechischen Mitschüler hatten sie „Marci“ genannt, und sprachen es wie „Marzi“ aus. Nun musste sie sich daran gewöhnen, dass die Schweizer sie „Martschella“ nannten. Die italienische Form des Namens war den Deutschschweizern geläufig, doch von einer tschechischen Form, die auf der ersten Silbe betonte und das C als Z aussprach, hatten sie noch nie gehört. MARZela versus MarTSCHELLa. Es wäre so einfach gewesen, den Namen grundsätzlich mit einem Z zu schreiben, doch im Reisepass des Vaters war sie als „Marcela“ mit C eingetragen und ein amtlicher Eintrag in einem Reisepass war für Tschechen unantastbar. Nicht so für Schweizer. Aus Marcela Hašková war mündlich „Martschella Haskoofa“ geworden. Im besten Fall sprach man ihren Namen französiert als „Marssela“ aus. Dann begannen die unendlichen Erklärungen von vorne. Wegen des Vornamens. Wegen des Nachnamens. Hašková – man spricht es aus wie „Haschkowah“, auf der ersten Silbe betont, das ist wichtig – und das „K“ ist nicht „Kchhh…“, und das „V“ ist bei uns ein „W“…. Es führte nur zu blödem Grinsen über die erste Silbe „Hasch-“. Marcela und ihre Eltern versuchten natürlich stolz zu erklären, dass dieser Nachname sehr bekannt war, da ihn der Autor des „Braven Soldaten Švejk“ getragen hätte, Jaroslav Hašek. Da nickten einige, denn der brave Soldat hatte seit langem seinen Platz in der Weltliteratur, und man wusste am Ende der Sechziger Jahre, dass ein berühmter Schweizer Film nach Motiven von Hašeks Švejk entstanden war. Den „HD Läppli“ kannten alle gut. Aber warum hiess dann der Schriftsteller – und warum hiess Marcelas Vater – Hašek und nicht Hašková? Ob man in der Familie nicht denselben Namen hätte? Doch, doch, erwiderten die Tschechen, das ist derselbe Namen – nur in anderer grammatischer Form. Es gäbe eine männliche und eine weibliche Form der Namen. Die Schweizer fanden das unangebracht. Für ihre Ohren klang es nach zwei unterschiedlichen Namen, was in einer Familie in den sechziger Jahren nun wirklich fehl am Platz war. Nein, nein, sagten die Tschechen, es sei viel einfacher, da wisse man immer wer ein Mann und wer eine Frau sei. Schliesslich seien die weiblichen Nachnamen aus der Zugehörigkeit zu den Männern entstanden, es handle sich wirklich nur um eine grammatische Form. Die Schweizer zuckten die Schultern. Es sei nicht so wichtig dass man Frauen am Namen von den Männern unterscheiden konnte, dafür gäbe es doch bei einem Ehepaar den Allianznamen, meinten sie, da werde der Nachname der Ehefrau an jenen des Mannes angehängt, mit Bindestrich, das sei doch sehr praktisch.
Schweizer Beamte waren verwirrt. Dabei hatte man nicht zum ersten Mal Tschechen in der Schweiz aufgenommen. Schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts waren in der Stadt Zürich tschechische, mittelständische Gewerbler ansässig, die sogar ihre eigenen Vereine gründeten. Dann kam das Ende des Ersten Weltkrieges und für die Tschechen und Slowaken begann ihre Erste Republik. Stolz auf den politischen Erfolg zogen viele Auslandtschechen in ihre alte und doch neugegründete Heimat, die sich endlich aus dem Verband des Habsburger Kaiserreichs gelöst hatte. Die aufstrebende Zeit der ersten Republik fand ein frühes und jähes Ende mit dem Regime der deutschen Nationalsozialisten unter Hitler – die „Tschechei“ wurde vereinnahmt, erste Flüchtlinge verliessen das Land, auch in Richtung Schweiz. Eine zweite Welle setzte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein, als weitere Tschechen nun vor dem kommunistischen Regime flüchteten und sich ebenfalls in der Schweiz niederliessen, wo sie zum Teil Verwandte und Freunde hatten. Man hätte denken können, dass den Schweizer Behörden die tschechische Namenspraxis im Laufe der Jahre bekannt war, doch wahrscheinlich war dieses Wissen zwischen 1948 und 1968 vergessen gegangen.
Ende der Neunziger, und ganz besonders zu Beginn des neuen Millenniums, machte ein anderer „Hašek“ von sich reden: Der tschechische Eishockey-Torhüter Dominik Hašek, der bald schon zu einer Sportlegende wurde. Damals machte Marcela eine andere Erfahrung mit ihrem Familiennamen. Als wäre der Ruhm des Eishockeyspielers auf alle Tschechen gleichen Namens übergesprungen. Als hätte der berühmte Sportlername plötzlich eine Tür des Wohlwollens aufgestossen, begegnete man Marcela nun mit offenem Lächeln und der Frage nach eventueller Verwandtschaft.
Eine andere Sache war der Gebrauch der Schweizer Allianznamen. Diese aufgezwungenen Mädchennamen der Frauen, bei Heirat mit einem Bindestrich dem Nachnamen des Mannes hintangestellt, lösten bei den 1968er Tschechen und Slowaken Gelächter aus. Marcelas Vater hiess plötzlich Rudolf Hašek-Michálková, und er lachte herzlich über seine behördlich verordnete Wandlung zur halben Frau. Doch dann änderten die Behörden die tschechischen Nachnamen der Frauen selbstherrlich in die männliche Form um. Einige Tschechinnen versuchten zu protestieren. Es wurde ihnen klar gemacht, dass Ehefrauen oder Töchter nicht eine andere Namensform haben könnten als ihre Ehemänner oder Väter – wo käme man da hin? Die Frauen schickten sich drein, da die Anweisung von Behörden kam – und mit Behörden legte man sich nicht an. Durch jahrzehntelange kommunistische Gehirnwäsche beeinflusst, wagten es Tschechen niemals, amtliche Entscheidungen in Frage zu stellen. Schon gar nicht Entscheidungen von Behörden jenes Landes, das ihnen Asyl gewährte. Nicht einmal in jenem Jahr als die Schweizer Männer über das Frauenstimmrecht entschieden. Marcela versuchte sich manchmal zu erinnern, ob alleinstehende, einzelne Frauen mit der grossen tschechischen Flüchtlingswelle 1968 in die Schweiz gekommen waren. Die Namen, die ihr dabei in den Sinn kamen liessen sich an einer Hand abzählen. Die meisten der Geflüchteten waren Familien oder Ehepaare.
„Martschella“. Während der ersten Zeit in der Schweiz hatte Marcela die neue Variante ihres Vornamens oft überhört, hatte einfach nicht wahrgenommen, dass sie damit gemeint war. Seitens der Mitschüler brachte ihr das den Ruf der Hochnäsigkeit ein. Die Mitschüler sagten ungeniert, was sie dachten, in der Annahme Marcela würde sie ohnehin nicht verstehen. Doch sie verstand intuitiv, was man ihr nachrief. Manchmal genügt der Ton einer Bemerkung, um ihren Sinn zu erahnen. Marcela versuchte sich zu wehren, was angesichts der Unkenntnis der Sprache scheiterte. – Seitens Erwachsener brachte es ihr erst den Ruf der Unaufmerksamkeit ein, danach sorgte man sich über ihr Hörvermögen. Das Hörvermögen war ausgezeichnet, wie eine ärztliche Untersuchung ergab – allerdings hatte sich das Sehvermögen innerhalb weniger Monate derart verschlechtert, das Marcela eine Brille verordnet bekam. Als ob sie die neue Welt, die sich plötzlich um sie herum auftat, nicht sehen wollte. Rückzug in sich selbst, in ihre Fantasie, in ein Inneres, das stets gleich blieb, das vertraut war und Geborgenheit verhiess.
Sie konnte sich später nicht erinnern, wie sie die Sprache gelernt hatte, auch nicht wann sie den Sinn der Worte und Sätze zu verstehen begann. Sie erinnerte sich nur, dass sie ungefähr anderthalb Jahre nach der Ankunft in der Schweiz fliessend hochdeutsch und schweizerdeutsch sprach – und dass sie es deshalb miteinander gelernt haben musste. Es liess sich nicht analysieren, es war einfach so. Damals hatte es keine Sprachkurse für Kinder gegeben, keine Betreuungspersonen oder Sozialarbeiter. Es gab nichts, was eine Integration in ein völlig fremdes Leben erleichtert hätte. Die Schweizer waren gleichzeitig sehr hilfsbereit und sehr überfordert. Wie gut, dass die meisten Erwachsenen unter den tschechischen Flüchtlingen bereits deutsch oder französisch sprachen, oder sich zumindest in diesen Sprachen verständigen konnten. Die Erwachsenen besuchten fleissig Sprachkurse an Abendschulen. Solche Kurse hatte man schon für die Gastarbeiter aus Südeuropa eingerichtet, das hatte nichts mit „Integrationsprogrammen“ für Flüchtlinge zu tun. Wörter wie „Integration“ oder „Förderungsprogramme“ wurden damals nicht benutzt. Es gab „humanitäre Hilfe“, es gab die Unterstützung der Caritas und anderer, auch kirchlicher Institutionen, und es gab vor allem sehr viel individuelle und spontane Hilfe. Die Schweiz hatte ihre Grenzen erst später offiziell für tschechische Flüchtlinge geöffnet, Auffanglager eingerichtet und Asyl gewährt. Die Tschechoslowaken erhielten den Status politischer Flüchtlinge und wurden amtlich zu „staatenlos“ erklärt – so stand es in Marcelas Ausländerausweis.
Marcela glaubte sich zu erinnern, dass ihre Eltern die Deutschkurse der Migros-Klubschule besuchten, doch sicher war sie sich nicht. Ihre Mutter brauchte ihr gutes Schuldeutsch nur ein bisschen aufzufrischen. Für Marcelas Vater war jedoch die Sprache eine ständige Quelle neuer Irrtümer, über die man meistens lachte. Der Vater war ein begnadeter Ingenieur und Mathematiker, doch sein Talent für Fremdsprachen hielt sich in Grenzen. Marcela schmunzelte immer wieder beim Gedanken an den Mix aus hochdeutschen und schweizerdeutschen Wörtern, der ihrem Vater als mündliches Kommunikationsmittel diente. Sie schmunzelte auch oft bei Erinnerungen an die unermüdlichen väterlichen Versuche Englisch zu lernen. Bei den Versuchen war es letztendlich geblieben. Jahrelang hatte der Vater Kurse besucht, ohne ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Marcela hegte allerdings den Verdacht, dass er die soziale Komponente dieser Kurse weit höher bewertete, als die zu erzielenden Sprachkenntnisse. Im Kreise von Bekannten Spass haben – das schien die wahre Devise des väterlichen Lebens zu sein, der Grund zu den freundschaftlichen Zusammenkünften war egal. Unter diesem Aspekt betrachtete der Vater natürlich auch Weiterbildung. Hauptsache Spass. In den Kursen ergaben sich Möglichkeiten zum Kennenlernen der Mitschüler und zum gemeinsamen Plaudern. Nach dem Kursabend ging man jeweils zusammen ein Bier trinken und kehrte in bester Laune nach Hause zurück. Wie oft hatte Marcela sich gewünscht, dass sie, wie ihr Vater, über eine solche ruhige und angenehme Art verfügen mochte, um auf unbekannte Menschen zuzugehen. In einer Zeit, als es das Wort Network noch nicht gab, war ihr Vater ein ausgezeichneter Networker gewesen. Dass er die Kontakte nicht für sich selbst nutzte, war eine andere Sache. Er freute sich an Geselligkeit, an Neuzugängen zum Freundeskreis – nicht an den Vorteilen, die man aus diesem Freundeskreis ziehen konnte. So zogen denn auch die Freunde mehr Vorteil aus der Bekanntschaft mit Marcelas Vater. Seinen Freunden, Bekannten und Kollegen zu helfen, war ihm zur zweiten Natur geworden. Nicht immer zum Gefallen seiner Frau. Doch das war wiederum eine andere Geschichte.
Während der Anfangszeit in der Fremde sprachen die Tschechoslowaken immer wieder von ihrer „Emigration“, von ihrem „Exil“. Es wurde als selbstverständlich angenommen, dass man sich nur für einige Jahre im „Exil“ befand, und dass man, wenn sich „die Situation besserte“, sofort die Koffer packen und zurückkehren würde. Noch zwanzig Jahre später, als sich die „Situation“ tatsächlich zu bessern begann, dachten viele, sie würden zurückkehren. Zurückkehren können. Nur wenige taten es. Für sie begann die Emigration von neuem, dieses Mal jedoch die Emigration zurück in eine Heimat, die sie vor zwei Jahrzehnten verlassen hatten und in der sie nun selbst fremd geworden waren. Die Rückkehrer wurden keinesfalls freundlich aufgenommen. Die Rückkehrer mussten sich viele unangenehme Dinge, bis hin zu offenen Anfeindungen, gefallen lassen. Die Re-Integration in das Land, in dem sie geboren waren, war schwieriger zu bewältigen als die Integration in ein fremdes Land zwanzig Jahre zuvor. Marcelas Mutter kehrte zurück. Marcelas Vater blieb in der Schweiz.
Marcela schüttelte die plötzlich auftauchenden Gedanken ab. Jetzt war nicht die Zeit, um sich mit tschechischer Problematik zu befassen. Diese Gedanken würde sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen. Sie nahm sie immer wieder auf. Das tschechische Erbe, ihre erste Identität, bildeten einen Teil ihres Lebens – und nicht den einfachsten. Marcela nannte sich oft selbst eine Frau mit zwei Identitäten, und manchmal war dies ein Gesprächsthema unter ihren tschechischen Bekannten. Diese sahen darin keine Behinderung. Sie wechselten mit Leichtigkeit zwischen ihren Zugehörigkeiten, fühlten sich als Schweizer mit tschechischen Wurzeln. Sie kochten zu Hause Knödel und Povidl-Buchteln und fragten jedes nachgeborene Kind im Freundeskreis – kaum hatte es überhaupt laufen gelernt: „…na? Sprichst du schon tschechisch?“