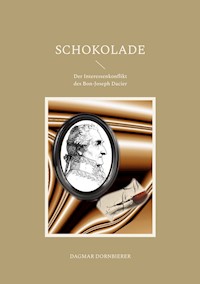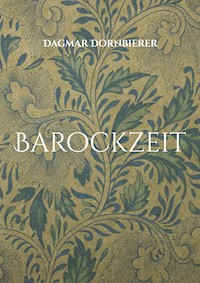Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Handschrift
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der 2. Teil der Luxemburger-Saga Die Handschrift, Chronik des Drachen, dreht sich um weitere Ereignisse des Jahres 1415 und des folgenden Jahres 1416. Das Konstanzer Konzil dauert an. Die Verbindung zwischen Florenz und Rom, die Machtspiele und Rangeleien unter den Konzilsherren zeigen sich vermehrt. Die päpstlichen Sekretäre, die sich nun Humanisten nennen, langweilen sich und beginnen ihre literarische Tätigkeit, die ihr dandyhafter Gönner Niccolo Niccoli in Florenz unterstützt. Spricht hier jemand von Fälschung? Die Renaissance hat begonnen... Ulrich Richental schreibt weiterhin seine Notizen über das Konzil, auch über die tragischen Hinrichtungen des Magisters Jan Hus und des Philosophen Hieronymus von Prag. Das Geheimnis um den Weisen Avraham und seinen Sohn wird gelüftet, und noch viel andere Einzelheiten seit der Flucht des Papstes aus Konstanz. Der Römische König Sigismund von Luxemburg reist inzwischen quer durch Europa und will die zerstrittenen Päpste und deren Parteien an den Verhandlungstisch zwingen. Daneben versucht er zwischen Frankreich und England in deren 100jährigem Krieg zu vermitteln, und für sich selbst endlich die Kaiserkrone zu erhalten. Die Saga wird fortgesetzt im Band 3, Die Handschrift, Chronik des Drachen, Die Jahre bis 1419
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 871
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelbildcollage:
„Sol“ – die Sonne (Planetenbild aus Bellifortis, 1405, von Konrad Kyeser) Illustration aus einer späteren Handschrift ca. 1420, die für ein Porträt Sigismunds von Luxemburg gehalten wird.
Emblem von Sigismunds Drachenorden; Aachener Karlsbüste
(Dagmar Dornbierer)
BISHER VERÖFFENTLICHT VON DAGMAR DORNBIERER:
Jan Hus – Der Wahrheit Willen
Betrachtungen, Essays und ein Schauspiel
(2015) ISBN-9783734754517
„Lieber Jan… Milý Jane…“
Ein fiktiver Brief an Jan Palach – 2005/2017
Deutsch und Tschechisch, ergänzt mit Vorwort und Erklärungen
ISBN 9783743166301
Das Buch der gespiegelten Zeit – Inspirierte Erzählungen
Kurzgeschichten
(2016) ISBN-9783837044881
Impressionen
Poesie aus vier Jahrzehnten und in drei Sprachen
(2016) ISBN-9783837045017
Frauen mittendrin Teil I. – Eliane und ihre GeschiCHten
Gegenwartsliteratur, Vergnügliches aus der Schweiz
(2016) ISBN-9783837044799
Frauen mittendrin Teil II. – Marcelas stille Integration
Gegenwartsbiographie, Tschechoslowakische Emigration in die deutsch-sprachige
Schweiz 1968
(2017) ISBN 9783837045215
Spätlese
Geschichten über Geschichten
(2018) ISBN 9783752839555
2392 – Enthüllte Wirklichkeiten
Science-Fiction / Fantasy
(2022) ISBN 9 783755 797319
Barockzeit
Das lange 17. Jahrhundert / Bd. 1 / Reihe: Für mich mit Bild
(2022) ISBN 9 783756 809271
Schokolade
Der Interessenkonflikt des Bon-Joseph Dacier
Historische Novelle / Fakten und historische Neuentdeckung
(2023) ISBN 9783756881437
Auslese
Philosophische Buntschriftstellerei
(2023) ISBN 9 783734 707582
Die Handschrift – Chronik des Drachen – Teil I.
Die Jahre vor 1410 bis Frühjahr 1415
(2024) ISBN 9 7837583 75019
Die Handschrift – Chronik des Drachen – Teil II.
Frühjahr 1415 bis Frühjahr 1416
(2024) ISBN 9 7837583 29999
Die Luxemburger-Saga wird fortgesetzt.
Die Autorin:
Dagmar Dornbierer ist in verschiedenen Sparten, Kulturen und Sprachen zu Hause. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie auch schon jahrelang als selbständige Antiquitätenhändlerin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sprachen sind ihre Instrumente und Werkzeuge – fünf davon beherrscht sie fließend und in vier weiteren findet sie sich gut zurecht. Seit ihrer Jugend studiert und recherchiert sie historische Themen. Ihre umfangreichen Kenntnisse über europäische Kultur- und Alltagsgeschichte legten zehn Jahre lang ein solides Fundament zu Theaterproduktionen mit dem Tanz-&-Musiktheater, von Bernhard Gertsch wo sie ihre Vielseitigkeit als Theaterautorin, Tänzerin und Schauspielerin beweisen konnte. Vor allem die Epochen der Renaissance und des Barock bieten eine unerschöpfliche und detailreiche Fülle an lebendigem und biographischem Material für ihre Erzählungen.
Dagmar Dornbierer betont miteinem Augenzwinkern, dass „…ihre Bücher KI-frei sind und nur mit natürlicher Intelligenz geschrieben werden.“
Inhalt
(Kapitelüberschriften sind zum Teil abgekürzt)
Fortsetzung der Chronik im kalten Frühling des Jahres 1415:
Königin Barbara in Petershausen
Florenz & Rom – Die Apostolischen Sekretäre
Die ungewisse Zeit nach der Flucht des Papstes
Konstanz, weitere Geschehnisse des Jahres nach der Geburt des Herrn 1415
Suche nach Gründen, um Jan Hus anzuklagen
Belauschtes Gespräch einiger mächtiger Männer
Der König an der Konzilssitzung – Die Protestnote
Jean Gerson & Pierre d’Ailly
Getreue & Ungetreue – Eidgenossen, Fürsten, Konstantinopel – König & Kardinal
Johannisnacht – Der Imbiss – Anna im Tägermoos
Ein Brief des Magisters Hus aus Konstanz nach Prag
Der König & sein Apotheker – Vor der 3. Anhörung des Magisters Hus
Romanitas – Poggio Bracciolini vor Kardinal Colonna
Anna Richentalerin und die Vision der Hl Brigitta
Vergerio und der Gott Apoll im Strahlenkranz
Sigismund und Vergerios Blick- Sol invictus!
Vorabend einer Tragödie – Der Ketzerhut
Kräfte der Hölle – Die Degradation des Priesters Jan Hus
Die Hinrichtung – Ulrich Richentals Flucht
Der Schicksalstag und die Tage danach – Hannes Richental& Petr Mladoňovic
Aufforderung zum Krieg gegen Hussiten – Graf Hermann von Celje
Die Humanisten in Konstanz unter sich
Königin Sophie erhält den letzten Brief des Magisters Hus
Poggio und Leonardo ihre Zukunft besprechend
Wird man sich an uns erinnern? – Die Zweifel des Leonardo Bruni
Was sich in Konstanz noch um die Gelehrten Jan Hus &Hieronymus von Prag abspielte und was dazu geführt hatte
Frühjahr 1416
Das geheime Treffen der Florentiner – Arkadische Akademien
Die heitere Tischrunde des Erzbischofs Jörg
Tradition! – Die Feinde des Doktors Hieronymus von Prag
Hieronymus von Prag – Die Freiheit des Gewissens
Die große Trauer des Bartolomeo Aragazzi – Poggios Brief an Leonardo Bruni
Anna und Ulrich & die Florentiner Messe
Florenz, die Mächtige
Die Torheit des Ritters Lacembok von Chlum
König Sigismund erfährt von Hieronymus‘ Tod
Bonus Material – Fakten & Fiktion mit separatem Inhaltsverzeichnis, Glossar, Anmerkungen, Personen, Literaturverzeichnis etc
Nachwort
Dramatis Personae – Die Herrscherfamilie (Luxemburg
)
Historisch nicht belegte & und fiktive Personen
Historische Personen
Halbfiktive Personen
Böhmisch versus Tschechisch
Fazit
:
Weitere Anmerkungen zu „Die Handschrift – Chronik des Drachen“
Römisches Kaiserreich und kein. „Deutsches“
Vereinfachte Übersicht der Herrscher-Geschlechter im Zeitraum des Romans – 14. & 15 Jahrhundert
Die wichtigsten herrschenden Adelshäuser
Länder, Nationen & deren Adelshäuser
Ost-Rom / Konstantinopel vs. „Byzanz“ - Weiß-Rot-Grün – Weiß-Blau-Rot / Die Reiche auf dem Balkan sowie im Osten
Glossar & Begriffserklärungen
Anmerkungen zum Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis
DIE HANDSCHRIFT
Die Chronik des Drachen
Teil II.
1415
Das Jahr des Feuers und der Wahrheit
1416
Das Jahr des Schreckens und der Langeweile
„Quod non est in actis… tamen es in historia“
„Was nicht geschrieben steht … fand trotzdem statt“
„Sich auf das Terrain des Spätmittelalters zu begeben ist als würde man auf eine wunderschöne Landschaft zustreben, in derer Mitte ein prächtiges Schloss steht. Je näher man jedoch kommt wandelt sich die Landschaft in Treibsand, morastige Wüste, Sumpf. Jeder Tritt, der dem Schloss näher kommt versinkt im schwankenden Untergrund, und Irrlichter gaukeln Erkenntnisse sowie Tatsachen vor. Doch in der Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts ist nur Weniges auch das, was es zu sein vorgibt …“
(Dagmar Dornbierer)
Fortsetzung der Chronik im kalten Frühling des Jahres 1415 Königin Barbara in Petershausen
Die junge römische Königin langweilte sich. Ein weiterer Regentag neigte sich seinem Ende zu, doch das Wetter machte keine Anstalten sich zu bessern. Trübe Wasserrinnsale rannen an den kleinen, grünlich getrübten Glasscheiben des Fensters herunter, aus dem Barbara die dunkelgraue Wasserfläche des Bodensees überblicken konnte, wenn diese nicht gerade mit dem trübem Regenhorizont verschwamm. Regen, Regen, Regen! In diesem Land schien es jeden Tag zu regnen! Außer dann, wenn es schneite. Die Feuchtigkeit drang durch Holz und Mauerwerk der Häuser und machte es schwierig Kaminfeuer anzuzünden. In den Truhen wurden Kleider, Tischtücher und Bettlaken klamm und verbreiteten einen muffigen Geruch. Es würde sicher nicht lange dauern bis der Schimmelpilz an den Wänden und Mauern ausbrach. Der ständige Regen machte die Männer streitsüchtig und die Frauen traurig. Selbst Tiere wurden unruhig. Die Pferde schnaubten und trampelten nervös in ihren Stallungen, die Rinder muhten wie von verhaltenem Zorn – und dem Gockel dort draußen auf dem Hof wollte die Königin selbst den Hals umdrehen, wenn er nicht bald mit seinem Gekrähe aufhörte. Konnte ein Hahn eigentlich nie heiser werden? Standen ihm nicht genug Hühner zur Verfügung oder warum schrie dieses Teufelsvieh eins ums andere Mal, so dass man dazwischen kaum auf zwanzig zählen konnte? Morgen würde es Hühnersuppe geben, beschloss die Königin grimmig. Einzig die Schafe und einige Kühe auf den Wiesen außerhalb der Stadtmauern weideten friedlich, ohne sich um die fallende Nässe zu kümmern.
Barbara wandte sich von Fenster ab um blickte in den Raum. Man hatte sie hier in diesem Kloster einquartiert nachdem man die Mönche erst ausquartieren musste. Wo hatte man sie untergebracht? In der Stadt wohl kaum. In einem anderen Kloster in der Nähe? Gab es hier überhaupt noch andere Klöster? Gewiss. Die Deutschen waren ja besessen von der Idee der Klöster und es gab unzählige davon. Sie waren errichtet worden, nicht nur um als Raststationen auf den Reisen der Könige und Fürsten zu dienen, oder um der Bevölkerung Fluchtstätten bei Überfällen von Räuberhorden zu bieten, sondern als tatsächliche Stätten zur Pflege des christlichen Glaubens und der stillen Einkehr. Ja, so sah es hier auch aus. Barbara und ihr Gefolge hatten das Refektorium des Klosters als Aufenthaltsraum zugewiesen bekommen. Die ungarischen Ritter und Knechte mussten sich mit den kahlen Wirtschaftsgebäuden und Schlafsälen der gemeinen Mönche begnügen. Die ungarischen Ritter sollten ja nicht meinen, dass es hier im Refektorium besser war! Der Kamin zog nicht richtig bei diesem Wetter, es war kalt und ungemütlich, die Fenster waren nicht abgedichtet. Barbara hatte sich zwar bemüht den Raum mit ihren mitgeführten Wandbehängen ein wenig angenehmer zu gestalten, doch es genügte nicht. Wenn es so weiter ging, würden die Wandbehänge Stockflecken bekommen. Die kostbare Wirkerei wäre dann unwiederbringlich beschädigt.
Im Raum war es stiller geworden, nachdem man zuvor getanzt und gesungen hatte, um sich die Kälte aus den Gliedern zu vertreiben. Doch es konnte nicht den ganzen lieben langen Tag getanzt werden – einmal wurden alle müde. Vor dem großen, hohen Kamin, in dem ein Feuer verglühte, stand eine lange Bank mit einer beweglichen Rückenlehne, die man je nach Bedarf in der gesamten Länge schwenken konnte, wollte man entweder angelehnt sitzen und die Füße zum Feuer halten, oder sich lieber den Rücken wärmen. So konnte die ganze lange und schwere Bank an Ort stehen bleiben. Diese neuartigen Möbelstücke kamen aus Flandern und die Aachener Bürger hatten ihrer neugekrönten Königin ein besonders schön geschnitztes Stück zum Geschenk gemacht. Auf dieser Bank saßen nun Barbaras Schwester Anna und Sigismunds Nichte Elisabeth. Die jungen Frauen hatten sich weiche Felle bringen lassen und viele Kissen. Sie hatten damit die Bank gepolstert und lagerten nun darauf. Sie saßen mit angezogenen Beine unter ihren langen Kleidern. Es wirkte sehr genießerisch, wie sie sich dort niedergelassen hatten, an Bechern mit heißem, süßemGewürzwein nippten und dazu Mandelgebäck mit Nüssen knabberten. Barbara lächelte. Wie unstatthaft sich doch ihre beiden Verwandten benahmen. Völlig privat und bar jeder höfischen Eleganz gaben sie sich dem Genuss eines Plauderstündchens am wärmendenFeuer hin. Sie hatten ja recht. Was sollte man bei diesem Wetter und in diesem kalten Gemäuer sonst tun? Gleichwohl, Barbara verspürte keine Lust auf weibliche Plauderei und süßes Nichtstun.Sie war unruhig und ungeduldig. Sie war sich bewusst, dass die Dinge in dieser Stadt nicht jenen schnellen Verlauf nahmen, den sie sich zusammen mit Sigismund ausgemalt hatte. Sie war sich auch bewusst, dass man sie hier, im Kloster Petershausen, wie auf einer Insel abgesetzt hatte, denn das Kloster war nur über eine einzige Brücke von der Stadt aus zu erreichen. Die Brücke konnte jederzeit gesperrt werden. Dann würde niemand mehr aus dem Kloster in die Stadt gelangen können und niemand aus der Stadt ins Kloster. Es war geschickt ausgedacht – man konnte sie sozusagen aussperren. Vielleicht sollte sie sich mal umsehen, ob es hier irgendwo Boote am Ufer gab. Wenn dieses Wetter doch endlich aufhören wollte!
Barbara war fest entschlossen, von ihrem Gemahl ein würdigeres Quartier zu fordern, wenn sie ihn das nächste Mal von sah. Man konnte sie beide doch nicht als das künftige Kaiserpaar bejubeln und sie gleichzeitig in so ein Loch stecken! Die ungarischen Ritter mochten gerne hier bleiben – dann trieben sie keine Dummheiten mehr unter den Stadtbürgern. Da wäre es durchaus angebracht die Petershauser Brücke zu sperren. Aber als Unterkunft für die Römische Königin, für ihre Schwester und für Kurfürstengattinnen, gehörte sich solches ein Nest gewiss nicht. Ihr Frauenzimmer war hier nicht sicher mit all den unberechenbaren Rittern und den Kumanen als engsten Hausgenossen. Die Ungarn und die kumanischen Krieger konnten gerne hier bleiben, sie sollten sogar hier bleiben, ansonsten waren die Frauen und Töchter der Konstanzer Bürger in wirklicher Gefahr. Die Kumanen machten keinen Unterschied zwischen ehrbaren Bürgertöchtern oder käuflichen Huren. Barbara seufzte. Sie würde mit dem Herzog von Sachsen ein ernstes Wort sprechen müssen. Es ging nicht an, dass sie mit den Kumanen, den Ungarn und alle ihren Knappen und Knechten hier eingesperrt war. Barbara und ihre Frauen mussten hier weg. Dann konnte sich der Herzog ja ein wenig um das Wohl der Männer kümmern und ihnen einige wilde Weiber herbringen – es sollte ihr Schaden nicht sein– weder der Schaden der Männer noch der Weiber. Warum merkte das eigentlich niemand? Musste sie sich als Königin jetzt auch noch um derlei Dinge kümmern? Die ungarischen Ritter und ihre Mannen hatten sich in er Stadt ungebührlich aufgeführt, und aus diesem Grund hatten die Konstanzer Ratsherren beschlossen, ausnahmslos alle Ungarn, ihre Untergebenen sowie sämtliche Gefolgsleute des königlichen Paares in Petershausen unterzubringen. Eigentlich war dies eine Beleidigung des königlichen Paares, insbesondere der Königin, denn sie wurde kurzerhand mit den unbändigen Ungarn in ein und dasselbe Quartier gepfercht. Die Männer sollten innerhalb der altehrwürdigen und dicken Klostermauern ihre Gelage abhalten können, dort mochten sie trinken und streiten so viel sie wollten und dazu ihre lauten, prahlerischen Lieder grölen bis ihnen die Kehlen heiser und kratzig wurden. Was dachten die Konstanzer Ratsherren eigentlich von ihrer Königin? Dass sie mit Kumanen in den gleichen Topf zu werfen war? Frechheit!
Barbara schnaubte verächtlich, als sie an die Konstanzer Ratsherren dachte, deren Köpfen das alles hier entsprang. Angeblich wollten sie dem Königspaar und ihrem Hofstaat einen ruhigen Ort anbieten! Ein ruhiger Ort! Ein Gefängnis war das hier! Eingebildetes Bürgerpack, hadernde kleinliche Krämer und stinkende Fischhändler! Es wurde endlich an der Zeit, dass Sigismund ihre frechen Mäuler stopfte, und dass er mit ihr zusammen, seiner Gemahlin und Königin, endlich ein Zeichen herrscherlicher Gewalt setzte. Diese Fischhändler mussten in ihren Fischköpfen begreifen, wer hier das Sagen hatte!
Das viele Wasser um das Petershauser Kloster verursachte Barbara Kopfschmerzen. Sie war gewiss kein Kind des Wassers. Das niemals aufhörende Geplätscher der Wellen am Ufer und der sumpfig modrige Geruch nach verfaultem Schilf zerrten viel mehr an ihren Nerven als es die Plauderstündchen ihrer Damen oder die Eskapaden der ungarischen Ritter tun konnten. Ganz besonders die Gerüche. Denen konnte sie nicht entfliehen, die Gerüche verfolgten sie bis in ihr Schlafgemacht, bis unter die Bettdecke, sogar nachdem sie in duftendem Wasser gebadet und ihren Körper mit kostbaren Essenzen eingerieben hatte. Die Gerüche waren noch schlimmer als die Geräusche, denen man wenigstens ein bisschen ausweichen konnte, indem man die Türen schloss, und nachts vor den geschlossen Fensterläden auch noch Vorhänge zuzog. Barbara hatte dafür eigens schmiedeeiserne Stangen über den Fenstern anbringen lassen. Nicht einmal das hatten die Mönche hier! Welch eine Lebensweise! Die Mönche glaubten tatsächlich, dass sie sich mit Leid, Anstrengung und Härte gegenüber ihren Körpern Gott näherten. Was für ein schrecklicher Gott musste das sein, dem es Freude bereitete Menschen zuzusehen, wie sie ihre Körper erschöpften und sich sogar bis aufs Blut geißelten. So ein Gott war nicht besser als ein abartiger Henkersknecht! Es war gewiss abartig zu denken, dass alles Schöne und Angenehme vom Teufel kam…
Dazu verschleppten sich die Konzilsangelegenheiten, und es war immer noch kein Papst gewählt worden, mit dem endlich wieder die Einheit der Kirche hergestellt wäre. Es gab keinen Papst, der Sigismund und Barbara zum Kaiserpaar krönen konnte. Deshalb war sie doch überhaupt in dieses Nest mitgekommen! So war es vorgesehen, seit man die Pläne zu diesem Konzil gefasst hatte. Aber dann hieß es plötzlich, dass die Kaiserkrönung nur der neugewählte Papst vollziehen könnte. Das waren doch alles nur Ausflüchte dieses schmierigen Neapolitaners, der Sigismund nicht einmal die Bestätigung der Kaiserwürde gönnte! Die Kaiserwürde war unerlässlich. Mit ihr würde Sigismund endlich die notwendige Macht in die Hände gelegt werden, die er brauchte, um Ordnung in Europa zu schaffen. Barbara würde dann seine ehrenvolle Kaiserin sein, sein weibliches Gegenpol, seine Ergänzung, die Quelle seiner Kraft und Inspiration. So sollte es sein, so stand es in allen geheimen Büchern geschrieben, so hatte es die Natur der Dinge seit alters her vorgesehen. Mann und Frau – die Gegenpole. Sonne und Mond, Feuer und Wasser, Geist und Materie. So wirkte die göttliche Alchemie auf den Laufder Welt. Doch stattdessen wurden sie hier von den Konstanzer Fischköpfen festgehalten und am großen Werk gehindert. Warum hatte man denn seit dem Weihnachtsfest all die Rituale durchgeführt, all die Zeichen im Äußeren gesetzt? Sigismund bekam die goldene Rose überreicht, man erwies der Königin und ihrem hochadeligem Frauenzimmer Ehren, alles war vorbereitet – und jetzt? Was kam jetzt?
Jetzt war es genug. Barbaras Geduld war erschöpft. Sie musste tätig werden. Genug Zeit verschwendet. Sie musste aus dem feuchten Kloster raus, musste sich umsehen und sich Leute gefügig machen, die ihr Nachrichten brachten und die nur gemäß ihren Anweisungen handelten. Sigismund hatte ihr erklärt, dass man noch eine Weile abwarten musste, bis die Causa dieses einen Prager Professors abgeschlossen war – und dann, dann würde man die Krönungszeremonien in die Wege leiten. Der Papst Johannes hatte doch in Italien versprochen, dass er die Krönung vornehmen würde, aber dann hatte er einen Vorwand nach dem anderen gefunden, um es nicht zu tun. Barbara hatte dem schmierigen Cossa nie getraut. Sie hatte ihm schon misstraut, als sie ihn das allererste Mal gesehen hatte – und sie hatte recht behalten. Sigismund wusste das ganz genau.
Bis endlich ein neuer Papst gewählt war, würde es sicher noch Monate dauern. Die wollten doch alle gar keinen Kaiser über sich wissen! Sigismund wird nämlich ein starker Kaiser, einer, der sich Respekt verschaffen kann, ein Kaiser, dem alle gehorchen. Das wussten die anderen ganz genau! …und darum zögerten sie es hinaus. Auch dieser Tscheche, dieser Professor, natürlich spielte auch der seine kleinlichen Spielchen. Alle spielten Spielchen, spielten sich gegeneinander aus. Keiner war besser als der andere. Dieser Professor sollte endlich klein beigeben. Er sollte so viel wie nur möglich für sich selbst dabei herausschlagen, wen kümmerte das. Er sollte endlich widerrufen und danach ein ruhiges, bequemes Leben führen. War denn das so schwer? Hatte der sich immer noch nicht genug in Szene gesetzt? Es wurde allmählich langweilig. Diese Causa Hus zog sich nun schon übermäßig in die Länge, dem musste jetzt Einhalt geboten werden! – Einige Tage zuvor war Barbara trotzig gewesen, hatte sich bockig gegeben, hatte ihrem Gemahl Vorwürfe gemacht und hatte erklärt, dass sie keinen einzigen Grund erkennen konnte, warum ein bürgerlicher Universitätslehrer eine Kaiserkrönung verhinderte. Was für eine unglaubliche Frechheit das war! Sigismund hatte über diesen Vorwürfen nur einen Seufzer unterdrückt und seiner jungen Gattin noch einmal alle Beweggründe und Verflechtungen erklärt, warum diese Causa dermaßen wichtig war. Natürlich hatte Barbara alles sehr gut verstanden. Sie sah ein, dass sich hier die Gelegenheit bot gleichzeitig die Papstwahl in Sigismunds Interesse zu beeinflussen, seinen Bruder in Prag in die Schranken zu weisen – mitsamt seiner der Ketzerei verdächtigen Gattin – und gleichzeitig ein Exempel zu statuieren für alle europäischen Universitäten, die sich mächtig und eigenständig wähnten. Vor allem und insbesondere war die Prager Hohe Lehranstalt zu einer Brutstätte höchst gefährlichen Gedankengutes geworden, weil sie die Menschen zur Illusion einer eigenen Gedankenwelt verleitete. Eigene Gedanken nicht nur zu denken, sondern auch zu äußern – sogar danach sein Leben zu gestalten – das hatte beim niederen Adel und im Volk großen Anklang ausgelöst. Das musste aufhören. Um der göttlichen Ordnung willen – die der Menschheit eine klare Standesordnung auferlegte – musste solches Gebaren im Keim erstickt werden! Deshalb war der Prozess gegen den unbedeutenden Magister aus Prag – wie immer der heißen mochte – angeblich „Gans“ oder so ähnlich – deshalb war dieser Prozess als Exempel dermaßen wichtig, dass sich sogar die höchsten Pariser Theologen damit befassten. Soweit war es schon gekommen, dass das Geschnatter einer kleinen tschechischen Gans die Hohe Pariser Theologie beschäftigte, als hätten die Theologen nichts anderes zu tun! Man sollte doch meinen, dass einer Prager Gans, auch wenn sie sich in den schwarzen Universitätstalar kleidete, der Schnabel bald zu stopfen war.
Barbara lächelte bei der Vorstellung, obwohl sie sich immer noch gereizt fühlte. Was konnte ihr schon eine schwarze Gans aus Prag anhaben? Ihr, der Römischen und Ungarischen Königin! Barbara hatte das Erbe des Geschlechts von Celje im Blut, sie war ehrgeizig, klug, geschickt und kaltblütig – und vor allem war sie reich. Gegen Reichtum waren schwarze Gänse machtlos, mochten sie auch noch so von ihren Mitläufern gerühmt werden. Es würden sich auch weiterhin Gelegenheiten finden, um diesen Reichtum zu mehren, ihn ungeheuer anwachsen zu lassen, so dass man durch den Reichtum unverwundbar – unüberwindbar – wurde. Barbara hatte hervorragende Lehrer gehabt, was das betraf. Der beste Lehrer war gewiss ihr eigener Vater gewesen. Doch all die Klugheit, all der Reichtum, alle Geschicklichkeit waren umsonst, wenn sie sie weiterhin auf dieser verwünschten, verregneten Klosterinsel nutzlos vergeudete! Es wurde Zeit zu handeln. Es wurde Zeit, dass sie wieder ein angemessenes Quartier in der Stadt bezog, um dem Geschehen näher zu sein.
Königin Barbara stand auf und kehrte ihren schwatzenden Hofdamen den Rücken. Dann verließ sie den Saal, um sich in der Abgeschiedenheit ihrer Schlafkammer dem Schreiben von Briefen zu widmen.
Im Jahre nach der Geburt des Herrn gezählt, 1415
Florenz und Rom – Die Apostolischen Sekretäre
Florenz bestimmte…
Florenz bestimmte, wohin Rom zu gehen hatte. Florenz hatte auch bestimmt, wohin Avignon sich wenden sollte, doch die Tage Avignons waren gezählt. Wie das magnetische Metall sich vom äußersten Norden der Erde angezogen fühlt, so richteten sich die Mächtigen der Welt nach dem glänzenden Gold der Florentiner aus. Die glänzenden Goldstücke mit der dreiblättrigen Lilie traten ihren Siegeszug durch die Welt an. Lediglich die ebenso goldenen Dukaten der Stadtrepublik Venedig waren ihnen gleich. Florentiner Gold, Florentiner Geist, Florentiner Macht breiteten sich aus und durchsetzten die bekannte Welt allmählich in allen Himmelsrichtungen, wie der Sauerteig das Brot. Überall stieß man auf Florentiner, mochte es sich um Abgesandte, Geistliche, Kurienbeamte in Rom, in Avignon oder in Bologna handeln, mochten es Kaufleute, Bankherren, Heerführer und Krieger sein, Goldschmiede, Alchemisten, Schreiber, Notare, Lehrer, glücklose Dichter und Schriftsteller oder Handwerker – und vor allem Spione – in jedem Stand und jedem Beruf waren Florentiner anzutreffen. Selbst der Ordensgeneral des gefürchteten Prediger Ordens der Dominikanerbrüder war ein gebürtiger Florentiner. Sein Name war Leonardo Dati, Sohn des Anastasio genannt Stagio und der Madonna Zenobia Soderini. Leonardo Dati war durch seine Mutter eng mit dem Gonfaloniere der Justiz der Republik Florenz verwandt, dieser war sein Großonkel. Der florentinische Gonfaloniere di Giustizia war in der Tat ein mächtiger Mann. Da die Florentiner ihre alt-republikanische Gesinnung beteuerten, duldeten sie einen „Princeps inter pares“ unter sich, deshalb war der Gonfaloniere unter den obersten Stadtvertretern der Mächtigste von allen – von Rechts wegen das Staatsoberhaupt, wenn auch auf Zeit gewählt. Anders als auf Zeit oberste Macht zu haben, wäre auch gar nicht möglich gewesen, denn die reichen und streitsüchtigen Florentiner Geldherren hätten sich eher gegenseitig getötet, als einem einzigen das oberste Amt für die Dauer seines Lebens zu überlassen. Sie brachten sich zwar auch so gegenseitig um, doch ihre Familien waren fruchtbar – sie gingen eher durch Bankrotte unter, als wegen ihrer ständigen, bereits jahrhundertealten Fehden.
Aus der näheren Verwandtschaft einer dieser mächtigen Familien stammte nun der Dominikaner Leonardo Dati. Er hatte schon in jungen Jahren Geist und Intelligenz bewiesen. Er hatte sich in seiner Heimatstadt so gut bewiesen, dass sich sogar die Florentiner Signoria für ihn einsetzte, als man ihn an eine andere Stelle versetzen wollte. Stellvertretend für die Signoria, die Florentiner Regierung, schrieb ihr Kanzler, Coluccio Salutati, im Jahr 1403 einen Brief an den Generalmeister der Dominikaner, mit der flehentlichen Bitte, den damals achtunddreißigjährigen Leonardo Dati in Florenz zu belassen, da seine Predigten in der Kirche des Klosters Santa Maria Novella und anderswo großen Erfolghatten, und sowohl Geistliche als auch Laien zu einem gottgefälligen Leben anhielten. Nichtsdestotrotz verfolgte Leonardo Dati später eine Laufbahn außerhalb von Florenz, die ebenso erfolgreich war wie seine Predigten. Er war Theologe, Redner und der Inquisitor von Bologna. Zur Zeit des Pisaner Konzils im Jahre 1409 war er klug genug gewesen, um die Partei des Papstkandidaten Petros Philargos zu ergreifen. Als Philargos zum Papst Alexander V. gewählt wurde, leistete ihm Leonardo Dati zusammen mit allen Dominikanerbrüdern der Provinz Toskana den Gehorsamseid. Der Dank ließ nicht lange auf sich warten – Dati wurde zum Ordensleiter der Provinz Toskana ernannt. Ein Jahr verging, und die gesamte Römische Provinz der Dominikaner erhielt einen neuen Provinzial in der Person des Leonardo Dati. Vierundvierzig Jahre hatte er vollendet, und seine Tatkraft schien von Jahr zu Jahr zu wachsen. Ebenso wuchs der Kreis seiner Freunde und Förderer. Darunter war ein besonderer Mann, ein Jurist in Bologna, doch aus uraltem römischem Adel – sein Name war Oddo Colonna. Eine besondere Freundschaft verband den Theologen und den Juristen. Eine besondere Freundschaft sollte sie bis zu beider Tod bleiben. Beide Männer waren an grundlegenden Reformen innerhalb der katholischen Kirche interessiert. Beide Männer wollten jedoch behutsam vorgehen, um ihre Pläne nicht zu gefährden. Man durfte sich nicht zu früh offenbaren, solange man noch keinen festen Boden unter den Füssen hatte. Deshalb hielten beide Männer nach dem frühen Tod des Papstes Alexanders V. zum neugewählten, dritten Papst, Johannes XXIII. aus der neapolitanischen Familie Cossa. Es sollte ihr Schaden nicht sein.
Am Michaelstag des Jahres 1414 – der Tag zählt als neunundzwanzigster im Monat September – wurde Leonardo di Stagio Dati zum Generalmeister des Ordens der Dominikaner ernannt. Bereits im November des gleichen Jahres ritt er mit dem Papst Johannes und dem Freund Oddo Colonna feierlich in Konstanz zur Großen Kirchenversammlung ein.
Leonardo Datis Anwesenheit in Konstanz war unter anderem damit begründet, dass er Reformen im Orden durchzuführen hatte und deshalb ein Generalkapitel des Ordens einberufen wollte. Der Orden war in sich gespalten, seine Provinzen hatten nach Belieben jeweils allen drei päpstlichen Obödienzen den Gehorsam geschworen. Diese Lage war unhaltbar. Wenn der Orden nicht bald wieder zu einer Einheit zusammengeschweißt wurde, würde dies seine Autorität untergraben. Durch ihre Aufgabe als Prediger, übten die Dominikaner starken Einfluss auf die Gläubigen aus – diesen Nutzen durfte man sich nicht verscherzen. Ebenso kamen aus ihren Reihen die Inquisitoren. Einheit war deshalb das oberste Gebot der Stunde, zumindest für den Orden des Heiligen Dominikus. Man hatte noch nicht entschieden, an welchem Ort die Generalversammlung stattfinden sollte. Der Stadt Konstanz war es nicht zuzumuten, weitere Scharen von Geistlichen aufzunehmen. Es mochte sich aber durchaus von Vorteil erweisen, wenn man in eine andere Stadt auswich. Es galt vorsichtig zu sein – der Verlauf des Konzils war nicht abzusehen, vor allem, weil an diesem Konzil der neugewählte Römische König, Sigismund von Luxemburg seine starke Präsenz beweisen wollte.
Doch Leonardo Dati, der neue Generalmeister der Dominikaner, hatte nicht nur dieses Amt zu erfüllen – er hatte zusätzlich noch eine andere, ebenso wichtige Aufgabe: Er war der abgesandte Vertreter der Stadtrepublik Florenz am Konstanzer Konzil, und als solcher von der Florentiner Signoria mit allen Befugnissen ausgestattet.
Die Florentiner Signoria hatte ihrem Abgesandten besonders nachdrückliche Empfehlungen mitgegeben, als sie ihm diese heikle Aufgabe anvertraute. Leonardo Dati sollte während des Konzils genauestens und unverzüglich über alles Bericht erstatten, was er sah und hörte. Ausdrücklich wurde er darauf hingewiesen, dass die Signoria sämtliche Einzelheiten zu erfahren wünschte, die etwa den Frieden und die Ruhe Italiens betreffen mochten, sowie das Gegenteil davon – dabei war es gleichgültig, ob es sich um weltliche oder kirchliche Angelegenheiten handelte. Ferner sollte der Ordensmeister dafür Sorge tragen, dass er in theologische Kommissionen gewählt wurde, die irgendetwas zu entscheiden hatten, was von Belang war. Es ging schließlich nicht an, dass Florenz irgendwo nicht die Finger im Spiel hatte – und als ehemaliger Inquisitor war Leonardo Dati für solche Kommissionen geradezu vorbestimmt. Dem Ordensmeister der Dominikaner würden selbstverständlich die ganze Zeit über die Florentiner Bankherren in Konstanz unterstützend zur Seite stehen. Mit der „heiligen Florentiner Dreieinigkeit“ aus Geld, Geist und Verbindungen sollten sich dann einige bereits gefasste Pläne leicht verwirklich lassen. Der „Geist“ war natürlich der Geist des Heiligen Dominikus, des strengen Ordensgründers, des großen Inquisitors und Bekehrers der Ketzer. Auf diesen Geist war letztendlich der Spottname der Dominikaner zurückzuführen: Aus dem lateinischen Begriff „Dominicanes“ waren die „domini canes“ geworden, die Hunde des Herrn. Nun denn, ein Spottname ist oft auch ein Zeichen herausragender Fähigkeiten, und wozu sind Hunde, abgerichtete Jagdhunde, da? Sie spüren Beute auf, das hieß, nicht nur jede Art von Irrlehren, sondern auch mögliche Abtrünnigkeiten anderer Natur – insbesondere Abweichungen der geschäftlichen und finanziellen Natur. Die Stadtrepublik Florenz hatte große Pläne, die ihr noch größeren Reichtum einbringen sollten. Die Florentiner Stadtväter sahen dabei den Tatsachen sehr nüchtern ins Auge. Sie wollten sich keinesfalls mit den mächtigen Herrschergeschlechtern messen und weltliche Macht anhäufen. Die Florentiner Stadtväter wollten beide Mächte dieser Welt lenken – sowohl die weltliche als auch die geistliche. Sie wussten, dass dies allein durch Geldmittel zu erreichen war, welche sie beiden Mächten reichlich zur Verfügung stellten. Die Häupter der beiden Mächte sollten weiterhin ihre Herrschaft ausüben, doch Florenz verstand sich als der Hals, der die beiden Köpfe bewegte – allen voran zum reichlichen Gunsten der Stadtrepublik Florenz.
Aus der Stadtrepublik Florenz stammte auch der päpstliche Sekretär Poggio Bracciolini, der sich ernsthafte Gedanken über seine Zukunft machte. Er war fünfunddreißig Jahre alt. Vor etwa mehr als zehn Jahren hatte er eine Stelle an der Kurie erhalten. Danach war er allmählich in der Hierarchie der vielen Schreiber aufgestiegen, die ihre Posten eifersüchtig hüteten. Die Inhaber höherer Titel konnten den Unterschied zu den niederen Schreibern nicht genug betonen. Wie andere vor ihm, hatte auch Poggio alle Mittel eingesetzt, um endlich dem niederen Schreibervolk zu entrinnen und einen höheren Posten zu ergattern. Einerseits befähigten ihn seine Talente zum Schreiber und Notar – seine auffällig schöne und gleichmäßige Handschrift – anderseits war dies nicht genug, um auf sich aufmerksam zu machen. Poggio setzte seine Bekanntschaft mit dem Florentiner Kanzler Coluccio Salutati zielstrebig ein, wie er schon seine Bekanntschaft mit dem ehemaligen Mitschüler, Leonardo Bruni, eingesetzt hatte. Durch Leonardos intensive Fürsprache, war Poggio zuerst als Skriptor, ein einfacher Schreiber, an der Kurie aufgenommen worden. Poggio war nach Rom gegangen und war dort in den folgenden Jahren von einem Papst nach dem anderen, mit den gesamten Administrationsapparat übernommen worden. Er war seinen Vorgesetzten an all jene Orte gefolgt, an denen sie sich sicher fühlten, wo sie weder vom Römer Mob noch vom König von Neapel ums Leben gebracht werden konnten. Trotz der offensichtlichen Gefahr blieben Poggio und seine Schreiberkollegen Die Kanzlei, die Kammer, das Gericht, alles blieb, nur die Vorgesetzten, die Päpste, wechselten in rascher Aufeinanderfolge: Kaum hatte Poggio unter Bonifaz IX. angefangen, schon musste er sich an Innozenz VII. gewöhnen, zwei Jahre später an Gregor XII. und weitere zwei Jahre darauf an Johannes XXIII. Unter Gregor hatte er endlich den ersehnten Sekretärstitel erhalten. Johannes XXIII. hatte ihn danach zu seinem Secretarius domesticus ernannt. Das Wort „domesticus“ gefiel Poggio dabei überhaupt nicht. Er fand, dass es ihn zu sehr an die Gefolgschaft – sogar an die Dienerschaft – des Baldassare Cossa, band. Er strebte nach dem Titel „Apostolischer Sekretär“, nannte sich bisweilen so – was machte es schon aus… Schließlich gehörte er zu der Gruppe jener Sekretäre, unter denen sich tatsächliche einige „apostolische“ befanden, wie sein Freund Leonardo Bruni, oder wie der hagere und verschlossene Doktor Vergerio. Warum der nicht höher strebte bei all seiner Bildung, und worauf er wartete, war Leuten wie Poggio unklar. Allerdings gehörte Pier-Paolo Vergerio zum Umkreis des Kardinals Zabarella – bei ihm hatte er an der Universität Padua die Jurisprudenz studiert. Es war auch Zabarella, der den damals jungen Vergerio beauftragt hatte, das Epos „Africa“ von Francesco Petrarca zu redigieren. Was war eigentlich daraus geworden? Nun gut, das spielte jetzt keine Rolle…
Poggio zog Bilanz. Was hatten ihm alle seine Posten während der vergangenen, bewegten zehn Jahre gebracht? Ansehen, Einfluss, Geld, Freiheit? Gewiss nicht so viel davon, wie sich Poggio gewünscht hätte. Der Titel „Apostolischer Sekretär“ bedeutete aber leider auch den Höhepunkt seiner möglichen Laufbahn an der Kurie. Es gab keine höhere Stufe mehr für einenGianfrancesco Poggio Bracciolini aus Florenz, Sohn eines Spezereihändlers aus Terranuova bei Arezzo. Nicht einmal Arezzo als Geburtsstadt konnte er angeben, Arezzo, wo der große Petrarca gelebt hatte! Wenigstens war Poggios Mutter die Tochter eines Notars aus Florenz. Aus diesem Grund hatte sie ihren Sohn zu einem Florentiner Notar in die Lehre geschickt. Poggio hatte die Lehre absolviert und die Prüfung bestanden, doch wollte er keineswegs Notar bleiben und sich mit kleinlichen Angelegenheiten der gewöhnlichen Leute beschäftigen. Wie langweilig – und wie überaus geistlos! Er verspürte nicht die geringste zu einem Notarendasein in Florenz, wie seine Mutter sich das sehnlichst gewünscht hatte. Wozu sollte er sich all die öden Fälle und Streitigkeiten anhören, trockene Protokolle und Register führen, haarspalterische Verträge aufsetzen, belanglose Inventarlisten erstellen und beglaubigen. Er gähnte jedes Mal, wenn er an die Arbeit eines bürgerlichen Notars dachte. Wenigstens hatte ihm die Ausbildung keine große Mühe bereitet, sie war kurz genug gewesen und hatte ihm gute Möglichkeiten eröffnet. Wozu sich also noch mit einem Jurastudium im teuren Bologna herumplagen, nur um weitere nutzlose Prüfungen ablegen müssen? Vermaledeite Prüfungen! Wie konnten überhaupt Prüfungen beweisen, welche Talente tatsächlich in einem schlummerten?
Poggio war er nicht der Einzige, der sich den Titel eines Apostolischen Sekretärs wünschte. Ursprünglich waren ihrer vier gewesen, dann hatte man zwei weitere dazu genommen, und während der letzten Jahre war der Titel an viele andere Kleriker vergeben worden, die ihn zwar trugen, doch sich niemals an der Kurie blicken ließen, geschweige denn das Amt ausübten. Dass sich diese Männer unter ihren Arbeitsgefährten nicht gerade großer Beliebtheit erfreuten, lag auf der Hand. Auch deshalb fühlte sich Poggio zur Gänze berechtigt, den Titel eines Apostolischen Sekretärs zu benutzen – schließlich tat der die Arbeit jener Faulpelze, die nur ihre Pfründen bezogen. Außerdem hatte sich nie jemand dagegen beschwert…
Poggio wollte mehr. Doch mehr hätte geheißen die höheren Weihen anzunehmen und Priester zu werden. Dann wäre eine ganz andere Laufbahn möglich gewesen, als nur die zum Endpunkt des Apostolischen Sekretärs. Doch Poggio wollte keine höheren Weihen. Die Aufgaben eines Priesters zusätzlich zum Kurienamt zu erfüllen, das schien ihm unerträglich. Da hätte er gleich Notar bleiben können. Warum sich so viel Unnützes aufbürden? Er verspürte keinerlei Berufung, um sein Leben Gott zu weihen und den Mitmenschen zu dienen. Man schalt ihn dumm, man zeigte ihm hunderte von Beispielen von Priestern, denen es weder an weltlichen Freuden noch an weltlichem Reichtum mangelte – allen voran und als strahlendes Beispiel dieser Tugenden, der Papst Johannes XXIII. selbst, Baldassare Cossa von Procida, ehemaliger Raubritter und reicher Winkeladvokat. Die Juristerei hatte den umtriebigen Doktor beider Rechte zum Papstthron gebracht und nicht die Berufung zum allerchristlichsten Hirtenamt. So sagte man. Kein Geistlicher gab sich, kleidete sich, benahm sich weltlicher als Cossa. Keinen Genuss, kein Vergnügen verwehrte er sich, dabei allerdings stets der durchtriebene Machtmensch und Politiker bleibend. Doch Cossa konnte neben all der Befriedigung seiner Lüste auch Berge von Arbeit bewältigen, komplexe Zusammenhänge durchschauen und diese je nach seinem Bedarf und Belieben lösen – oder noch mehr verwickeln. Er war ein unerquicklicher Arbeitgeber für seine Administratoren, Sekretäre und Richter. Er war fähig nächtelang über Dokumenten, Sendschreiben und Akten zu brüten, um sich deren Inhalt zu Nutze zu machen. Alles, was Baldassare Cossa je tat, tat er ausschließlich für sich. Manchmal schien es, als bereite ihm sogar die Arbeit grenzenloses Vergnügen, von dem er nicht genug bekam.
Poggio Bracciolini eiferte jedoch nicht dem Papst Johannes nach. Er dürstete auch nicht nach weltlicher Macht. Schon eher nach dem stillen und unmerklichen Einfluss nach Florentiner Art. Poggio war kein Schachspieler, der es liebte andere Menschen nach seinem Willen auf dem Spielbrett der Politik zu bewegen, ob sie sich bewegen ließen oder nicht. Er fand keine Befriedigung bei der Vorstellung, dass viele Menschen sich seinen Befehlen zu beugen hätten, dass sie seinen Willen ausführten und jeden seiner Wünsche erfüllten, dass sie ihn vielleicht sogar fürchteten.
Poggio wollte ebenfalls keine universitäre Laufbahn einschlagen und sich jahrelang mit den Sieben Freien Künsten und danach mit Theologie oder Jurisprudenz beschäftigen. Er hatte keine Lust Traktate namhafter Gelehrter zu memorieren, zu disputieren, und zu den einzelnen Fächern Prüfungen abzulegen, um dann selbst in der Hierarchie einer Hochschule aufzusteigen und seinerseits Studenten zu unterrichten. Es grauste ihn vor der Vorstellung des Auswendiglernens staubtrockener, ihm ganz und gar fremder Thesen und Theorien. Er schauderte, wenn er an all jene Fallen und Missgriffe dachte, die ein Theologiestudium für seine Kandidaten bereithielt. Wie leicht konnte man der Ketzerei beschuldigt werden, wenn man eine eigene Ansicht äußerte! Wie leicht war es, in Konflikte mit hohen Autoritäten zu geraten, mit unnachgiebigen, starrköpfigen Gelehrten und Doktoren! Dazu müsste er auch noch Studenten unterrichten, sich ernsthaft ihrer Ausbildung annehmen, ihnen als väterlicher Freund und Lehrer zur Seite stehen und ihnen fast Tag und Nacht zuhören! Nein, eine solche Laufbahn strebte Poggio Bracciolini gewiss nicht an.
Poggio hatte auch nicht den geringsten Wunsch sich um ein öffentliches Amt zu bewerben. Politik war eine heikle Sache, ein unsicheres Laufen auf brechendem Eis. Man war in einem politischen Amt nie sicher, ob man den nächsten Morgen noch erlebte – vor allem in Florenz nicht. Für Politik waren andere besser geeignet, wie zum Beispiel Coluccio Salutati – Friede seiner Seele! Der alte Coluccio war der geborene Politiker gewesen, der Macher, der Schachspieler, der Figurenbeweger. Salutati war ein alter Fuchs, war es schon als junger Mann gewesen. So ausgefuchst wie Salutati war Poggio nicht. Poggios Ehrgeiz war anders geartet, das war sicher. Er war sich zwar noch nicht im Klaren darüber, was er tatsächlich erstrebte, doch er fühlte, dass seine Zeit näher rückte, die Zeit seiner wirklichen Berufung. Nur über eines war er sich völlig im Klaren…
…Poggio Bracciolini sehnte sich nach Freiheit. Persönlicher Freiheit, das zu tun und zu lassen, wonach einem der Sinn stand. Freiheit, die Gedanken fliegen zu lassen. Freiheit, jene Gedanken aufzuschreiben, sofern einem danach war. Freiheit, sich den schöneren Dingen des Lebens zuzuwenden, so wie es sein Gönner Niccolò Niccoli tat. Doch Niccoli hatte Geld und das war der große Unterschied zwischen ihm und Poggio. Geld bedeutete einen großen Schritt in Richtung Freiheit.
Poggio Bracciolini wollte Freiheit – und Freiheit kostete Geld. So musste er zähneknirschend anerkennen, dass erst Geld zu verdienen und anzuhäufen war, bevor man sich in aller Freiheit seinen schöngeistigen Beschäftigungen widmen konnte. Um Geld zu verdienen hatte Poggio sich mit aller Kraft um die Stelle an der Kurie bemüht, hatte Leonardo Bruni ins Rennen geschickt, damit er Poggio empfahl. Später hatte Poggio auch Salutati und nach ihm Niccoli als Garanten gewonnen. Er war von einem Beamten zum anderen gewandert, hatte sich selbst ins beste Licht gesetzt und alle Vorteile seiner Person sowie seiner Arbeitskraft für einen künftigen Dienstherrn hervorgehoben. Was ihm dabei zugutekam waren seine schöne, gleichmäßige und gut lesbare Handschrift, seine scharfe Beobachtungsgabe und eine eher unauffällige äußere Erscheinung.
Die ersten Jahre als einfacher Schreiber an der Kurie ertrug Poggio geduldig. Er musste sich bewähren. Er musste beweisen, dass er zu Höherem fähig war als nur nach Diktat zu schreiben und zu kopieren. Er beobachtete und lernte. Er hatte sich fest vorgenommen, sich von allen anderen Schreibern zu unterscheiden. Man sollte ihn auf gute Art in Erinnerung behalten. Man sollte ihn als einen ernsthaften und klugen, jungen Mann in Erinnerung behalten. In diesen Jahren lernte Poggio sich zu verstellen. Immer sein Ziel vor Augen – Freiheit zu erlangen mittels genügender Absicherung durch Geld – heuchelte er nicht selten Interesse, wo er sonst vor Langeweile gegähnt hätte. Manchmal bot er sich diensteifrig an, um gewisse Aufgaben zu erledigen, die den anderen Schreibern zur Last fielen. Danach wartete er auf einen günstigen Augenblick, um geschickt und diskret darauf hinzuweisen. Einige Male griff er zu der einen oder anderen verzeihlichen List. Alle taten das. Alle wollten um jeden Preis vorwärts kommen, wollten aus ihrem ärmlichen Dasein, aus der Enge ihrer Abstammung, aus der Trostlosigkeit ihrer durch Geburt und geringe Mittel vorgezeichneten Zukunft ausbrechen. Der Weg dazu führte an der päpstlichen Kurie nur über die verschiedenen Stufen der Ämter: Scriptor, Abbreviator, Scriptor penitentiarius, Scriptor apostolicus – und zu guter Letzt Apostolicus secretarius. Schritt für Schritt, Stufe um Stufe, erstieg Gianfrancesco Poggio Bracciolini die Ämterleiter, immer die strahlende Vision seiner Freiheit, einer durch genügende Mittel abgesicherten, komfortablen Freiheit vor Augen.
Gute zehn Jahre später, nach dem Erreichen der für ihn höchstmöglichen Stufe, und nach endlosen Bemühungen, schien nun mit der Flucht seines Brotherrn, des Papstes Johannes XXIII., der goldene Traum von der Freiheit in Scherben zu liegen – zerschlagen von päpstlicher Selbstsucht. An der Flucht des Papstes aus Konstanz konnte sogar das Konzil scheitern, bevor es seine Arbeit überhaupt richtig aufgenommen hatte. Nach der Flucht des Papstes schien die Zukunft aller bedroht, die jemals für ihn gearbeitet hatten.
Die Flucht des Papstes hatte auch viele andere angeregt, um die Stadt Hals über Kopf zu verlassen. Unter ihnen befand sich ein Amtskollege Poggios, einer der tatsächlichen Apostolischen Sekretäre – Benedetto da Piglio.
Was der sich wohl versprach? dachte Poggio. Hatte Benedetto tatsächlich die fixe Idee, dass sich Cossa ihm gegenüber dankbar zeigen würde, wenn er seine Flucht begleitete, dass er sie vielleicht sogar zu planen half? Armer verblendeter Benedetto! Es hieß, man hätte ihn irgendwo unterwegs in einen Kerker geworfen, nur um ihm zu erlauben, Bittschreiben an das Konzil zu schicken. Flehentliche Bittschreiben um Lösegeld und Befreiung. Glaubte Benedetto im Ernst, dass das Konzil für einen abtrünnigen, unbedeutenden Sekretär auch noch Geld aus dem Fenster warf? Erst hatte Benedetto seine Hoffnung auf den flüchtigen Papst gesetzt, dann auf dessen Gegner unter den Konzilsvätern. Dem Benedetto war nicht mehr zu helfen! Nur keine Freundschaft für einen solchen Strohkopf zeigen! Am Ende konnte der ihnen allen noch gefährlich werden. Der Name Benedetto da Piglio war fortan zu meiden wie die Pest.
Wenigstens waren die anderen Sekretäre vernünftig genug, um auf ihren Posten zu bleiben, und weiterhin diensteifrig verfügbar zu sein. Schließlich waren Kurie und Papst zwei verschiedene Dinge, und die Kurie konnte eine Weile ihre Arbeit aus eigenem Antrieb alleine fortführen. Der Leiter der päpstlichen Kanzlei, der Kardinal von Ostia, Jean-Allarmet de Brogny, eine Persönlichkeit mit Autorität und Befugnissen, war unerschütterlich in Konstanz geblieben. Brogny hielt das administrative Zepter fest in seiner Hand, und außerdem präsidierte er kraft seines Amtes als oberster Kanzler der Kirche die Sitzungen des Konzils. An Kardinal Brogny konnte man sich halten. Am Kardinal Brogny würden sich die päpstlichen Sekretäre festhalten wie Kinder an den Röcken der Amme – und würden sicher nicht solche Dummheiten begehen wie Benedetto da Piglio!
Die meisten der päpstlichen Sekretäre waren Florentiner, oder auf eine Art mit Florenz – und vor allem mit dem allbekannten Coluccio Salutati – verbunden. So auch der fünfundvierzigjährige Leonardo Bruni aus Arezzo. Doch Nardo liebäugelte mit einer anderen Laufbahn als der Langeweile an der Kurie. Nardo wollte in die Fußstapfen Salutatis treten, er strebte ein politisches Amt in Florenz an. Er wollte Ansehen und Achtung seiner Mitbürger gewinnen, jemand sein, dessen Namen man in Ehrfurcht vor seiner Weisheit aussprach. Dafür hatte er auch das richtige Alter erreicht, länger sollte er wirklich nicht warten. Poggio zweifelte nicht daran, dass Nardo Erfolg beschieden war. Schade eigentlich. Mit Nardo konnte man über alles und jedes reden, er war ein kluger Kopf und angenehmer Gesprächspartner – bisweilen ein wenig zimperlich, doch das machte ihn unterhaltsam. Allerdings hatte ihm die Stadt Konstanz, in dem kalten nördlichen Land, auf den Magen geschlagen. Nardo sehnte sich deshalb zurück nach Florenz, nach dem toskanischen Sommer und der heimatlichen Küche. Nardo würde sicher bald abreisen, sobald es nur ging, und sobald keine Gefahr mehr drohte als Parteigänger des geflohenen Papstes angesehen zu werden.
Antonio Loschi, mit siebenundvierzig Jahren der älteste der vier Sekretäre, stammte aus Vicenza, hatte aber in Florenz Studienkurse besucht, als Florenz sich noch rühmte eine Universität innerhalb seiner Stadtmauern zu haben. Auch Loschi hatte damals dem Kreis um Salutati angehört. Danach verdiente er sein Brot als Hauslehrer bei der Familie Nogarola in Verona. Seine zwei Schüler waren nichts wert, wie er später zu erzählen pflegte, doch deren Schwester, Angela, hätte die Anlagen zu einem großen Dichter gehabt. Die junge Angela schrieb danach tatsächlich viele Werke im Stil des Dichters Petrarca. Sogar als verheiratete Gräfin d’Arco widmete sie sich dieser Tätigkeit, unterrichtete ihre ebenfalls klugen Nichten und korrespondierte mit gelehrten Männern, darunter auch mit ihrem ehemaligen Lehrer, Antonio Loschi. Antonio hatte danach dem Herrn von Mailand, Giangealeazzo Visconti als Hofpoet gedient, bevor er der falschen Lobreden auf den Brotherrn müde wurde und sich um eine Stelle an der Kurie bewarb. Müde geworden war Antonio auch des ständigen Wechseln der Obrigkeit seiner Heimatstadt Vicenza. Nach der Flucht des Papstes aus Konstanz wollte Antonio noch in der Stadt bleiben, solange es angebracht war. Er wollte erst mal abwarten. Antonio machte nicht viel Aufsehens, er hatte vielmehr eine natürliche Gabe, um herauszuspüren, wohin sich die Launen des Glücks wandten, und wen sich Frau Fortuna zum nächsten Gefährten erkor.
Der junge Mittzwanziger Cencio de‘ Rustici, war der Römer unter ihnen. Sein Bezug zu Florenz kam ebenfalls durch Salutati, der Cencio zu Manuel Chrysoloras vermittelt hatte, als jener noch in Florenz Griechisch lehrte. Cencio war mit Nardo der Einzige, der tatsächlich Griechisch verstand. Andere waren nicht über die Anfängerkenntnisse hinaus gekommen, was sie nicht daran hinderte damit zu prahlen. Cencio war gescheit, geschickt und lernbegierig. Sprachkenntnisse schienen ihm mit Leichtigkeit zuzufliegen, er saugte Wissen auf wie ein Schwamm, um es im nächsten Augenblick genauso leicht wieder loszulassen. Cencio verdrehte sowohl Frauen auch als Männern den Kopf, Cencio war der Lieblingsgast der Konstanzer Tavernen, Badestuben und Rosenhäuser. Cencio, schön wie ein Engel, leichtsinnig wie ein Gaukler, schlau wie ein Markthändler.
Poggio hatte niemals Salutatis Drängen nachgegeben Griechisch zu lernen. Griechisch hatte für Poggio keine Bedeutung. Die Griechen mochten einst einige Philosophen unter sich gehabt haben, deren Gedanken es wert waren in Erinnerung zu bleiben. Doch die griechische Nation war für den Florentiner Poggio zum Sterben verurteilt. Griechenland bedeutete für Poggio Ost-Rom. Allzu alt, allzu lange an der Macht, allzu selbstverständlich und selbstherrlich im Anspruch auf kaiserliche sowie geistliche Oberhoheit, obwohl bereits vom sichtbaren Zerfall, von den Runzeln der Zeit und der Altersschwäche gezeichnet. Nach Poggios Ansicht gehörte die Zukunft Rom, Italien und einer erneuerten lateinischen Sprache. Poggio war er einer Meinung mitseinem Gönner Niccolò Niccoli, dass die ost-römischen Griechen, die Rhomäer, ein zum Aussterben verurteiltes Volk mit einer dahinsiechenden Kultur waren. In Salutatis Freundeskreis waren Poggio und Niccoli vielleicht die einzigen, deren Feindschaft gegenüber allem Griechischen geduldet wurde. In Niccolis Vorstellung lebte ein anderes Griechenland, ein Arkadien, dass es so nie gegeben hatte – ein friedliches Griechenland von Philosophen und weisen Schäfern bevölkert.
Aus dem toskanischen Montepulciano stammte der etwa dreißigjährige Bartolomeo Aragazzi. Auch er hatte die Bekanntschaft von Salutati gemacht und war von ihm zu Manuel Chrysoloras geschickt worden, um Griechisch zu lernen. Doch Bartolomeo gab den Kampf mit der fremden Sprache schon bald auf. Er kam nie über die ersten Anfänge hinaus. Bartolo hatte andere Ziele, andere Eigenschaften aufzuweisen. Bartolo verkörperte den schwärmerischen Abenteuergeist unter den Sekretären.
Pier-Paolo Vergerio war ein Fremder unter der sonst eingeschworenen Gruppe der päpstlichen Sekretäre. Er war der Fremde aus Capodistria, das auf dem Gebiet der Republik Venedig lag. Doch auch der Fremde hatte eine, wenn auch schwache Verbindung zu Coluccio Salutati. Dieser hatte nämlich einen großen Teil der Bibliothek aus dem Nachlass des Dichters Francesco Petrarca aufgekauft, und ein Werk davon für gutes Geld an die Universität Padua veräußert. Dort hatte sich der Florentiner Kardinal Zabarella um das Werk bemüht und dessen Überarbeitung und Redaktion seinem Studenten Vergerio übertragen. Vergerio hatte gute Arbeit geleistet – fast zu gut. Sowohl der Student als auch sein Lehrer waren bestürzt über die Schwülstigkeit des Epos. Sie fanden, dass Petrarcas „magnum opus“ seines Autoren unwürdig war und verbannten sein Werk vorerst in die geschlossenen Truhen der Bibliothek. Die Entscheidung, was damit geschehen sollte, wurde auf ungewisse Zeit vertagt.
Pier-Paolo Vergerio war fünfundvierzig Jahre alt. Der scheue und verschlossen Mann wurde von seinen Kollegen oft als hochnäsig erachtet – vielleicht nur deshalb, da Vergerio der Einzige unter ihnen war, der sich mit den ehrlich verdienten universitären Titeln eines Magisters Artium sowie eines Doktors beider Rechte und der Medizin schmücken durfte.
…und da war noch Benedetto da Piglio, der Unglücksrabe. Eigentlich gehörte er gar nicht zu den Sekretären. Eigentlich lautete sein Titel „Apostolischer Schreiber“, was Poggio als Hohn betrachtete. Poggio mochte Benedetto von ganzem Herzen nicht leiden. Das aufgeregte Gehabe des älteren, fünfzigjährigen Kollegen, sein nervöses Herumflattern, sein großes Aufheben wegen jeder Kleinigkeit, machten Poggio kribbelig. Der kleine, drahtige, kahlköpfige Mann wies keine weiteren besonderen Talente auf, als sich vorteilhaft einschmeicheln zu können. Diese Gabe hatte ihm in Rom einen reichen Gönner beschert, und dieses zweifelhafte Talent brachte ihn auch in den Dienst des Kardinals Pietro Stefaneschi. Dennoch durfte Benedetto seinen apostolischen Schreibertitel an der Kurie behalten und insbesondere das Gehalt daraus. Obwohl, man wusste ja nicht, ob der Kardinal seinem neuen Schreiber überhaupt einen Lohn zahlte, oder ob er ihn unentgeltlich für sich arbeiten ließ, da Benedetto ohnehin schon von der Kurie bezahlt wurde. Schlauer Kardinal! Beschäftigte der vielleicht noch andere Diener für Gottes Lohn?
Benedetto aus dem Dorf Piglio im Latium war Poggio schon in Rom auf die Nerven gegangen. Er passte jedoch mit seinen schlechten Eigenschaften besonders gut zu seinem Dienstherrn. Wenn Benedetto manchmal Poggio und dessen Freunde vom römischen Erbe der alten Zeit sprechen hörte, so mischte er sich jedes Mal sofort ein, hatte natürlich schon alles vorher gewusst, gekannt, gesehen, gehört. Als Poggio einmal unvorsichtig erwähnt hatte, dass er in Rom nach den Denkmälern der Altvorderen suchen wollte, so ließ Benedetto nicht locker bis er Poggio seine Begleitung aufgezwungen hatte. Dass Poggios Erkundungen dann unter Benedettos nicht abbrechendem Geplapper eher zu einer Art Sühnegang wurden, verstand sich von selbst. Als Poggio und seine Amtskollegen sich für antike Texte zu interessieren begannen, als sie hin und wieder uralte Schriften kauften oder danach in der Kurienbibliothek – das hieß, was davon übrig geblieben war – stöberten, da begann auch Benedetto auf einmal Bücher anzukaufen. Woher er sie hatte, und woher er das Geld dazu hatte, blieb ein Rätsel. Die Sekretäre hielten Benedettos reichen Gönner für den Spender, der sich zum Zeitvertreib als Mäzen eines Gelehrten sah. Warum sich der Gönner dabei ausgerechnet Benedetto ausgesucht hatte, war für die Sekretäre nicht zu ergründen. Vielleicht hielt sich der hohe Herr den Benedetto wie ein seltenes Tier, das man unter wissenschaftlichen Aspekten interessiert beobachtet. Benedetto begann natürlich auch schon bald eigene Schriften nach der neuen Art der Gebildeten zu verfassen – und zu ihrem großen Schrecken mussten die Sekretäre feststellen, dass sein Stil gar nicht so übel war.
Benedetto war an der Kurie nicht sonderlich geachtet. Wahrscheinlich bemerkte er es nicht einmal. Seine Büchersammelwut hatte ihn umso unbeliebter gemacht, denn während Benedetto Geld mit vollen Händen ausgab, kratzten die Sekretäre für ihre literarische Liebhaberei den Verdienst mühsam zusammen, Als dann der schicksalshafte Tag des Jahres 1413 kam, an dem sie alle mitsamt Papst Johannes XXIII. Hals über Kopf aus Rom vor den Truppen des Königs Ladislaus von Neapel fliehen mussten, war es ein Freund und Gönner Benedettos gewesen, ein Angehöriger der einflussreichen römischen Familie Caetani, der Benedettos Bibliothek rettete. Benedetto hatte sich auch bei diesen Mächtigen als Familiar eingeschmeichelt. Seine Amtskollegen rätselten manchmal, wie er das anstellte – aber vielleicht war Benedetto in der Tat jener seltene Vogel, den ein jeder Förderer einmal in seiner lebenden Sammlung haben mag. Einer von dieser Sorte genügte allerdings…
Nun war Benedetto da Piglio zusammen dem Kardinal Stefaneschi und mit einigen anderen aus dessen Gefolgschaft aus Konstanz abgereist, dem flüchtenden Papst nachjagend und einem ungewissen Schicksal entgegenstrebend. Ungewiss vor allem für Benedetto, denn wie nur wenig später bekannt werden sollte, wurde der gesamte Stefaneschi Konvoi vom Grafen Konrad von Neuenburg-Freiburg kurzerhand gefangen genommen und eingesperrt. Der Kardinal kam zwar sofort wieder auf freien Fuß, seine Gefolgsleute wurden aber im Kerker belassen. Allen voran der sich ständig in höchsten Tönen beklagende, allen lästige, quirlige Benedetto da Piglio. Monate sollten vergehen, bis er im November des Jahres 1415 nach Konstanz zurückkehrte – allein, ohne den Dienstherrn und hinkend nach einem misslungenen Fluchtversuch. Der Kardinal Stefaneschi hatte den Ländern der Reichsfürsten schon lange den Rücken gekehrt. Er hatte dem Grafen von Neuenburg seine Leute als Geiseln überlassen und war eiligst nach Italien gefahren, um sich nie wieder nördlich des Alpengebirges blicken zu lassen.
Hätte Poggio in die Zukunft sehen können, so hätte sich ihm folgendes Bild geboten: Der eingekerkerte Benedetto da Piglio hatte endlich gemerkt, dass der Kardinal Stefaneschi ihn im Stich gelassen hatte, und dass ein etwaiges Lösegeld erst in vielen Wochen, wenn überhaupt, eintreffen mochte – und der durchtriebene Benedetto begann nun sich nach neuen Freunden und Gönnern umzusehen. Er brachte es fertig, dass man ihm im Kerker Schreibmaterial zur Verfügung stellte. Vielleicht hatte der Graf Konrad dies auf einen Wink seines Schwagers, des Bischofs von Konstanz getan… Wer kannte schon die Beweggründe? Benedetto fing also an Briefe und Gedichte zu schreiben. Man ließ seine Briefe durchgehen, Graf Konrad versprach sich zumindest ein schönes Lösegeld daraus. Benedetto sah bald ein, dass seine Freunde in Rom nicht den kleinsten Finger für ihn rührten, und dass der Kardinal Stefaneschi ihn verraten hatte. Deshalb wandte er sich von allen Mitgliedern der Familie Stefaneschi ab – vor allem von jenen, die mit den Caetani verwandt und verschwägert waren. Er wandte sich selbst von den Orsini ab und suchte ausgerechnet Schutz bei dem mit sämtlichen Stefaneschi, Caetani und Orsini verfeindetem Kardinal Oddo Colonna. Benedetto vertraute darauf, dass er sich später, nach einige Umdrehungen von Fortunas Rad, wieder bei all den reichen Caetani, Orsini – und sogar den Stefaneschi – nach Bedarf einschmeicheln konnte. Noch ahnte Benedetto nicht, dass er mit Oddo Colonna auf das gewinnende Pferd gesetzt hatte…
Wenn Poggio hätte in die Zukunft sehen können, so wäre er sehr erstaunt gewesen, den umtriebigen Benedetto Apostolischen Sekretär im Gefolge nächsten Papstes Oddo Colonna zu sehen. Poggio hätte sich noch mehr gewundert zu sehen, dass Benedetto sogar an den Römischen König Sigismund eine schmierige Ekloge richtete, die Ecloga ad honorem invicti principis Sigismundi Romanorum et Hungariae regis. Nun war Poggio zwar selbst nicht ganz ungeübt in der Kunst, wie man hohe Gönner umwarb, doch vor so viel Speichelleckerei hätte er sich mit Abscheu abgewandt. Dazu sollte Poggio in der nahen Zukunft auch noch ertragen müssen, wie der zappelige Benedetto über sein Studium in Bologna und seine Freunde dort angab. Es sollte sogar noch schlimmer kommen, denn Benedetto würde öffentlich über den altvorderen Autor Lucanus dozieren…
Wie gut, dass Poggio nicht in die Zukunft schauen konnte.
Poggios Gedanken waren gewiss nicht vor Freude erfüllt gewesen, als die Papstflucht öffentlich bekannt wurde. Die Gedanken trübten sich noch mit jedem nachfolgenden Tag. Poggio Bracciolini aus Florenz war fünfunddreißig Jahre alt, und sein Traum von der Freiheit schien in Stücke zerborsten, wie ein auf harten Boden gefallener Glaspokal. Der flüchtende Papst hatte so viele schöne Hoffnungen zerstört. Poggio musste auf Abhilfe sinnen. Er musste beobachten, was in Konstanz vor sich ging, wer mit wem was verhandelte, und auch wer nicht wollte, dass dies bekannt würde. Poggio musste einige der hohen Mitspieler an diesem Konzil sehr genau beobachten und Schlüsse daraus ziehen. Es war auch an der Zeit dies alles mit den Freunden zu besprechen. Bis wieder Klarheit herrschte blieb ihm wenigstens Muße genug, um sich wieder seiner noch geheim gehaltenen Schreibtätigkeit zuzuwenden und endlich die von Niccolò Niccoli bestellten Schriften nach Florenz zu senden. Poggio Bracciolini fasste danach noch weitere Entschlüsse, und er fasste wieder Mut. Kaum verging eine Weile, kaum begannen die Bemühungen von König Sigismund sowie einiger hoher Konzilsherren zu fruchten, damit das Konzil weiter tagte, sah Poggio klarer. Er blickte zwar nicht in die Zukunft, doch er sah ihr nun zuversichtlicher entgegen.
Was sonst noch während der Lenzmonate bis zum Sommer im Jahre nach der Geburt des Herrn 1415 geschah.
Die ungewisse Zeit nach der Flucht des Papstes Die tschechischen Gelehrten Hus und Hieronymus Poggio, der Kardinal Orsini & die Florentiner Bankherren
Cossa war weg. Der Papst war aus Konstanz geflohen.
Die Nachricht verbreitete sich durch die Stadt wie Feuer in einer trockenen, windigen Sommernacht. Der Papst war weg! In Verkleidung hatte er sich angeblich aus der Stadt geschlichen. Die Stadt war in Aufruhr. Gerade war ein prächtiges Turnier zu Ende gegangen, als die Nachricht sich verbreitete. Befehle wurden gebrüllt die Tore zu schließen; Schreie ertönten, Rufe erklangen, und man glaubte, dass die Basler Konstanz angriffen. Kopflose Angst breitete sich aus. Die Ratsherren liefen eiligst ins Rathaus, riefen nach den Stadtwachen und ließen schleunigst alle Truhen mit Geld und Registerbüchern in den Ratshauskeller tragen. Sie packten sogar selber mit an. Die Konstanzer Hausväter verriegelten die Eingangstore ihrer Häuser, und die Hausmütter riefen verzweifelt nach den Kindern. Irgendjemand erinnerte sich, gesehen zu haben wie eine Reitergruppe in unauffälligen grauen Reisekleidern durch das Kreuzlinger Tor hinaus geritten war. Doch an diesem Tag war so viel Volk durch das Kreuzlinger Tor aus und ein gegangen, dass die Zeugenaussage keinen großen Wert hatte. Neben dem ritterlichen Turnier fand auch ein Schützenfest der Bürger statt, so dass viele Fremde in die Stadt kamen. Einige Turnierkämpfer hatten ihre schönen Zelte aufgeschlagen und lagerten vor der Stadt beim Turnieranger. Ritter, Edelleute, Knappen, Damen mit Gefolge, Kleriker, Bürger und ihre Ehefrauen, freche Kinder, Händler, Gaukler, Hübschlerinnen, Bettler – und gewiss auch Diebe und anderes Strauchvolk. Alles strömte entweder zum Turnier oder zum Schützenfest, und die Torwächter konnten nicht jeden Einzelnen überprüfen, da sich sonst lange Kolonnen vor und hinter dem Tor gebildet hätten. Die Adelsherren und ihre Damen duldeten keine Wartezeit, die Bürger schimpften, da sie Verluste bei ihrem Geschäft befürchteten, das niedere Volk drängte und schubste sich. Dazu schnaubten die Pferde voller Ungeduld, Esel schrien, und sogar die Maultiere scharrten unruhig mit den Hufen. Deshalb drückten die Torwächter, trotz des strengen Auftrags sich die Leute genau anzusehen, beide Augen zu und bemühten sich den Ansturm von Menschen und Reittieren so gut es ging zu lenken.
Irgendjemand berichtete später, er hätte den einen Mann gesehen, der große Ähnlichkeit mit dem Österreicher Herzog Friedrich hatte. Eigenartigerweise wäre aber dieser Mann nicht durch das Tor hinaus zum Turnier, sondern hinein in die Stadt geritten. Jemand anderer fügte hinzu, dass dieser Mann gesehen wurde, wie er das Haus Zur Wannen betrat, das Haus des reichsten jüdischen Kaufmanns von Konstanz. Danach versiegten die Zeugenberichte. Stattdessen hörte man überall in den Gassen die Herolde des Königs. Sie verschafften sich durch Trommler und Posaunenbläser Gehör und verkündeten mit ihren lauten Stimmen, dass allen Leuten – Edlen, Bürgern, Geistlichen und anderen, geboten wurde, innerhalb der Stadtmauern zu verbleiben. Keinem sollte ein Leid geschehen, und alle, die aus der Stadt zu fliehen gedachten, würden in den Bann getan, sie wären der Mittäterschaft mit dem geflohenen Papst angeklagt! Die Gerüchte wurden zur Wahrheit: Der Papst, Johannes XXIII., Baldassare Cossa, war vom Konzil geflüchtet.
Daraufhin konnte man sehen, wie verängstigte und bleiche Florentiner Geldwechsler zum König rannten, und wie sie ihre Quartiere von Söldnern bewachen ließen, die bis an die Zähne bewaffnet waren. Eine Weile später, sah man die Bankherren wieder zurückkehren, etwas langsameren Schrittes dieses Mal, nicht mehr ganz so blass um die Nase, und ein wenig zuversichtlicher. Anscheinend hatte es König Sigismund verstanden die Florentiner zu beruhigen, sie wenigstens davon überzeugt zu warten und in der Stadt auszuharren.
Man befragte auch den jüdischen Kaufmann im Haus Zur Wannen nach dem Verbleib des Österreicher Herzogs, man durchsuchte sein Haus, doch man fand außer seiner Familie und den einquartierten Gästen keine andere Person. Von Herzog Friedrich fehlte jede Spur.
Die Konzilsherren wagten sich zuerst nicht aus ihren Wohnungen heraus, doch dann, nach und nach, gaben sie einige Tage später bekannt, dass sie sich doch noch wieder zur Session versammeln wollten. Der päpstliche Kanzleileiter, Jean-Allarmet de Brogny, hatte sie zusammengetrieben, trieb sie ins Plenum in den Konstanzer Dom, trieb sie vor sich her, wie der gute Hirte seine Schafe in den Pferch treibt. Es durfte nicht geschehen, dass das Konzil sich auflöste! Diese List sollte dem fuchsigen Baldassare Cossa nicht gelingen! Mit seiner Flucht stellte er sich in eine Reihe mit dem störrischen Pedro de Luna in Spanien und mit dem greisen Angelo Correr, die sich beide immer noch Papst Benedikt XIII. und Papst Gregor XII. nannten. Cossas Anhänger, und mit ihnen viele Feiglinge, verließen im Geheimen und trotz des ausdrücklichen Verbotes des Königs die Stadt. Sie stahlen sich durch die Gassen, überstiegen Mauern, schlichen in Verkleidung durch die Stadttore, versuchten sogar über den Rhein zu schwimmen. Dass ihnen dies meistens nicht gelang, war ihr Unglück, jedoch ihre eigene Schuld. Niemand trauerte ihnen nach.