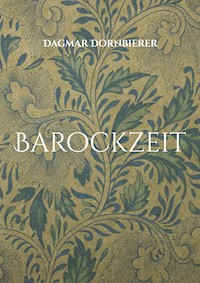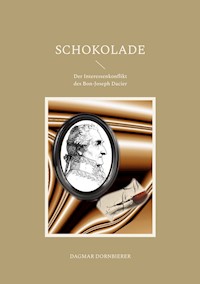
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erster Teil Historische Novelle Frankreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das Land möchte nach der Revolution und der Herrschaft Napoleons Atem schöpfen. Man fragt sich, wie da Geschäfte mit Schokolade dazu passen, und warum der Pariser Apotheker Sulpice Debauve plötzlich einen Vorfahren aus dem 17. Jahrhundert braucht. Der gelehrte Historiker und Philologe Bon-Joseph Dacier muss sich auf einmal mit der Geschichte des Kakaos befassen, obwohl er Schokolade nicht mag. Fantasie und Fakten, Geschäft und Interessenkonflikte. Doch wie sagte schon der römische Dichter Horaz. Utile dulci. Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Zweiter Teil Historische Tatsachen Die Wahrheit hinter der Geschichte. Die Firma Debauve und Gallais und ihre Werbepraktiken. Die Chaillou-Dokumente sind vielleicht eine Fälschung. Die Spuren führen ins 17. Jahrhundert an den Hof des Sonnenkönigs, zu einem Schweizer Gardisten, und dessen Schokoladehandel. Eine historische Neu-Entdeckung. Das Buch bietet Einblick in die spannungsgeladene Zeit des Wandels vom Ancien Regime zur neuen, aufgeklärten Epoche, welche die Vernunft hochhielt, und trotzdem mit vielen gegensätzlichen Leidenschaften zu kämpfen hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Titelbildcollage mit Porträt von Bon-Joseph Dacier (Dagmar Dornbierer)
VON DER AUTORIN SIND AUSSERDEM ERSCHIENEN:
Jan Hus – Der Wahrheit Willen
Betrachtungen, Essays und ein Schauspiel
(2015) ISBN-9783734754517
„Lieber Jan… Milý Jane…“
Ein fiktiver Brief an Jan Palach – 2005/2017
Deutsch und Tschechisch, ergänzt mit Vorwort und Erklärungen
ISBN 9783743166301
Das Buch der gespiegelten Zeit – Inspirierte
Erzählungen
Kurzgeschichten
(2016) ISBN-9783837044881
Impressionen
Poesie aus vier Jahrzehnten und in drei Sprachen
(2016) ISBN-9783837045017
Frauen mittendrin Teil I. – Eliane und ihre
GeschiCHten
Gegenwartsliteratur, Vergnügliches aus der Schweiz
(2016) ISBN-9783837044799
Frauen mittendrin Teil II. – Marcelas stille Integration
Gegenwartsbiographie, Tschechoslowakische Emigration in die
deutsch-sprachige Schweiz 1968
(2017) ISBN 9783837045215
Spätlese
Geschichten über Geschichten
(2018) ISBN 9783752839555
2392 – Enthüllte Wirklichkeiten
Science-Fiction / Fantasy
(2022) ISBN 9 783755 797319
Barockzeit
Das lange 17. Jahrhundert / Bd. 1 / Reihe: Für mich mit Bild
(2022) ISBN 9 783756 809271
„…Omne tulit punctum, qui miscuitutile dulci .”
(Man wird in hohen Tönen gelobt, wenn man das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet)
Quintus Horatius Flaccus:
Inhalt
FIKTION
Schokolade –
Der Interessenkonflikt des Bon-Joseph Dacier
Historische Novelle
FAKTEN
Der Hintergrund
Was ist nun wirklich wahr an der Geschichte?
Historische Personen und Ereignisse
Wissenswertes zur Recherche
Die „Chaillou-Dokumente“
Schokolade in Frankreich
Debauve & Gallais
Facts, Fakes und Flunkerstrategien
Die Entdeckung der Schweizer Gardisten David Chaillou
… und vieles mehr.
Anhang
Die „Chaillou-Dokumente“ – eine Fälschung?
Familienbeziehungen, Geschäftsnachfolge, D&G, Glossar
Über die Autorin:
Dagmar Dornbierer ist freie Schriftstellerin. Sie lebt und arbeitet in der Schweiz – deshalb die Schweizer Rechtschreibung mit dem doppelten S. Ihr Interesse gilt vor allem historischen Themen und dabei der „Geschichte hinter der Geschichte“. Dass Schreiben ihre Berufung war, wurde Dagmar Dornbierer schon sehr früh klar. Einige Umwege führten dazu. Dies waren Tätigkeiten wie Dolmetschen, Übersetzen, Antiquitätenhandel, Arbeit in Rechtsabteilungen und die Leitung des ehem. Tschechischen Konsulats in Zürich – nebst Familie mit zwei Kindern. Daneben zehn Jahre Theaterschaffen und historische Tanz-Performance. Das intensive, andauernde Studium hauptsächlich europäischer Geschichte und Kultur bleibt weiterhin bestehen.
Fiktion
SCHOKOLADE
DER INTERESSENKONFLIKT DES BON-JOSEPH DACIER
Historische Novelle
Die folgende Geschichte begann in Paris des Jahres 1817, irgendwann im Frühjahr. Es war abends, zur Zeit der letzten Mahlzeit des Tages, als man die Lichter schon angezündet hatte. Bon-Joseph Dacier, angesehener Gelehrter, Historiker, Philologe und Direktor der Nationalen Bibliothek Frankreichs, Sekretär auf Lebenszeit der Akademie der Inschriften und der Literatur, in Ehren ergraut und aufgrund seines Lebenswerks und Lebenswandels respektiert, legte Messer und Gabel neben den Porzellanteller, auf dem sich Käsemakkaroni innig mit der Sauce eines Kalbseintopfs verbanden. Er faltete die Damastserviette zusammen und legte sie behutsam neben das Gedeck auf die blütenweisse Tischdecke. Bon-Joseph Dacier, politischer Vermittler, aussergewöhnlich begabt in Angelegenheiten der Diplomatie, von Napoleon zum Baron des Kaiserreiches geadelt, hatte keinen Appetit mehr.
„Keine Sorge, meine Liebe“, sagte er, den fragenden Blick seiner Verwandten und gleichzeitigen Haushälterin beantwortend. „Dass ich nicht mehr essen mag, liegt keineswegs an diesem vorzüglichen Ragout, nicht an der Suppe und nicht an den überbackenen Makkaroni. Dein Essen ist vortrefflich, und es tut mir leid, dass ich es nicht wie sonst geniessen kann. Du musst verzeihen, aber in letzter Zeit gibt es Dinge, die fordernd und unangenehm sind – und das schlägt mir ein wenig auf den Magen.“
„Möchtest du mich näher darüber aufklären, Cousin?“ fragte Madame Françoise mit ruhiger Stimme.
„Nein… nein… Ich möchte dich nicht mit meinen Angelegenheiten belasten. Ausserdem, es ist nur vorübergehend, dass mich eine Sache derart vereinnahmt, so dass ich am Tisch keinen Appetit verspüre. Es wird bald vorüber sein. Mach dir deswegen keine Sorgen, ma chère.“
Die Aufforderung war höflich gemeint, doch unbegründet. Madame Françoise, „ma chère“, machte sich keine Sorgen. Sie hatte sich abgewöhnt Sorgen zu machen. Dies schien ihr die einzig vernünftige Herangehensweise an das Leben zu sein. Françoise Marie Anne, geborene Fadière, verwitwete Rouire, war eine jüngere Cousine der verstorbenen Gattin Daciers. Françoise Marie Anne war vom Leben nicht gerade sanft behandelt worden. Es grenzte an ein Wunder, dass sie zu einer Persönlichkeit von freundlicher Güte und Milde heranreifte. Bei aller Barmherzigkeit war Françoise aber auch tatkräftig und praktisch veranlagt. Bon-Joseph Dacier schätzte ihre unaufdringliche Hauswirtschaftsführung sowie ihre gelegentliche Gesellschaft bei einem Gespräch. In der Nachbarschaft wurde sie wegen ihrer ruhigen Art geachtet. Sie hatte für die Sorgen und Nöte der Nachbarn immer ein offenes Ohr und hatte schon manchen mit einem dienlichen Rat aus einer Notlage geholfen. Die Nachbarn nannten sie schon bald nach ihrer Ankunft in Paris achtungsvoll „Madame Françoise“. Von der Familie Dacier wurde sie jeweils als „teure oder liebe Cousine“ angesprochen.
Françoise Marie Anne war mit sechsundvierzig Jahren in den Haushalt der Daciers gekommen. Sie war zehn Jahre jünger als ihre Cousine, mit der sie sich sehr gut verstand. Damals hatte sich Daciers Gattin, Marie Marguerite Olympe, begonnen krank zu fühlen, und ihr Arzt hatte nach vielen Konsultationen mit seinen Berufskollegen jedes Mal eine ernstere Miene aufgesetzt. Schon bald war Madame Dacier zu erschöpft, um sich um die alltäglichen Dinge des Hauses kümmern zu können. Man hatte eine weitere Magd in Stellung genommen, doch Madame Dacier wünschte sich eine sorgsamere Pflege ihres Haushaltes und bald auch ihrer selbst. Obwohl ihr Arzt bei jedem Besuch von Mut und Zuversicht sprach, war ihr klar geworden, dass für sie die Zeit gekommen war, um alle irdischen Dinge zu regeln. Sie schrieb an ihre Cousine Françoise nach Montpellier.
Françoise lebte damals als Gesellschafterin einer alternden, begüterten Witwe. Zwei Jahre zuvor war sie selber Witwe geworden. Kaum verheiratet, im Wonnemonat des Jahres 1794, des schrecklichen zweiten Revolutionsjahres, hatte ihr Ehemann beschlossen, sich als Wissenschaftler dem Ägyptenzug des jungen Generals Bonaparte anzuschliessen. Napoleon hatte viele Forscher und Wissenschaftler rekrutiert, welche dem mysteriösen Land seine Geheimnisse entreissen sollten. Er war überzeugt, dass er schon bald als Eroberer des Nillandes ganz Ägypten mit französischen Stützpunkten überziehen würde, wo fachkundige Männer Verwaltung und Erforschung an die Hand nehmen sollten. Ägypten, fernes Sehnsuchtsland der Freimaurerei – Frankreich sollte seinen verdienten Anteil daran haben, und welcher Mann wäre besser geeignet gewesen, der Weltmacht England ein grosses Stück davon abzujagen, als der Freimaurer Napoleon Bonaparte? Doch das Ergebnis der Unternehmung war verheerend: Napoleon verlor zwei Drittel seiner Armee, von den Zivilisten ganz zu schweigen, dazu brachte er Frankreich um den Grossteil seiner Mittelmeerflotte. Am Schluss bestieg ein elend anzusehender Haufen Franzosen einige englische Schiffe, welche diesen kläglichen Rest von Napoleons Armee wieder zurück auf französischen Boden brachen. Die Männer, die überlebten hatten, waren erschöpft, ausgehungert, krank oder verletzt. Antoine Rouire, auf den seine Frau Françoise zu Hause wartete, für den sie jeden Tag betete, war nicht unter den Überlebenden. Er war bereits zu Beginn des Jahres 1799 der Beulenpest erlegen.
Françoise sass ganz ruhig in einem Polstersessel, als man ihr die Nachricht überbrachte. Es war früher Abend gewesen, und sie hatte die ganze darauffolgende Nacht in jenem Sessel verbracht, ohne sich zu rühren. Am Morgen fand das Dienstmädchen Françoise ohnmächtig zusammengesunken vor. – Ihr ganzes bisheriges Leben war in jener Nacht an ihr vorüber gezogen. Derselbe Schmerz, den sie empfunden hatte als ihre Mutter gestorben war, die erschöpfte und am Ende ihrer Kräfte angelangte Frau, durch den Charakter und das unberechenbare Temperament ihres Gatten ausgelaugt. Françoise hatte damals befürchtet mit dem Vater alleine leben zu müssen, denn andere Geschwister hatte sie nicht. Später, da kamen strenge Inspektoren der Vormundschaftsbehörde ins Haus und ihre Blicke verhiessen nichts Gutes für Françoise. Dazu kam das Getuschel der Nachbarn. Doch zuweilen entscheidet das Schicksal zugunsten desjenigen, den es gerade noch im Würgegriff hielt: Der Vater brachte Françoise zu seinen Verwandten – der gleichnamigen Familie Fadière, die von La Rochelle in den okzitanischen Süden gezogen war und denen er früher als Jurist einige Dienste erwiesen hatte. Diese gegenseitige Vereinbarung erwies sich als Glück für Françoise, denn sie lernte ihre Cousine Marie Marguerite Olympe Fadière kennen. Françoise war damals noch ein junges Mädchen, doch sie hatte einen reifen und verständigen Charakter, so dass die ältere Cousine sie als gleichwertig an Alter und Kenntnissen empfand. Wie die Jahre dann vergingen, heiratete „Magali“, wie Marguerite genannt wurde, den bereits angesehenen Gelehrten Bon-Joseph Dacier und zog nach Paris. Françoise blieb weiterhin bei der Familie der Cousine. Ihre Stellung veränderte sich allmählich zu der einer Gesellschafterin und zur Aufseherin über das Hauswesen.
Während der folgenden Jahre korrespondierten die beiden Cousinen regelmässig und blieben sich trotz der weiten Distanz verbunden. Dann lernte Françoise bei einer Soirée ihren künftigen Mann, Antoine Rouire kennen. Er beeindruckte sie durch sein enormes Wissen auf den Gebieten der Geographie, Geologie und der Botanik. Bald schon siedelte Françoise um. Sie zog in Antoines Haus in Montpellier, kümmerte sich um dessen Mutter, mit der er alleine wohnte und half ihm bei der Auswertung seiner Notizen und Forschungsergebnisse. Irgendwann wurde sie Antoines Geliebte. Irgendwann starb Antoines Mutter, das Haus gehörte nun ihm allein. Als Antoine Françoise die Ehe vorschlug, da waren sie beide keine jungen Grünschnäbel mehr. Sie hätten noch lange so weiterleben können, doch in einem Augenblick der Vorsehung hatte Antoine über Verantwortung nachgedacht und sich entschlossen Françoise abzusichern. Sie heirateten.
Als sich nach der Nachricht von Antoines Tod der allererste Schmerz ein wenig abgeschwächt hatte, ordnete Françoise ihre Dinge und blickte nach vorne. Sie hatte eine kleine Sicherheit, dank der Voraussicht ihres Gatten, doch die würde nicht lange andauern. Sie hatte aber auch das Haus geerbt. Dies vermietete sie, um daraus regelmässige Einnahmen zu ziehen. Dann bewarb sich auf verschiedene Annoncen, in denen eine Gesellschafterin gesucht wurde. Auf Anhieb fand sie die Stelle bei der älteren Witwe. Es war eine gute Stellung, ordentlich bezahlt, ruhig und nicht überaus anstrengend. Die Dame war umgänglich und das Haus, in dem auch Françoise Kost und Logis hatte, komfortabel. Die folgende Zeit ab Mitte des Jahres 1799 bis zum Erhalt von „Magalis“ Brief 1804, verliefen zumindest im Haus jener Witwe friedlich, wenn auch nicht im Land, und schon gar nicht im Süden Frankreichs.
Nachdem Françoise die Bitte ihrer Cousine gelesen hatte, war ihr klar geworden, wohin ihr Lebensweg sie führte. Die Witwe, ihre Brotgeberin, bedauerte den Entschluss ihrer Gesellschafterin sehr, doch sie verstand ihn. Françoise sagte also Lebewohl zu Montpellier, einzig das Haus, ihr Erbe von Antoine, behielt sie der regelmässigen Einnahmen wegen und beauftragte das Bureau eines Anwalts mit der Verwaltung.
In Paris nahm sich Françoise in ihrer besonnenen und fleissigen Art der Pflege der Cousine an und der Führung des Hausstandes. In ihrer Gegenwart ertrug die Kranke den Gedanken an das baldige Scheiden besser, und auch der Gatte, der Gelehrte Dacier, schien die lange Zeit des Dahinsiechens seiner Gemahlin besser zu hinnehmen zu können. Im Jahre 1806 hauchte „Magali“ ihre Seele aus.
Françoise, nun achtundvierzig Jahre alt, hätte wieder in ihre Heimat zurückkehren können, doch der nun verwitwete, Bon-Joseph Dacier, bat sie zu bleiben. Sie wäre doch bereits mit den Gepflogenheiten des Dacier’schen Hauswesens vertraut, meinte er, und auch mit den Lebensgewohnheiten des Hausherrn. Was lag also näher, als dass sie ihre Arbeit fortführte? Ausserdem wurde die Arbeitslast jetzt, nachdem die Pflege der Kranken wegfiel, nur noch leichter. Françoise sagte zu – sie musste nicht einmal lange überlegen. Bei Dacier erhielt sie Kost, Logis und ein angemessenes Gehalt. Dies kam zu den Einnahmen aus der Vermietung ihres Hauses in Montpellier und summierte sich allmählich zu einer ausreichenden Pension. Françoise hatte es geschafft, sich durch Beharrlichkeit und Geduld ein durchaus komfortables Leben einzurichten. Deshalb liess sie Sorgen und Kummer an sich vorbeifliessen wie ein behäbiges Rinnsal. Sie sah die Sorgen, die Befürchtungen und Ängste anderer Menschen wohl, sie linderte sie auch, wo sie nur konnte, doch sie liess sie nicht mehr an sich heran. So auch an dem Abend, als Bon-Joseph Dacier das gute Ragout mit den Makkaroni nicht schmecken wollte.
Françoise war daran gewöhnt, dass der Cousin, wie sie Dacier nannte, während ganzer Tage, Wochen und Monate mit irgendwelchen geistigen oder politischen Themen beschäftigt war, so dass er zu Hause mehr oder weniger zerstreut und abgelenkt wirkte. So etwas mochte es wohl auch dieses Mal sein. Sie läutete deshalb dem Dienstmädchen, damit der Tisch abgeräumt wurde. Danach kümmerte sich um die allabendlichen Belange des Haushaltes. Sie wies dem Dienstmädchen die Aufgaben des folgenden Tages zu, schickte es dann nach Hause und zog sich selbst nach getaner Pflicht in das kleine Boudoir neben ihrem Schlafzimmer zurück.
Sowohl der Gelehrte Bon-Joseph Dacier als auch seine Hausvorsteherin liebten solche privaten, abendlichen Stunden. Der Vorwand gegenseitiger Rücksichtnahme ermöglichte es ihnen das Zusammensein auf das Allernotwendigste zu beschränken – was sowohl im Interesse von Dacier als auch von Françoise lag. Zudem, in ihrer beidem Alter, beschränkte sich ihr gesellschaftlicher Umgang meist auf die gemeinsamen Mahlzeiten und die Fragen nach den Belangen des Haushalts und der Gesundheit.
Ausser des Hausherrn und seiner Haushaltvorsteherin wohnte niemand sonst im Haus. Die beiden Töchter und der Sohn der Daciers hatten das elterliche Heim längst verlassen und waren verheiratet. Der Sohn und die jüngste Tochter hatten bereits Kinder und weitere mochten folgen. Der gelehrte Grossvater schätzte allerdings die lauten Kinderstimmen gar nicht, und so besuchten ihn die jüngste Tochter und der Sohn mit ihren jeweiligen Ehegatten alleine. Einmal im Jahr die Enkel zu sehen, befand Bon-Joseph Dacier als genug.
An jenem Abend des Frühjahrs 1817, als ihm das gute Essen nicht schmecken wollte, blieb Bon-Joseph Dacier alleine im Salon zurück. Er genehmigte sich ein Gläschen Mandellikör und setzte sich in einen der bequemen Polstersessel, deren zwei zu beiden Seiten des Kamins standen. Aus den Beistellmöbeln, die sich zu den Sesseln gesellten war ersichtlich, welcher Platz dem Hausherrn gehörte und wo die Hauswirtschafterin hin und wieder einige Mussestunden verbrachte, denn neben ihrem Sessel stand ein zierliches Nähtischchen. Beim Hausvaterplatz bot eine Art Etagère Platz für die neuesten Zeitungen. In der Schublade dieses äusserst praktischen Möbelstücks befanden sich nützliche Dinge wie, Bleistifte, ein Futteral mit Brille, eine Schere und eine Mappe für ausgeschnittene Zeitungsartikel. Sein Notizbuch, in florentinisches Papier gebunden, trug Bon-Joseph Dacier immer mit sich in der Tasche seines Anzugs. Dacier war ein äusserst ordentlicher Mensch, dessen Verstand die Zusammensetzung und Gliederungen der Dinge rasch erfasste. Er war sehr wohl in der Lage diese Dinge auch in grössere Zusammenhänge zu setzen, doch zu diesem Zweck bedurfte er manchmal unterstützender Notizen.
Nichtsdestotrotz, an jenem Abend, boten ihm weder Notizen noch universelle Ordnungsprinzipien eine Hilfe bei seinen Gedankengängen. An jenem Abend brauchte Bon-Joseph Dacier dringend eine Idee. Einen schöpferischen Einfall. Eine salomonische Lösung. Einen Geistesblitz, der seinem diplomatischen Können Ehre machen mochte, wüsste man davon, doch genau das sollte man nicht, da es sich um eine äusserst diskrete Angelegenheit handelte.
Bon-Joseph Dacier, gelehrter Philologe und Kenner der Historie, gefeierter Experte unter Experten, einer der fähigsten Diplomaten sowohl des Ancien Régime als auch des Kaiserreichs unter Napoleon, befand sich in einem Interessenkonflikt. In einer heiklen Situation, die Fingerspitzengefühl erforderte, zumal es dabei um ihn selbst ging, um seine Reputation und seine Überzeugungen. Besser gesagt – er befand sich genau zwischen den Polen seiner Überzeugung und seiner Sympathien. Es ging um seinen Ruf als Gelehrter und Ehrenmann. Sollte er in diesem Interessenkonflikt offen Position beziehen, so waren die Folgen nicht absehbar. Dessen ungeachtet – Position beziehen würde sich in dem vorliegenden Fall nicht einmal lohnen. Es gab nichts zu gewinnen. Bon-Joseph Dacier mochte sich vielleicht eine gewisse Entscheidung bezahlen lassen, doch diesen Gedanken hatte er bereits zu Beginn weit von sich gewiesen. Ein diskreter Vorschlag in dieser Richtung war ihm von jener Person unterbreitet worden, welche Daciers gegenwärtigen Interessenkonflikt ausgelöst hatte. Dacier hatte sich gezwungen gesehen den Vorschlag energisch abzulehnen. Die Situation, die ganze Sache, war in der Tat äusserst unangenehm.
Bon-Joseph Dacier stand auf, um sich ein stärkeres geistiges Getränk von der Anrichte zu holen. Der Mandellikör genügte hier nicht. Der Trank war nicht in der Lage den Gedanken die notwendige Leichtigkeit zu verleihen, damit die Angelegenheit mit Esprit gemeistert werden konnte. Der Mandellikör war zuckrigsüss und klebte an den Lippen. Er verklebte den Lauf des Geistes, verführte mit seiner schweren Süsse zu wohliger Schläfrigkeit. Sorglose Mattigkeit war nun gewiss kein guter Ratgeber. Bon-Joseph Dacier griff zu einer anderen Kristallkaraffe und goss daraus klare, goldgelbe Flüssigkeit in ein bereitstehendes, ein wenig bauchiges Glas. Er hielt das Glas geniesserisch unter die Nase und schwenkte es leicht, damit sich der Duft des Inhalts entfaltete. Welch ein Duft! Begnadeter französischer Erfindergeist, der solch ein Erzeugnis fertigbrachte! Begnadeter Weinbrand aus Cognac! Da waren fliegende Ideen am Werk, Inspiration, Kunst und Geschicklichkeit. Ein Zusammenspiel von Wissen und Können um das Ausgangsprodukt und die Wandlung, die es unter gewissen chemischen und physikalischen Prozessen durchlief. Ein wenig Alchemie und Experimentierfreude, ein wenig Ingenieurkunst und viel, viel Ehrgeiz, um bei diesem landestypischen Erzeugnis nicht auf der ökonomischen Ebene von irgendwelchen ungebildeten Holländern übervorteilt zu werden! Was verstanden die Holländer denn schon von solch edlen Gütern? Nichts. Doch sie verstanden sehr viel von Handel und den Gepflogenheiten einer weltumspannenden Wirtschaft – und sie waren geschickt genug, nicht nur den Franzosen die Gewinne zu verringern… Bon-Joseph Dacier nahm andächtig einen Schluck des edlen Brandes und liess ihn genüsslich über die Zunge rollen. Der Genuss des Weinbrandes und dessen erhellende Schärfe, halfen ihm jene Szene, die ihm abends den Appetit vergällt hatte, noch einmal in seiner Vorstellung Revue passieren zu lassen.
Am Morgen desselben Tages hatte Bon-Joseph Dacier in seinem Bureau in der Nationalen Bibliothek Besuch erhalten. Man hatte ihm einen Monsieur Sulpice Debauve angekündigt, seines Zeichens Apotheker und Chocolatier, mit Geschäftssitz in der Rue Saint-Dominique. Monsieur Debauve erwähnte jedoch nicht, in welchem der beiden Strassenteile sein Geschäft lag, ob im Gros Caillou oder Saint-Germain-de-Près – als wollte er sich nicht im Detail darüber auslassen. Warum wohl? Das war doch sehr einfach nachzuprüfen. Wie dem auch war – Dacier mochte keine Schokolade, also hatte er auch keinerlei Kenntnisse von der Lage der Geschäfte, welche dieses unappetitliche Gebräu verkauften. Françoise mochte es wissen. Als gute Hausfrau sollte sie darüber Bescheid wissen, zudem schmeckte ihr der dicke, braune Trank so gut, dass sie ihn hin und wieder zu sich nahm – ungeachtet der Tageszeit. Angeblich kräftigte Schokolade den Körper am Morgen oder verlieh ihm die notwendige Schlafschwere am Abend. Gleich welchen körperlichen Zustand man gerade benötigte, Schokolade brachte vermeintlich das erwünschte Resultat. Nun gut, Cousine Françoise mochte ihre kleinen Freiheiten geniessen – sie sollte aber niemals den Hausherrn damit behelligen. Jedem das Seine.
Dacier nippte erneut an dem goldenen Weinbrand aus Cognac und dachte nach. Er hatte ebenfalls nachgedacht, als ihm der Chocolatier und frühere Apotheker Sulpice Debauve sein Anliegen unterbreitet hatte. Dacier kannte diesen Debauve nur flüchtig aus den Zusammenkünften der Freimaurer-Loge, zu deren Mitgliedern sie beide zählten. In der Loge Société Saint-Lazare nannten sie sich Brüder und diskutierten einmütig über die geistigen Ziele der Menschheit, über Wissenschaften und schöne Künste. Von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wurde in der Loge nicht mehr so häufig gesprochen wie noch vor zwanzig Jahren. Die Welt hatte sich gewandelt. Es war viel geschehen in den vergangenen zwei Jahrzehnten, und selbst die Mitglieder der französischen Freimaurer-Logen schienen solcher Gesprächsthemen überdrüssig. Ausserdem hatte man gesehen, dass die Gleichheit die erste jener drei Tugenden war, die dem imperialistischen Gedankengut schnell und bereitwillig den Platz geräumt hatte. Kaum war der General Bonaparte an die Macht gekommen, schon wollte er ein Kaiser sein. Nun weilte zwar Napoleon seit etwa zwei Jahren im Exil auf der Insel St. Helena, doch die Gleichheit war nicht wieder in die Staatsgeschäfte zurückgekehrt. Im Gegenteil, die Franzosen restaurierten ihre seit einem Vierteljahrhundert mit Füssen getretene Monarchie, und mit Ludwig XVIII. sass wieder ein Bourbone auf dem Thron der französischen Könige. Wozu waren all die Kriege, die Schrecken und die langen Jahre der Angst gewesen? Wozu all das Leid, die Blutbäder und die Hinrichtungen mit jenem neuen Todesinstrument, der Erfindung des Doktors Guillotin? Was war aus dem Sehnsuchtstraum aller Reformer, Republikaner und Revolutionäre geworden? War er zu Tode gestochen, geschleift und getrampelt worden wie die Körper der Aristokraten und der Geistlichen während des Aufstandes? Oder hatte er sich während der Schreckensherrschaft, die der grossen Befreiung gefolgt war, einfach verflüchtigt? War er verhungert in jenen Jahren, in denen das Land nach Krieg und Schlechtwetterperioden unweigerlich Not, Krankheit und Armut ausgesetzt war?
In den Freimaurerlogen widmete man sich gegenwärtig vermehrt Themen wie dem technischen Fortschritt, dem Erfindungsgeist in den Bereichen des täglichen Lebens und der Bedeutung all dessen für die Staatswirtschaft. Reges Interesse fanden die Naturwissenschaften, allen voran die Chemie. Man erwog neue Methoden der Agrarwirtschaft und der mechanisierten Herstellung von Gebrauchsgütern und Handelswaren. Man betonte die Wichtigkeit der Bildung und Erziehung der jungen Generation. Dazu sollten einheitliche Lehrgänge in neuen, ebenfalls einheitlichen Ausbildungsstätten dienen, sowie Diplomierungen der Absolventen. Ferner zählte man die Vorteile einer konstitutionellen Monarchie auf und beteuerte immer wieder, wie unabdingbar diese Regierungsform für eine sich fortschrittlich entwickelnde Gesellschaft war.
Alsdann interessierten die neuesten Forschungsergebnisse der Philologie und der Geschichtswissenschaften, natürlich immer in Bezug auf die herausragende Epoche der Antike im alten Griechenland und Rom. Doch seit Napoleons Feldzug nach Ägypten schien es fast, als hätte das Interesse an den Geheimnissen jenes Landes alle anderen Fragen und Angelegenheiten in den Hintergrund gedrängt. Unter der Ägide von Bon-Joseph Dacier arbeitete ein junger, genialer Gelehrter fieberhaft an der Übersetzung der alten, ägyptischen Schriftzeichen. Man sagte allerdings, dass der Philologe und langjährige Sekretär der Akademie der Inschriften und der Literatur, Bon-Joseph Dacier, einer der letzten Übriggebliebenen war, die noch an das erfolgreiche Gelingen des jungen Genies namens Champollion glaubten. Schon zu lange währten einigen Leuten die Bemühungen um die Entzifferung der Hieroglyphen, anderen wiederum erschien solch ein Vorhaben nicht machbar und daher nicht einmal wünschenswert. Die Gelehrten stritten sich wie üblich leidenschaftlich um ihre hehren Probleme, derweil sich die Welt draussen in Not und Schrecken wand.
Zugleich hatten die gelehrten Freimaurer auch Interesse an der Orientalistik gefunden, an den Sprachen Armeniens und Indiens, und man richtete das Augenmerk nach dem fernen Osten und den unendlichen Weiten Chinas. Andere wiederum rühmten die unaufhörlich neupublizierten Entdeckungen in Medizin, Physik und Chemie, in Botanik und Pharmazie. Für die Gelehrten tat sich Grossartiges in der Welt, und Frankreichs grosse Geister führten den Reigen der Gelehrtheit an. Verstand, Wissen, Aufklärung, Forschung – lauteten die neuen Devisen. Deshalb war es kein Wunder, dass sich in der Société Saint-Lazare Männer aus den unterschiedlichsten Berufen eingefunden hatten, um gemeinsam den Wissenschaften zu huldigen und damit das Wohl der Menschheit für die nachfolgenden Generationen zu sichern.
Jener Sulpice Debauve war ein Bruder innerhalb der Loge und trotz aller manifestierten Brüderlichkeit blieb er ein seltsamer Zeitgenosse. Er dehnte die Grenzen der Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe unter den Brüdern ein wenig über die Gebühr aus –man konnte freilich sagen, dass die Unterstützung, die er von den anderen erwartete bisweilen das erträgliche Mass überstieg. Er selbst gab sich im umgekehrten Fall eher neutral. Ja, neutral war das richtige Wort, dachte Dacier. Wenn Debauve von einem Bruder um Hilfe angegangen wurde, so sicherte er mit ernster Miene seine unbedingte Unterstützung zu. Meistens ging es dabei um seine Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Bereitung von Arzneien und Heilmitteln. Natürlich wollten die anderen Brüder allesamt für nur wenige oder gar keine Kosten von den Leistungen eines Apothekers profitieren. Natürlich wollten alle für wenig Geld an Heilmittel für sich selbst und ihre Familien herankommen. Da war es einerseits verständlich, dass sich Debauve nach anfänglich in Aussicht gestellter Hilfeleistung wieder zurückzog oder den Brüdern lediglich mit wohlfeilen Mitteln aushalf, welche nicht ganz dieselbe Wirkung hatten. Womit er allerdings nie sparte, das waren Ratschläge und grosse Worte.
Dieser Debauve wollte jedoch seit einiger Zeit seinen Apothekerberuf nicht mehr so sehr in den Vordergrund stellen. Er hörte es auch gar nicht gerne, wenn man in seiner Gegenwart die Wörter „Apotheke“ und „Apotheker“ aussprach. Oft wies er diejenigen Sprecher unverblümt zurecht, dass es sich dabei um das Vokabular des Ancien Régime handelte, und dass aufgeklärte Franzosen sich der Wörter „pharmacie“ und „pharmacien“ zu befleissigen hätten. Über Apotheker würden gegenwärtig sogar komische Opern geschrieben, so dass der ganze Berufsstand der Verunglimpfung anheimfiel!
Ein wenig umgänglicher könnte sich der Mann schon zeigen, fand Dacier; ein wenig offener und vertrauensvoller. Anderseits verstand Dacier auch, dass Debauve nicht seine gesamten Vorräte an Medizin an die Logenbrüder verschenken konnte, oder etwa die Rezepturen seiner Mittel – und schon gar nicht das Geheimnis der Herstellung seiner Schokolade! Da musste man doch vernünftig sein. Gewisse Grenzen durfte auch das Ideal der Brüderlichkeit nicht überschreiten, dessen sollten sich vor allem Logenmitglieder bewusst sein. Auch wenn der Apotheker Debauve seiner Herkunft nach ein Kleinbürger war, und auch wenn er den hochkarätigen Gelehrten der Loge nicht das Wasser reichen konnte, er verdiente als Mitglied der Société Saint-Lazare Respekt. Daneben sicherte das Apothekergeschäft, und nicht Schokolade, ihm selbst und seiner Familie die Lebensgrundlage – das sollten doch die Brüder Freimaurer verstehen!
Doch jene Sache, die Debauve nun von Dacier verlangte – quasi als Gefälligkeit unter Brüdern der Freimaurerloge – das war eine ganz andere Geschichte. Wie sehr Dacier auch das Anliegen seines Logenkameraden drehte und wendete, von welcher Seite er es auch immer betrachtete – er geriet dabei in einen äusserst unerfreulichen Interessenkonflikt. Tat er Debauve den Gefallen, würde die Sache grossen Verdruss bereiten, wenn sie vielleicht platzte. Auf die Geheimhaltung anderer verliess sich Dacier grundsätzlich nicht, und Debauve war in der Loge dafür bekannt, dass er sich gerne mit den grossen Namen hochgestellter Persönlichkeiten brüstete, die auf seine vermeintlich gesundheitsspendenden Mittelchen schworen. Ob alle diese hochrangigen Persönlichkeiten jene Mittelchen auch tatsächlich nahmen, sie überhaupt kauften, ja auch nur kannten – das würde nie nachgeprüft werden können, denn die meisten von ihnen waren in den Wirren der Revolution ums Leben gekommen. Und überhaupt, hatte nicht selbst Debauve, dieser überragende Jünger der pharmakologischen Kunst, zwei seiner Kinder im zartesten Alter verloren als damals, zu Beginn des Jahrhunderts eine Seuche in Paris wütete, welche die Kleinen haufenweise sterben liess? Dagegen war auch bei Sulpice Debauve kein Kraut gewachsen, kein Pülverchen zerstampft und keine Essenz destilliert worden. Ein Glück, dass Debauve und seine Frau die Seuche damals selbst überlebt hatten, und dass ihnen später ein Kind geblieben war, eine Tochter, die mittlerweile etwa sechzehn Jahre alt sein mochte.
Dacier erinnerte sich, dass eine Pause im Gespräch entstanden war als Debauve seinen Wunsch geäussert und sich wortreich darüber ausgelassen hatte, wie wichtig jene Angelegenheit für ihn war und wieviel davon abhing. Dacier hatte sich in Fragen geflüchtet, um Zeit zu gewinnen, und auch um zu sondieren, was der Andere tatsächlich von ihm wollte. Der Mann auf dem Besucherstuhl verwirrte ihn. Sie befanden sich nicht in der schützenden Umgebung der Loge, sie führten kein Ritual aus, mit den beruhigend gleichen Worten und Bewegungen – sie sassen einfach einander gegenüber – zwei Männer mit verschiedenen Berufen und verschiedenen gesellschaftlichen Stellungen. Sulpice Debauve war mittelgross und schlank. In seinem schlichten, dunklen Anzug aus vorzüglichem Wollstoff wirkte er allerdings schmächtig. Er mochte die Sechzig schon überschritten haben, war aber immer noch bedeutend jünger als Dacier, der auf die fünfundsiebzig zuging. Nichtsdestotrotz wirkte Dacier mit seinem borstigen Grauschopf und dem kantigen Schädel jünger und energischer als der kleinere Debauve mit seinem bereits schütteren Haar, welches er der Mode entsprechend von einem Punkt am Hinterkopf ausgehend nach vorne gekämmt und mit ein wenig Pomade geglättet trug. Die Mode der Perücken, der Zöpfe, und der Haarrollen zu beiden Seiten des Kopfes, war endgültig vorbei. Die Perücken waren zusammen mit den Aristokratenköpfen vom Podest der Guillotine in die bereitstehenden Körbe gerollt, und von den Henkersknechten in Massengräber geworfen worden. Die Perücke, das Wahrzeichen des Ancien Régime, verschwand zusammen mit den toten und geflüchteten Aristokraten. Es wurde gemunkelt, dass König Ludwig XVIII. die Perücke wieder einführen wollte, sowie das gesamte veraltete, und gnadenlos starre Hofzeremoniell.
„Wonach genau suchen Sie, Bruder“, hatte Dacier schliesslich gefragt. „Nur wenn Sie mir Ihren Wunsch genau schildern können, kann ich mögliche Quellen ausfindig machen – ich betone, mögliche Quellen.“
„Ich forsche nach einem endgültigen Beweis, dass es am Hof des Sonnenkönigs einen patentierten Chocolatier gab – einen Franzosen“, antwortete Debauve, „Sie, Monsieur, gelten als der profundeste Kenner jenes Zeitalters, wen sollte ich also sonst um Auskunft bitten, wenn nicht Sie? Man sagt, dass Ihr Gedächtnis phänomenal sei….“
Dacier verwarf die Arme. „Bruder! Ich bitte Sie! Sie überschätzen mich. Ich leite eine Bibliothek – ich habe sie nicht im Kopf.“
Debauve schwieg, was Dacier nach einigen Augenblicken fast aus der Fassung brachte. Er fühlte sich auf eine unangenehme Art und Weise zum Sprechen genötigt, obwohl er diesem Mann gar nichts zu sagen hatte. Als jedoch Debauve weiterhin schwieg, sogar leise seufzte und die Augen zu Dacier aufschlug, um sein Bedauern diskret auszudrücken, hielt es Dacier nicht länger aus.
„Nun…,“ begann er unsicher, „nun… es gab wohl Personen im Haushalt der Königin Anne d‘Autriche, von denen es heisst, sie hätten für ihre Herrin ein Getränk zubereitet, das sich Schokolade nannte – aber das waren Frauen, Spanierinnen – ich glaube kaum, dass Sie das interessiert, Bruder…“
„Spanierinnen, sagen Sie?“ fragte Debauve. „Nein, nein – ich suche nach einem Franzosen – einem Mann natürlich.“
„Natürlich… Nun ja, vielleicht könnten Sie mir dann vielleicht einen Namen nennen?“ stellte Dacier die Gegenfrage. Es klang leicht verärgert. „Ohne einen Namen ist eine Quellensuche fast sinnlos“, fuhr er fort. „Können Sie sich vorstellen, wie viele Memoiren, Tagebücher, Verzeichnisse, Inventare und Ähnliches hier lagern? Können sie sich die Berge an Registerbüchern, losen Dokumenten und Sammlungen vorstellen? Das Material füllt Regale und Kisten, mit denen man ganze Säle vollstopfen könnte! Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Dinge noch übriggeblieben sind, nicht wahr, nach all den Katastrophen der vergangenen Jahre!“
„…und der König?“ unterbrach Debauve ohne auf Dacier zu hören. „Der König, Ludwig XIV. Ist es vielleicht bekannt, ob er Schokolade schätzte? Ein so seltenes und teures Getränk mit derart hervorragenden, die Gesundheit befördernden Eigenschaften – so etwas muss der König doch überaus hoch geschätzt haben, finden Sie nicht? Zumal das Gerücht ging, dass die Schokolade gewisse Leibeskräfte stärkte – Sie wissen schon – die Belange Amors…“
Dacier streifte Debauve mit einem schrägen Blick. Was wollte der Mann von ihm? Das Gespräch wurde allmählich nicht nur ermüdend sondern auch heikel.
„Da geben Sie sich einer Täuschung hin, verehrter Bruder“, frotzelte er deshalb, „der Sonnenkönig verabscheute das heisse, klebrige, süsse Zeug, das ihm den Appetit nahm ihn aber nicht satt machte – dies sind seine eigenen Worte…!“ und seufzend fügte Dacier nach einer Weile hinzu, sich genüsslich an der verdatterten Miene von Sulpice Debauve weidend: „Ich bin im Übrigen ganz und gar der Meinung Seiner Majestät selig.“
„Aber, aber Monsieur – ich meine, Bruder Dacier“, stotterte Debauve. „Ich bitte Sie aufrichtig… Von Ihrer Auskunft hängt für mich sehr viel ab. Es wäre in der Tat von grossem Nutzen, wenn Sie mir mit Ihren herausragenden Kenntnissen helfen könnten an diese Hinweise zu kommen. Es müsste doch möglich sein – von Bruder zu Bruder…?“
Dacier seufzte erneut.
„Das erwähnten Sie bereits, Bruder“, bemerkte er kühl, „doch glauben Sie mir, ohne nur den geringsten Fingerzeig auf einen Namen ist die Suche, die Sie von mir verlangen nur verschwendete Zeit.“
Debauve drehte nachdenklich seinen Spazierstock in den Händen, als könnte er aus ihm die notwendigen Antworten herauswinden. Er schien sich keinen Deut um Daciers abweisende Haltung zu kümmern.
„Ein Name, ja, ein Name“, murmelte er. „Sie haben recht, Bruder Dacier, ein Name muss her… Nun… wie wäre es zum Beispiel mit „Chaillou“?“
Dacier war befremdet. Was sollte das nun schon wieder? Chaillou, Chaillou…! Zum Kuckuck! Chaillon, Challiou, Chaliot, Caillot, Cailloux – so hiessen doch Tausende von Leuten in ganz Frankreich, Hunderte davon sicher allein in Paris! – Augenblick mal! Was war das eben? Da klang etwas nach, ein flüchtiger Gedanke, eine aufblitzende Idee…. Chaillou – wonach klang das? Chaill….. Caill…. Caillot…. Cailloux…. Ja! Genau! Das war es Caillou! Die Rue Saint-Dominique! Der Sitz von Debauves Geschäft! Eigentlich gab es zwei Strassen dieses Namens: Eine Rue Saint-Dominique Saint-Germain und eine Rue Saint-Dominique du Gros Caillou, dazwischen lag die Esplanade des Invalides! Wollte dieser Debauve mit ihm, Dacier, einem hochangesehen Gelehrten und Bruder der Sociètè Saint-Lazare, ein Spielchen treiben? Wollte er ihn etwa verhöhnen? Waren ihm die Dämpfe seiner Schokolade schon derart ins Hirn gestiegen, dass er nicht mehr wusste, wem Respekt gebührte? Durch seine aufgeregten Gedanken hindurch, hörte Dacier wie Debauve ruhig und ungerührt weitersprach.
„Meine Grossmutter väterlicherseits, verehrter Bruder – nichts für ungut – meine Grossmutter also, trug den Namen Chaillou, Marie Françoise Chaillou. Sie hatte Philippe François Louis de Bauve geheiratet, meinen Grossvater. Damals wurde der Name noch getrennt geschrieben und mit dem vorangestellten Adelsprädikat. Ach ja, mein lieber Bruder Dacier – das ging alles verloren in den Wirren der Revolution. Aus meiner Familie wurden die „Bürger Debauve“, aber, nicht wahr, so erging es doch uns allen…“
Debauve schien den plötzlich strengen Blick nicht zu bemerken, mit dem Dacier ihn streifte. ‚Was erzählte da dieser Mensch von Adel? Sollte das eine Anspielung sein auf den Titel eines „Barons des Kaiserreichs“, den Napoleon Dacier verliehen hatte – wohlgemerkt zu dessen grosser Bestürzung? Dachte Debauve, dass er sich mit Dacier sozusagen auf Augenhöhe begab, wenn er seinen Vorfahren ein Adelsprädikat andichtete? Aber, gewiss doch! Natürlich! Selbstverständlich! Während des Ancien Régime waren die Parser Kleinhändler und Krämer alle von Adel – aber sicher doch! Fast wäre dem ehrwürdigen Gelehrten Dacier eine bissige Bemerkung herausgerutscht, doch so tief durfte und wollte er nicht sinken.
„Obwohl, so manche bürgerliche Tugend schätze ich sehr“, fuhr Debauve ungerührt in seinem Monolog fort. „Zweifellos – ja! Ich halte unsere Grundsätze einer freien, gleichgestellten und brüderlichen Gesellschaft überaus hoch – aber, wissen Sie, Bruder, zuweilen, da packt mich die Wehmut nach der alten Zeit. Da ähnle ich unserem hochverehrten König, möge ihn die Vorsehung schützen und leiten…
… doch ich sprach von meiner Grossmutter. Nun, sie sollte als junges Mädchen einen begüterten Kaufmann von der Insel Martinique heiraten, und man besorgte ihr deshalb eine Passage auf einem schönen, bequemen Handelsschiff, dessen Kapitän sehr höflich und zuvorkommend war. Mein lieber Bruder Dacier, stellen Sie sich das, bitte, vor! Ein junges, schönes Mädchen auf hoher See! Die Abenteuer, die Stürme, die Gefahren… ja, sogar Piraten! Dies alles überstand Marie Françoise Chaillou glücklich – jedoch, nur um zu erfahren, dass bei ihrer Ankunft auf Martinique ihr Bräutigam schon vor Monaten an Gelbfieber gestorben war. Welch ein Unglück, doch damals kannte man eben die wirksamen Arzneien unseres erleuchteten Zeitalters noch nicht. Man konnte nicht zwischen sthenischen und asthenischen Krankheiten unterscheiden. Man hatte nicht die entfernteste Idee davon, dass bei manchen auf Phlogosis beruhenden Krankheiten plötzlich eine, obzwar nur temporäre, Umänderung der Diastesis erfolgt, so dass ein asthenischer Zustand eintritt, bei welchem die kontrastimulierenden Mittel nicht vertragen werden, ungeachtet dessen… Aber was langweile ich Sie mit Krankheiten und Arzneien, mein verehrter Bruder Dacier! Verzeihen Sie, ich wollte doch nur bemerken, dass meine Grossmutter unverrichteter Dinge wieder nach Frankreich zurückkehrte. In ihrem Gepäck soll sich auch eine Schokoladenkanne mit allem Zubehör und eine Büchse voll gerösteter Kakaobohnen befunden haben – so sehr hatte sich meine Vorfahrin an die auf Martinique gepflegte Tradition des Schokoladetrinkens gewöhnt…
… dies alles trug sich aber nach dem Tod des Sonnenkönigs zu, während der Regentschaft des Herzogs von Orléans… Aus diesem Grunde, Bruder Dacier, dachte ich, dass es mit Gewissheit schon frühere Vorfahren gegeben haben muss, die am Hofe lebten, und die mit der Verarbeitung und Zubereitung jenes göttlichen Getränks beschäftigt waren.“
Debauve schwieg. Er lächelte. Er blickte Dacier erwartungsvoll an, seine Hände auf den Griff des Spazierstocks gestützt. Eine Fliege summte kurz auf, verschwand wieder auf geheimnisvolle Weise dort, woher sie gekommen war. Es wurde sehr still im Raum.
Dacier wirkte blass. Er hatte einige Male versucht Debauves Wortflut zu unterbrechen, doch der setzte sich über jeden dieser Versuche elegant hinweg. Dacier schluckte, räusperte sich, und wunderte sich sehr über die verschrobene Logik seines Gegenübers. Warum sollten bereits am Hof des Sonnenkönigs schokoladenzubereitende Vorfahren des Bürgers Sulpice Debauve gelebt haben, wenn seine Ahnin erst eine oder zwei Generationen später das Getränk auf der Insel Martinique kennen lernte? Wenn überhaupt…
Dacier schwirrte der Kopf und allmählich kroch Ärger in ihm hoch. Er streckte seinen Rücken und räusperte sich nochmals. Jetzt musste ein Schlusswort gesprochen werden:
„Bruder, ich darf Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Ihre Bitte kaum erfüllbar ist. Es könnte Wochen dauern, wenn nicht Monate, bis ich alle brauchbaren Manuskripte gesichtet hätte. Ich erwähnte bereits, dass es notwendig wäre Tausende von Seiten durchzulesen. Unsere Vorfahren waren äusserst produktive Verfasser von Memoiren und anderer Denkwürdigkeiten schriftlicher Art. Ich müsste Listen und Verzeichnisse studieren, Hunderte von Namen vergleichen! Es ginge ja nicht nur um die Hofhaltungen des Königs und der Königin, sondern auch der Fürsten von Geblüt, der Herzöge, überhaupt aller Aristokraten in Paris und später Versailles. Wer sagt uns denn, dass der Mann den Sie suchen – sofern es ihn jemals gab – zu den königlichen Haushaltungen gehörte? Ganz zu schweigen vom Haus des königlichen Bruders, des Herzogs von Orléans, in Saint Cloud? – Wir würden die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen suchen! Sie verstehen sicher, dass ich keinesfalls soviel Zeit erübrigen kann und aus diesem Grund auch nicht will.“
„Dann suchen wir eben diese Nadel gemeinsam, Bruder! Ich stehe ganz zur Ihrer Verfügung als Gehilfe!“
Debauve lächelte breit. Er spielte wieder mit dem Spazierstock, stützte einen Ellbogen lässig auf die Rückenlehne seines Stuhls, hatte die Beine gekreuzt und bot ein Bild der zuversichtlichsten Zwanglosigkeit und unschuldiger Hilfsbereitschaft.
Dacier glaubte sich verhört zu haben. Dann fasste er sich. Es schien, als müsste er sich an jenem Morgen noch oft fassen. Soweit käme es noch, dass er diesem Schwätzer auch noch erlaubte in den Beständen der Bibliothek zu wühlen! In den Beständen, welche zuweilen unbequeme Wahrheiten preisgaben und Geschichten erzählten, die man lieber in der Dunkelheit zwischen zwei Buchdeckeln liess. Geschichten über Tatsachen, für die es noch zu früh war, um ans Tageslicht gebracht zu werden. Geschichten, die ein neugieriges Publikum hungrig verschlingen mochte, ein Publikum, welches lediglich nach Sensation dürstete. Geschichten, die weitere Stürme auslösen konnten, obwohl sich die jüngst vergangenen noch nicht gelegt hatten.
Dacier schüttelte entschieden seinen grauen Kopf.
„Bruder Debauve, Sie können sich gewiss vorstellen, dass viel Material im Laufe der Zeit verloren ging. Wissen Sie, es sind nicht nur die Feuchtigkeit, die Feuersbrünste oder die Nagetiere, welche den alten wie den neuen Schriften beträchtlichen Schaden zufügen können. Es ist oft leider auch die menschliche Dummheit. Wussten Sie, dass es hier früher Bibliothekare gab, die alles andere als ehrenhaft handelten? Solche Individuen bereicherten sich gerne an gestohlenen Büchern, die sie unter der Hand verkauften. Dann gab es auch solche – vor allem nach dem Umsturz, als der Pöbel überall Zutritt hatte – die waren dermassen dumm, dass sie sich sogar aus Pergamentseiten Schuhsohlen für ihre kotbespritzten, löchrigen Schuhe schnitten!!!“
Dacier holte sein Taschentuch hervor und tupfte sich den Schweiss von der Stirn, der ihm angesichts solcher Barbarei ausgebrochen war.
„Nun, Bruder Dacier“, bemerkte Debauve trocken, „im 17. Jahrhundert wird wohl niemand mehr auf Pergament geschrieben haben…“
„Habe ich etwas vom 17. Jahrhundert gesagt?!“ ereiferte sich Dacier und blickte beleidigt drein. „Wie wenn das alles gewesen wäre – warten Sie, es kommt noch besser! Es gab hier Leute, arme Schlucker, die benutzten Papierseiten, um sich damit im Winter ihre Leibröcke zu polstern, damit sie nicht froren, und weil sie kein Geld für Mäntel hatten!“
Dacier hatte aufgetrumpft. Insgeheim hoffte er, den „Bruder Debauve“ mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Wenn er ihm nur lange genug irgendwelche schaurigen Histörchen auftischte, würde Debauve vielleicht aufgeben. Geschwätz gegen Geschwätz. Oft glaubten einem die Leute die haarsträubendsten Ungereimtheiten, während sie die Wahrheit aus den Stuben scheuchten, als wäre sie ein lästig brummendes, giftiges Insekt.
„Ich würde mir von Herzen wünschen, werter Bruder, dass Sie diese Recherche für mich durchführten. Und wenn Sie meine Wenigkeit nicht als Gehilfen annehmen wollen, bitte, besorgen Sie sich andere. Ihre Hilfe soll ja letztendlich nicht umsonst sein… Sie verstehen…?“
Dacier beherrschte sich, um nicht hörbar nach Luft zu schnappen. Jetzt wurde der Mann auch noch frech und versuchte ihn zu bestechen! Ihn, den man den „Aufrechten“ nannte. Ihn, den Direktor der Nationalbibliothek von Frankreich, den Kurator ihrer Sammlungen, den Sekretär auf Lebenszeit der Akademie der Inschriften und der Literatur, Mitglied in Akademien von weltweiter Bedeutung. Ihn, Bon-Jeseph Dacier, den Bürger der aufgeklärten Gelehrtenrepublik und vielgelesenen Autor historischer sowie philologischer Abhandlungen!
Laut und deutlich sagte er deshalb zu Debauve:
„Bruder, möchten Sie etwa, dass am Tag danach die halbe Stadt genüsslich kolportiert, dass Monsieur Sulpice Debauve, Apotheker und Chocolatier mit Geschäft in der Rue Saint-Dominique – oder wo auch immer – damit beschäftigt sei, einen Vorfahren am Hof des Sonnenkönigs zu suchen?“
Daciers Ton machte Debauve unsicher. Trieb der alte Mann jetzt ein Spiel mit ihm? Verspottete er ihn etwa seiner Herkunft wegen? Wollte er ihn loswerden, oder bedeutete seine letzte Frage gar eine Drohung?
„Was wollen Sie denn?“ platzte Debauve heraus.
„Aber Bruder“, begann Dacier nun beschwichtigend und verspürte eine jähe Freude über den plötzlich erfolgten Rollenwechsel. Er lächelte freundlich über das ganze Gesicht und sagte:
„Lieber Bruder, Sie sind es doch, der etwas von mir will – nicht umgekehrt.“
Sulpice Debauve fühlte sich in die Ecke gedrängt. Er war aufgebracht. Alle Ungezwungenheit seiner Haltung war plötzlich verflogen. So war das nicht gedacht gewesen. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Er hatte geglaubt leichtes Spiel zu haben, indem er Dacier ein wenig schmeichelte, ihm ein wenig den gelehrten Honig um die akademischen Lippen strich, und ihm eine Belohnung in Aussicht stellte. Doch wie sollte der unbedeutende Sulpice Debauve den stählernen Gelehrten Bon-Joseph Dacier mit Geschenken ködern sollen, einen Mann, der sogar das Angebot ausgeschlagen hatte Finanzminister des Königs Ludwig XVI. zu werden?!
Der Mann, der zum richtigen Zeitpunkt das richtige Amt abgelehnt hatte, bemerkte die plötzlich verdrossene Laune seines Gegenübers. Es wurde Zeit diesen Besuch zu verabschieden, ohne sich dabei etwas zu vergeben. Danach konnte Dacier immer noch überlegen, wie er diese Angelegenheit am besten behandeln mochte.
„Bruder Debauve, lassen Sie uns vernünftig miteinander reden“, meinte er deshalb versöhnlich. „Sie haben eine Bitte an mich gerichtet, und im Gegenzug ersuche ich Sie mir ein wenig Zeit zu gewähren, um mich zu bedenken, wie ich Ihnen behilflich sein kann. Denn gegenseitige Hilfe ist unsere heilige Brüderpflicht, dies haben wir vor dem Meister unserer Loge geschworen. Deshalb sind Sie auch zu mir gekommen. Doch mehr kann ich Ihnen im Augenblick nicht versprechen. Seien Sie aber versichert, dass ich Sie unverzüglich benachrichtigen werde, sollte das Resultat meines Nachdenkens für Sie von Nutzen sein. – Und nun bitte ich Sie mich zu entschuldigen, man erwartet mich zu einer wichtigen Besprechung in der Akademie der Inschriften und der Literatur.“
Dacier stand auf und reichte Debauve die Hand zum Gruss mit einer Geste, durch die sich Mitglieder einer Freimaurerloge untereinander zu erkennen gaben. Dann läutete er dem Hausdiener, damit er Mantel und Hut des Gastes holte. Daraufhin komplimentierte er den Besucher aus dem Bureau hinaus und überliess ihn sich selbst.
Eine Weile nachdem Debauve gegangen war, liess Dacier einen seiner jungen, talentierten Mitarbeiter kommen und beauftragte ihn mit einer Recherche. Der junge Mann sollte nichts darüber verlautbaren lassen, und Dacier am nächsten Tag zur Besprechung aufsuchen. Danach liess sich Dacier in seinen bequemen Redingote-Mantel helfen, und mit dem Hut in der einen und dem Stock in der anderen Hand verliess er das Gebäude. Er lenkte seine Schritte in Richtung der Akademie der Inschriften und der Literatur. Er war froh einige Schritte gehen zu können. Er mochte immer noch an einer Strassenecke eine Mietsdroschke nehmen, wenn ihm danach war. Die Luft war klar und kalt. Der Winter war bereits auf dem Rückzug, doch die lauen Frühlingslüfte schienen noch weit weg. Dacier atmete tief und befreit. Er dachte nach, und hin und wieder schüttelte er den Kopf. Was für ein eigenartiger Mensch war doch dieser Debauve – und wie um alles in der Welt hatte er sich Zutritt zur Société Saint-Lazare verschafft? Die Mitglieder konnten nur auf Empfehlung anderer Mitglieder aufgenommen werden. Erst auf Probe, danach als Lehrlinge, dann als Gesellen, um zuletzt den Meistergrad zu erreichen. Viele der Freimaurer verschafften sich gegenseitig Geschäfte, obwohl dies im eigentlichen Sinn gegen die Prinzipien der einzelnen Logen verstiess. Im Lauf der Zeit jedoch, hatten sich daraus parallele Kommunitäten herausgebildet, welche an die Gilden des Mittelalters erinnerten. Die Geschäftstätigkeit der Brüder hatte während der letzten Jahre Vorrang vor der geistigen und persönlichen Entfaltung gewonnen. Geschäftsleute, Bankiers, Financiers, Fabrikanten und Gewerbetreibende begünstigten einander gegenseitig bei gewinnbringenden Unternehmungen. Dies war zu Beginn, bei der Gründung der Logen, nicht in dieser Art und Weise vorgesehen gewesen, doch die Entwicklung der Zeit schritt voran und mit ihr die Entwicklung der Gesellschaft. Folgerichtig war davon auch die Logentätigkeit betroffen. Bon-Joseph Dacier kümmerte sich nicht allzu viel um die geschäftliche Tüchtigkeit der modernen Welt, um Kapitalanlagen, Renditen, Anteilscheine und Beteiligungen an grossen Industrieprojekten. Bon-Joseph Dacier hatte seinen Lebensunterhalt mehr als gut gesichert und dabei ein Alter bei bester Gesundheit erreicht, von dem viele andere nur träumten – sofern sie nicht bereits jung verstorben waren. Jedes weitere Jahr seines Lebens nahm Bon-Joseph Dacier dankbar als ein Geschenk an. Er widmete seine Energie und Kraft der philologischen und historischen Forschung, der eigenen weiteren Bildung, dem Verfassen von Geschichtswerken und dem Ordnen der Bibliothek von nationaler Bedeutung, deren Bestand während der vergangenen zwanzig bis dreissig Jahre enorm angewachsen war. Während der Regierungszeit Napoleons waren viele private Bibliotheken aus Häusern adeliger Familien mitsamt dem Familienbesitz beschlagnahmt worden. Klöster wurden aufgelöst, religiöse Einrichtungen mussten weichen, Schulen und Institute wurden reformiert. In jener Zeit wurde jedes Buch aus den beschlagnahmten Besitzungen des Adels und es Klerus dem Bestand der Nationalbibliothek einverleibt, die bereits von Sammlungen grosser Fürsten und französischer Könige zehrte. Den Kern der französischen Nationalbibliothek bildete dabei immer noch die ehemalige, umfangreiche Privatsammlung des Kardinals Mazarin.
Bon-Joseph Dacier hielt nach einer Weile doch noch eine Droschke an und liess sich den Rest des Wegs in die Akademie der Inschriften fahren. Die Akademie war sein Zufluchtsort. Dort am Quai de Conti, in einem der Öffentlichkeit verschlossenen Gebäudetrakt, war Dacier vor weiteren Besuchen Debauves sicher. In die Arbeitsräume der Akademie konnte ihm der Chocolatier nicht folgen. In seinem Bureau in der Akademie konnte sich Dacier ungestört seinen Lieblingstätigkeiten widmen, dem Forschen und Schreiben. Er konnte sich am Schreibtisch hinter hohen Stapeln von Manuskripten und Büchern vergraben oder mit gleichgesinnten Mitgliedern der Akademie im komfortablen Salon gelehrte Gespräche führen. Gemeinsam konnten sie über die Antike disputieren, oder das ruhmreiche Mittlere Zeitalter Frankreichs erörtern, jene Epoche zwischen der Antike und der Ära der Entdeckungen. Er konnte mit ausgewiesenen Kennern stundenlang über die schönen Künste und die Erhabenheit des menschlichen Geistes philosophieren, darüber, wie der Mensch zur Wandlung fähig war, wenn ihm die richtige Bildung und Anleitung zuteil wurde.
Bon-Joseph Dacier verbrachte den Rest des Tages in der Akademie, doch nach dem morgendlichen Gespräch mit Debauve konnte er an seiner Arbeit nicht die gewohnte Freude finden. Der Verlauf jenes Gesprächs ging ihm ständig durch den Kopf. Er erinnerte sich zum wiederholten Mal an Debauves Bemerkungen und die Forderung nach dem Auffinden eines Vorfahren, den es nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit nie gegeben hatte. Als könnte Dacier für beliebige Leute beliebige Vorfahren aus den Regalen der Bibliothek oder der Akademie zaubern, wie der Gaukler ein Kaninchen aus dem Hut!
Als der Abend anbrach, war Dacier müde geworden von Gedanken, die ihn nicht losliessen, und besorgt darüber, noch nicht einmal eine Idee zu einem Ausweg gefunden zu haben. Zu Hause angekommen, zog er sich zum Abendessen um und machte sich frisch, um Cousine Françoise vor dem Essen ein wenig Gesellschaft zu leisten. Die Gute hatte es mehr als verdient. Cousine Françoise war eine kluge Frau, belesen und gebildet, wenn auch mehrheitlich auf dem Gebiet der Pflanzenkunde, da sie ihrem verstorbenen Gatten jahrelang eine fleissige Helferin bei seinen Forschungen gewesen war. Doch es wurde ein mehrheitlich stiller Abend, und nicht einmal das gute Essen hatte Dacier zuversichtlicher stimmen können. Schade um das gute Ragout, das er sonst so liebte.
Bon-Joseph Dacier stellte das leere Cognacglas auf die Anrichte zurück, wo es das Dienstmädchen am Morgen früh einsammeln würde, um es in die Küche zum Spülen zu bringen. Dacier schürte noch das Feuer im Kamin, schob Asche und verbrannte Holzstücke zusammen und stellte den Kaminschirm vor die Glut. Er löschte die Kerzen in den beiden Lampen auf der Anrichte. Die Kerzen im Leuchter über dem Esstisch hatte Cousine Françoise vom Dienstmädchen löschen lassen, welches zu diesem Zweck auf einen Stuhl steigen musste.
Bon-Joseph Dacier nahm das Nachtlicht und stieg die Treppe hinauf zu seinem Schlafzimmer. Das Haus war ruhig. Nur das Ticken der grossen Standuhr im Entree war zu hören. Ein beruhigendes Geräusch. Ein gleichmässiges Geräusch, welches Vertrauen in den Lauf der Welt schenkte. Im Herrenschlafzimmer glühten Holzscheite im Kamin, der ebenfalls mit einem Gitter geschützt war. Der warme rötliche Schein verbreitete ein tröstendes Gefühl im Raum. Die Tagesdecke auf Daciers Bett, lag säuberlich aufgerollt am Fussende. Das Dienstmädchen hatte mit der Bettpfanne die Zudecke und die Laken vorgewärmt und eine kupferne, mit heissem Wasser gefüllte Bettflasche unter die Decke geschoben. Der Herr sollte zu dieser Jahreszeit auf keinen Fall über kalte Füsse zu klagen haben, so hatte es Madame Françoise angeordnet. Die kupferne Bettflasche steckte zusätzlich in einem Leinensack, damit sich der Herr die Füsse auch nicht daran verbrannte.
Bon-Joseph Dacier machte sich bereit für die Nacht. Eine kurze Weile später zog er die Bettdecke bis zum Kinn hinauf und atmete genüsslich aus. Im weichen Bett liegend, die Frische der sauberen Bettwäsche einatmend, und die Wärme des Kaminfeuers fühlend, wurde sein Gemüt zuversichtlicher. Am nächsten Tag würde ihm noch früh genug einfallen, was zu tun war, um diesem aufdringlichen Bruder Debauve die Bitte zu erfüllen, ohne dass sich Dacier dabei selbst kompromittierte. Am nächsten Tag würde ein Plan heranreifen. Gewiss. Das konnte doch nicht so schwierig sein! Hatte er nicht schon grössere Gefahren überstanden und gefährlichere Klippen umschifft? Er war doch nicht fünfundsiebzig Jahre alt geworden, hatte nicht drei bedeutende Regimewechsel mitsamt der grössten Revolution aller Zeiten ehrenhaft überstanden, um sich ausgerechnet an einem prinzipienlosen Apotheker die Zähne auszubeissen! Ja… gut… die Bitte eines Freimaurerbruders verpflichtete. Doch das hiess nicht, dass man nicht wohlüberlegt zu Werke ging!
Dacier würde Debauve seinen Vorfahren schon noch liefern – aber er wollte es so geschickt anstellen, dass ein jeder gebildete Mensch sofort den Braten roch! Debauve sollte eine Lektion verpasst erhalten. Kein gebildeter Mann, und schon gar kein Gelehrter, sollte die Geschichte des Ahnherrn eines Apothekers – und erst noch eines Chocolatiers! – ernst nehmen. Ja, das war wohl das Beste: Debauve sollte nicht ernstgenommen werden. Lächerlich, wie der sich plötzlich an aristokratische Rockschösse zu klammern suchte! Während der Revolutionsjahre hatte er wahrscheinlich das Gegenteil getan und wohl heftig auf seine Abstammung aus dem Pariser Bürgertum geklopft. Zugegeben, Debauves Vater hatte mit Gewürzen und Lebensmitteln aus den Kolonien gehandelt, doch damit fiel er unter all die anderen Verkäufer von Limonaden, Kaffee oder Tee – selbst Schokolade. All die Kleinhändler, die oft nicht einmal einen Geschäftsraum zur Verfügung hatten, sondern nur einen beweglichen Verkaufsstand oder gar einen Bauchladen.
Dacier nahm sich vor, im Vertrauen einige Worte mit dem Grossmeister der Loge zu wechseln – und er wollte diesem Debauve alle erdenklichen Strafen androhen, zu denen Freimaurer fähig waren, sollte sich dieser vermaledeite Pülverchenmischer erdreisten, Daciers Namen im Zusammenhang mit Schokolade auch nur zu erwähnen! Nicht einmal die Spur eines Zusammenhangs durfte zwischen Dacier und Schokolade hergestellt werden!! Jawohl! Ein weiteres Mal würde er sich den Appetit auf ein schmackhaftes Nachtmahl nicht verderben lassen! Schade um die schönen Makkaroni!
Mit diesen kämpferischen Gedanken, und voll Vertrauen in die Macht der Vorsehung, schlief Bon-Joseph Dacier in jener Nacht endlich ein.
Am selben Abend, als dem Gelehrten Bon-Joseph Dacier sein Nachtmahl nicht schmeckte, fühlte sich Sulpice Debaube verstimmt. Der Besuch in Daciers Bureau und die nachfolgende Unterredung hatten nicht das gewünschte Resultat erbracht. Einerseits anerkannte Debauve, dass Dacier recht hatte. Die Suche nach dem angeblichen Vorfahren sollte diskret behandelt werden, anderseits brauchte Debauve aber schon bald einen Beweis, der ihn mit ausgewiesenen Fachleuten in Sachen Kakaoverarbeitung und Schokoladenherstellung in eine Reihe stellte, insbesondere mit den neuerdings sehr reichen Importeuren und Fabrikanten. Der Wettbewerb um den Titel des Hoflieferanten lief bereits, und das Patent war hart umkämpft. Ein Hoflieferant hatte nicht nur das bequeme Privileg eines bestimmten, regelmässigen Warenabsatzes sondern auch das Ansehen, welches mit dem Titel einherging. Natürlich würden sich dann die bestehenden Kunden eines solcherart ausgezeichneten Händlers in ganz Paris damit brüsten, dass man seine Schokolade vom Hoflieferanten bezog. Was dem König schmeckte, sollte Monsieur und Madame XY nur recht und billig sein! Debauves Firma mochte sich dann auf ein ganz spezielles Segment der Kakao-Erzeugnisse konzentrieren, ohne auch den Geschmack anderer, vor allem tieferer, Schichten der Gesellschaft berücksichtigen zu müssen. Mit Massenware hätte Debauve ein Vermögen verdienen können – doch er hätte zuerst ein Vermögen investieren müssen. Erstens, besass er ein Vermögen in solcher Höhe nicht, und zweitens, wäre dazu der Aufwand für Personal, Gebäude, Grundstücke, und für die teuren Maschinen und deren Unterhalt gekommen. Debauve schauderte vor solch hohen Krediten, den Schuldzinsen und soviel zusätzlicher Arbeit.
Sulpice Debauve war im Grunde seines Wesens Apotheker. Er wollte den Leuten das Geld mit der Sorge um ihre Gesundheit aus der Tasche ziehen, so etwas gelang immer. Eigentlich durfte Schokolade niemals zu Massenware werden, denn dann wäre sein Geschäftsplan ständig bedroht. Zum Glück investierten die reichen Finanzleute immer noch am liebsten in Kriegsmaterial und in die neuen Technologien der Dampfmaschinen, mit denen die Herstellung verschiedenster Gebrauchswaren unendlich beschleunigt und die Menge unermesslich gesteigert werden konnte – sowie die Gewinne… Sollten die finanzkräftigen Investoren beginnen ihr Geld in die Herstellung schnell zu erzeugender Lebens- und Genussmittel einzuschiessen, so war nicht abzusehen, was mit den privaten, kleineren Händlern geschehen mochte. Am besten, man sicherte sich nach allen Seiten ab!
Wäre Sulpice Debauve ehrlich mit sich selbst gewesen, so hätte er zugeben müssen, dass es ihm mehr um die gesellschaftliche Achtung ging, als um hohe Gewinne. Sein Leben lang hatte er um Anerkennung gekämpft. Die hatte ihm in jungen Jahren schon der eigene Vater verweigert. Danach hatte es viel Geduld und Durchhaltevermögen gebraucht, um in der beruflichen Tätigkeit gewürdigt zu werden. Später kamen die schrecklichen Jahre der Revolution, als er beinahe alles für verloren hielt, was er sich bis dahin mit viel Mühe aufgebaut hatte. Selbst die Zeit unter Napoleons Herrschaft, als Debauve Protektion durch die Kaiserin Joséphine genoss, hatte nicht das gewünschte Ansehen seiner Person und seiner Fähigkeiten gebracht. Nun, mittlerweile hatte sich die Politik wieder gewendet, und man war besser beraten, wenn man nicht als Bonapartist, oder als von der Familie Bonaparte gefördert galt. Doch die Zeiten blieben weiterhin unruhig. Dies war einer der Gründe, weshalb Sulpice Debauve seinen Logenbruder Dacier um Hilfe gebeten hatte.
Etwas Wichtiges brannte Debauve auf der Seele: Es war angebracht, dass er schleunigst seine napoleonische Vergangenheit loswurde. Es machte sich nicht gut, als ehemaliger Befürworter von Napoleons Kaiserreich zu gelten, wenn man königlicher Hoflieferant am neu restaurierten Bourbonenhof werden wollte. Zwar hatten die meisten von Debauves Zeitgenossen eine „bonapartistische Vergangenheit“, doch man vermied tunlichst darüber zu reden. Viele Männer, die mit dem Ehrgeiz ausgestattet waren zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bereinigten nun ihre Lebensläufe. Alle – ausser vielleicht den Ärzten. Die Mediziner stellten sich auf den Standpunkt, dass sie zu jeder Zeit und während jedes beliebigen politischen Regimes ohnehin dazu verpflichtet waren die Menschen zu heilen oder ihre Leiden zumindest zu lindern. Ob es sich nun um Jakobiner oder Royalisten handelte, war gleichgültig – Schmerzen und Krankheiten befielen alle ohne Unterschied. Sulpice Debauve sah genau diese Haltung als seinen Ausweg. Als Apotheker, Arzneimittelfachmann, war er dazu verpflichtet, Heilmittel herzustellen zum Wohl und zur Gesundung der gesamten Bevölkerung, sofern sie die Heilmittel bezahlte. Als Apotheker und Hersteller verschiedener Arten von Medizin, war er den Ärzten gleichgestellt, was die egalitäre Behandlung seiner Patienten anging, daher hatte er Anspruch auf Neutralität in Belangen der politischen Zugehörigkeit. Als jemand, der jahrelang in Saint-Germain-en-Laye eine Apotheke recht erfolgreich geführt hatte, war Sulpice Debauve bekannt. Aber als Chocolatier? Auf diesem Gebiet brauchte er Kontinuität. Eine kontinuierliche Linie seines eigenen Lebens, seiner Vorfahren und seiner Familie – immer in Bezug auf das Erzeugnis Schokolade. Er brauchte ganz einfach wenigstens einen Vorfahren aus dem Beruf eines Chocolatiers – irgendjemanden, den man mit dem königlichen Hof in Verbindung setzen konnte, und zwar noch vor der Zeit Ludwigs des XVI. oder Ludwigs XV. Der Sonnenkönig und dessen Hofhaltung waren dazu wie geschaffen. Am Hof des vierzehnten Ludwigs war Schokolade bekannt gewesen, zu seiner Zeit wurde sie konsumiert, doch galt sie noch als exklusiver Luxus. Ein Heilmittel eben – und ein äusserst wohlschmeckendes dazu.
Debauves Ahnherr musste deshalb von Wesen her ein Abenteurer sein, ein weitgereister und welterfahrener Mann. Am besten ein unbekannter Landedelmann, doch das mochte schwierig werden. Als Apotheker konnte Sulpice Debauve nicht gut auf Vorfahren aus Adelshäusern beharren. Solche Dinge konnten nachgeprüft werden, da war man sich nie ganz sicher. In der Zeit der grossen Revolution, und vor allem seit der Abdankung Napoleons, waren die Exilrückkehrer darauf erpicht, die Reihen ihrer Vorfahren möglichst lückenlos zu führen – schliesslich wollte man sich wieder zurück holen, was einem die Revolution und der Bonaparte weggeschnappt hatten. Viele der royalistischen Rückkehrer sannen auf Rache an den Revolutionären und Bonapartisten. Das Pendel schwang auf die andere Seite. Vermögen und Landbesitze wurden restituiert, Titel, Auszeichnungen, Orden und offizielle Funktionen wieder hervorgeholt und amtlich neu aufpoliert.
Vielleicht mochte die Schreibweise des Namens de Bauve einem Hoflieferanten besser anstehen als nur Debauve – anderseits, Lieferanten für Königshöfe pflegten seit jeher Personen aus dem Bürgerstand zu sein. Man stelle sich nur vor: Der Herzog von Sowieso und der Graf von Da-und-dort als Kaffee- oder Schokolade-Lieferanten ihres Königs! Obwohl, hinter vielen gutgehenden Geschäften standen seit über hundert Jahren schon Aristokraten – sie strichen als Halter von Patentbriefen, den sogenannten „Privilegien“, die Gewinne ein, welche ihre Beauftragten erwirtschaftet hatten. Dass dabei die Beauftragten auch fleissig in die eigenen Taschen wirtschafteten – wer mochte es ihnen verübeln, wenn sie dabei nicht übertrieben…
Was den Apotheker und Chocolatier Sulpice Debauve mehr wurmte, war sein hauptsächlicher Konkurrent. In den Kreisen der Händler mit Schokolade, ob als Rohprodukt, Getränk oder in fester Form, prahlte jener Mann damit, dass er im Besitz einer Urkunde war, die seinem Vorfahren, einem Sieur François Damame, im Jahr 1692 ein Monopol auf die Herstellung und den Vertrieb von Schokolade garantierte. Fragte man jedoch genauer – und bohrte man sogar mit Fragen nach – so erwies sich die Verwandtschaft als nur sehr entfernt, und allein auf dem gleichen Familiennamen aufbauend. Aufmerksamere Frager fanden noch heraus, dass gemäss der Abschrift jener Urkunde, der angebliche Vorfahr sein Privileg bereits ein Jahr später zurück gegeben hatte, da er sich die überteuerten Gebühren für das Privileg nicht leisten konnte – und wahrscheinlich auch nicht die Feindschaft der anderen Händler. Damames Urkunde, obwohl echt und wahrheitsgetreu, bewies im Grunde genommen nichts. Doch die Familie von Debauves Konkurrenten befand sich in Verhandlungen um den Ankauf eines Geschäfts, das in der holländischen Kolonie Batavia angesiedelt war und mit Vanille handelte. Die Familie stammte selbst aus den Niederlanden, war aber schon lange in Paris angesiedelt. Ihre familiären und geschäftlichen Beziehungen zu Holland hatten sich immer als gewinnbringend erwiesen. Nun wollten sie ihr Geschäft weiter ausbauen und hatten sich gleichzeitig mit Sulpice Debauve um das Patent des Hoflieferanten für Schokolade beworben. Aus diesem Grund befürchtete Debauve das Schlimmste. Es ärgerte ihn auch ungemein, dass die Konkurrenten mit ihrem Ahnherrn aus dem Jahr 1692 einen Trumpf im Ärmel hatten. Genau so etwas brauchte auch er, Sulpice Debauve – und zwar dringend! Mochte der Andere seinetwegen kistenweise Vanille an den Hof liefern, aber die Schokolade sollten sie gefälligst ihm, Sulpice Debauve überlassen! Ihm waren allerdings die Hände gebunden, er konnte nicht einmal mit den Konkurrenten verhandeln – was hätte er ihnen schon als Gegenleistung anbieten können, wenn sie sich aus dem Wettbewerb zurückzogen? Etwa, dass er ihnen ihren Kakao als Rohmaterial abkaufen würde? Lächerlich! Das würde ihn ja zu einem Zwischenhändler herabwürdigen.
Sulpice Debauve setzte deshalb alles auf eine Karte: Die Freimaurerbrüder mussten Abhilfe schaffen. Dazu waren Freimaurer verpflichtet – und jetzt zierte sich der alte Dacier und machte unnötig viel Aufhebens um nichts.
Bon-Joseph Dacier hatte trotz seiner Sorgen einen guten und erholsamen Schlaf gehabt. Auf alle Fälle fühlte er sich erfrischt und hatte – kaum wach geworden – sogar eine Eingebung. Es war nicht die endgültige, erleuchtende, alles auf- und erlösende Idee, doch es war ein erster Einfall, der ein wenig Hoffnung versprach.