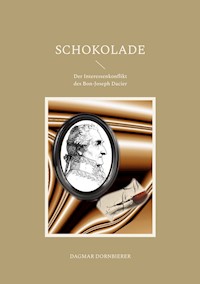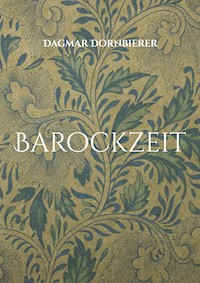Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Handshrift
- Sprache: Deutsch
Konstanz zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Die Geheimnisse der Luxemburger Herrscher auf dem Tschechischen Königsthron, warten darauf, enthüllt zu werden. Die Stadt Konstanz wird zur Weltbühne der Mächte. Was treibt den Notar Richental um, und warum langweilen sich einige Florentiner Kuriensekretäre... Inmitten von Fälschungen und Falschheit steht die Wahrheit der Prager Gelehrten Jan Hus und Hieronymus. Inmitten von Selbstsucht steht die Unschuld der Heilerin Anna, Richentals Frau. Die erste Zeit des Konstanzer Konzils und dessen Vorgeschichte. Im Mittelpunkt steht Ulrich Richental, der Konstanzer Bürger, der die weltbekannte Chronik des Konzils schrieb. Er und seine Familie sind eng ins Konzilsgeschehen eingebunden, vor allem in die Ereignisse um die Prager Gelehrten Jan Hus und Hieronymus von Prag. Zusätzlich entwickelt sich ein Nebenschauplatz, der die Kulturgeschichte beeinflussen wird, die Literatur der Renaissance wird in Konstanz geboren. Dieses Buch basiert auf historischen Fakten, historischen Personen und ist trotzdem ist ein Werk der Fabulierkunst. Im Vordergrund steht der Genuss in ein Zeitgemälde des Spätmittelalters einzutauchen. Bonus-Material am Ende des Buches enthält weitere Hintergründe und Erklärungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vor 1400 bis 1414
Prolog – Eine Spur aus Schriftzeichen
Das Zeitalter des Drachen
Omnipotens Deus – Ulrich Richentals Stoßgebet
Anna Eglin von Tägerwilen - Richentalhochzeit
Hannes Richentals erste Jahre in Konstanz
Die Große Konjunktion – Gründung des Drachenordens
Hannes lernt den Cisiojanus – Das Ochsengestell
Das Geheimnis von St. Gallen
Die königlichen Brüder – Zwischen den Zeiten
Annas Zweifel
Der Rat von Lodi
Ulrich Richentals Erinnerungen an Prag
Ulrich Richental und der Herold
Fremde Herolde & Quartiermeister
Eintreffen der Kirchenfürsten & der Einzug des Papstes
Geschenke der Konstanzer an den Papst Johannes XXIII.
Hannes Richental wird zum Mann
Der Konstanzer Rat & die fremden Apotheker
Butterbriefe
Leonardo Bruni & der Stein von Konstanz
Anna Richentalerin nimmt Abschied von Magister Jan Hus
Die Ankunft des Kanzlers der Sorbonne in Konstanz
Ulrich Richental & Vater Dacher
Die Heilige Weihnacht des Jahres 1414
Frühjahr 1415
Magister Jan Hus & der Mönch František
Die polnischen Gäste im Goldenen Bracken
Zu Beginn des Monats Hornung
Pippo Spano von Ozora, Freund des Königs
Michael de Causis, Procurator de causis fidei
Die Krankheit des Knaben Lamech in Konstanz
Der Unterricht des Ehrwürdigen Manuel Chrysoloras – Cencio il Fanciullo
Die Flucht des Papstes
Poggio Bracciolinis Besucher – Chrysoloras Tod – Cencio & die Rede
Das Epitaph des Gelehrten Pier-Paolo Vergerio – Die Bibliothek
Bonus Material – Fakten & Fiktion
mit separatem Inhaltsverzeichnis, Erklärungen, Glossar… und mehr.
BISHER VERÖFFENTLICHT VON DAGMAR DORNBIERER:
Jan Hus – Der Wahrheit Willen
Betrachtungen, Essays und ein Schauspiel
(2015) ISBN-9783734754517
„Lieber Jan… Milý Jane…“
Ein fiktiver Brief an Jan Palach – 2005/2017
Deutsch und Tschechisch, ergänzt mit Vorwort und Erklärungen
ISBN 9783743166301
Das Buch der gespiegelten Zeit – Inspirierte Erzählungen
Kurzgeschichten
(2016) ISBN-9783837044881
Impressionen
Poesie aus vier Jahrzehnten und in drei Sprachen
(2016) ISBN-9783837045017
Frauen mittendrin Teil I. – Eliane und ihre GeschiCHten
Gegenwartsliteratur, Vergnügliches aus der Schweiz
(2016) ISBN-9783837044799
Frauen mittendrin Teil II. – Marcelas stille Integration
Gegenwartsbiographie, Tschechoslowakische Emigration in die deutschsprachige Schweiz 1968
(2017) ISBN 9783837045215
Spätlese
Geschichten über Geschichten
(2018) ISBN 9783752839555
2392 – Enthüllte Wirklichkeiten
Science-Fiction / Fantasy
(2022) ISBN 9 783755 797319
Barockzeit
Das lange 17. Jahrhundert / Bd. 1 / Reihe: Für mich mit Bild
(2022) ISBN 9 783756 809271
Schokolade
Der Interessenkonflikt des Bon-Joseph Dacier
Historische Novelle / Fakten und historische Neuentdeckung
(2023) ISBN 9783756881437
Auslese
Philosophische Buntschriftstellerei
(2023) ISBN 9 783734 707582
Die Handschrift – Chronik des Drachen – Teil I.
Die Jahre vor 1410 bis Frühjahr 1415
(2024) ISBN 9 7837583 75019
Die Handschrift – Chronik des Drachen – Teil II.
Frühjahr 1415 bis Frühjahr 1416
(2024) ISBN 9 7837583 29999
Die Luxemburger Saga wird fortgesetzt
„Sich auf das Terrain des Spätmittelalters zu begeben ist als würde man auf eine wunderschöne Landschaft zustreben, in derer Mitte ein prächtiges Schloss steht. Je näher man jedoch kommt, wandelt sich die Landschaft in Treibsand, morastige Wüste, Sumpf. Jeder Tritt, der dem Schloss näher kommt versinkt im schwankenden Untergrund, und Irrlichter gaukeln Erkenntnisse und Tatsachen vor. In der Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts ist nur Weniges auch das, was es vorgibt zu sein…“ (Dagmar Dornbierer)
Die Autorin:
Dagmar Dornbierer ist in verschiedenen Sparten, Kulturen und Sprachen zu Hause. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie auch schon jahrelang als selbständige Antiquitätenhändlerin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sprachen sind ihre Instrumente und Werkzeuge – fünf davon beherrscht sie fließend und in vier weiteren findet sie sich gut zurecht. Seit ihrer Jugend studiert und recherchiert sie historische Themen. Ihre umfangreichen Kenntnisse über europäische Kultur- und Alltagsgeschichte legten zehn Jahre lang ein solides Fundament zu Theaterproduktionen mit dem Tanz-&-Musiktheater, von Bernhard Gertsch wo sie ihre Vielseitigkeit als Theaterautorin, Tänzerin und Schauspielerin beweisen konnte. Vor allem die Epochen der Renaissance und des Barock bieten eine unerschöpfliche und detailreiche Fülle an lebendigem und biographischem Material für ihre Erzählungen.
DIE HANDSCHRIFT
Die Chronik des Drachen
Teil I.
vor 1400 – 1414
Die Jahre der Ungewissheit,
der wiedererweckten Hoffnung und der Angst
Frühjahr 1415
Das Jahr des Feuers und der Wahrheit
„Quod non est in actis, tamen es in historia“
„Was nicht geschrieben steht, fand trotzdem statt“
Damnatio memoriae Wenceslai
Zur Verdammnis verurteilt wurde das Andenken Wenzels, des Königs, Vierter seines Namens, in den Ländern der Tschechischen Krone. Verdammt das Andenken, nicht jedoch der Name. Diejenigen, welche Verleumdungen in die Welt setzten, wünschten keine abolitio nomini, wie dies im alten römischen Reich Sitte war. Sie wünschten keine Tilgung von König Wenzels Namen aus den Annalen und Chroniken, kein Vergessen, kein Auslöschen der Erinnerung. Was sie einzig wünschten, war Verleumdung und üble Nachrede. Indem sie des Königs Andenken mit Schmutz bewarfen, glaubten sie sich selbst zu reinigen. Dieser Schmutz, jedoch, blieb auch an ihnen selbst haften, leider auch an Wenzels Person. – Für lange Zeit war ihr perfider Plan aufgegangen. Für lange Zeit – aber nicht für immer. Auch wenn manche Ereignisse niemals niedergeschrieben wurden, sie fanden trotzdem im Lauf der Geschichte statt...
Prolog
Ergo explorando est veritas multum,prius quam stulte prava iudicet sententia.
So zitiert aus einer Fabel des Phaedrus (Fabel 3, 10 Vers 5f). Der Autor soll ca. um 50/60 nach Christus gestorben sein. Vielleicht. Vielleicht schrieb tatsächlich ein Mann namens Phaedrus einige Fabeln um jene Zeit, wie man uns glauben lässt. Doch gewiss nicht deren zweiunddreißig. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Autor der meisten dieser Fabeln ein Gelehrter war, der Niccolò Perotti hieß und in den Jahren 1429-1480 lebte. Er war Sekretär des Kardinals Bessarion, sogar ein poeta laureatus – das heißt ein zeremoniell mit dem Lorbeerkranz gekrönter Dichter. Dazu war er noch Erzbischof von Sponto und päpstlicher Gouverneur in Süditalien – ein vielbeschäftigter Mann. Woher nahm er nur die Zeit, um angeblich in verstaubten Bibliotheken zu wühlen und dabei wahre Schätze der alten Literatur ans Tageslicht zu fördern? Werke, die den Argusaugen aller anderer „Humanisten“ entgangen wären?. Gab es zur Zeit des Erzbischofs Perotti überhaupt noch verstaubte Bibliotheken, wo doch so viele Gelehrte jener Zeit angeblich überaus eifrig damit beschäftigt waren sie bis ins hinterste Regal zu durchstöbern?
Daher muss man die Wahrheit sorgsam erforschen,
bevor eine falsche Meinung ein törichtes Urteil fällt.
Den Lauf der Zeit durchzieht eine Spur von Schriftzeichen…
…so stand es in einem sehr alten Buch der Prophezeiungen geschrieben…vielleicht… denn was niedergeschrieben wird, hat Bestand. Aufgeschriebene Worte heischen Wahrheit. Doch ob die Worte wahr sind, die da mit Tinte auf Papier oder Pergament aufgetragen wurden – wer mag es beurteilen?
Eine Spur aus Schriftzeichen durchzieht die Zeiten. Die Geschichte der Menschheit ist seit alters her niedergeschrieben worden – doch oft können wir die Zeichen nicht mehr lesen, die Sprache nicht mehr verstehen. Oft wissen wir nicht mehr, wo sich die Zeugen dieses Schrifttums verbergen. Jedoch, nicht alles wurde aufgeschrieben. Die größten Geheimnisse der Schöpfung wurden von den Menschen in erzählte Geschichten und vorgetragene Verse gekleidet. Sie umgaben die Geheimnisse mit Sinnbildern. Sie versteckten sie unter Sagen, Mythen, Märchen. Gelehrte Barden und Weise Frauen trugen die Geheimnisse in ihren Liedern von Generation zu Generation, und jedes Volk erfand seine eigene Ausdruckweise, um die Geheimnisse zu verbergen, aber nicht zu vergessen.
Nicht allen Lebewesen gefiel es, dass die Menschen sich ihrer Abstammung und ihres Weges bewusst waren. Diese Lebewesen waren anders als die Menschen. Die Menschheit nannte sie Götter, Schlangen der Weisheit oder Drachen. Sie waren hochgewachsen, hatten längliche Gesichtszüge, helle Augen, die an grünliche Wasser erinnerten, feurig leuchtendes Haar und eine milchweiße Haut. Sie hatten schon lange vor den Menschen auf der Erde gelebt und sollten der sich entwickelnden Menschheit ihr großes Wissen und Können weitervererben. Doch sie rissen die Schätze der Weisheit an sich und gaben den Menschen im Austausch dafür nur wertlosen Tand. Diese Drachen der Weisheit hüten die geistigen Schätze weiterhin, und nur mit Mut und äußerstem Einsatz gelingt es von Zeit zu Zeit sie ihnen zu entreißen. Die Schätze gehören ihnen nicht – sie gehören der Menschheit. Dies wissen die Drachen der Weisheit und deshalb führen sie die Menschen in die Irre und beherrschen sie.
Feuer, Liebe, Gold, leuchtende Farben, Begeisterung – dies alles wollen die Drachenwesen für sich einnehmen. Sie beziehen daraus ihre Lebenskraft. Sie sind den Menschen überlegen und können sich nach Belieben wandeln. Dies tun sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Vor Jahrtausenden hatten sie begonnen sich von der Wärme und der Lebenskraft der Menschheit zu nähren. Am nahrhaftesten sind für sie die menschlichen Gefühle der Angst. Sie verbreiten deshalb gerne Besorgnis unter den Menschen, sie legen in den menschlichen Geist Furcht und Kummer – dadurch binden sie die Menschheit an sich. Sie haben es verstanden die Liebe und Freude der Menschen zueinander mit Sorgen zu durchmischen und mit Selbstsucht. So können sie gewiss sein, dass die Menschheit ihnen als Quelle der Lebenskraft dienen wird, ohne es zu bemerken. Seit alters her wurde den Menschen Angst vor Gotteswesen eingeredet. Ehrfurcht und Angst vor ihren Göttern sollten die Menschen haben. Später siegte der Glaube an einen übermächtigen, alleinigen Gott-Vater. Seitdem beten die Menschen voller Furcht zu einem Gott, den sie barmherzig nennen. Der Geist der Menschen wurde entzwei gespalten, so dass die Menschen die Sphäre der Welt und die Sphäre des Geistes als zwei unterschiedliche Welten betrachten.
Die Drachen der Weisheit eigneten sich die Geheimnisse der Menschheit an und hüten sie nun im Verborgenen. Die Menschen haben um die Drachen ihre eigenen Geschichten gewoben. Die Menschen verehrten sie und brachten ihnen Opfer dar. Sie nannten sie Wächter der Geheimnisse und Hüter der Schwelle.
Doch die Geheimnisse waren einst die wertvollsten Schätze der Menschheit. Niemand anderem standen sie zu. Es waren Zeichen zu Sätzen geformt, geritzt oder geschrieben auf Blätter, Tafeln und Rollen aus Stein, Leder, Ton, Holz, Baumrinden, auf Seiten aus gepressten Pflanzenfasern oder Tierhäuten. Alle Arten von Werkstoffen und Formen wurden benutzt, um die Geheimnisse zu erhalten. Selbst die Gebrauchsgegenstände des Alltags dienten dazu, um Schätze des Wissens zu bewahren. Krüge, Schalen und Gefäße wurden mit Mustern versehen, die beschwörende Formeln des Dankes und des Segens enthielten.
Die Geistesschätze verschwanden nach und nach in den Tiefen des Vergessens, von den Drachen der Weisheit gestohlen und an geheimen Orten verwahrt, so dass die Menschheit nun nach Schätzen aus Gold und Edelsteinen sucht. So sehr verhärtet haben sich die Menschen, dass sie bei „kostbaren Schätzen“ nur noch an Gold und edle Steine denken. Die Menschen glauben, dass fremdartigen Drachenwesen in dunklen Höhlen hausen und dort unermessliche Schätze bewachen. Schlangenartigen Leibes sollen sie sein. Furcht und Schrecken sollen sie verbreiten, mehrere Köpfe sollen sie haben und Feuer speien, um damit die Schätze angeblich für die Menschheit zu beschützen. Doch das ist gelogen: Die Drachen wollen die Schätze der Weisheit für sich allein. Sie haben auch keine grässlichen Klauen, mit denen sie das Wertvollste an sich reißen. Das Wertvollste halten sie mit ihren schönen, weißen Händen fest, betrachten es mit ihren klaren Augen. Das Wertvollste, das die Menschheit besitzt, sind die Geheimnisse des Lebens.
Von Zeit zu Zeit geschieht es, dass Auserwählte der Menschheit auf der Erde geboren werden, deren Aufgabe es ist, die Schätze zu heben. Das Wertvolle sollen sie den Drachen entreißen und wieder ans Licht holen. Jedermann, der versteht, darf und soll dann in den Genuss der Schätze kommen. Die Auserwählten sind manchmal Könige, manchmal Ritter, manchmal Bürger, manchmal sehr einfache Menschen. Sie sind alle Lehrer auf ihre Art. Die Auserwählten sind sowohl Männer als auch Frauen. Ihr Geist verströmt Licht und Wärme, und eine tröstende Kraft geht von ihnen aus. Den Auserwählten werden Helfer zur Seite gestellt, denn sie werden ihre gesamte Stärke brauchen, und all ihre Gaben und Fähigkeiten, um wenigstens einige der Drachenschätze wieder zurückzuholen. Mitunter sind die Anforderungen an die Auserwählten und ihre Helfer unüberwindbar.
Zuweilen gelingt es, Teile des Menschheitserbes wieder zugänglich zu machen. Manchmal wird es erforderlich, dass die Geheimnisse niedergeschrieben und gut verwahrt werden, damit sie den Händen der Drachen entgehen. Dann werden unter den Menschen Bewahrer der Geheimnisse erwählt – solche, die das Wort hüten und solche, die es verkünden. Gemäß ihrer Fähigkeiten werden sie erwählt. Die Verkünder der Worte müssen in der Lage sein, die Stimme in ihrem Innersten zu vernehmen und danach zu handeln, sei es durch gesprochen oder geschriebenes Worte. Die menschlichen Hüter der geheimen Schätze wählen ihre Nachfolger selbst. Sie bestimmen auch den Ort, wo die Schätze am sichersten verwahrt werden können. Dieser Ort bildet dann das größte der Geheimnisse, denn es gilt die kostbare Weisheit vor dem Zugriff der Drachen zu schützen.
Im Laufe der Zeit entfremdeten sich die Menschen von ihren Geheimnissen, den Schätzen ihres Geistes. Nichtsdestotrotz bleibt die Wirkung des angesammelten Wissens bestehen. Weder Lüge noch Betrug, noch üble Nachrede mögen die Wahrheit des Wissens angreifen oder gar verändern. Auch wenn die Menschheit eine Zeit lang die Wahrheit nicht sieht, bleibt die Wahrheit dennoch bestehen. Wahrheit genügt sich selbst. Sie verschenkt sich selbstlos an jene, welche sie lieben, sie verschleiert sich vor denen, die sie verleugnen.
Auch wenn der gesamte Erdkreis in Flammen aufgehen und das Universum in sich zusammen stürzen sollte, die Wahrheit bleibt in der Erinnerung des Kosmos bestehen.
Wahrheit kennt keine Zeit…
Das Zeitalter des Drachen
Ápokálipsis – Enthüllung göttlichen Wissens, Zeitenwende
Die Welt hatte sich verändert. Der Lauf des Schicksals hatte an Geschwindigkeit zugenommen und die Menschen hinkten langsam hinterdrein.
Der Große Karl IV., Kaiser des Römischen Reiches, hatte Kenntnis vom anstehenden Wandel der Zeiten. Karl war der Sohn der Geschlechter Luxemburg und Přemysl, die von manchen Gelehrten für Gralsgeschlechter gehalten wurden. Die Menschen glaubten damals an den Gral. Sie glaubten, dass die Gralsgeschlechter auserwählt waren, um zu herrschen. Sie waren fest davon überzeugt, dass gewisse Sippen, Familien, oder deren Verbände dazu bestimmt waren, andere Menschen zu führen. Für die Menschen jener Zeiten stand fest, dass Gralsangehörige einen stärkeren Geist, einen kräftigeren und größeren Körper und eine andersartige Seele hatten – darum war es ihre Aufgabe über andere Menschen zu herrschen. Derart war der Glaube, und er stammte aus der alten Zeit, als in den Ländern des europäischen Kontinents die Lehren des Jesus, genannt der Christus, noch nicht bekannt waren, als dieser Jesus noch lange nicht geboren war.
Die Menschen des europäischen Kontinents wussten um die Kräfte der Natur, denn sie waren von ihnen abhängig. Mit den Naturkräften verbanden sie auch ihre eigene Abstammung und ihren Platz innerhalb der gesamten Ordnung. Die Naturgesetze galten noch lange Zeit nach der Einführung des Christentums in Alt-Europa. Die christliche Lehre brauchte Jahrhunderte, um von Ost nach West zu gelangen, manchmal auf Umwegen, manchmal direkt. Auf ihren Umwegen wurde die Lehre des Jesus, genannt der Christus, jedoch verfälscht und verbogen. Die Menschen verkündeten sie nach ihrem eigenen Verständnis, und vieles ging dabei verloren.
Zu jener Zeit, in der Karl IV. als Kaiser des Römischen Reiches herrschte, waren noch lange nicht alle europäischen Gebiete in den Lehren des Jesus Christus unterrichtet. Doch die Welt ging einer großen Veränderung entgegen…
Kaiser Karl IV: beendete schließlich seine Aufgabe und schloss die Epoche des 14. Jahrhunderts, die mit ihm zu Ende ging, auf würdige Art und Weise ab. Als er starb, schrieb man das Jahr des Herrn 1378. Eine neue Zeit sollte bald anbrechen.
Karl IV. hatte vieles vollbracht. Vieles war aber nur ein Versuch geblieben, um die Welt ihrem Ziel näher zu bringen. Karl IV., Kaiser des Römischen Reiches, verfügte über die Apokalypse – das heißt Einsicht und Übersicht, Erkenntnis der entschleierten Dinge. Nun lag es an seinen Söhnen, aus der abgeschlossenen Epoche eine neue Zeit auferstehen zu lassen. Neuer Wein in neuen Schläuchen. Neue Gedanken, neue Ideen, neue Erkenntnisse. Die Zeit versprach vieles.
Karl hatte ein Musterreich erschaffen. Ein Vorbild für alle anderen Herrschenden. Ein beispielhaftes Staatswesen war auf dem Gebiet der Tschechischen Kronländer entstanden, welche in der lateinischen Sprache Bohemia genannt wurden. Den Menschen jener Länder war dieser Ausdruck fremd, denn sie sprachen eine andere, eine slawische Sprache, die nichts mit dem Latein der Römer zu tun hatte. Ihre Sprache war viel älter. Sie hatte Wurzeln in der Natur, in den Sagen und Gesängen der Barden, im Rascheln der Blätter uralter Bäume.
Die Tschechischen Kronländer waren Karls ureigenes Erbe, auf ihn gekommen durch seine Mutter und die weibliche Linie des Hauses Přemysl. Der Gral ist weiblich. Der Gral bezeichnet die Abstammung durch die Mütter. Der Gral stand am Anfang der Menschheit. Doch die Zeit änderte sich, und die Macht der Väter verdrängte das Naturgesetz der Mütter. Es war an der Zeit, dass die Menschheit auch mit dieser Kraft umzugehen lernte.
Damals, als Karls Epoche heraufdämmerte, damals als er noch nicht einmal geboren war, da hatte die Zeit mit Jenen zu kämpfen, die sie anhalten wollten. Jene Männer im Königreich der Tschechischen Kronländer, die keine Änderung wünschten, denn sie hätten ihre Gewohnheiten, ihre Gebräuche und Sitten, der neuen Zeit anpassen müssen, und davor schreckten sie zurück. Sie wünschten, dass die alten Zeiten nie aufhören mochten. Sie wünschten, dass sie die Herren über Leib und Seele eines jeden ihrer Untertanen blieben. Sie wollten keine Städte, keine Bürger, keinen Handel und schon gar keine Entwicklung der Geistesfähigkeiten innerhalb der eng bemessenen Grenzen ihrer Machtbereiche. Sie waren die Landesherren, sie wollten Herren bleiben. Sie pochten auf ihre Rechte: Entweder würde man einen König aus ihrer Mitte wählen – oder – wenn das nicht möglich war – sollte ein Fremder ins Land geholt werden, damit sich die Adelsherren nicht gegenseitig zerfleischten und bekriegten. Wäre in der Tat einer von ihnen König geworden, so hätten sich die anderen unmittelbar darauf gegen ihn verschworen, denn sie konnten es nicht leiden, dass jemand ihnen befahl. Sie wollten weiterhin ihre Burgen, ihr Jagdrecht und all die Rechte behalten, die sie als Herren an sich gerissen hatten, die ihnen jedoch nie zustanden. Solcherart waren Jene, die sich Herrscher, Fürsten oder Grafen nannten.
Keine Veränderung zulassen. Keine neue Zeit. Keine neuen Wege. Schon gar keine freien Lehr- und Lernanstalten zur Bildung des Geistes – und wenn schon, dann nur Schulen im Auftrag der Herren und nach ihrem Sinn. Die tschechischen Herren hätten bereits unter Karls Großvater in Prag eine Universität haben können, doch sie wollten sie nicht.
Nicht nur die tschechischen Adelsherren, sondern auch die Fürsten aller Länder des Römischen Reiches sowie des gesamten Kontinents wollten und würden keine Oberhoheit über sich anerkennen. Vor allem jene freien, unabhängigen und stolzen Reichsfürsten, die durch das Band der deutschen Sprache miteinander verbunden waren. Sie beharrten auf ihren Fürstentümern, und wollten doch gleichzeitig einen aus ihrem Kreis – einen Princeps inter pares – zu ihrem Oberherrn wählen. Der Princeps inter pares, der Führende unter Gleichrangigen, sollte das Gleichgewicht zwischen ihnen herstellen, obwohl sie dies gar nicht wünschten. „Du sollst uns regieren“, sagten die Fürsten zu Jenem, den sie sich als Kaiser erwählten. „Du sollst uns befrieden und unseren Streit schlichten. Doch wir wollen nicht regiert werden, wir wollen nicht befriedet und auch nicht versöhnt werden!“ Eine unmögliche Aufgabe. Ein Kaiser – der König der Könige – hatte nur für dann Erfolg, wenn er siebenmal stärker war als alle Fürsten zusammen. Ein unlösbarer Auftrag, an dem schon andere starke Herrscher vor Karl IV. gescheitert waren – allen voran sein großes Vorbild, Friedrich II. von Hohenstaufen.
Siebenmal stärker an Leib und Seele war Karl als die Fürsten. Ihm gehorchten sie wie gebändigte Wildtiere, murrend und auf die erste Gelegenheit wartend, bei der er Schwäche zeigte.
Siebenmal klüger als die Fürsten seiner Zeit, war Wenzel, Karls Sohn, und hätte man auf ihn gehört, hätten alle in Wohl und Überfluss leben können – doch wer kann es schon ertragen Klugheit neben sich zu wissen?
Siebenmal schlauer war Karls Sohn Sigismund. Er hielt die Fürsten, die wütenden Löwen glichen, mithilfe der altbewährten Mittel von Zuckerbrot und Peitsche im Zaum. Wie lange würde es dauern, bis seine Kraft erschöpft war?
Die hohen Herren und Fürsten des gesamten Abendlandes, und besonders jene des Römischen Reiches, konnten warten. Sie warteten auf ihre Gelegenheit zum selbstsüchtigen Sieg. Sie übten sich darin, ihre Herrscher herauszufordern und zu ermüden. Sie schlossen Bündnisse, schworen sich gegenseitige Treue und brachen sie noch bevor die Sonne einmal über ihren Schwüren untergegangen war. Niemand konnte sicher sein, ob sein neuer Verbündeter ihn im nächsten Augenblick nicht schon verriet. So verblendet waren sie in ihrem selbstsüchtigen Tun, dass sie sich für langlebiger hielten als die Kaiser.
So war der Adel jener Zeit beschaffen, und aus diesem Adel stammten nicht nur die Machthaber der Länder, sondern auch die geistlichen Würdenträger der christlichen Kirche. Die Kirchenherren, die Bischöfe, Fürstbischöfe, Erzbischöfe und gefürsteten Äbte, sie waren allesamt aus den gleichen Familien und Sippen hervorgegangen wie die weltlichen Fürsten, ihre Brüder und Vettern. Genährt mit demselben Geist wie ihre Verwandten, die Krieger und Eroberer. Die hohen Geistlichen befehligten die ihnen anvertrauten Kirchenprovinzen wie ihre Brüder die Herzogtümer und Grafschaften. Die Kirchenherren machten sich aber dabei ein anderes Machtmittel zunutze: Sie studierten die Rechtsprechung. Sie lernten die Sammlungen der Gesetze auswendig, und sie begannen mit deren Hilfe ihre Widersacher zu verdrängen und zu stürzen. Das Wort des Rechts erwies sich als eine ungemein starke Waffe, als schnell wirkendes Gift und eine doppelt geschliffene Klinge.
Längst war alles Vereinigende, Liebliche und Befriedende aus der Welt gewichen. Schon längst hielten sich die mehrenden und nährenden Kräfte bedeckt vor den Augen der Weltenherren. Die Zeit änderte sich und wandte sich gegen Frauen. Maria, die Gottesgebärerin hatte Maria, der von ihrem Sohn gekrönten, entrückten Himmelskönigin zu weichen. Die Gottesmutter wurde zu Heiligen Jungfrau. Sie sollte nun Kriegszüge segnen, Waffen lenken und Sieg über die Feinde bringen. Als wäre Maria eine sagenhafte, vergöttlichte Stammesfürstin, eine Kriegerin aus barbarischem Volk, so erbaten sich von ihr christliche Ritter den blutigen Sieg über andere christliche Heere. Nach erfolgreicher Schlacht legten dann Überlebende Opfergaben zu Füssen ihrer „Lieben Frau“, als gälte es eine Göttin der Zerstörung mit Weihegaben aus blutig erbeutetem Raubgut zu besänftigen. Niemand sprach dagegen, kein Geistlicher sah den furchtbaren Widerspruch. Im Gegenteil, der Oberste Hirte der Christenheit, der Mann, der sich Bischof von Rom und Papst der Lateinischen Kirche nannte, rief sogar zu weiteren Gräueln auf, zu Mord an Unschuldigen, zu Plünderungszügen im Zeichen des Kreuzes – zu Kreuzzügen und zur angeblichen Befreiung eines Landes, das den Christen als heilig galt, da ihr Gott – den sie Erlöser nannten – dort in Menschengestalt gelebt hatte.
Die Zeit schritt voran und wandte sich ebenfalls gegen friedfertige, vorausschauende und selbstlose Menschen. Es war dies erst der Beginn. Mit fortschreitender Zeit sollte alles, was Heilung, Linderung und Trost bot, als abtrünnige Ketzerei verdammt und verurteilt werden. Die Welt war krank geworden… Die Zeiten hatten sich bis ins Unkenntliche gewandelt. Die Menschheit war nicht wiederzuerkennen. Nun brauchte es überaus mutige, überaus opferbereite, barmherzige und edelmütige Menschen, damit die Zeit sich nicht ganz in den dunklen Tiefen verlor. Solche Menschen mussten sogar bereit sein für die Wahrheit zu sterben – jene schlichte, grundlegende Wahrheit, die keine Gesetzessammlung benötigt, keine Bücher, in denen sowohl die Rechte beschrieben sind als auch die Wege, die Rechte zu umgehen. Die selbstlosen Menschen, Männer und Frauen, begannen sich bereits für ihre schwierigen Aufgaben zu rüsten. Wie gut, dass viele ihr Ende nicht ahnten, wie gut, dass sie Vertrauen hatten.
König Sigismund, der Kriegersohn des Großen Karl, der dem Bruder Wenzel hätte schützend zu Seite stehen sollen, hatte das Bewusstsein seiner Aufgabe weggeworfen. Tief in seinem Innersten konnte es der Krieger Sigismund nicht verwinden, den Halbbruder Wenzel als Erben des Vaters zu sehen. Stark war die Wirkung der Worte seiner Mutter gewesen, die sie ihm unablässig wiederholte, und deren Gift seine junge Seele verätzte. Anstatt dem Bruder ein stützender Arm gegen die Anfechtungen der Fürsten zu sein, hatte Sigismund den Wurm des Neids in sich genährt und fühlte sich vom Vater ungerecht behandelt. Hatte er nicht bewiesen, dass er der Bessere, Stärkere, Ausdauerndere war? Nein, dem war nicht so. Er wäre beinahe in sinnlosen und kopflosen Schlachten getötet worden, und die Fürsten jener Länder, die ihm als ihrem König anvertraut waren, empörten sich genauso gegen ihn, wie es die tschechischen und die deutschen Fürsten gegen den Bruder Wenzel taten. Sigismund hatte die ungarischen Adelsherren nur zum Frieden zwingen können, indem er einige von ihnen hinrichten ließ. Da nutzte es nicht viel, dass er die ungarische Stadt Ofen mit schönen Bauten schmücken ließ. Das Land Polen war Sigismund entglitten, der polnische König hatte einen Weg gefunden, das Land an seine kluge Tochter, Jadwiga, zu binden. Im Nachhinein gereichte dies dem Land Polen zum Segen. Die bereits vom Kaiser Karl IV. angestrebte polnisch-ungarische Union unter der Regierung seines Sohnes Sigismund löste sich zu einer entrückten Vision auf, wie der Morgennebel unter den Strahlen der Sonne. Sehnsucht des Hauses Luxemburg nach der Macht im Nordosten. Die slawischen Fürsten der baltischen Länder führten Sigismund an der Nase herum, und seine mährischen Vettern hatten ihm das Leben schwer gemacht. Sogar sein jüngster Bruder, Jan, hatte Partei für den Halbbruder Wenzel ergriffen. Es nutzte auch nicht viel, dass der mächtige, dunkle und undurchdringliche Graf Hermann von Celje Sigismund seine Tochter Barbara zur Frau gab. Der Graf hatte einmal Sigismunds Leben gerettet und konnte ihm nun die Bedingungen der Dankbarkeit diktieren.
Sigismund hasste es, ständig nur als der jüngere Bruder angesehen zu werden, hasste es sich ständig Lobeshymnen auf seinen großen Vater anhören zu müssen, hasste es auf der unteren Stufe zu stehen. Sigismund musste Kaiser werden. Er brauchte etwas Großes, eine Aufgabe, die nur aufgrund seines großen Talentes gelingen konnte. Ein Werk, welches ihm Nachruhm und Bewunderung sichern würde. Ein Ereignis, das er beherrschen und durch seinen Willen lenken konnte. Etwas, das ihm Dankbarkeit sichern und seine Titel als Bewahrer, Mehrer und Beschützer des Reiches rechtfertigen mochte.
Sigismund wollte sich der Aufgabe annehmen, das große Schisma, die entsetzliche Spaltung der katholischen Kirche zu heilen und den Menschen der lateinischen Christenheit den Frieden zu bringen – kostete es was es wollte. Sigismund war bereit jeden Preis zu bezahlen. Niemand sollte ihn daran hindern, die Würde eines Kaisers, die Nachfolge des Vaters, mit allen Rechten und Privilegien an sich zu nehmen!
Sigismund war bereit die Zügel in die Hand zu nehmen und den Löwen, welcher sich Europa nannte, zu zähmen. Dabei konnte es keine Rücksichtnahme geben. Entweder man war für, oder man war gegen Sigismund von Luxemburg. Es gab keinen dritten Weg.
Das Zeitalter des Drachen hatte begonnen.
Konstanz, etwa zehn ungewisse Jahre nach dem Ende der Großen Kirchenversammlung gerechnet
Die Chronik &das Wappenbuch des Ulrich Richental
Omnipotens Deus, qui es retributor omnium
bonorum, vindictor malorum, da mihi viam recte
scribendi, qui es trinus et unis.
Eintrag in der Konstanzer Chronik, angeblich von Ulrich Richental
Allmächtiger Gott, Der Du Deine Güte über die Welt
ausgießt, Der Du das Böse besiegst, weise mich an, damit
mein Schreibwerk gelinge.
Du, Der Du Drei-Einig und All-Einig bist.
Ulrich Richental legte die Schreibfeder beiseite. Er hatte die teure Gänsefeder genommen, um das Stoßgebet an den Allmächtigen niederzuschreiben. Für den Allmächtigen Herrn sollte kein Schreibwerkzeug zu teuer sein. Für den folgenden Text genügte ein sorgfältig gespitztes Schreibrohr, das gut in der Hand lag. Endlich sollte das Werk, welches er vor vielen Jahren begonnen hatte, seine endgültige Form erhalten. Richental hatte sich endlich dazu durchgerungen seine alten Notizhefte und Blätter zu ordnen. Die Zeit war gekommen, um ein Werk zu vollenden, welches im Jahre des Herrn 1414 begonnen worden war und seitdem nur in loser Form bestanden hatte. Nach dem Ende des Konzils zu Konstanz am Bodensee, und während der darauffolgenden Jahre, war sich Ulrich Richental nicht mehr sicher gewesen, ob er jemals zu diesem Werk zurückkehren wollte. Ein Wappenbuch hatte es ursprünglich werden sollen, mit darin gemalten Wappenzeichen aller wappenfähiger Teilnehmer des großen Kirchenkonziliums. Die Idee eines Wappenbuches musste jedoch schon bald dem Befehl des Römischen und Ungarischen Königs Sigismund weichen, der sich genaue Aufzeichnungen wünschte. Alles sollte aufgelistet werden: Die Teilnehmer, ihr Gefolge, ihre Quartiere, sogar die Anzahl der benötigten Reittiere und weiteres mehr – natürlich auch die Wappen. Während der gesamten Dauer des Konzils war Ulrich Richental unermüdlich in der Stadt unterwegs gewesen und hatte alles Wissenswerte gesammelt, dessen er habhaft werden konnte. Dazu hatte er persönliche Notizen geschrieben. Sein Ziehsohn war ihm dabei eine große Hilfe.
Ulrich Richental dachte jedes Mal mit Wehmut an den Ziehsohn. Er war außer Landes gegangen. Er lebte irgendwo auf den Besitzungen eines großen mährischen Adelsherren. Der Ziehsohn hat seinem Vater einige Monate zuvor ein Bündel Papiere zukommen lassen. Es war mit Fuhrleuten gereist und zuletzt mit einer Pilgern in Konstanz angelangt. Eine abenteuerliche Reise, auf der die Papiere hätten hundertmal verloren gehen können. Dass sie das nicht taten, hielt Ulrich Richental für göttliche Vorsehung und somit für einen Fingerzeig Gottes: Er sollte die Notizen seines Pflegesohnes mit den eigenen vereinen und davon eine Reinschrift anfertigen, eine Chronik des großen Konziliums zu Konstanz, beginnend im Jahre des Herrn 1414 und endend nach der Abreise aller Teilnehmer im Jahre 1418.
Kein Weg führte an dieser Reinschrift vorbei, denn schon bald nach dem Ende des Konzils begannen Gerüchte und verdrehte Behauptungen lautbar zu werden. Die Leute redeten… In der Zwischenzeit war viel geschehen: In Prag waren Unruhen ausgebrochen. Sie gipfelten im Jahre 1419 in einem Blutbad im Altstädter Rathaus, als die aufgebrachte Menge einige Ratsherren ergriff und aus dem Fenster warf. Es folgten Raub, Töten, Plündern. Der Tschechische König Wenzel IV. war über diesen Geschehnissen von einem Herzanfall ergriffen worden und verstarb. Seine Gemahlin, die Königin Sophie, versuchte zu retten was zu retten war, doch auch sie musste vor dem aufgebrachten Pöbel fliehen. Zu jener Zeit begann die Königin Sophie jene Leute zu hassen, die sich Anhänger ihres früheren Beichtvaters und Lehrers, des Magisters Jan Hus, nannten. Die Königin Sophie sah, dass die Lehren des Magisters Hus ins Gegenteil verkehrt wurden, dass die Menschen, die ihm angeblich folgten, nur an Macht interessiert waren. Die Hussiten, wie sie sich nannten, verdrehten die Worte ihres verstorbenen Meisters. Damit hatten sie sich die Königin zur Feindin gemacht. Sie töteten und plünderten. Von Großmut und Duldsamkeit konnte keine Rede sein. Das Volk rebellierte gegen jegliche althergebrachte Ordnung. Die Leute glaubten der Offenbarung des Evangelisten Johannes, sie glaubten, dass das letzte, das goldene Zeitalter angebrochen war, in dem es weder Standesunterschiede noch Pflichten gab. Jeden Tag erwarteten sie, dass der Heiland in einer gleißenden Wolke vom Himmel hinabfuhr und die Menschen von ihrem Joch befreite. In ihrer Verblendung warfen sie sämtliche Lehren der Frohen Botschaft Christi weg und folgten nur noch ihren Rachegelüsten. Am schlimmsten gebärdeten sich jene, die sich ungefragt auf den Besitzungen der Herren von Rožmberk eine Stadt aufbauten. Sie nannten ihre Stadt Tabor.
Die Königin Sophie verhärtete ihr Herz gegen diese Eiferer, doch sie verhärtete es dabei auch gegen die gemäßigteren Anhänger des Magisters Hus, die in Prag zurückgebliebenen Professoren und Studenten der Universität. Die Gelehrten waren der Königin keine Hilfe. Sie disputierten und schrieben Briefe an den neuen Papst Martin V., der sich jahrelang in Florenz aufhielt. Er hatte es nicht eilig in Rom Ordnung zu schaffen. Der Papst beachtete jene Briefe nicht, oder er ließ im Gegenzug geharnischte Briefe an die Prager Gelehrten verfassen. Er drohte mit Bann, mit Ausschluss aus der Kirche, mit ewiger Verdammnis der Seelen – als ob dies ein Mensch bewirken könnte. Die Königin Sophie musste aus Prag fliehen und sich unter den Schutz ihres Schwagers, des Römischen Königs und Kaiseranwärters Sigismund begeben. Sigismund war nach Wenzels Tod Erbe des Halbbruders und Tschechischer König geworden, doch das Land wies Sigismund zurück. Viele erinnerten sich sehr gut an die Feindschaft, die er gegenüber dem Halbbruder gehegt hatte, wie er ihn vor Jahren gefangen nehmen ließ, wie er auf die Silbervorräte der Stadt Kuttenberg erpicht war, wie er sich Zugang zur Burg Karlstein verschaffen wollte, weil dort die Kronjuwelen sowohl der Tschechischen Länder als auch des Römischen Reiches verwahrt wurden. Die Länder der Tschechischen Krone versanken im Tumult und in qualvollen Wirren. Die stolze Prager Universität wurde vom neuen Papst an ihren Rechten beschnitten. Der neue Papst, Martin V. aus der römischen Kriegerfamilie Colonna, rächte sich unbarmherzig für angeblich erlittene Beleidigungen tschechischer Universitätsgelehrten und rief zu Kreuzzügen auf. Die Prager Städte – einst Zeugen königlicher Pracht – wurden durch Gewalt und Feuer geschändet, ihre Kunstschätze gingen in Feuersbrünsten auf. Adel, Bürger und Volk waren im Streit um die Auslegung der christlichen Religion gespalten.
In der Zwischenzeit hatten die Kirchenherren ein neues Konzil anberaumt. Es sollte im Jahre des Herrn 1423 in der italienischen Stadt Pavia stattfinden. Doch weder der Papst noch der König erschienen. Man verlegte das Konzil in die Stadt Siena, man stritt sich herum, nichts wurde erreicht. Das Konzil von Siena wurde aufgelöst, und es hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass der der Papst Martin V. es damals mit allen Mitteln zu verhindern suchte, und dass er es ablehnte, überhaupt noch Konzilien stattfinden zu lassen. Allerdings drängte die Situation der Hussiten in den Tschechischen Ländern zu einer Stellungnahme oder gar zu einem Kompromiss. So stark und so zahlreich waren die Hussiten geworden, dass man sie nicht einfach alle zusammentreiben und in die Flammen der Scheiterhaufen werfen konnte, wie dazumal in Konstanz die Gelehrten Jan Hus und Hieronymus von Prag. Die Kirche entschied sich nun mit den von ihr als Ketzer bezeichneten Hussiten zu verhandeln. Dann wurde lange gestritten, wo und wann ein nächstes Konzil stattfinden sollte.
Als Ulrich Richental sich schließlich entschied seine Notizen doch noch in einer einzigen Schrift zusammenzufassen und sie somit der Nachwelt zu erhalten, war die Erinnerung an die erfolglosen Konzil von Pavia und Siena bereits am Verblassen. Gleichwohl wurden überall in Europa Stimmen laut, die den Papst Martin V. dazu ermahnten ein Datum und einen Ort für eine neue, Reformen bringende Kirchenversammlung festzusetzen. Es sollten aber noch Jahren vergehen, bis man sich schließlich auf das Jahr des Herrn 1431 und die Bischofsstadt Basel einigte…
Ulrich Richental hatte für sein Buch die zu beschreibenden Blätter gekauft und vorbereiten lassen. Seit den Tagen des Konstanzer Konzils waren Schreibwerkzeuge und Papier in allen nur wünschbaren Formen und Ausführungen zu haben. Der Kaufmann Lütfried Muntprat hatte erfolgreiche Geschäfte mit seinen Papiermühlen gemacht. Er bot dazu alles feil, was man als Notar oder als Schriftsteller brauchte. Der Kaufmann Lütfried Muntprat verwöhnte seine gut zahlende Kundschaft. Er bot bereits vorbereitete Papierseiten an, gar ganze gebundene Bücher. Die Schreiber mussten die zu beschreibenden Seiten nicht erst mühsam mit Linien versehen. Mithilfe eines Lineals waren die Ränder der Seiten bereits beim Kauf markiert. Dazwischen waren feine Linien mit dem Silberstift gezogen worden, damit die Reinschrift auch ordentlich gerade gelang. Die Linien ließen sich ausradieren, wenn ein Bild zwischen den Text gesetzt wurde – und Bilder wollte Ulrich Richental in jedem Fall in seinem Buch haben. Einige Bildseiten waren schon in dem Paket enthalten, das Ulrich vom Ziehsohn bekam. Andere, größere Bilder, die eine ganze Seite in Anspruch nahmen, sollten von Konstanzer Buchmalern ausgeführt werden. Die Bildseiten sollten beim Binden zwischen die beschriebenen eingefügt werden. Richental hoffte, dass sich einige der Maler noch an die Ereignisse des Konzils erinnerten. Dass es trotzdem viele Besprechungen brauchen würde, was darzustellen war und wie, davon war er überzeugt – ebenso, dass niemand anderes dafür Geld bezahlen würde als er.
Doch mit Gottes Segen würde die Arbeit gelingen, und Gottes Segen benötigte Ulrich Richental. Er war nicht mehr jung. Wer wusste schon, wann Gott ihn zu sich berief? Dieses Buch zu schreiben war jetzt notwendig geworden. Der Lauf der Zeit bestätigte es – und der Lauf der Zeit drängte.
So sollte in Gedanken noch einmal alles beginnen… was sich damals zugetragen hatte. Damals… noch vor dem Großen Konzil… Damals als in Ulrich Richentals Leben eine Wende eintrat… Damals, noch vor dem Jahr des Herrn 1410…
Endlich, viele Jahre später – begann Ulrich Richental zu schreiben.
Die Jahre des Herrn von 1400 bis 1413 am Bodensee
Anna Eglin von Tägerwilen
Anna spürte den Schmerz der Kreatur. Wenn Mensch oder Tier Not litten, fühlte Anna die Qual an eigener Seele, am eigenen Leib. Schon als sie ein kleines Mädchen war, und gerade gelernt hatte zu denken, hatte sie die Lebewesen um sich herum gefühlt.
Ein oder zweimal im Jahr säuberte Annas Vater, der Gevatter Eglolf, Egli genannt, den Hof von neugeborenen Katzen. Er packte die kleinen, wollenen und miauenden Knäuel erbarmungslos in einen groben Sack, trug ihn zur Brücke am Mühlbach und schüttete den Inhalt unterhalb des großen Mühlrades in die Tiefe, dort wo das Wasser in schäumenden Strudeln spritzte. Eines Tages war Anna dem Vater nachgelaufen. Sie fühlte Schmerz im ganzen Körper – in ihrem Unterleib, in der Brust, im Kopf. Der Schmerz lärmte, stach und bohrte unerträglich. Anna schrie. Weinte. Rief den Vater an. Doch das Wasser toste und der Vater hörte sie nicht. Er blickte von der Brücke herab, versicherte sich mit grimmiger Genugtuung, dass die überzähligen Tiere den Tod in den Fluten fanden. Nur Anna hörte ihre Angst. Die Schreie der hoffnungsvoll Geborenen rissen fast ihr Gehör entzwei.
Der Vater wunderte sich, als er plötzlich die Tochter entdeckte. Er schimpfte. Was sie da zu suchen hätte, wollte er wissen. Warum sie überhaupt hierhergekommen wäre? Anna wich zurück, rannte weinend davon.
Seit jenem Tag passte sie genau auf. Sie machte sich vertraut mit den Tieren des Hofes. Seitdem rettete sie jedes halbe Jahr den neugeborenen Katzenwurf im Frühjahr und im Herbst, indem sie die Tierchen behutsam in einen gepolsterten Korb barg und mitsamt der Katzenmutter im Wald aussetzte. Im Wald konnten sie zumindest überleben.
Mit der Zeit erkannte die Familie Annas seltsame Verbindungen zu leidenden Tieren und Menschen. Mit der Zeit lernten sie ihre Gabe zu nutzen. Schon bald rief man Anna in den Stall zu werfenden Mutterkühen. Sie brauchte sich nur neben das Muttertier zu knien, mit der Hand über den wehen Leib zu streichen, sich manchmal selbst ins Stroh neben dem angeschwollenen Kuhkörper zu legen – die Tiergeburt würde nun rasch vor sich gehen, Muttertier und Wurf würden gesund sein und gedeihen.
Einmal, als das jüngste Kind der Nachbarin hohes Fieber bekam, wurde Anna eilends gerufen. Sie kam, betrat die Stube, sah das fast bewusstlose kleine Geschöpf zwischen Decken und Schaffellen des großen Familienbettes liegen. Anna taumelte. Doch sie näherte sich dem Bett, schlug die Decken und Laken zurück, nahm das Kind auf. Es war sieben Jahre alt und für die zierliche Anna fast zu groß. Sie drückte es an sich, umarmte es, hielt es in an ihren Körper geklammert, bis jemand sie zum Herdfeuer führte und sie in einen Fassdaubenstuhl drückte. In die hohe, fellbedeckte Lehne des Fassstuhles gekuschelt, hielt sie das Kind für mehrere Stunden auf sich. Von Zeit zu Zeit verlangte sie, dass man dem Kind Wasser einflößte, dass man ihr selbst Wasser zu trinken gab. Sie hielt den Kopf des Kindes an ihrer Schulter, umarmte es innig und summte frei erfundene Melodien. Fast die ganze Nacht saß sie da und hielt das Kind auf ihrem Schoss. Als der Morgen graute, hatte das Fieber nachgelassen. Als die Sonne aufging begannen die rötlichen Flecken, die bis dahin die Haut des Kindes bedeckt hatten zu verblassen und noch bevor es von der fernen Kirche Mittag läutete, schlug das Kind die Augen auf und blickte um sich. Dann lächelte es und verlangte zu essen.
Nach diesem Ereignis wurde Anna zu allen Menschen im Dorf gerufen, die erkrankt waren. Einige gesundeten vollkommen von ihren Leiden. Die meisten erfuhren Linderung. Bei einigen wenigen schüttelte Anna jedoch den Kopf noch bevor sie die Schwelle des Hauses überschritten hatte. Diese Kranken waren dem Tod geweiht. Ihre Familie sollte für sie beten, meinte Anna, ihre Gabe zu heilen wäre da verschwendet.
Nach einem harten Winter und einem verregneten Frühling rannte Anna aus dem Dorf davon. Sie lief in den Wald – weit, weit weg von allem Leid und aller Krankheit. Die Menschen liefen ihr nach, suchten sie. Anna war ihre Hoffnung. Sie durften sie nicht verlieren, nicht davonlaufen lassen. Die Menschen verstanden nicht, dass sie Annas Kräfte beinahe aufgezehrt hatten. Anna lief tiefer und tiefer in den Wald, nur vom Wunsch besessen, den Menschen mit ihren Begehren und ihren Schmerzen davonzukommen. Am Anfang suchte man sie. Dann, Tage später, wurde die Suche aufgegeben. Anna wurde aufgegeben.
Tage vergingen, Wochen und Monate. Die rotgeweinten Augen von Annas Mutter erholten sich allmählich, der Vater ging immer noch schweigsam in Haus und Hof umher, doch man bemerkte, dass er den letzten Wurf der Maikatzen am Leben beließ. Er gewährte den Jungtieren, dass sie auf dem Hof herumtollten und sich zusammen mit der Katzenmutter tagsüber im Heu verbargen.
Das Leben im thurgauischen Tägerwilen und in Haus und Hof des Eglolf, genannt Egli, nahm seinen gewohnten Lauf. Vielleicht ein wenig stiller und hie und da mit einigen Seufzern durchzogen.
Es war in jenem Jahr um die Erntezeit, als Annas Familie die Nachricht erreichte, dass ihre Tochter wohlauf war, und dass sie von den Weisen Frauen, den Waldschwestern im Tägermoos in der Kunst der Heilung unterwiesen wurde. Die Nachricht kam von den Tägerwiler Beginen, gottesfürchtigen Frauen, die in einer klosterähnlichen Gemeinschaft lebten, ohne sich in einen Orden einzugliedern. Die Beginen waren als Heilerinnen tätig, unterhielten ein Spital und kümmerten sich um die Armen und Gebrechlichen. Mit den Waldschwestern vom Tägermoos waren sie in ständiger Verbindung. Es gab auch Männer, die in solchen Gemeinschaften lebten, sie wurden Begharden genannt. Beginen und Begharden waren den Menschen in den Städten, Dörfern und auf den Höfen eine große Hilfe in ihrem Alltag. Vor allem ihre Heilkunst wurde hochgeschätzt. Weniger geschätzt wurden die freiwilligen Gemeinschaften jener Männer und Frauen von den Kirchenherren. Die geistlichen Führer der Kirche versuchten seit Langem, die Begharden und Beginen den bewilligten Klosterorden einzuverleiben. Eine Regel sollten diese Gemeinschaften haben, nach der sie sich zu richten hatten – und vor allem sollten sie unter die Aufsicht eines Abtes oder Bischofs gestellt werden. Die Kirche betrachte die selbständigen Beginen und die genügsamen Begharden als Verbreiter von ketzerischen Ansichten, die den Dogmen der Kirche widersprachen. Aus diesem Grund machten die Kirchenherren den Beginen und Begharden das Leben schwer. Noch war aber nicht die richtige Zeit angebrochen, um diese Nester der Häresie, wie es die Kirchenherren nannten, auszuräuchern, noch nicht, doch bald schon. Die Kirche konnte warten… Die Zeit gehörte der Kirche – wem sonst?
Vater Egli stiftete in der Pfarrkirche eine Kerze als Dank für die gute Nachricht von seiner Tochter. Nun wusste die Familie, dass Anna am Leben war, und dass sie sich ganz ihrer Nähe befand. Sie folgte ihrer Berufung zur Heilerin. Zwei oder drei Jahre sollten vergehen bevor sie sie wiedersahen.
Es war eines frühen Abends, als bei goldenem Sonnenlicht zwei Frauen gesehen wurden, wie sie über die Flur auf das Dorf zuschritten. Die Neugierigen, welche die Frauen beobachteten, sahen wie sie durch das noch offene Tor das Dorf betraten, wie sie den Weg zum Dorfplatz einschlugen und von da aus zum Haus des Egli einbogen. In einer der Frauen erkannten sie Anna. Sie hatte sich verändert, doch es war unverkennbar Anna. Das lange Haar, zu einem Zopf geflochten, baumelte auf ihrem Rücken. Sie trug ein gerade geschnittenes Kleid aus gebleichtem Hanf, das sie mit einem Baststrick gegürtet hatte. Ihre Füße steckten in Bastbundschuhen. Anna hielt einen Korb am Arm, der mit Pilzen und Beeren gefüllt war. Auf dem Rücken trug sie ein großes Stoffbündel, aus dem es nach getrockneten Kräutern und Blumen duftete. Anna und ihre Begleiterin lächelten sanft.
Vor dem Haus des Vaters blieben sie stehen. Die Familie hatte sich längst vor dem Tor versammelt, denn die Neugierigen waren mit der Neuigkeit vorausgerannt. Von links und rechts erschienen weitere Leute, die erwartungsvoll um sich blickten. Annas Mutter hielt ihre Hände vor dem Mund. Man sah, dass ihre Augen in Tränen schwammen. Das Gesicht des Vaters war undurchdringlich. Die fremde Frau und Anna waren nun stehen geblieben. Der Vater nickte wortlos. Die Mutter schloss ihre Tochter in die Arme. Nun weinte sie endlich vor Erleichterung. Annas Begleiterin hatte ebenfalls einen wohlgefüllten Korb und ein Bündel mit Kräutern mitgebracht. Sie stellte beides vor sich auf die Erde. Die Leute wussten, wer diese andere Frau war. Sie wussten, dass sie im Wald lebte, doch nur wenige kannten sie. Die Hex, die Waldfrau, die Heilerin, die Kundige und Seherin. Es war lange Jahre her, seit man sie das letzte Mal im Dorf gesehen hatte. Es hieß, dass sie den Waldschwestern eine Oberin war. Nun hatte sie Anna zurückgeführt. Sie hatte sogar Geschenke mitgebracht. Anna musste demnach der Waldfrau lieb und teuer sein. Die Dörfler knieten im Staub der Straße, die Männer hatten ihre Mützen abgenommen und neigten die Köpfe. Die Waldfrau erhob ihre Arme und sprach einen Segen. Dann wandte sie sich noch einmal zu Anna, umarmte sie zum Abschied und schritt denselben Weg zurück, auf dem sie gekommen war. Niemand hielt sie auf. Niemand stellte sich ihr in den Weg. Die Dörfler riefen ihr noch hie und da Dankesworte nach. Sie schauten wie sie das Dorf verließ, durch die Wiesen schritt und im Wald verschwand.
Von da an war Jungfer Anna Eglin die Heilerin des Dorfes. Von da an bereitete sie lindernde Mittel aus den heiligen Pflanzen, mischte Kräuter und Wurzeln zu Räucherwerk, Aufgüssen, Salben und Umschlägen, richtete Knochenbrüche, versorgte Wunden, half der Hebamme und kümmerte sich um die Wöchnerinnen. Sie lieh ihre Kraft allen Leidenden, ob Mensch, ob Tier, und sie betete zusammen mit den Sterbenden.
Die Jahre gingen durchs Land. Jahreszeiten wechselten sich ab im ewigen Drehen des Weltenrades.
Es war wieder Hochsommer und die Dörfler hatten Glück gehabt, dass sie noch den letzten Wagen mit dem geernteten Korn unter ein Scheunendach geschoben hatten, als Blitze den plötzlich verdunkelten Abendhimmel durchfuhren. In der Ferne grollte der Donner. In den Häusern saßen müde und glückliche Menschen auf Bänken und Fassstühlen, spülten mit Wasser und Bier aus groben Tonkrügen den Staub des heißen Erntetages aus ihren Kehlen und warteten bis der Abendbrei gar wurde. Die ersten schweren Tropfen fielen schon, als die Frauen die vollen Breischüsseln zu Tisch trugen. Je nach Belieben der Hausfrau duftete der Brei nach feingeschnittenem Speck, frischem Gartenkraut, schmelzender Butter oder Dörrzwetschgen und Rüben. In den Häusern rückten die Menschen auf den Bänken zusammen, damit alle am Tisch Platz hatten. Sie dankten Gott und den Heiligen, dass die Ernte im Trockenen war, sie dankten, dass der Regen wieder fiel – und sie baten innig, dass die Blitze ihre Häuser verschonen mochten. Dann tauchten sie ihre Holzlöffel hungrig in die gemeinsamen Schüsseln mit dem Abendmahl. Das Rauschen des Regens verstärkte sich. Gesättigte Dörfler streckten ihre müden Beine aus, die Kinder legten sich bereits auf den Bänken zum Schlafen hin. Die Frauen räumten das Geschirr weg, säuberten es und ordneten ihre Küchen für den nachfolgenden Morgen. Dann wurde Wasser aus großen Bottichen in Holzgelten geschöpft, und diejenigen, die noch nicht schliefen, wuschen so gut es ging den Staub eines langen Erntetages von ihren Körpern. Die Hausväter gingen noch einmal hinaus, um trotz des strömenden Regens den abendlichen Rundgang um ihre Gehöfte zu machen, zu prüfen, ob Stall, Scheune und Tor gut geschlossen und gesichert waren. Es konnte nun regnen so viel es wollte. Die Ernte war eingebracht, das künftige Jahr war gesichert. Gott mochte alle andere Gefahr und Feuersbrunst verhüten, in seiner großen Allmacht und Kraft. Amen.
Das Dorf schlief schon, selbst die Wachhunde dösten an trockenen Plätzen unter Vordächern und vorspringenden Mauerteilen, als vor dem geschlossenen Tor in der Dorfmauer Lärm hörbar wurde. Die Ummauerung des Dorfes bestand aus einem soliden Fundament und starken Palisaden. Grobes Astgeflecht, mit Dornengestrüpp aufgefüllt und mit Lehm verfestigt, bildete eine wehrhafte Ummantelung. Die Mauer bot sowohl Schutz gegen die Wildtiere des Waldes als auch gegen menschliche Tücke. Bei einem Angriff würde sie zumindest so lange standhalten, bis alle Dorfbewohnen wach und auf den Beinen waren, um sich zu verteidigen – oder um wenigstens die Kellerlöcher in ihren Häusern zu verdecken, wo sie Vorräte und etwas Habe zur Not horteten. Im äußersten Notfall war noch die steinerne Kirche da, die innerhalb der Dorfmauern Schutz bot. Schutz war notwendig, denn noch vor einigen Jahren gefährdeten die Appenzeller, die sich mit dem Kriegsvolk der Eidgenossen verbündet hatten, den Frieden des Dorfes sehr.
Der Nachtwächter schlug Alarm, als er den Lärm vor dem Dorftor hörte, und rief die Wehrleute zusammen. Die ersten Dörfler erwachten und liefen mit brennenden Kienspänen in den Händen nach draußen. Vor dem Tor riefen Stimmen, baten um Einlass und Hilfe in der Not. Es waren Konstanzer Kaufleute mit Ochsengespannen. Vom Unwetter überrascht, waren sie auf den regendurchweichten Straßen steckengeblieben. Die Räder und Achsen eines ihrer Wagen waren beim Versuch das Gefährt aus dem Schlamm zu ziehen zerbrochen.
Der Nachtwächter, der Dorfvorsteher und ein kräftiger junger Waffenknecht schlüpften aus dem Seitentor hinaus und sprachen mit den Kaufleuten. Sie begutachteten lange den nicht beschädigten Wagen und die ausgespannten Ochsen des anderen Gefährtes. Sie gingen zusammen mit den Fuhrknechten die Straße hinunter, in die Richtung, aus der die Wagen gekommen waren. Da lag nach einer Biegung, wie der gestrandete Walfisch des Jonas aus der Heiligen Schrift, der Wagen mit den gebrochenen Rädern und beschädigten Achsen. Die Fuhrwagen hatten Eisenbarren geladen, die in Konstanz den Schmieden sowie auf dem Markt verkauft werden sollten. Bisher war seit Beginn der Fahrt alles gut verlaufen, und nun dieses verfluchte Unwetter! Die Fuhrknechte erzählten, wie der Regen sie überrascht hatte, wie sie fürchteten vom Blitz getroffen zu werden, wie sie bei jedem Donnergrollen zusammengezuckt waren. Nun müssten wohl einige von ihnen die Nacht über beim Wagen bleiben – so eine kostbare Fracht ließ man nicht unbewacht in der Nacht zurück. Obwohl, in einer Nacht wie dieser wäre wohl nur wenig Diebesgesindel unterwegs, denn auch die saßen lieber im Trockenen und dachten wohl, dass bei dem Wetter kein Hund die Pfote vor die Hütte setzte, und dass schon gar keine Kaufleute unterwegs waren. Und – wenn Kaufleute im Morast der Straße steckenblieben, so würden es Diebe auch – ein Leichtes sich das auszurechnen! Die Fuhrknechte, drei stämmige Kerle mit Pferdepeitschen und Knüppeln bewaffnet, wollten trotzdem den zerbrochenen Wagen bewachen. Sie waren en Dörflern dankbar, wenn diese sich der Kaufleute, des unbeschadeten Wagens und der Tiere annahmen.
Die Dörfler halfen. Sie zogen den Wagen hinter die Dorfmauer, stellten die Ochsen in einem Stall unter, und sie nahmen sich der Fremden an. Es waren doch Konstanzer unter ihnen, da war Hilfe angebracht. Man brachte die Männer zum Schankwirt. Jemand lief auch schnell zum Haus des Dorfammans, um ihn zu wecken und zu benachrichtigen. Den Pfarrer ließ man weiterhin ruhig schlafen, der wurde jetzt nicht gebraucht. Beim Schankwirt bekamen die Konstanzer Brot und Käse aufgetischt, und in der Küche machte sich die Magd daran auf der restlichen Glut einen Topf übriggebliebener, dünner Biersuppe aufzuwärmen. Die Wirtin richtete inzwischen in der Nebenstube ein Gästebett. Sie breitete auch auf dem Boden neben dem Bett noch einige Matten aus und legte Schaffelle drauf. Die Konstanzer würden ein bisschen zusammenrücken müssen, aber sie konnten wenigstens im Trockenen schlafen. Noch redeten die Männer mit dem Dorfamman in der Schankstube. Der Amman bot Hilfe an. Er wollte dafür sorgen, dass gleich in der Früh der Wagner und dessen Knechte den beschädigten Wagen wieder flott bekamen.
Einer der Konstanzer hatte sich ans Ende der Bank gesetzt, damit er sein Bein ausstrecken konnte. Er hätte sich das Bein gestoßen, sagte er, als er dabei half den beschädigten Wagen aus dem Morast zu ziehen. Doch jetzt sah man, dass eines seiner Hosenbeine zerrissen und mit Blut getränkt war. Die Männer erschraken. Niemand hatte es bisher bemerkt, nicht einmal der Verwundete selbst. Auf die Frage, ob er denn keinen Schmerz verspürte, zuckte er nur mit den Schultern. Er hätte schon etwas gemerkt, aber es wäre nicht so schlimm gewesen. Das Bein tat eigentlich erst jetzt weh, darum wollte er es ein wenig ausstrecken. Die herbeigerufene Schankwirtin besah sich die Wunde und schüttelte den Kopf.
„Das soll die Heilerin machen“, beschloss sie, „ich schicke gleich unseren Hausknecht zum Egli.“
Einige Augenblicke später lief der Knecht durchs Dorf zu Eglis Haus, um Anna zu holen. Die Männer im Wirtshaus aßen derweil die Suppenschalen leer und äußerten ihre Hoffnung, dass die Beinwunde ihres Gefährten nicht allzu schlimm wäre. Der Wirt erklärte ihnen, dass die Heilerin Anna hieß und die Tochter des Egli wäre. Dann gingen die Männer schlafen, und der Verletzte blieb in der Schankstube alleine zurück.
Kurze Zeit später betrat Anna die Wirtsstube. Sie trug einen Korb mit Verbandszeug, Lappen und einem Salbtiegel darin. Die Wirtin brachte einen Krug mit Wasser und eine Schüssel. Anna sah den verletzten Mann auf der Bank sitzen. Er war nicht mehr jung, und er sah müde aus. Sein Gesicht verriet nun, dass er Schmerzen litt. Anna stellte ihren Korb auf den Tisch und grüßte. Der Mann erwiderte ihren Gruß. Er lächelte schwach. Es wäre ihm überhaupt nicht recht, sagte er, dass man sie seinetwegen aus dem Bett holte. Anna antwortete, dass sie das gewohnt wäre. Dabei machte sie sich bereits an seinem Bein zu schaffen. Das Hosenbein musste herunter, erklärte Anna, nur so könnte sie sich einen Überblick verschaffen. Der Mann zögerte einen Augenblick, dann griff er unter seinen Rock und löste die Nesteln des Hosenbeins von seiner Bruch. Er trug einen wadenlangen Leinenrock, hatte eine Gugelkapuze über die Schultern gestreift und hüllte sich in einen Umhang. Er schien zu frieren. Seine Kleider waren immer noch feucht vom Gewitterregen. Anna half ihm das Hosenbein behutsam abzustreifen. Der Unterschenkel des Mannes war voll mit Blut, die Wunde klaffte an einer Stelle tief, dann lief sie in einer Schramme aus. Anna machte sich an die Arbeit. Sie wusch die Wunde vorsichtig aus, dann strich sie etwas Salbe um die Wundränder. Mit geübten Griffen legte sie einen Verband an, der das Bein fest umschloss, damit die Wundränder schnell zusammenwuchsen. Danach packte sie ihre Sachen mitsamt den blutigen Lappen wieder in ihren Korb und sah sich in der Schankstube um. Sie schüttelte den Kopf.
„Hier könnt Ihr nicht bleiben“, sagte sie, „auf der harten Bank könnt Ihr nicht schlafen und in der Nebenstube sind schon Eure Begleiter. Außerdem braucht ihr einen oder zwei Tage Ruhe, und der Verband muss regelmäßig gewechselt werden…“
Sie schien zu überlegen. Dann sagte sie:
„Es wird am besten sein, wenn wir Euch ins Beginenhaus bringen. Sie haben dort eine Krankenstube. Dort wird man sich um Euch kümmern, und eine der Schwestern wacht immer des nachts.“
Der Mann seufzte. Die Aussicht auf ein Nachtlager auf der harten Bank und dazu noch mit Schmerzen, behagte ihm gar nicht. Aber wie sollte er in das Haus der Beginen kommen? Es lag neben der Kirche, und das Haus des Schankwirts war für sein wundes Bein viel zu weit entfernt. Wenigstens hatte der Regen nachgelassen, das Sommergewitter hatte sich ausgetobt.
Anna hatte eine Idee. Und so ratterte eine gute Weile später ein Karren durch die Gassen von Tägerwilen, gezogen vom Schankwirt und dessen Hausknecht. Es sollte ihr Schaden nicht sein, hatte ihnen der Verletzte versichert. Anna ging neben dem Karren, ihren Korb auf dem Arm. Sie war es, die der wachhabenden Begine die Lage erklärte, die dem Mann half vom Karren herunter zu steigen und in den Hof des Beginenhauses zu gehen. Sie stützte ihn zusammen mit dem Schankknecht. In der Diele des Beginenhauses brannte eine Öllampe in einem Wandhalter. Die Begine öffnete eine Tür. Aus dem Raum drang ebenfalls er schwache Lichtschein einer Öllampe. Die Begine ließ den Verwundeten in den erleuchteten Raum bringen, in die Krankenstube. Drei schmale Bettgestelle standen dort, ein jedes mit einem gurtenbespannten Rahmen, auf dem ein Laubsack und ein Kopfkissen lagen, darüber ein frischgewaschenes Laken und eine Bettdecke. Die Frauen betteten den Verwundeten auf eines der Krankenlager und schickten den Wirtsknecht nach Hause. Der fremde verwundete Mann war dankbar seinen Umhang, die Kapuze und den Rock ausziehen zu können und sich nur im Hemd ins Bett zu legen. Die Begine versprach, am folgenden Tag nach seinen Kleidern zu sehen. Anna verabschiedete sich nun und wünschte eine gute und baldige Genesung.
Zwei oder drei Tage vergingen. Das Wetter war wieder warm geworden und die vom Gewitterregen aufgeweichten Straße trocknete in der Sonne. Die Konstanzer Eisenhändler hatten den Schaden an ihrem Wagen behoben, alle Schulden beglichen, und machten sich auf den Heimweg. Für den Verletzten wurde auf einem der Wagen Platz geschaffen, sein Sitz mit Schaffellen weich ausgelegt. Die Ochsen zogen an, einige Dörfler winkten den Konstanzern zur guten Fahrt.
Die Heilerin Anna Eglin hatte nicht zum Abschied kommen können. Sie war zu einer Geburt gerufen worden. Doch eine der Beginen war anwesend, und sah zu, dass der Verwundete einen bequemen Platz auf dem Wagen erhielt. Der Verwundete hieß Ulrich Richental, und war Kaufmann und Notar in Konstanz.
Noch bevor der Wagen losfuhr, bat Ulrich die Begine der Heilerin seine Grüße auszurichten und ihr eine kleine Entgeltung zu übergeben. Er hatte aus seiner Geldkatze einige Münzen heraus genommen und legte der Schwester einen Betrag für Anna und einen Betrag für das Beginenhaus in die Hand. Er hätte sich gern noch mehr erkenntlich gezeigt, sagte er, deshalb wollte er, sobald er wieder gesundet wäre und sein Weg ihn wieder an Tägerwilen vorbei führte, einen Besuch abstatten. Die Begine lächelte zum Dank und versicherte, dass Herr Ulrich bei ihnen allen jederzeit willkommen wäre.
Als Ulrich später in seinem gepolsterten Sitz auf dem Eisenwagen über die Straße nach Konstanz ruckelte, dachte er über die Worte der Begine nach. Er wäre bei ihnen allen jederzeit willkommen. Dazu noch das Lächeln der Schwester. Wollte sie etwa damit andeuten, dass Ulrich auch bei der Heilerin willkommen wäre? Oder hatte sie ganz allgemein von den Tägerwilern gesprochen? Ulrich hätte die Begine sehr gerne nach der Familie der Heilerin ausgefragt, doch bis zuletzt hatte er es nicht getan. Warum eigentlich nicht? Er war doch kein schüchterner Domschüler, der sich nicht zu fragen traute, er war ein bestandener Mann, ein Notar mit Ansehen und Besitz, er war Bürger der Stadt Konstanz und Sohn des ehemaligen Stadtschreibers. Er war viel in der Welt herumgekommen und kannte einige sehr hochstehende, einflussreiche Leute. Warum traute er sich dann nicht zu fragen, ob die Heilerin von Tägerwilen einen Gatten und Familie hatte? Es interessierte ihn sehr. Er dachte umso mehr darüber nach, je näher sie Konstanz kamen. Als man ihn beim Haus des Eisenhändlers vom Wagen half, hatte er bereits eine Idee. Allerdings musste er warten, bis sein Bein wieder ganz hergestellt war und er wieder reiten konnte.
Der Eisenhändler war ein Verwandter von Ulrich Richental. Die Verwandtschaft war über den Großvater Jürg Richental, den früheren Schmied und Eisenhändler, zustande gekommen. Man führte Ulrich deshalb hilfsbereit ins Haus, brachte ihm Essen und einen Krug Bier zur Erfrischung und schickte nach seinem Haus. Ulrichs Hausknecht sollte seinen Herrn am Abend, wenn es schon dunkel geworden war, mit einem Eselskarren abholen. Ulrich war es peinlich, sich am helllichten Tag auf einem Karren durch die Gassen fahren zu lassen. Er wollte Aufsehen vermeiden. Es war nie gut, wenn zu viele Leute wussten, dass man verletzt oder geschwächt war. Am nächsten Tag ließ er den Arzt rufen, der sich im Pfarrbezirk von St. Stephan um die Kranken und Verletzten kümmerte. Der Arzt besah sich Ulrichs Bein, nickte und versicherte, dass alles auf dem Weg der Heilung war. Er versorgte die Wunde mit einer Salbe, verband das Bein neu, und empfahl Ulrich sich in den folgenden Tagen ein wenig zu schonen.
Zeit verging. Ulrich Richentals Bein heilte vollständig, nur eine schmale, kaum sichtbare Narbe blieb zurück. Man sah den Notar Richental wieder kräftig ausschreiten, seinen Geschäften und Angelegenheiten nachgehend. Ein aufmerksamer Beobachter hätte vielleicht bemerkt, dass der Notar Richental manchmal ein bisschen geistesabwesend wirkte, dass einige Male ein sehnsuchtsvoller Ausdruck auf seinem Gesicht erschien und er dabei sogar leise seufzte. Allerdings – so genau achtete niemand auf das Mienenspiel des Notars Richental.
Eines Tages im Spätsommer ritt Ulrich aus dem Kreuzlinger Stadttor hinaus und wandte sich auf der offenen Straße in Richtung Tägerwilen. Hinter sich hatte er auf sein Pferd einen großen Ballen und eine kleinere Holzkiste geschnallt. Das Pferd war robust und behäbig. Es trug Reiter und Gepäck in gleichmütigem Trott. Ulrich hatte sich einen sonnigen Tag für