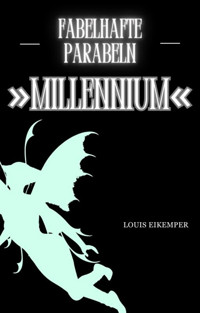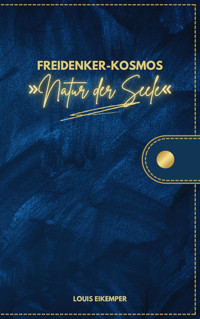
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die vierte Ausgabe von Louis Eikempers Freidenker-Kosmos erscheint unter dem Namen »Natur der Seele.« Der Autor lädt seine Leser/innen in den 13 Kapiteln dieser Bindung dazu ein sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen, indem er seine Gedanken mit philosophischem Tiefgang kleidet, in erzählerische Rollen schlüpft oder auch über Fabeln, Parabeln und Gleichnisse auf stets empathische, humorvolle und poetische Art und Weise dazu besinnt das Glück in sich selbst zu finden und dem Geschenk des Lebens mit Dankbarkeit und Liebe zu begegnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Freidenker-Kosmos
»Natur der Seele«
Impressum
Louis Eikemper
Freidenker-Kosmos
»Natur der Seele«
1st edition 2024
© Louis Eikemper
All rights reserved, in particular that of public performance, transmission by radio and television and translation, including individual parts. No part of this work may be reproduced in any form (by photography, microfilm or other processes) or processed, duplicated or distributed using electronic systems without the written permission of the copyright holder. Despite careful editing, all information in this work is provided without guarantee. Any liability on the part of the author and the publisher is excluded.
Font set from Minion Pro, Lato and Merriweather.
Im bleiben und werden
Piero entdeckte in der allmählich verglimmenden Asche der Feuerstelle ein Stück noch glühender Buchenholzkohle. Es kämpfte um die letzten Energien, welche sich aus dem Minimum ergaben, dass vom Holz übrig geblieben war. Sein Vater hatte ihm gesagt, dass er auf keinen Fall mit dem Feuer spielen solle, ehe er nicht zurück von der Jagd wäre - doch was würde alle Beute, die er gefangen hätte bringen, wenn kein Feuer mehr loderte, um sie zubereiten zu können? Als der letzte noch glimmende Scheit drohte im Dampf zu erlöschen, prüfte er seine Umgebung mit Argus-Augen, dass sein Vater ihn nicht ertappen würde, wie er sich trotz des Verbotes an der Kraft des Feuers bediente. Heimlich schlich er zum zurechtgehackten Stapel Brennholz, versah die Feuerstelle mit neuem Material und entzündete einen der Scheite, sodass die Flamme wieder erwachte. Eine Feuerzunge schlüpfte zwischen das Holz und wuchs durch die trockenen Strünke an, welche darüber aufgehäuft waren. Immer weiter begann sie sich zu recken, verjagte die Luft, die zwischen den Hölzern lag und spielte mit allem, was sich über und unter ihr befand, in immer weiter greifendem Wachstum ihrer selbst. Das Feuer begann seine Zunge über das Holz hinaus auszustrecken - neue Mündungen suchend, nach denen es Boten von rötlichen Funken sprühte. Er beobachtete das Schauspiel in gebannter Bewunderung, als er bemerkte wie die Schatten, die sich in dem Szenario um die Feuerstelle rankten, länger und flüchtiger wurden, darüber die Flammen weiter anwuchsen und immer ausgelassener mit der umgebenden Luft flanierten - bevor sie begannen in sanft süßen Knister-lauten für ihn zu singen. Piero erschrak, als das Feuer, dass sich jetzt dem Holz entwachsen sah, plötzlich anfing seinen Sinn zu ändern. Aus der Milde und Ruhe, dass es zuvor noch spendete, ergab sich nun ein aufgeblasenes Unheil, dass im Schnauben die Stelle mit Knallen und Flackern erfüllte. Es richtete seine große Flamme in die Höhe, verging in einem Flug der Überheblichkeit und - endete an dem schwarzen Boden des Kessels, den sein Vater, der soeben von der Jagd zurückgekehrt war, über der Stelle platzierte. »Mit Feuer spielt man nicht«, sprach er. »Es wurde uns Menschen geschenkt, um daraus Fortschritt zu ziehen. Das können wir nur, wenn wir verstehen seine Kräfte zu kontrollieren. Es ist wichtig die Dinge zu bewundern, bevor man es lernt ihr Naturell zu kontrollieren - doch wer unachtsam ist, wird nicht selten Opfer davon, dass er das Wesen seiner Bewunderung ausufern lässt, ohne es vorher im Kern verstanden zu haben.« Der Vater wuschelte durch Pieros Haare und bereitete parallel zu seinem Tadel zwei Bärsche zu, welche er am Ufer des Flusses Ticino gefangen hatte. »Das Feuer wäre erloschen, hätte ich kein Holz nachgelegt. Ich meinte es nur gut«, sprach Piero in einem leichten Anflug von Missmut und rümpfte die Nase, ehe sein Vater entgegnete: »Um die Güte deines Willens bin ich sicher, mein Sohn. Sei du es dir auch, wenn ich dir Rat aus meinen Erfahrungen gebe. Wenn man Mächte wie das Feuer nicht kontrolliert, dann findet man nichts als Zerstörung durch sie. Erst in ihrem Verständnis, kann man aus ihnen Nutzen ziehen, so wie wir nun. Die Hitze, die das Feuer dem Kessel bereitet, wird die Basis für das Wohl-bekommen unseres Mahls werden. Und so lassen wir das Feuer im Zauber, der für uns Menschen hier auf Erden heimisch ist, über einen kontrollierten Rahmen seinen Lauf nehmen. Es darf bleiben wie es ist und wächst dabei zu dem heran, was es innerhalb seiner gegebenen Stelle werden will...«
Nathans Glück
Auf seinen Pfaden hatte Nathan bald 30 Meilen zurückgelegt, als ihn die Plagen seines leeren Magens einholten - dicht verfolgt vom ungestillten Durst. Sehnsüchtig träumte er, wie er sich an einer warmen Mahlzeit labte und die wahrhaft qualvollste Durststrecke seiner bisherigen Lebtage mit einer eiskalt temperierten Karaffe glasklaren Tafelwassers beendete - ehe er im Anflug unendlich währender Erleichterung die unverwechselbaren Silhouetten der sagenumwobenen Mauern und Türme von Amorem erblickte. Ihre allseits bekannten, charakteristischen Diorit-Prägungen erschienen in der mystischen Anmut des Mondscheinlichts noch um ein Vielfaches pittoresker, als seine kühnsten Träume es je hätten ersinnen können. In nimmersatter Vorfreude, die ihm sein überschwänglich laut knurrender Magen verwirkte, schaffte er es die letzten Kräfte zu bündeln, um mit leuchtenden Augen zum großen Stadttor zu sprinten - Jubel jauchzend, als wäre er gerade Vater geworden. Endlich an der Pforte angelangt, sollte aller Eifer jedoch ebenso schnell wieder verfliegen, wie er aufgekommen war. Zu Nathans Enttäuschung überkreuzten die beiden Stadtwachen ihre Speere und verweigerten den erhofften Eintritt. »Ihr seid zu spät. In Amorem herrscht längst die Nachtruhe. Auf königlichen Erlass wird danach keinem Gast mehr Einlass gewährt«, brummte einer der beiden durch seinen Helm. Nathan sprach entgeistert: »Nun lasst uns menschlich bleiben, gute Herren! Ich bin weit gereist. Mir knurrt der Magen und meine Kehle ist bald so trocken, wie der Wüstengrund. Jedem von euch biete ich einen Sack Dukaten, wenn ihr hinter euren Helmen ein Auge für mich zudrückt!« Er kramte zwei Beutel voller Münzen aus seiner Manteltasche und präsentierte sie den Wachen. Die beiden blickten sich an und nickten einander zu, ehe der Kräftigere der beiden auf Nathan zuschritt und ihm einen Tritt versetzte, welcher ihn einige Meter nach hinten fallen ließ. »Für heute ist Nachtruhe! Versucht Euer Glück bei Tagesanbruch wieder und lasst Euch das eine letzte Warnung gewesen sein!«, bellte der Wachmann erbost. Es dauerte eine Weile, in der Nathan sich in dem Schmerz krümmte, den ihn der eiserne Tritt des Wächters spüren ließ. Als er es wieder auf die Beine schaffte, keuchte er: »So soll es sein. Was Gott mir schickt, das wird zu meinem Besten dienen.« Schnaufend schleppte er sich in den einige hunderte Meter westlich gelegenen Nibelungenwald, wo er unter einer großen Zeder zusammensackte und ohne weiteres Schäfchen zählen in den Tiefschlaf verfiel. Als Nathan in den Morgenstunden vom Schall sich kreuzender Schwerter, verzweifelter Hilferufe und dem Gewieher angsterfüllter Pferde erwachte, rieb er sich den Schlaf zweimal aus den Augen. Dichter Rauch zog aus dem Inneren von Amorem auf. Die Stadt stand in Flammen. Eine Truppe skrupelloser Söldner hatte die Festung über Nacht eingenommen und jeden, der sich widersetzt hatte, erbarmungslos gemeuchelt. Nathan wurde zum Speien übel und er hätte sich wohl übergeben, wenn sein Magen nicht leer gewesen wäre. Sofort packte er zusammen, was er mit sich führte und begab sich auf eine alternative Route, abseits von Amorem, um seine Reise fortzusetzen. Selten war er so froh gewesen, dass noch ein langer Weg vor ihm lag. In Entsendung tiefster Dankbarkeit hob er den Blick gen Himmel, legte eine Hand aufs Herz und dachte in ehrfürchtiger Stille: »Gott sei Dank, dass mir der Zutritt zu Amorem verwehrt blieb. Manchmal erkennt man das Glück erst am hellen Morgen, wenn das Unglück der dunklen Nacht vorüber ist.«
Der Glücksschmied: Natur der Seele
»Bei allem Respekt, Meister! Habt Ihr in Eurem Werk nun eine Frau oder einen Mann abgebildet? Wenn ich mir das Gemälde von der linken Seite anschaue, blickt mich eine Dame an. Wandern meine Augen hingegen von rechts darauf, wirkt es fast so, als wäre es ein Herr.« Ein Momentum war vergangen, seitdem Romolus seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht hatte. Ihm stand die Charmesröte ins Gesicht gepinselt, einprägsam unterstrichen von dunkelbläulich zerfurchten Ringen, die sich unter seinen Augen abzeichneten. In der Glücksschmiede fand sich tiefgreifendes Unbehagen wieder und es schien, als fiele den anwesenden Schülern die Atmung schwerer. Kaum etwas zog sich so unangenehm in die Länge, wie das bedachte Schweigen des Meisters, welches immer dann aufkam, wenn man seine Werke hinterfragte. Beinahe wäre in Romolus Gemüt auch der letzten Funken Contenance erloschen, da räusperte der Glücksschmied sich so plötzlich, dass jeder im Raum erschrocken zusammenzuckte.
»Es ist all das, was du darin erkennst« sprach er und hob den Blick, während er in den Moment zurückkehrte. Seine Lippen deuteten ein Lächeln an und es wirkte, als würde das rechte seiner graugrünen Augen lachen; das linke wiederum schien in Romolus Gedanken zu lesen und versetzte ihm das Gefühl, bis auf den Grund der Seele geschaut zu bekommen. »Was du in dieser Welt erkennst, musst du zwangsläufig zuerst in dir selbst verstanden haben. Vergleiche mein Werk also mit einem Spiegel, in den du blickst. Was du darin siehst, ist das, was du in dir trägst. Die Wertung geht stets vom Betrachter aus.« Romolus nickte und petzte sich nervös ins Handgelenk, ehe er hervorstieß: »Wie man Euch kennt, werdet Ihr sicher einen tieferen Gedanken verfolgt haben, als Ihr diese Erscheinung berufen habt. So teilt ihn mit uns, wenngleich unser Verständnis stets von unserer Perspektive abhängt.« Der Meister entgegnete: »Über die Jahre habe ich gelernt, dass es klüger ist niemandem die vollkommene Tiefe der eigenen Gedanken zu offenbaren.« In seelenruhiger Gelassenheit deutete er auf das Gemälde. »Deine Betrachtung, die meinem Werk gleich zwei Gestalten zu entnehmen vermag, ist einem meiner wesentlichen Gedanken jedoch von gar nicht allzu fremder Natur. Der Effekt dahinter rührt aus dem Zusammenspiel von Licht und Schatten.« Romolus staunte in gebannter Bewunderung, während der Meister fortfuhr. »Wende deinen Blick von der Erscheinung im Bild ab und dechiffriere die Atmosphäre, welche sie umgibt. Du wirst erkennen, dass dort wo sie steht, wohl gerade Dämmerung vorherrscht; oder ein trüber Tag, an dem sich die Sonne hinter den Wolken verbirgt. Zu dieser Zeit hebt sich die Zärte der Gesichter von Mann und Frau ganz besonders hervor. Ein Maler mit verständnisvollem Blick auf die Dinge dieser Welt meistert es, die Schattenverhältnisse naturgemäß wiederzugeben und sich gemächlich im Licht verlieren zu lassen, sodass sie rauchartig verschwinden und verklingen - wie die Töne einer leise gespielten Musiksinfonie. Merke dir, Romolus: zwischen Licht und Schatten gibt es noch eine Mitte, etwas Zwiespältiges, was beiden eigen ist - gleichsam lichter Schatten und dunkles Licht.« Der Glücksschmied legte die rechte über seine linke Hand - so wie immer, wenn es bei Themen der Malerei philosophischer wurde. Schließlich sprach er: »Es ist das Dazwischenliegende, mein Schüler. Genau dort finden wir das Geheimnis der vollkommenen Schönheit, welche uns die Natur der Seele wiedergibt.«
Dem Feind sei gedankt
Auf seiner Reise durch das Hieronymus-Gebirge war Arthur bereits einige Tage und einige Nächte gewandert, als seine Muskeln übersäuerten und ihm die Knochen ermüdeten. Die Wonne der Sonne brütete bei bald 40 Grad Celsius und wirkte hoch oben in den Bergen noch um ein Vielfaches intensiver, da ihre Strahlen in all den Felsen reichlich Speicher fanden und ihm das Gefühl gaben, wie ein Braten im Ofen zu schmoren, während er seine Pfade beschritt. Als er schweißgebadet und vom Sonnenbrand geplagt einen prächtig gewachsenen, Schatten spendenden Feigenbaum entdeckte, ließ Arthur sich zum ersten Mal auf seiner Reise zur Rast nieder. Erschöpft nahm er einige große Schlücke aus seiner Wasserflasche und goss sich einige weitere daraus über, ehe er keuchte, sich hinlegte und den Strohhut über das Gesicht zog, um im Schatten des Feigenbaumes zur Regeneration einen Schlaf zu nehmen.
Es waren schon anderthalb Tage vergangen, die er schlief, als ihn eine der gefährlichen Hornotter Schlangen, die im Gebirge heimisch waren, auf ihrem Weg durch die Gräser entdeckte. Hinterlistig schlich sie sich an, musterte Arthur von Kopf bis Fuß und zischte mit lüsterner, gespaltener Zunge: »Im Namen der Medusa - das nenne ich einen Feiertagsschmaus! An diesem Wesen werde ich sicher eine lange Weile und satt verdauen können. Seinen Hals hat der schlafende Tölpel unbedeckt gelassen. Diese Schwachstelle sieht wahrlich zum Anbeißen aus.«
So kam es, dass die Hornotter ihm in den Hals biss und eine tödliche Dosis ihres Nervengifts verwirkte. Arthur schreckte im Schmerzensschrei aus seinem Tiefschlaf hoch, richtete sich auf und erblickte die gehässig grinsende Schlange, die seine Reaktion aufmerksam beobachtete. Als sie in seinen Augen erkannte, dass er weder sie noch den Tod fürchtete, wollte sie sich schon wieder auf und davon winden, doch Arthur sprach: »Bleib bei mir, schöne Hornotter! Mein Dank gilt dir. Du hast mich zur rechten Zeit aus dem Tiefschlaf geweckt. Der Weg, den ich beschreite, ist noch weit und danach habe ich genug Zeit, um zu ruhen.« Die Schlange entgegnete boshaft zischend: »Ich denke nicht, dass dein Weg noch allzu weit wird. Mein Gift ist tödlich!« Arthur lächelte selbstbewusst und bündelte alle Selbstbeherrschung, um gegen die Schmerzen, die ihn des Schlangenbisses toxische Wirkungen erfahren ließen, anzukämpfen. »Starb ein Mann meiner Güte, groß und stark wie ein Drache, denn jemals am Biss einer Schlange? Nimm dein Gift zurück, schöne Hornotter. Du bist nicht reich genug, um es mir zu vermachen und ich bin dir schon dankbar dafür, dass du mich auf meiner Reise geweckt hast. Teile dir dein Gift gut ein!« Im Deut von einer sanften Geste präsentierte Arthur der Schlange das sich allmählich entzündende Ödem, welches sich aus der Bisswunde ergeben hatte. Ohne weiteres Zögern fiel ihm die Hornotter erneut um den Hals und leckte die Stelle sauber, bevor sie ihren Weg durch die Gräser fortsetzte.
Diese Geschichte verfechtet den Gedanken, dass die beste Antwort, die man auf feindselige Absicht geben kann, das Bewahren der eigenen Contenance ist, - sowie das Beweisen, dass der boshaft gesinnte Feind einem mit seiner Tat im Grunde etwas Gutes vermachte.
Der Unterschied
Im indischen Bundesstaat Odisha war eine Gruppe ignoranter Männer in den Laubwäldern der bedeutsamen Stadt Bhubaneswar auf der Jagd - nicht etwa, um neue Erkenntnisse zu dem Ursprung der vielen Tempel zu erringen - sondern um die seltenen, weißen Bengal Tiger zu schießen, denen der Schwarzmarkt hohe Kurse entgalt. Ein von Schüssen verfolgter Bengal hatte sich auf der Flucht ins Dickicht gerettet und rang um Luft zum Atem schöpfen, als er in den Zweigen, die über seinem massiven Kopf wucherten, ein schelmisches Kichern vernahm. »Hihihi! Wusst ich's doch. Ihr fetten Katzen nehmt mit euren mächtigen Tatzen und dem lauten Gebrüll ein Ende des Schreckens. Alle Anmut, die man euch zuspricht, halte ich für schieren Irrtum. Es fehlt die Fähigkeit sich an gegebene Verhältnisse anzupassen. Sieh nur, wie kleinlaut du starker Kerl bist - jetzt, da dein Ende naht!« Der Tiger versuchte den Schadenfrohen ausfindig zu machen - doch da war niemand. Einzig Laub und Zweige befanden sich über ihm, schwankend im tropischen Wind. Gerade wollte er aufbrechen, als die Stimme fortfuhr. »Während sich der Dschungel gegen dich wendet, habe ich es gemeistert von der Natur zu lernen. Anpassung verwirkt Wohlfahrt!« Der Königstiger schüttelte sich, ehe er sprach: »Und wer bist du?« Die Stimme kicherte: »Ich bin das Chamäleon aus dem Hause der Reptilien! In der Anpassung überliste ich nicht nur meine Feinde, sondern auch alles was ich jage.« Endlich entdeckte der Tiger das Wesen. Es kletterte schwerfällig die Äste entlang und hatte dabei die Farbe grünen Laubes getarnt. Mit tückisch hervorschnellender Zunge erhaschte es kleine Insekten, auf die es stets lauerte.