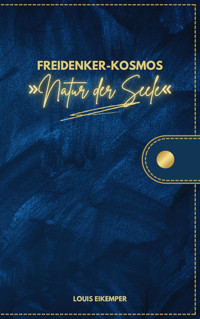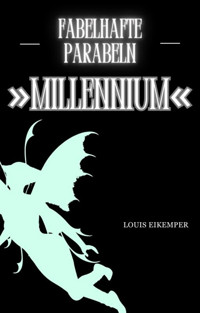
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mit »Millennium« erwarten uns Fabeln, die Parabeln gleichen - und umgekehrt. Und das Ganze in der zweiten Ausgabe von Louis Eikempers epischer Bücherserie des weltliterarischen Lesevergnügens: Fabelhafte Parabeln. In den insgesamt neun Kapiteln der zweiten Bindung verschmelzt der Autor aus Frankfurt am Main auf schier magische Art und Weise Fabeln, Parabeln sowie Gleichnisse zu einer gemeinsamen, einzigartigen Ebene; und beweist dabei neben Facettenreichtum auch jede Menge Empathie und Feingefühl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Fabelhafte Parabeln
Millennium
Impressum
Louis Eikemper
Fabelhafte Parabeln
Millennium
1st edition 2025
© Louis Eikemper
All rights reserved, in particular that of public performance, transmission by radio and television and translation, including individual parts. No part of this work may be reproduced in any form (by photography, microfilm or other processes) or processed, duplicated or distributed using electronic systems without the written permission of the copyright holder. Despite careful editing, all information in this work is provided without guarantee. Any liability on the part of the author and the publisher is excluded.
Font set from Minion Pro, Lato and Merriweather.
Inhaltsverzeichnis
Die Lebensprüfung
Der geerntete Dank
Das dunkle Licht
Iram Uva
Gesunde Grenzen
Millennium
Der Feuerdorn
Der Froschkönig
Die Begegnung mit sich selbst
Bei Nacht
Die Lebensprüfung
Der von der Stadt Fatum für den Naturschutz berufene Isaac Aesopus hatte über die Jahre einige Hektar Land zu einer prächtig und wild bewucherten Blumenwiese gedeihen lassen. Im Umkreis mehrerer hunderter Kilometer diente sie Insekten verschiedenster Gattungen als hoch und heilig beschworene Luxus-Residenz, in der sie mitsamt Familie und Freunden immerzu willkommen geheißen wurden, um sich ein Heim werden zu lassen. So krochen, liefen, sprangen und flogen die Tiere auf dem reichhaltig bewachsenen Grund des Naturschutzbeauftragten umher - im vollen Genuss eines Lebens, welches sie wohl nirgendwo sonst harmonischer hätten vorfinden können, als in diesem Paradies auf Erden.
Bald schon hatten sich die Bewohner der Wiese zu einer Gesellschaft kultiviert, die aufeinander abgestimmt florierte und füreinander wirkte. Nur ein Wesen unter ihnen lebte einsam, einzig und für sich: eine große, grüne Raupe. Ihre Bewegungen waren weit schwerfälliger, als die der anderen Tiere und im Gegensatz zu den ringsherum singenden und summenden Insekten, war sie obendrein auch noch stumm. Aufgrund ihres andersartigen Wesens galt sie in der Residenz als unmittelbare Außenseiterin und fand sich stets alleine wieder, wenn sie auf den Pflanzenblättern ihre Runden drehte. Trotz allem fühlte die Raupe keinen Unmut. Im tiefsten Inneren wusste sie, dass die Natur ihrer Wesenheit alle Einsamkeit im Schicksal vorbestimmt hatte und ihr Dasein einem höheren Zweck diente. Als Raupe war es ihr zur Lebensaufgabe vermacht worden, dass sie die wunderliche Kunst vom Weben seidigen Schaums in absoluter Perfektion meisterte. Dies war der einzige Weg für sie, eine eigene Behausung zu erlangen - und dem tristen Leben als Außenseiterin zu entwachsen, um von der Welt mit symbolischer Bedeutung versehen und als wunderschönes Flügelwesen, in majestätischer Anmut, wiedergeboren zu werden.
So machte sich die Raupe diszipliniert, eifrig und von höchstem Fleiß geprägt an ihr Lebenswerk. Sie schuftete unermüdlich; tagein, tagaus - im ständigen Bestreben den Sinn ihrer Existenz zu erfüllen und ein Leben nach dem diesseitigen zu verdienen. Eine bedeutsame Weile schien vergangen, als sie sich endlich in ihrem kunstvoll gewebten, lauwarmen Kokon aus feinster Seide eingeschlossen hatte und nunmehr ganz und gar abgetrennt von der übrigen Welt war. Darin sollten für sie viele Stunden gezählt werden und in einigen Tagen münden, ehe sie im Klang der Stille zweifelnd stimmte: »Wie wird es nun um mich geschehen? Hoffentlich habe ich auch alles richtig gemacht, sodass mir die Verwandlung in ein neues Leben, als Wesen von anbetungswürdiger Natur, gewährt wird!« Weitere Weilen des Wartens hatten zu verstreichen, bevor alle Geduld sich bezahlt machen sollte. Eines schönen Sommermorgens war es schließlich so weit. Mit den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne fuhr ihr ein sanfter Strom der Wärme geistig inne und sprach: »Du hast deine Lebensprüfung bestanden. Liebe sei mit dir!«
Die Raupe entschlüpfte ihrem Kokon und trat als wiedergeborener Schmetterling mit zwei herrlichen Flügeln hervor, die in den lebhaftesten Farben geschmückt waren. Von göttlichem Ansehen geehrt, erhob sich ihre Gestalt sogleich fort in die verdiente Freiheit der ihr nun ergebenen Lüfte; weiter, höher und höher, immer mehr und mehr himmelwärts.
Der geerntete Dank
So spürbar nah und doch so weiter Ferne strahlte sie aus sich heraus - hoch oben, am wolkenfreien Himmelszelt, dass sich den Feldern von Amorem ergab. Die Sonne war am Höhepunkt ihrer zur Routine getakteten, täglichen Dienste angelangt und schien voller Wonne hinab Richtung Erde - im stetigen Spenden der sich dank ihr ergebenden, Wege weisenden Lichtblicke für alle dort heimischen Wesen, die sich an diesem, wie jenem Fleck des Planeten, im Angesicht ihrer Antlitze bewährten. Vorbei waren die erbetenen Tage der reifen Zeit, sodass die von reichlich Fleiß und Geduld beseelten, ortsansässigen Wirte, alles was sie den Feldern Amorems bereit gewesen waren zu säen, in hohen Erträgen abernteten - und sich die Felder in kahles Ackerland verwandeln sollten. Dort, im tristen Nichts, erwartete das letzte verbliebene Weizenkorn der Reifezeit - als einziges seiner Art ungeerntet zurückgelassen - bereits sehnsüchtig den Regen, um in die bergenden Ebenen der Erde zurückzukehren. So kam es, dass die Fügungen dem Korn die Bekanntschaft einer Ameise erschlossen, die es sich auflud, um es entlang des Weges zur Heimat ihres Stammes zu schleppen. Einige Meilen ging sie bereits, als das Weizenkorn zunehmend schwerer auf ihre ermüdenden Schultern einwirkte. »Halt inne - wieso lässt du mich nicht liegen? Das wird dir den Weg nach Hause erleichtern, du fleißiges Wesen«, sprach das Korn. Die Ameise entgegnete tapfer: »Das kann ich nicht verantworten, gutes Korn! Für meinen Stamm hängt das eine am anderen. Wenn ich dich hier liegen lasse, werden wir zum Anbruch des Winters möglicherweise zu wenig bevorratet haben. Als großes Volk mit Ambitionen wachsen wir beständig, sodass wir stets immer so viel bevorraten, wie wir in dieser Welt für uns vorfinden können.« Das Korn seufzte besorgt, als es erkannte, dass ihm nun ein Ende drohte, ohne der Erde sein ureigenes, von der Natur verliehenes Potenzial hingegeben zu haben - sodass es der Ameise einen Handel vorschlug. »Erkenne und verstehe, dass ich nicht einzig zum Verzehr geschaffen wurde, sondern gleichsam ein von der Natur mit mächtiger Entwicklungskraft versehener Samen voller Lebenssinn bin! Meine Bestimmung ist es, dass ich meinen Platz auf dieser Welt tief begründe, indem ich die in mir verankerten Keime zum Vorschein bringe und eigene Wurzeln wachsen lasse - um mich in eine prächtige Pflanze hoch zu entwickeln und einen Beitrag zur Vielfalt des Ganzen hinzugeben. Und das ist noch nicht alles! So höre mir gut zu, denn ich habe dir und deinem Stamm einen lukrativen Vertrag anzubieten, der sich daraus ergibt.« Die Ameise war zur Rast nicht abgeneigt und legte das Weizenkorn nieder. »Nun, gut. Was für ein Vertrag soll das denn sein?« Das Korn sprach: »Wenn du mich hier ein Heim begründen lässt, sodass ich meine Natur vertiefen kann, werde ich dir und deinem Stamm in einem Jahr das Hundertfache von dem, was mein Wesen jetzt für dich bereithält, erweisen können.« Die Ameise starrte im Zweifel und stutzte ungläubig, bis das Korn ergänzte: »Vertrau dem Geheimnis des Lebens, welches meiner Natur innewohnt, liebe Ameise. Ich werde dir in diesem Jahr einen Schatz bereiten, wenn du einwilligst. Hebe mir eine kleine Grube aus und belasse mich in den Ebenen der Erde, wo ich meinen Lebenssinn erfülle. Du wirst, so wahr ich hier bin, nicht enttäuscht!«
Ein Jahr später kehrte die Ameise schließlich in die Felder Amorems zurück, um den Vertrag einzufordern - und sie sollte vollends zufrieden gestellt werden. Für ihren Stamm fand sich ein blühendes Feld voller Vorräte wieder, denn das Weizenkorn hatte sein Versprechen gehalten.
Das dunkle Licht
In den letzten Momenten eines von malerischer Schönheit beseelten, späten Abends, sahen die alles fügenden Launen der Natur es vor ihren Betrachtern über die in den Böen der leisen Winde heimischen Aerosole eine Dämpfung des final einstrahlenden Sonnenlichts zu verwirken, um die bald schon einkehrende, dunkelblaue Tiefe einer neuen Nachtruhe zu begrüßen. Anders als die sonstigen Wassertropfen und Eiskristalle brachen sie die Sonnenstrahlen - und sollten somit zur Hauptverantwortlichkeit eines selten zu bewundernden Naturspektakels erklärt werden. Mit dem letzten Leuchten der untergehenden Sonne und einer tief hängenden Wolkendecke gepaart, ergab sich für sie an diesem Abend eine Kombination aus Rosa und Marineblau, welche das Himmelszelt in der mystischen Anmut einer Amethyst artigen Mixtur von Violett offenbarte.
In ebendiesem poetischen Ausdruck, den der seinen Dienst erledigt habende Tag dem Anbruch der Nacht über ebenjene Schwebe des späten Abends malerisch am Horizont zu deuten pflegte, fand sich ein von schier manischer Panik beseelter, umherstreifender Moskito wieder. Die Einkehr der allabendlichen Dunkelheit ließ ihn ängstlich hin und her flattern - erfüllter Furcht, dass er in der Absenz vom Tageslicht keinen ihn nährenden, heißblütigen Träger mehr erblicken würde, an dem sich seine nimmersatte Sucht nach Wärme in der Außenwelt festsaugen konnte. Als mit dem letzten Sonnenstrahl beinahe auch die Hoffnung des armen Moskitos gewichen wäre, erspähte er in der Ferne ein verheißungsvoll flackerndes Licht, dass ihm Nähe und der Dunkelheit trotzende, Wege weisende Erleuchtungen zur Bedeutung gab.
»Oh, du heller Schatten von dunklem Licht! Bist du meine Botin des Glücks und Rettung vor der finsteren Nacht?«, dachte der Moskito erleichterter Sinne und lenkte seine Flügel hin zum Licht, um es lebhafter Neugierde zu umkreisen und wie ein Wunder zu bestaunen. Anders als die sonstigen Träger heißen Blutes blieb die Flamme vom Wesen des Moskitos unbeeindruckt und ignorierte dessen Präsenz ganz und gar - so, als wäre er nicht einmal da. Unzufrieden damit, die Rolle des Bewunderers zu geben, setzte der Blutsauger sich in den Kopf mit dem dunklen Licht dasselbe Spiel zu treiben, wie mit den anderen Wesen von heißblütiger Natur, die er ansonsten heimsuchte. So lenkte sein Flug entgegen der sich in der Dunkelheit erhebenden Flamme, welche er oberhalb streifte. Augenblicklich wusste er nicht mehr, wie ihm geschah - und der Moskito fand sich, betäubter Gefühle bestürzt, vor den Füßen des dunklen Lichtes wieder. Im flüchtigen Flackern der geworfenen Schatten erkannte er, dass ihm ein Bein fehlte und seine Flügelspitzen angesengt worden waren.
»Um Himmels willen! Was ist bloß mit mir geschehen?«, rätselte der Moskito erschrocken in die dunklen Stunden der weilenden Nacht, ohne zunächst eine Erklärung für den ihm zuteilgewordenen Schaden zu erkennen. Er vermochte nicht auszudenken, dass ihm von einer solch leuchtenden Wesenheit wie dieser wunderschönen Flamme ein Übel geschähe; und deshalb sammelte er allen Mutes, dessen er in seiner Ungläubigkeit bewusst werden konnte, um sich über einen erneuten Flügelschlag zu erheben. So zog der Blutsauger eine prüfende Schleife um die wundersame Natur des in verheißungsvollem Hoffnungsschimmer strahlenden Lichtes - und sollte in ihrem Bann der eigenen Instinkte nicht mehr mächtig werden. Von der Magie der Flamme angezogen ließ sich der Moskito auf ihr nieder, ehe er schließlich verbrannt in das heiße Öl fiel, welches ihr Leben nährte. »Du verfluchter Trugschluss!« wetterte der Moskito entgeistert, sein Leben nun beendend. »Ich hätte doch wissen müssen, dass bei Nacht keine Sonne mehr scheint, auf dieser Welt. Das Licht des Schöpfers ist einzig für den Tag besinnt worden. Wer oder was auch immer dich berufen hat, wird dabei also sicher nicht über mein Wohlergehen nachgedacht haben. Die innere Unruhe führte mich zu dir, du trügerisches Licht von falscher Hoffnung - und elendes Verderben! Auf der Suche nach dem Glück fand ich in deiner übernatürlichen Anmut meinen Tod. Ich bereue mein törichtes Verlangen nach dem Leuchten vom Licht der Außenwelt, weil ich die Gefahren dahinter zu spät verstand.«
Als der Moskito in der Hitze des dunklen Lichts eins wurde, antwortete der Geist der Flamme im Echo seiner flüchtig flackernden Schattenwürfe, sich keiner Schuld bewusst: »Armer Moskito, so Ruhe in Frieden! Dein Trugschluss möge sich für all jene, die wie du auf der Suche nach dem Glück in der Außenwelt umherirren, als beispielhafte Botschaft finden - auf das man sich fortan des eigenen inneren Lichts, welches einem von allem vorhandenen zugeteilt wurde, in Erkenntnis ermächtige und es aus sich heraus scheinen lasse - um sich dem Glück das Licht der Welt zu erfahren nicht nur bei Tag bewusst zu sein - sondern die einem erwiesenen Lebenspfade auch bei Anbruch der dunklen Stunden aus eigener Kraft erleuchten zu können und dabei auf dem rechten Weg zu bleiben. Ich bin nicht die Sonne gewesen, welche du dir im Leichtsinn deiner Naivität erhofft hast. Und wer mich nicht mit Klugheit behandelt, der verbrennt sich!«
Iram Uva
Die Zeit war reif - und es wieder einmal so weit gewesen. Der blaue Planet hatte das Wege weisende, Licht bringende Gestirn der schöpferischen Natur ein weiteres Mal umrundet, sodass sich für die den Globus besiedelnden Menschenwesen der feierliche Anlass vom Jahresabschluss ergab - sowie das Anbrechen einer neuen Rechnung, welche sie dankbaren Herzens begleichen durften, im Antlitz ihrer Wärme schenkenden Gottheit.
Zur traditionsreichen Festivität ebenjenes Jahreswechsels lag es der auf Erden heimischen Gemeinde von Amorem, rund um ihren obersten Lehnsherrn Iram Uva, in kultivierter Routine üblich nach dessen Neujahresansprache die lieblichsten und saftigsten, prächtig und prall gewachsenen Trauben, welche zur Reifezeit von der städtischen Winzerei zerstampft und als Wein gekeltert worden waren, für die neue Saison zur allgemeinen Präsentation bereitzustellen. So kam es, dass sich in der Kredenze des feierlich beschmückten, lang läufigen Tafelgedecks von Iram Uva ein mächtiger Schluck vom gegorenen Nektar der Reben wiederfand - üppig eingeschenkt im großen Platingral des Lehnsherrn, wo er sich in seinen entrichteten Gedanken augenscheinlich innerhalb der letzten ihm zuteilgewordenen Momente gegenüber sah.
»Oh weh! Nun naht es also, das Ende. Nachdem ich meiner geliebten Heimat hoch oben, auf den großen Hügeln über den weiten Feldern Amorems, so unsagbar unsanft entrissen, von den dreckigen Stiefeln der Menschen skrupellos zerstampft wurde und infolgedessen eine unsäglich lange Weile in den kühlen Schatten von einem ihrer unzähligen, dunklen Fässer zu reifen hatte - scheint mir jetzt auch das Finale dieser schrecklichen Odyssee denkbar unrühmlich in Erscheinung zu treten. Was nur tue ich hier, als Nachwuchs der wundervollen Rebe? Seht, wie mich der gierige Schlund vom Lehnsherrn Iram Uva in die stinkenden, inneren Windungen seines Menschenleibs hinab gießen will! Bin ich erst einmal dort unten angelangt, wird sich mein so lieblich und süß duftender Nektar in übel riechenden Urin verwandeln!«, klagte der Wein im Wehleiden seiner Sinne und fuhr fort: »Wenn all dieses Unheil nicht bereits genug der Zumutung für meine Wesenheit wäre, so steht mir danach auch noch die Spülung in eine düstere, weit verzweigte Kanalisation bevor - wo ich zusammen mit all der anderen übel riechenden Niedertracht, welche die menschlichen Därme dieser Stadt im Lauf ihrer Erdenjahre schon ausgeschieden haben, eine Dauer im Gefühl von trostlos ewiger Schmach zu dulden haben werde!«
Als Iram Uva seinen großen Platingral gerade anhob und zum Salut mit den versammelten Gästen des Neujahresfestes ansetzte, richtete sich der Nektar mit einer hoffnungsvollen, letzten Bitte gen Himmel.
»Oh himmlischer Schöpfer, ich bitte Euch sehnlichst um die gerechte Quittung für solch eine bodenlose Erniedrigung. Es kann nicht recht sein, dass sich das Leben von uns Kindern der Rebe durch Eure gekrönten Menschenwesen in so geringer Wertschätzung wiederfindet. Gütiger Himmel, bitte fügt es, dass wir Trauben nie mehr zu Wein gemacht werden!«
Und so sollten die Launen der schöpferischen Natur die Bitte des Weins erhören - und beschließen ihrer nachzukommen. Nachdem der Lehnsherr die gegorene Traube aus dem Platingral getrunken hatte, stiegen ihm die Nachklänge ihres Geistes zu Kopf und füllten sein Gemüt trunkener, benebelter Benommenheit. Der Rausch hatte zur Folge, dass sich Iram Uva wie ein Narr verhielt - von einer, in die nächste Unüberlegtheit tappte - und Irrtum um Irrtum beging. Am darauffolgenden Morgen im eigenen Erbrochenen erwacht sowie von den Plagen starken Kopfschmerzes heimgesucht, ließ der oberste Lehnsherr zum Gemeinwohl der Stadt Amorem ein Gesetz in Kraft treten, dass allen Einwohnern fortan verbot den erlesenen Wein zu trinken.
Von diesem Tage an lebten die süßen Trauben der Rebe glücklich und voll Ruhe belassener Zufriedenheit auf den hohen Hügeln, die sich für sie, in der Gnade des Herrn, rund um die weitläufigen, sonnigen Felder Amorems ergaben.
Gesunde Grenzen
Eines Abends, als die Sonne über Porta Fati tief stand, wartete das treue Zugpferd vom Stall des Bauern Nemelius geduldig auf den gebeugten Knien, dass sein Herr aufhören würde, es zu beladen. Nach der ersten folgte die zweite Ladung Gepäck, dann die dritte und auch eine vierte ließ nicht lange auf sich warten. »Wann wird der werte Herr Nemelius bloß aufhören mich vollzupacken? Ist er sich denn gar nicht bewusst, dass meine Arbeitsleistung vom rechten Maß der mir zugetragenen Belastungen abhängt?« fragte es sich still und leise. Als Nemelius mit dem Aufladen seiner Gepäcklasten fertig war, schnalzte er zum Befehl mit der Zunge und das Pferd erhob sich. »Vorwärts! Wenn wir zügig vorankommen, schaffen wir es vielleicht noch vor Einkehr der dunklen Stunden heim nach Fatum«, forderte Nemelius und ruckelte ungeduldig am Halfter. Das Zugpferd jedoch protestierte widerspenstig und schnaubend; es bewegte sich nicht. »Na los, auf jetzt. Marsch!« befahl der Bauer und zog fest am Seil. Das Pferd blieb stur, stemmte die Hufen in den Boden und verharrte im Stillstand. »Nun gut, ich verstehe schon, was du mir sagen willst, mein treues Pferd«, seufzte Nemelius und nahm zwei der Gepäckstücke von der Kruppe herunter. »Schon viel besser! Jetzt scheint mir das Gewicht vom Gepäck doch um einiges vernünftiger zu sein«, wieherte das Pferd und setzte sich in Gang. So marschierten sie flotten Galoppes durch die Abendstunden und Nemelius hoffte, bald in Fatum anzukommen. Doch im Zuge der letzten Meilen hielt das Pferd inne. »Nun komm schon«, tobte der Bauer, »wir haben es doch bald geschafft! Nur noch wenige Meilen, dann sind wir endlich daheim.« Das Zugpferd antwortete rebellisch, indem es sich für ein Nickerchen niederlegte. »Meine strammen Beine deuten mir, dass wir für heute genug marschiert sind.« Und so sah der Bauer Nemelius sich schließlich genötigt das Gepäck fürs Erste abzuladen und die Nacht über neben seinem treuen Zugpferd zu kampieren.