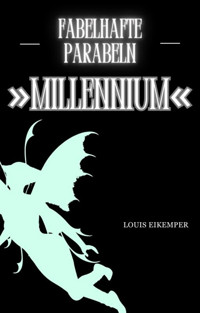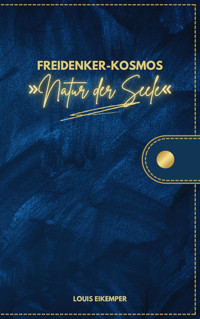9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die neue Ausgabe von Louis Eikemper Freidenker-Kosmos erscheint unter dem Titel „Spiegel der Taten.“ In den 14 Kapiteln dieser Bindung empfängt der Autor aus dem hessischen Rhein-Main Gebiet über eine breite Auslese an literarischer Abwechslung. So erwarten die Leser hier sowohl spannende Kurzgeschichten, als auch allerlei lyrischer Tiefgang, der mit Stilmitteln der Narrative zu unterhalten weiß. Konkret trifft man dabei auf pointierte Erzählungen, in denen der Autor auf schier magische Art und Weise Poesie, Fabeln, Parabeln und Gleichnisse miteinander verschmelzt, sodass von allen Ebenen der klassischen Weltliteratur etwas enthalten bleibt. Des Weiteren finden sich in den Kapiteln dieser Freidenker-Kosmos Ausgabe Texte wieder, in denen Louis Eikemper die Leser zur Gedankenreise einlädt. Hier taucht der Autor in die Rolle eines spirituellen Ratgebers ein und teilt seine Philosophie mit der Welt, in der er Wege zur inneren Balance aufzeigt, seine Gedanken der Kraft der Liebe widmet oder über emotionale Intelligenz schreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Impressum
Über den Autor
Louis Eikemper wurde im Oktober 1996 in Bad Homburg geboren und wuchs im hessischen Wetteraukreis auf. Nach dem Abschluss der Realschule im Jahr 2016 sammelte Louis zunächst Erfahrungen in der Schulsozialarbeit, wo er einen Freiwilligendienst leistete. Danach unterzog er sich einer Lehre zum Industriekaufmann.
2021 setzte der Autor seinen beruflichen Weg dann im Ausland fort, als er seinen Wohnsitz auf die Mittelmeerinsel Zypern verlegte, wo er bis zum Jahr 2023 in der südlich gelegenen Hafenstadt Larnaka arbeitete und lebte, um seinen Horizont zu erweitern. Danach zog es ihn zurück in die Heimat bei Frankfurt am Main, wo er seinen Job bei einem Online-Zahlungsdienstleister (Tätigkeiten: Datenanalyse und Marketing) weiterführte.
Im November 2024 hat Louis dann entschlossen sich zum UX/UI-Designer schulen zu lassen und den beruflichen Werdegang als App und Software-Entwickler fortzusetzen.
Die Freizeit widmet er mit großer Leidenschaft dem kreativen Ausdruck. So fließen insbesondere dem Schaffen als deutscher Schriftsteller, Maler, Zeichner, Grafikdesigner, Philosoph und Live-Poet große Anteile seines Herzbluts inne.
Zurzeit übt er sich auch im Gesang, der eigenen Vertonung und dem Gitarre spielen, um sich in seiner Geistesstärke auch als Musiker zu bekräftigen und somit der großen Leidenschaft seines Vaters (Thomas) nachzugehen.
Der Lauf der Jahre hat für Louis ergeben, dass er seinen privaten Kreis bewusst enger hält, insbesondere für seine Familie und Vertrauten.
Zur Belohnung erfreut sich der Autor an Speisen aus der mediterranen/südländischen Küche, treibt Kraft- und Ausdauersport oder verbringt Zeit mit seinem amerikanischen Waldkater Sir Hurley. Wenn er nicht selbst gerade neue Schriften stellt, taucht Louis gerne als Leser in die Gedanken anderer Autoren ein, um sich die Themengebiete einzuschenken, die ihn interessieren. Vor allem begeistert ihn die Weltliteratur (Poesie, Fabeln, Erzählungen). Zudem fasziniert er sich für Rätsel, die Mystik, Symbolik und alles rund um die bildenden Künste. Man kann behaupten, dass er gerne das ergründet, was dem gewöhnlichen Auge im Verborgenen bleibt. Zu seinen Interessengebieten gehören die Seelenforschung, Ethik, (Grenz)-wissenschaften, Psychologie, Gesundheit und Ernährung, alternative Medizin sowie alles rund um die Errungenschaften der modernen Technologien; insbesondere den Themen im Bereich der Informatik.
Kapitel 1
Das ist eben Politik
»...hier spricht "Radio Lightern shadow" - eure Nummer eins in Fatum und Umgebung! Für heute ist unsere Sendung beendet«, ertönte die Ansage aus dem alten Radioapparat, welcher in einer Ecke der verräucherten, niedrigen Küche von Tante Leona stand. Das Ohr dicht an den Lautsprechern hatte sie den Nachrichten gelauscht, auf das ihrer Aufmerksamkeit auch sicher keine Inhalte aus der Sendung entgangen wären. Gerade richtete sie den Skalenzeiger auf 0 und stellte den Apparat ab, als ihr das Essen in Erinnerung gerufen wurde, dass in einem großen Topf auf dem Küchenherd vor sich hinköchelte. Der entzündete Ischias ließ Tante Leona den Weg dorthin in gebückter Haltung gehen. Ihr Arzt gab gegen die Entzündung zwar wöchentliche Injektionen ein, doch diese halfen nicht wirklich. Im Lauf der Zeit hatte sie dadurch die Fähigkeit aufrecht zu laufen ganz und gar verloren und es schien beinahe, als wäre mit den Jahren auch ihr einst so blütenzartes Gesicht immer eingefallener geworden. »Da seid ihr ja endlich«, sprach sie heiterer Freude, als Vater die Wohnung aufschloss und mit mir und meiner kleinen Schwester Isabel zur Tür hineinkam. Er grinste verschmitzt und gab Tante Leona zur Begrüßung jeweils ein Küsschen links und rechts, gefolgt von einer innigen Umarmung. »Auf der B43 standen wir eine Weile im Stau, Schwesterchen. In Amorem ist heute die Neujahresfeier gewesen. Du weißt ja selbst, was dann auf den Straßen los ist, gerade jetzt, wo zum ersten Mal seit Monaten wieder eine Waffenruhe vereinbart wurde. Ich habe Rasmus und Isabel noch von dort abgeholt, da sie insistiert haben dabei sein zu wollen, wenn ich dich besuche.« Tante Leona freute sich. »Das ist schön, dass ihr gemeinsam gekommen seid. Wie die Fügungen es so wollten, habe ich sogar dein Lieblingsessen vorbereitet, Rasmus, mein Herzel«, sprach sie und klatschte in die Hände. Tante Leona nannte mich schon immer Herzel. »Germknödel?«, fragte ich mit leuchtenden Augen. »Ganz genau«, lachte sie und gab uns über eine wohlwollende Geste zu verstehen, dass wir uns schon einmal an den Esszimmertisch setzen sollten, während sie die Mahlzeit anrichtete. Vorfreudig gab ich theatralische Laute von mir und leckte den Silberlöffel ab; nicht nur, weil ich mich ungemein auf diese herrlichen Leckerbissen von Tante Leonas Germknödeln freute, sondern auch, weil ich wusste, wie sehr es meine kleine Schwester provozierte, wenn ich theatralische Laute von mir gab und dabei die Löffel abschleckte. Im Augenwinkel vernahm ich, wie sie die Arme verschränkte und genervt eine Haarsträhne nach oben pustete, die ihr ins Gesicht fiel. So tat sie es immer, wenn ich sie provozierte. Es dauerte nicht lange, da musste ich losprusten. Ein Lachen konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Vater erkannte die Situation zeitnahe und war sich in seiner Erfahrung sicher genug, um ihr zu entgehen. Kaum etwas war so unangenehm, wie die Aura, die Isabel versprühte, wenn ich sie provoziert hatte - und doch gefiel es mir gleichermaßen, wenn meine Schwester wegen einer Nichtigkeit sauer wurde; getreu dem Motto „Was sich liebt, das neckt sich.“ »Leona, lass mich dir helfen«, sprach er und sprang auf. »Mit deinem entzündeten Ischias ist das doch sicher kein Zuckerschlecken, wenn du den Topf schleppst.« Vater ging Tante Leona zur Hand und richtete das Essen für uns an. »Danke dir, Karel. Das kommt mir gerade recht«, antwortete sie und hielt sich die Stelle ihres schmerzenden Nervs, in den gerade schon der nächste Plagegeist einzufahren schien. Der köstliche Duft von den Germknödeln legte sich in jeden Winkel des gesamten Raumes, von solcher Fülle geladen, dass selbst Isabels provozierte Miene wieder aufklarte. Gerade band ich mir eine Serviette um den Hals und schleckte mir über beide Lippen, als Vater mir einen Schabernack spielte. Er täuschte an, dass er mir einen von Tante Leonas köstlichen Germknödeln auftischen würde, doch tat es stattdessen für Isabel. »Wer seine Schwester ärgert, erhält als letzter einen Germerl«, schnalzte er. Isabel klatschte freudestrahlenden Applaus, als Vater ihr die Leckerei kredenzte. Wie der Knödel meine Schwester doch anlächelte, so süßer und herrlich dampfender Beschaffenheit! »Fantastisch, Tante Leona«, sprach sie. »Wirklich, viel leckerer könnte man einen Germknödel wohl kaum zubereiten.« Tante Leonas Wangen ergaben eine rosafarbene Wonne, als sie sich für das Kompliment bedankte, zwinkerte und dabei Isabels Hand fest drückte. Über dem Tischgedeck waren pralle, gelb gesättigte Maiskolben an einer ausgespannten Schnur aufgehängt. Das Feuer in Tante Leonas Kaminofen knisterte laut und ließ im Raum noch mehr Wohlbefinden aufkommen, auch wenn es ihn aufgrund der kaputten Dichtungen in den Türrahmen nicht wirklich wärmer zu machen schien. Nachdem Vater gerade den fünften Bissen seines Germknödels vertilgt hatte, sprach er: »Leona, was haben sie im Radio Lightern shadow heute gesendet?« Tante Leona schaute in die Runde. »Nun, es hieß heute, dass die UNO unentwegt tagt, aufgrund der Ausnahmesituation, die sich wegen der russischen und den amerikanischen Besatzungen ergibt.« Vater entgegnete: »Wie rührend von der UNO, dass sie wegen der Situation unentwegt tagen. Schön wäre ja, wenn einer dann auch mal etwas unternimmt.« Tante Leona ergänzte: »Ja und es hieß außerdem, dass die Amerikaner außer sich sind, vor lauter Empörung. Sie hätten ja bloß recht, dass sie uns besetzen und auf Nummer sicher gehen, nachdem die Tyrannei von König Liebighirsch beendet wurde.« Vater seufzte. »Ja, das ist nun wahrlich keine Überraschung, dass sie empört sind. Wem gefällt es schon, wenn die eigenen Taten allgemein angefechtet werden? Und doch bin ich mir sicher, dass die Soldaten insgeheime Freude fanden, dass sich die Menschenrechtsorganisationen allmählich einschalten, aufgrund der Herangehensweise und Brutalität, welche die Truppen hier auszuführen haben. Keiner von denen will das ja wirklich, zumindest ein Großteil von ihnen nicht! Am liebsten wäre jeder von ihnen zu Hause bei der eigenen Familie - und sicher betet jeder Dritte von ihnen, dass keiner für seine Kriegsverbrechen in den Spiegel der Taten blicken muss, wenn er am Ende des Lebens ins Jenseits verscheidet.« Mich überkam der Schluckauf, als ich gerade einen kräftigen Schluck Wasser genommen hatte. Stutzig fragte ich Vater: »Moment, Vater; heißt das etwa, dass Ihr denkt, die feindlichen Soldaten seien gar nicht böse?« Vater nickte. »Ja, Rasmus. Das will ich ungefähr damit sagen. Die Truppen sind Söhne, Brüder und Väter, so wie wir auch - und sie tun eben das, was ihnen von den Kriegstreibern befohlen wird, da sie ansonsten wegen verweigertem Dienst standesrechtlich erschossen werden. Die Soldaten dürfen natürlich nicht zugeben, dass sie insgeheim ein Dankesgebet sprechen, da sich jetzt externe Organisationen in die Lage um unser Land einmischen. Genauso wenig dürfen sie zugeben, dass es ihnen zusagt, wie man hierzulande bei uns denkt; und über all das Unglück in den Berichten zu schreiben pflegt.« Ich runzelte die Stirn. »Aber die mächtigen Kriegstreiber können doch nicht alle auf einmal erschießen, oder? Ein Feuer ist und bleibt die Summe vieler Funken. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann kann alle dem ein Ende bereitet werden. Ich glaube kaum, dass einer von uns hierzulande auch nur einem einzigen von ihnen nachweint, wenn sie zu ihren Familien heimkehren - genauso wenig wie einer von ihnen seinem Dienst hier in den Besatzungszonen nachtrauern wird.« Vater sah mich mit ernster Miene an, nahm einen weiteren Bissen und entgegnete: »Ganz richtig, Rasmus. Und deswegen sind die Mächtigen genauso mächtig wie machtlos, verstehst du?« »Nicht wirklich, doch muss man das verstehen? Das ist eben...«, begann ich, ehe Isabel mir ins Wort fiel. »...das ist eben Politik! Ein riesengroßes Theater, dass auf dem Rücken der Völker ausgetragen wird.« Ich nickte grinsend. »Natürlich. Und genau deswegen kann ich es wohl nicht verstehen.«Nachdem wir fertig gegessen und noch eine gute Weile in trauter Geselligkeit beisammen gesessen hatten, bedankten wir uns bei Tante Leona für Speis und Trank und standen auf, um uns nach Hause zu verabschieden. Gerade zogen wir die Schuhe an, da beobachtete ich, wie sie einen flüchtigen Blick durch das Küchenfenster warf. In der Ferne ratterten Maschinenpistolen. Immer wieder flackerten die Lichter der abgegebenen Schüsse am Horizont auf; Schreckensschreie ertönten und verstummten gleichsam im Schall der vielen Salven, die zu Boden fielen. »Ist es schon nach zwölf? Es hieß doch, dass heute Waffenruhe sei«, fragte Vater verdutzt und fuhr fort: »Unter den Bedingungen können wir nicht heim. Nach Hause sind es gute zwanzig Meilen und in der Dunkelheit müssen wir ohnehin langsamer fahren, besonders wenn es das letzte Stück durch den Nibelungenwald geht.« Es war halb zwölf gewesen. »Scheinbar haben die Truppen es kaum abwarten können, wieder zu schießen. Die Waffenruhe haben sie jedenfalls eine halbe Stunde eher beendet, als von offizieller Seite angekündigt«, sprach Tante Leona besorgt, ehe sie auf meine kleine Schwester und mich deutete. »Ihr beiden Geschwister, legt euch ruhig ins Gästezimmer. Es wird wohl besser sein, wenn ihr heute Nacht allesamt hier bleibt. Und du, mein lieber Bruder, du kannst hier im Wohnzimmer schlafen. Das Sofa ist bequem und den Kamin kann ich dir gerne anlassen, über Nacht.« Vater seufzte, legte die Stirn in Falten und pflichtete Tante Leona schließlich bei. Isabel und ich machten es uns in den Gästebetten bequem. Im spärlichen Schein des durch die Schlafzimmerfenster einfallenden Mondlichts wanderten meine Blicke über einen großen, eingerahmten Öldruck, den Tante Leona zentral im Raum, über der prächtigen Kommode aus Walnussholz aufgehängt hatte. Es war ein christliches Banner, gemalt von Samuel Levy und Söhnen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so stand es in der Signatur des Werks. Der Druck zeigte den Messias und seine Gefolgsleute im Garten von Gethsemane. Alle ihm ergebenen Jünger schienen zu schlafen, doch der Messias stand vor ihnen, erleuchtet und wachsam, als einziger. Mit seiner zur Heiligengeste erhobenen Hand schien es so, als verkündete er den Ausspruch, welcher am unteren Bildrahmen stand: »Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet! Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.« Und so betrachtete ich das Werk noch eine gute Weile im Gedankenkreisen, ehe ich einschlief, in dieser Dienstagnacht.
Kapitel 2
Zur dunkelsten Stunde
Mitchell keuchte in die Tiefen der alles in der Umgebung einnehmenden Versenkungen nächtlicher Finsternis hinein, wo sich einzig im schwach schimmernden Lichtscheinwurf von Lennox alt gedienter Taschenlampe eine Erhellung fand, um den beiden ihren Weg zu weisen. Als er zuvor vom allabendlichen Auslauf ohne seinen treuen Windhund Tiberius zurückgekehrt war, hatte sich ihm Lennox als einziger der Gruppe noch nüchtern genug erwiesen, um zur fortgeschrittenen, bald in der dunkelsten Stunde mündenden Nachtruhe mit auf die Suche nach dem Vierbeiner zu gehen. Dichter Nebeldunst verschleierte in dieser eiskalten Oktobernacht die von nassem Laub bedeckten Ebenen des Nibelungenwaldes und verwirkte matschigen Untergrund, sodass die Wanderstiefel der zwei Freunde mit jedem Schritt darin versanken. »Wie konnte das überhaupt passieren, Mitch? Der gute Tiberius weicht dir doch sonst nie von der Seite«, fragte Lennox und klapste druckvoll gegen das Gehäuse der immer schwächer scheinenden Taschenlampe, in der Hoffnung ihren Batterien einige extra Reserven zu entlocken. »Auf dem ganzen Weg wirkte er total angespannt und zog laufend an der Leine - als hätte er Gefahr gewittert«, begann Mitchell und deutete auf die Umrisse eines Dickichts, dass sich einige Meter vor ihnen in der Dunkelheit abzeichnete. »Das Gestrüpp dort war ständig in seinem Fokus. Er ließ sich nicht mehr beruhigen und ich wollte schon umkehren - da hat Tiberius sich losgerissen und war auf und davon.« Mitchell hielt einen Moment inne und sammelte seine Gedanken, ehe er fortfuhr. »Ich hörte es nur noch hektisch rascheln und kurz darauf schien es, als würden alle Geräusche in der Dunkelheit bis zum Nullpunkt herunterfahren. Das war die unheimlichste Stille, die ich je erfahren habe. Es war eine Stille, die dir unterbewusst die Warninstinkte schärft und sämtliche Urängste, die in einem verankert sind, auf einen Schlag erwachen lässt - kennst du dieses Gefühl?« Lennox schüttelte den Kopf. »Nein, bisher nicht. So wie du das Gefühl beschreibst, kann ich darauf auch gerne verzichten. Hast du in dem Busch mal nachgeschaut, Mitch? Wenn er dort nicht sein sollte, dann wird er sicher noch tiefer in das Waldinnere gerannt sein.« Nach einem erneuten Klaps gegen das Gehäuse der Lampe, wich auch der letzte Lichtscheinwurf in der Finsternis. »So ein verdammter Mist, Mitch! Ohne Licht können wir das Ganze hier vergessen. Lass uns zurück zu den anderen und morgen weitersuchen. Die dunkelste Stunde naht. Ich kenne weitaus tollere Orte, an denen ich mich dann aufhalte«, zischte Lennox in die dunkel-bläulichen Schwärzen der Nacht, als ihn in unmittelbarer Reichweite das Geräusch von knacksenden Ästen erschrocken zusammen zucken ließ. So sehr er sich auch bemühte zu erkennen, was sich in ihrer Nähe bewegte, war es mit bloßem Auge unmöglich in der Dunkelheit überhaupt etwas zu sehen. Die Absenz des Lichtes nahm im Gesamtgefüge der Umgebung immer spürbareren Einfluss und verwirkte sich dem Zeitgefühl mit beklemmender Enge, sodass es schien, als würde eine Minute wie eine Stunde vergehen. Unweigerlich dachte er daran, was Mitchell zuvor noch beschrieben hatte.
In ihm keimte tiefgreifendes Unwohlsein und intensivierte um so mehr, als eine Antwort ausblieb. »Was ist mit dir, Mitch? Die anderen fragen sich bestimmt schon, wo wir bleiben.« Weiter herrschte Stille. Er spürte, dass Mitchell von seiner Seite verschwunden war, als die dunkelste Stunde dieser Nacht begann ...
Kapitel 3
Das dunkle Licht
In den letzten Momenten eines von malerischer Schönheit beseelten, späten Abends, sahen die alles fügenden Launen der Natur es vor ihren Betrachtern über die in den Böen der leisen Winde heimischen Aerosole eine Dämpfung des final einstrahlenden Sonnenlichts zu verwirken, um die bald schon einkehrende, dunkelblaue Tiefe einer neuen Nachtruhe zu begrüßen. Anders als die sonstigen Wassertropfen und Eiskristalle brachen sie die Sonnenstrahlen - und sollten somit zur Hauptverantwortlichkeit eines selten zu bewundernden Naturspektakels erklärt werden. Mit dem letzten Leuchten der untergehenden Sonne und einer tief hängenden Wolkendecke gepaart, ergab sich für sie an diesem Abend eine Kombination aus Rosa und Marineblau, welche das Himmelszelt in der mystischen Anmut einer Amethyst artigen Mixtur von Violett offenbarte.
In ebendiesem poetischen Ausdruck, den der seinen Dienst erledigt habende Tag dem Anbruch der Nacht über ebenjene Schwebe des späten Abends malerisch am Horizont zu deuten pflegte, fand sich ein von schier manischer Panik beseelter, umherstreifender Moskito wieder. Die Einkehr der allabendlichen Dunkelheit ließ ihn ängstlich hin und her flattern - erfüllter Furcht, dass er in der Absenz vom Tageslicht keinen ihn nährenden, heißblütigen Träger mehr erblicken würde, an dem sich seine nimmersatte Sucht nach Wärme in der Außenwelt festsaugen konnte. Als mit dem letzten Sonnenstrahl beinahe auch die Hoffnung des armen Moskitos gewichen wäre, erspähte er in der Ferne ein verheißungsvoll flackerndes Licht, dass ihm Nähe und der Dunkelheit trotzende, Wege weisende Erleuchtungen zur Bedeutung gab.
»Oh, du heller Schatten von dunklem Licht! Bist du meine Botin des Glücks und Rettung vor der finsteren Nacht?«, dachte der Moskito erleichterter Sinne und lenkte seine Flügel hin zum Licht, um es lebhafter Neugierde zu umkreisen und wie ein Wunder zu bestaunen. Anders als die sonstigen Träger heißen Blutes blieb die Flamme vom Wesen des Moskitos unbeeindruckt und ignorierte dessen Präsenz ganz und gar - so, als wäre er nicht einmal da. Unzufrieden damit, die Rolle des Bewunderers zu geben, setzte der Blutsauger sich in den Kopf mit dem dunklen Licht dasselbe Spiel zu treiben, wie mit den anderen Wesen von heißblütiger Natur, die er ansonsten heimsuchte. So lenkte sein Flug entgegen der sich in der Dunkelheit erhebenden Flamme, welche er oberhalb streifte. Augenblicklich wusste er nicht mehr, wie ihm geschah - und der Moskito fand sich, betäubter Gefühle bestürzt, vor den Füßen des dunklen Lichtes wieder. Im flüchtigen Flackern der geworfenen Schatten erkannte er, dass ihm ein Bein fehlte und seine Flügelspitzen angesengt worden waren. »Um Himmels willen! Was ist bloß mit mir geschehen?«, rätselte der Moskito erschrocken in die dunklen Stunden der weilenden Nacht, ohne zunächst eine Erklärung für den ihm zuteilgewordenen Schaden zu erkennen. Er vermochte nicht auszudenken, dass ihm von einer solch leuchtenden Wesenheit wie dieser wunderschönen Flamme ein Übel geschähe; und deshalb sammelte er allen Mutes, dessen er in seiner Ungläubigkeit bewusst werden konnte, um sich über einen erneuten Flügelschlag zu erheben. So zog der Blutsauger eine prüfende Schleife um die wundersame Natur des in verheißungsvollem Hoffnungsschimmer strahlenden Lichtes - und sollte in ihrem Bann der eigenen Instinkte nicht mehr mächtig werden. Von der Magie der Flamme angezogen ließ sich der Moskito auf ihr nieder, ehe er schließlich verbrannt in das heiße Öl fiel, welches ihr Leben nährte. »Du verfluchter Trugschluss!« wetterte der Moskito entgeistert, sein Leben nun beendend. »Ich hätte doch wissen müssen, dass bei Nacht keine Sonne mehr scheint, auf dieser Welt. Das Licht des Schöpfers ist einzig für den Tag besinnt worden. Wer oder was auch immer dich berufen hat, wird dabei also sicher nicht über mein Wohlergehen nachgedacht haben. Die innere Unruhe führte mich zu dir, du trügerisches Licht von falscher Hoffnung - und elendes Verderben! Auf der Suche nach dem Glück fand ich in deiner übernatürlichen Anmut meinen Tod. Ich bereue mein törichtes Verlangen nach dem Leuchten vom Licht der Außenwelt, weil ich die Gefahren dahinter zu spät verstand.« Als der Moskito in der Hitze des dunklen Lichts eins wurde, antwortete der Geist der Flamme im Echo seiner flüchtig flackernden Schattenwürfe, sich keiner Schuld bewusst: »Armer Moskito, so Ruhe in Frieden! Dein Trugschluss möge sich für all jene, die wie du auf der Suche nach dem Glück in der Außenwelt umherirren, als beispielhafte Botschaft finden - auf das man sich fortan des eigenen inneren Lichts, welches einem von allem vorhandenen zugeteilt wurde, in Erkenntnis ermächtige und es aus sich heraus scheinen lasse - um sich dem Glück das Licht der Welt zu erfahren nicht nur bei Tag bewusst zu sein - sondern die einem erwiesenen Lebenspfade auch bei Anbruch der dunklen Stunden aus eigener Kraft erleuchten zu können und dabei auf dem rechten Weg zu bleiben. Ich bin nicht die Sonne gewesen, welche du dir im Leichtsinn deiner Naivität erhofft hast.
Und wer mich nicht mit Klugheit behandelt, der verbrennt sich!«
Kapitel 4
Aus dem Gefühl in die Erkenntnis
Ich kann mir gut vorstellen, dass Du mir in dem Punkt zustimmst, dass der Erfolg beim Erlernen neuer Fähigkeiten für uns Menschen stets mit einer emotionalen Grundlage verbunden ist. Je weiter unsere Sinne geschärft sind, desto stärker ist logischerweise auch das Fundament, dass wir aus unseren Erkenntnissen beim Lernen ziehen. Wir setzen unsere Gefühle im Idealfall also gezielt ein, um der Qualität unserer Gedanken mit Feinjustierung begegnen zu können. Sie sind es, die unser Verhalten und unsere Taten koordinieren. Unsere emotionale Intelligenz findet sich also in der Praktik darin, Gefühle zu verstehen und sie für optimale Ergebnisse in unseren alltäglichen Projekten effizient einordnen zu können, sodass wir in der Lage sind die Dinge, die uns im Herzen Erfüllung bereiten, auf die immer nächste Ebene zu heben, also unsere Lebensqualität bewusst zu steigern. Somit ist eine für uns dienliche Anwendung der eigenen Emotionen für mein Verständnis etwas, dass sich durch die Definition eines eigenen philosophischen Konzepts und/oder Glaubensbildes ergibt, sowie das beharrliche Entwickeln einer in unseren immer neu hinzugewonnenen Erkenntnissen reifenden Strategie - durch eben solch eine selbstbestimmte, klare Leitlinie im Leben lässt sich die Balance der eigenen beiden Pole am effektivsten regulieren. Was wir aus uns heraus erschaffen; aus dem Schatten ins Licht rücken, bzw. aus dem Gefühl in die Erkenntnis aufnehmen ist schließlich das, worum es in diesem Essay geht: emotionale Intelligenz. Für mich funktioniert dabei ein Modell, dass ich über ein Fundament von regelmäßiger, kritischer Selbstreflexion, einer konsequenten Widmung der eigenen Meisterschaft in individueller, kreativer Ausdrucksstärke und einer unmissverständlich offenen Kommunikationsstrategie lege. In diesen drei Grundsäulen fordere ich stringenten Selbstrespekt ein, welcher in meinem Verständnis notwendig ist, um sich individuell ausbalancieren zu können. Ich denke, dass man als Mensch, der sich selbst regelmäßig kritisch hinterfragt, konsequent an der Erweiterung seiner eigenen kreativen Schaffenskraft arbeitet und sich über einen gesunden Selbstwert klar und eloquent mit seinem direkten Wirkungsfeld verständigen kann, gleichzeitig auch das eigene Empathievermögen stärkt, seine Fantasie fördert und sich vor allem im Bereich der zwischenmenschlichen Performance auf immer neue Stufen erhebt. Denn wer für das eigene Leben einen harmonischen Einklang zu spielen versteht, der kann diesen in aller Regel auch im direkten Umfeld in der Wiedergabe finden. Wer einen hohen emotionalen Quotienten mit sich bringt, hat also im Regelfall auch eine höhere soziale Intelligenz. Für meine Einschätzung setzt sich eine hohe emotionale Intelligenz mit einem hohen IQ nicht nur von gegengleicher Bedeutung, wenn es um den Erfolg von einer in ausgewogener Zufriedenheit stimmenden Lebensgestaltung geht - sondern sogar noch um ein Vielfaches bedeutsamer! Denn wer aus einem breit aufgestellten Portfolio an kreativem Ausdruck schöpfen kann, eine generelle mentale Kontrolle für seine eigene Performance etabliert hat, Empathievermögen mitbringt, fantasievoll ist und Interpretationsstärke in seinem Leben kultivieren kann, der gewinnt im Regelfall deutlich mehr an Wachstumsessenz und Beständigkeit in den Bereichen des eigenen Werdegangs für sich, als es ein hoher IQ alleine wohl je könnte.
Zumindest denke ich so, in meinem Status Quo. Welchen der beiden Quotienten findest du wichtiger für dein Leben? Und wie stehst du im Allgemeinen zu dem Thema rund um unsere emotionale Intelligenz?
Kapitel 5
Memento vivere
Im Jahr 1955 schrieb Albert Einstein einen Brief an die Familie seines verstorbenen Freundes Michele Basso.
"Nun ist er mir mit dem Abschied von dieser sonderbaren Weltein wenig vorausgegangen. Das bedeutet nichts. Für uns gläubigen Physiker hat die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen, Illusion."
Einsteins Worte verknüpfe ich als eine der Fügungen, die diese Gedankenreise ebneten - zu der ich nun einlade, um mein Verständnis von unserer (relativen) Sterblichkeit als Fundament menschlicher Schaffenskraft offenzulegen. Wenngleich es nicht das angenehmste Thema ist, bleibt es doch am elementarsten von allen Gebieten, denen man sich innerhalb des diesseitigen Lebens zu stellen hat: der bewussten Differenzierung zwischen eigener und allgemeiner Vergänglichkeit und die sich daraus erschließende Erkenntnis über die Quintessenz dessen, was vom eigenen Kosmos bleiben soll. Ich werde in diesem Sinnesbrief also auf den alltäglich verlautbarten Zuruf des "Memento mori" (Gedenke des Sterbens) mit einem optimistisch ausbalancierten "Memento vivere" (Gedenke des Lebens) entgegnen. Warum denn auch nicht?
Wenn aus allem, was um uns ist, alles wird, was uns künftig umgibt, dann lässt sich deuten, dass alles von allem kommt und unabdingbar in alles zurückkehren wird - weil das was in den Elementen der Natur enthalten ist, zwangsläufig daraus besteht. Was ist wurde also von dem, was war definiert und wird perpetuell alles werdende definieren. Sollte man sich trotz der daraus ergebenden Erkenntnis, dass der Tod die unabdingbare Konstante des Lebens gibt, noch damit quälen, dass er vor einem liegt, dann kann folgender Gedanke in Anbetracht der allgemeinen Relativität zum Schlüssel der Erlösung verhelfen. Wenn das Ableben vor uns liegt, muss es, relativ gesehen, ebenso hinter uns liegen. Ja, es liegt hinter uns - wir finden es in den Höhen und Tiefen begraben, die wir auf dem Weg zum Gipfel des Lebens schon beschreiten durften. Somit ist der Tod auch Urheber aller Erinnerungen - und die Triebfeder menschlicher Schaffenskraft. Er ist Fundus der Erfahrungen, die man innerhalb des diesseitigen Lebens gewinnt, im Verstreichen jedes Moments präsent - ja, er ist es, der all unser Zeitliches segnet, oder nicht? Letztlich lässt er uns also erkennen, dass jeder Augenblick auf dem Konto des Lebens von unbezahlbarer Kostbarkeit bepreist ist - und genau das ist es, was ihn so wertvoll macht! Womit wir unser Lebenskonto befüllen und verjubeln, bleibt uns letztlich zur freien Wahl. Erfahrungsgemäß zahlen sich die positiven, ermutigenden und inspirierenden Impressionen für uns aus. Schließlich werden uns die charakterstarken Einflüsse dieser Welt am längsten im Lauf des Lebens verweilen lassen, richtig? Die Haltbarkeit unserer Kreationen definieren wir also stets in uns selbst - durch die Natur dessen, woran wir festhalten. Unser Lebenswerk erschaffen wir maßgeblich aus den Tugenden, die wir manifestieren. Sie sind das Schlüsselelement der eigenen Unsterblichkeit. Ihre Essenz ist es, die es uns ermöglicht dem Lauf des Lebens beständig sprießende Entwicklungen hinzugeben, die immerwährend erhalten bleiben. So lasst uns im Hier und Jetzt bewusst werden, um zeitlos wirksam zu verweilen.
Kapitel 6
(Nächsten)liebe
Die grundlegende Konstante vom Wesen der menschlichen Liebe, welche allen anderen Formen der Zuneigung innewohnt, ist unsere Gabe der Nächstenliebe. In ihr bilden wir unsere wichtigsten Tugenden, welche gleichsam die Säulen vom Allgemeinwohl des weltlichen Friedens darstellen: Verantwortungsbewusstsein, Dankbarkeit, Empathie, Fürsorge, der Wille seinem eigenen Wirkungskreis eine positive Bereicherung zu sein und seine Mitmenschen zu fördern sowie Sanftmut, Achtsamkeit, Respekt, Toleranz und Nachsicht - und vor allem auch ein ausgeprägtes, lernbereites Verständnis, welches aus unserer Bereitschaft zur Disziplin resultiert, dass wir dem Lauf des Lebens neue Erkenntnisse hingeben - denn schließlich können wir nur dann Verständnis zeigen, wenn wir uns dafür offen halten die vielfältige Natur dieser Welt in all ihren Einzigartigkeiten unvoreingenommen erkennen und lieben zu wollen - für uns selbst, unsere Nächsten und vor allem für den Frieden dieser wundersamen Welt, die wir auf unserer Reise erfahren dürfen. Ja, es ist letztlich mit dem Wesen jener Liebe zu vergleichen, von der das heilige Buch der Bibel spricht, welche verheißt: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« (Lev 19,18). Unsere Nächstenliebe birgt den Pfad zum Frieden auf unserer Welt, da sie allen Wesen gilt, ohne dabei allzu exklusiv zu sein. Sie startet jeden Morgen aufs Neue beim Blick in den Spiegel - in uns selbst. Wer in seinem eigenen Wesen die Kraft zu lieben befähigt hat, der kann in seiner Glückseligkeit zumeist ja gar nicht anders, als seinen Nächsten über die positive Beflügelung ihrer Offenbarungen zu begegnen. Und ebendieser Beginn bei sich selbst und das eigene positive Wirken, welches sich daraus für unser direktes Umfeld ergibt, hat das Potenzial sich über das Prinzip vom Domino-Effekt auf uns alle zu übertragen - wenn wir an einem Strang ziehen. Über ebenjene Wertschätzung von menschlicher Solidarität beinhaltet die Nächstenliebe also die Chance zur Einheit mit der Welt - ein menschliches Einswerden, dass uns eines gemeinsamen Sinnes bestärkt. So gründet ihr Fundament auf der Erkenntnis, dass wir alle eins sind, wenn wir wesentlich manifestieren, dass wir den stets subjektiven Einbildungen, welche sich der Menschheit über den Schein vom Äußeren trügen - also oberflächliches Kategorisieren und verallgemeinerndes Verblenden über unser stets von Endlichkeit beschränktes, menschliches Urteilsvermögen - weniger Gewichtung erweisen, als dem Schärfen unserer (Gemeinschafts-)Sinne, welche uns zum Kern unserer wahren Natur vordringen lassen.
Warum? Weil wir, wenn wir bei unseren Mitmenschen nur auf die flüchtigen, vergänglichen Oberflächlichkeiten im Äußeren achten, stets dem Trugschluss von Unterscheidungen verfallen; also dem, was uns Menschen voneinander trennt. Dringen wir jedoch eines Gemeinschaftssinnes für die Nächstenliebe bestärkt zueinander vor, so nehmen wir im Kern unserer selbst eine weltlich vereinigende Identität wahr - und erkennen, dass wir im Wesen der Seele Brüder und Schwestern sind, die vom Glück des Lebensgeschenks, dass uns die Kraft der Liebe vermachte, die Vollkommenheit von einer großen Einheit bilden.
In dieser Begründung von gegengleichem Bezug, also über den einen Kern zum anderen Kern, anstatt einer kategorischen Trennung von Oberflächlichkeit zu Oberflächlichkeit, liegt der entscheidende Faktor, welcher in der gerechten Balance einer goldenen Mitte mündet und uns das Ziel eines friedvollen Paradieses in Erfahrung von weltlicher Nächstenliebe ebnet - einer Liebe zwischen Gleichen.
Kapitel 7
Iram Uva
Die Zeit war reif - und es wieder einmal so weit gewesen. Der blaue Planet hatte das Wege weisende, Licht bringende Gestirn der schöpferischen Natur ein weiteres Mal umrundet, sodass sich für die den Globus besiedelnden Menschenwesen der feierliche Anlass vom Jahresabschluss ergab - sowie das Anbrechen einer neuen Rechnung, welche sie dankbaren Herzens begleichen durften, im Antlitz ihrer Wärme schenkenden Gottheit.
Zur traditionsreichen Festivität ebenjenes Jahreswechsels lag es der auf Erden heimischen Gemeinde von Amorem, rund um ihren obersten Lehnsherrn Iram Uva, in kultivierter Routine üblich nach dessen Neujahresansprache die lieblichsten und saftigsten, prächtig und prall gewachsenen Trauben, welche zur Reifezeit von der städtischen Winzerei zerstampft und als Wein gekeltert worden waren, für die neue Saison zur allgemeinen Präsentation bereitzustellen. So kam es, dass sich in der Kredenze des feierlich beschmückten, lang läufigen Tafelgedecks von Iram Uva ein mächtiger Schluck vom gegorenen Nektar der Reben wiederfand - üppig eingeschenkt im großen Platingral des Lehnsherrn, wo er sich in seinen entrichteten Gedanken augenscheinlich innerhalb der letzten ihm zuteilgewordenen Momente gegenüber sah.
»Oh weh! Nun naht es also, das Ende. Nachdem ich meiner geliebten Heimat hoch oben, auf den großen Hügeln über den weiten Feldern Amorems, so unsagbar unsanft entrissen, von den dreckigen Stiefeln der Menschen skrupellos zerstampft wurde und infolgedessen eine unsäglich lange Weile in den kühlen Schatten von einem ihrer unzähligen, dunklen Fässer zu reifen hatte - scheint mir jetzt auch das Finale dieser schrecklichen Odyssee denkbar unrühmlich in Erscheinung zu treten. Was nur tue ich hier, als Nachwuchs der wundervollen Rebe? Seht, wie mich der gierige Schlund vom Lehnsherrn Iram Uva in die stinkenden, inneren Windungen seines Menschenleibs hinab gießen will! Bin ich erst einmal dort unten angelangt, wird sich mein so lieblich und süß duftender Nektar in übel riechenden Urin verwandeln!«, klagte der Wein im Wehleiden seiner Sinne und fuhr fort: »Wenn all dieses Unheil nicht bereits genug der Zumutung für meine Wesenheit wäre, so steht mir danach auch noch die Spülung in eine düstere, weit verzweigte Kanalisation bevor - wo ich zusammen mit all der anderen übel riechenden Niedertracht, welche die menschlichen Därme dieser Stadt im Lauf ihrer Erdenjahre schon ausgeschieden haben, eine Dauer im Gefühl von trostlos ewiger Schmach zu dulden haben werde!«
Als Iram Uva seinen großen Platingral gerade anhob und zum Salut mit den versammelten Gästen des Neujahresfestes ansetzte, richtete sich der Nektar mit einer hoffnungsvollen, letzten Bitte gen Himmel.
»Oh himmlischer Schöpfer, ich bitte Euch sehnlichst um die gerechte Quittung für solch eine bodenlose Erniedrigung. Es kann nicht recht sein, dass sich das Leben von uns Kindern der Rebe durch Eure gekrönten Menschenwesen in so geringer Wertschätzung wiederfindet. Gütiger Himmel, bitte fügt es, dass wir Trauben nie mehr zu Wein gemacht werden!« Und so sollten die Launen der schöpferischen Natur die Bitte des Weins erhören - und beschließen ihrer nachzukommen. Nachdem der Lehnsherr die gegorene Traube aus dem Platingral getrunken hatte, stiegen ihm die Nachklänge ihres Geistes zu Kopf und füllten sein Gemüt trunkener, benebelter Benommenheit. Der Rausch hatte zur Folge, dass sich Iram Uva wie ein Narr verhielt - von einer, in die nächste Unüberlegtheit tappte - und Irrtum um Irrtum beging. Am darauffolgenden Morgen im eigenen Erbrochenen erwacht sowie von den Plagen starken Kopfschmerzes heimgesucht, ließ der oberste Lehnsherr zum Gemeinwohl der Stadt Amorem ein Gesetz in Kraft treten, dass allen Einwohnern fortan verbot den erlesenen Wein zu trinken. Von diesem Tage an lebten die süßen Trauben der Rebe glücklich und voll Ruhe belassener Zufriedenheit auf den hohen Hügeln, die sich für sie, in der Gnade des Herrn, rund um die weitläufigen, sonnigen Felder Amorems ergaben.
Kapitel 8
Der Feuerdorn
Die weltlichen Zeitgefüge hatten ergeben, dass am Rande der Handelsstraße, welche die Tiefen und Weiten des Nibelungenwaldes in zwei Hälften unterteilte, ein prächtiger Feuerdorn emporwachsen sollte. In den dunklen Schatten, die seine Schutzhecke mitsamt all den die kräftigen Stämme schützenden Verzweigungen warfen, fand sich eine verführerische, grüne Clematis vor, die sich um ihn rankte. Allmählich in der Höhe angelangt, blickte sie sich um und erkannte einen weiteren Feuerdorn, der so wie ihrer die Handelsstraße flankierte; jedoch am gegenüberliegenden Teil der Route.
»Uh, wow! Wie würde ich es schön finden, bis dahin zu wachsen, sodass ich auf beiden Seiten des Nibelungenwaldes schlanken könnte. Es reizt mich ungemein, mir diesen überaus stattlich beschaffenen Feuerdorn genauer anzusehen. Der Weg zu ihm würde mir obendrein auch noch die Gunst der Gelegenheit bereiten, dass ich die Handelsstraße passieren könnte«, dachte sich die Clematis im Zuge allen strategischen Geschicks. Eine ganze Weile beobachtete sie langsam und genau, wie sich jener anvisierte Feuerdorn noch höher als der ihre entwickelte. So begann sie ihren Pfad auf die andere Seite und näherte sich jeden Tag, wie jede Nacht ein Stückchen mehr dem gegenüber heimischen, toxischen Tiefwurzler.
Eines Tages sollte die Zeit reif sein und zu Tag eins werden, als sie endlich die weit verzweigten, starken Äste des benachbarten Feuerdorns erreichte. Zügellos, befreit und ungehemmt wand sie sich um einen, wie den anderen seiner Zweige und begann glückselig zu umgarnen, was sie für gut befand.
Doch bald schon hatten die Fügungen es vorgesehen, dass die Handelsstraße für Bauarbeiten aufgerissen werden sollte, sodass man den expandierten Zweigen der Clematis ein unweigerliches Ende bereitete.
Zwei der für den Bau eingeteilten Arbeiter stießen eines Morgens unversehens auf ihre wuchernden Ranken. Das lüsterne Hahnenfußgewächs versperrte ihnen den Weg, als sie mit dem Karren die Straße passierten. Die beiden Männer hielten an, erachteten es für Unkraut, zerbrachen dessen Trieb und rissen das gesamte Geflecht ab, um es im Graben landen zu lassen.
So kam es für die Clematis, wie es für so viele kommt, wenn sie mit dem, was sie außen haben, innerlich nicht zufrieden sind; doch deshalb nicht etwa innerlich einen Pfad finden, sondern außen einen Weg ins Glück und die Zufriedenheit suchen. Sie wurde vom Geist der Zeit ins Endliche verschlungen.
Kapitel 9
Im geordneten Chaos
Systeme, deren Bestandteile im Takt gleichmäßig zueinander ablaufen, bezeichnet man als synchron. Man beschreibt damit die Wechselbeziehung von Dingen, die sonst unabhängig voneinander existieren könnten. Der Musiker nennt es Rhythmus. Der Maler nennt es Komposition. Ein Physiker wiederum Simultanität. Und das Leben tauft es liebevoll, wenn auch von paradoxer Anmut: geordnetes Chaos.
Es war etwa viertel vor 12 gewesen an diesem Montag, unmittelbar vor der Mitternacht zum Dienstag, als Nymela hundemüde die Einfahrt ihres Elternhauses erreichte. Eigentlich war sie erst zum kommenden Vormittag mit ihnen zum Brunch verabredet gewesen und nach zwei Dritteln der Autofahrt hatte sie es schon ein wenig bereut Arthurs Angebot abgelehnt zu haben, bei ihm zu übernachten. Doch nach diesem ereignisreichen Tag schwebte ihr nur noch das prächtige, weiche Polsterbett durch die Sinne, in dem sie ihre halbe Jugend geschlafen hatte; samt der flauschigen Kaschmir-Bettwäsche, den Wolkenkissen und allem, was dazu gehörte. Als sie die Einfahrt passierte, begrüßte sie das alt vertraute, weiß-goldene Schild mit der Aufschrift »Wer die Liebe lebt, der wird vom Leben geliebt« in all seiner Bedeutsamkeit über einen sanften Strom der Wärme, welcher sich gepaart mit der andächtigen Aura von den zu ihrer linken und rechten erstreckenden, im Maß von jeweils 33 Morgen an Reben bemessenen Weinberge - auch in der Dunkelheit noch einprägsam bemerkbar machte. Die Natur hatte die Hänge mit einer weitreichend gedeihenden, blühenden Fauna und Flora gezeichnet und bildete für das reizende, Corall farbene Eigenheim ihrer Eltern ein schier malerisch anmutendes Panorama. Mit seiner in einem einladenden Vermillion getränkten Eingangstür und den markanten, von Teakholz geprägten Fensterläden sowie den auf den Fenstersimsen über liebevoll verzierte, Terrakotta-farbene Blumentöpfe eingepflanzten Gerbera erfüllte das Haus all seine Betrachter mit einer in dieser Art und Weise meilenweit einzigartigen, barmherzigen Eingebung. Nymela stellte den Motor ihres Wagens ab und blickte aufmerksam aus dem Autofenster, um zu prüfen, ob ihre Eltern noch wach waren, zu solch spät fortgeschrittener Stunde. Einzig aus dem Schlafzimmerfenster schien noch Licht. Wahrscheinlich war es bloß ihre Mutter gewesen, die noch auf war; schmökernd im Bett, oder im Halbschlaf vor dem TV, berieselt dösend. Gutgläubig, dass sie beim Hereinschleichen nicht ertappt werden würde, stieg Nymela aus dem Auto und lief zur Eingangspforte, wo sie sich den Ersatzschlüssel nahm, den ihre Eltern für alle Fälle unter der Fußmatte versteckt hatten. Die Haustür knarzte beim Öffnen, da ihre Scharniere schon seit Ewigkeiten nicht mehr geölt worden waren; wenn sie jemand also erwischen würde, dann jetzt. Vorsichtig schloss Nymela die Tür auf und zu ihrer Erleichterung blieb es im Haus zunächst still. Im Eingangsbereich wurde sie von den vertrauten Duftkomponenten begrüßt, in die sich das Heim ihrer Eltern, seit dem sie denken konnte, gehüllt fand. Zunächst eine Mischung, deren Wesen hauptsächlich von Noten aus Bergamotte und Lilie geprägt war – irgendetwas, dass sich aus der Vielfalt an selbst zusammengestellten Putzmitteln ergab, die ihre Mutter so gerne kreierte. Ging man vom Flur aus weiter in das Wohnzimmer, so wurde man von der herrlichen Wonne begrüßt, die sich aus dem weitläufig angelegten Garten des Grundstücks vernehmen ließ. Besonders markant waren die hier vorherrschenden Noten vom Ziersalbei, der Clematis, den vielen Duftnesseln, dem Sand-Thymian und den herrlichen Bartblumen. Sie vermischten sich mit dem Temperament der Waldmeistergewächse, den strahlend schönen Hortensien und Silberkerzen, sowie dem Storchschnabel und dem verlockenden Duft vom Phlox; all diese Einzigartigkeiten vermengten sich mit den herrlichen Akzenten, welche die prächtigen Lavendel und Fliedersträucher zu setzen wussten und filterten schlussendlich über die Nuancen der vor den Wohnzimmerfenstern eingepflanzten Katzenminze-Gewächsen zu dem Wunder der Vielfalt, dessen Harmonien nur die Gesetze der Natur imstande waren hervorzubringen.
Sie vermied es das Licht anzuknipsen, als sie weiter in die Küche lief. Mit den zarten Fingern fuhr Nymela zuerst langsam und gediegen über die Arbeitsfläche, deren Marmor aus Crema Marfil beschaffen war und dann weiter zu der langen Essenstafel, die man einst aus Wildeiche geschreinert hatte. Das durch die Fenster einfallende Mondlicht ließ sie erkennen, dass noch Geschirr vom Abendessen auf dem Tisch stand – Porzellanteller, zwei Gläser und eine bis auf den letzten Schluck geleerte Flasche Nectar Dei.
Gerade beschloss Nymela sich nützlich zu machen und das Gedeck zum Abwasch einzusammeln, als die Dunkelheit durch einen eingehenden Anruf auf ihrem Mobiltelefon zerrissen wurde.
„Looking out Across the nighttime The city winks a sleepless eye Hear her voice Shake my window Sweet seducing sighs Get me out Into the nighttime Four walls won’t hold me tonight If this town Is just an apple Then let me take a bite If they say Why (why?), why (why?) Tell ‚em that it’s human nature Why (why?), why (why?) Does he do me that way?“, ertönte die zeitlos schöne Stimme von Michael Jackson, welche mit dem Song „Human Nature“ ihren Klingelton zu ehren wusste. Nymela eilte zurück zum Eingang, wo sie das Telefon in der Handtasche verstaut hatte. Wie immer, wenn ihr Handy zu einem unpassenden Zeitpunkt bimmelte, schien es für sie in dem unsortierten Gemenge ihres Gepäcks schier unauffindbar zu sein. Gedanklich entsendete sie mehrere Flüche, für die ihre Eltern sie zu Kindesaltertagen wohl sprichwörtlich die Zunge hätten waschen lassen. So vergingen geschlagene anderthalb Minuten, die sie in der Dunkelheit brauchte, um ihr Telefon hervorzukramen, im Gefühl von ein paar Stunden. Als sie es im endlos erscheinenden Gewusel ihrer Handtasche schließlich fasste und die grüne Hörertaste zur Gesprächsannahme drückte, war der Anruf am anderen Ende der Leitung gerade beendet worden. Es war Arthur gewesen. Unmittelbar nach dem Versuch sie zu erreichen, hatte er auch schon eine SMS gesendet. „Bist du heile bei deinen Eltern angekommen? Du hattest doch versprochen dich zu melden. Ich mache mir solche Sorgen. Bitte gib mir ein Zeichen“,lautete die Nachricht. Nymela wusste um die Sanftmütigkeit, die von Arthurs romantischen Avancen ausging; und doch nervte es sie, dass er durch eine solch rosarote Brille auf ihr Verhältnis zu blicken pflegte. Es nervte sie auf eine Weise, die sich wohl irgendwo zwischen dem Leidensdruck, der von ihrem durch hormonelle Verhütungsmittel bedingten Östrogenmangel sowie dem Gesetz von push and pull begründen ließ und nicht zuletzt der Natur des Tinder-Zeitalters in Rechnung zu stellen war. Wie so viele Menschen stieß es sie ab, wenn man bereits in der Kennenlernphase romantische Gefühle zeigte. Wo lag dann noch der Reiz des Eroberns? Welche heißblütige Löwin mochte es schon, wenn sich ihr die Beute wie ein Aas ergeben präsentierte? Nymela wollte sich die Aufmerksamkeit eines Liebhabers wie eine Walküre erkämpfen, sie erringen. Scheinbar hatte Arthur ihr Prinzip noch nicht ganz verstanden! Für einen kurzen Moment folgte sie der fiebrigen Hitze, die den Geist ihres Gedankenflusses immer stärker temperierte. Sie brachte ihn zum Brodeln und Kochen, verwandelte ihn zu Dampf und benebelte ihre Gefühle; stieg in ihrem Verstand so weit auf, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Beinahe hätte sie sich zu der Kurzschlussreaktion verleiten lassen den Kontakt zu Arthur auf die denkbar verletzendste Art und Weise zu ghosten – als sie vernahm, dass die kräftigen Schritte ihres Vaters die Wendeltreppe herunterkamen. Der Lichtscheinwurf seiner Mag-Lite Taschenlampe leuchtete prüfend in das Wohnzimmer und darauffolgend in die Küche, ehe er schließlich raunzte: „Wer ist da? Ich bin bewaffnet! Versuchen Sie gar nicht erst irgendein Spielchen mit mir zu treiben. Gott ist und bleibt auf meiner Seite! Ihnen zu zeigen, warum ich beim Fest des Theseus zum vierten Mal in Folge zu Amorems König der Schützen gekrönt wurde, würde mir kein schlechtes Gewissen bereiten. Glauben Sie gerne, dass es mir sogar eine Ehre wäre!“ Wenngleich Nymela sich dem Ernst der Lage bewusst war, fand sie den einem Hütehund gleichenden Beschützerinstinkt, der von ihrem Vater ausging, in gewisser Weise niedlich und jene fast filmreife Übertreibung, die sich seiner ins Detail verliebten Wortwahl ergab, sogar amüsant. Entsprechend konnte sie einen Kicherlaut nicht verkneifen. „Alles gut, Papa. Ich bin’s bloß“, zwitscherte Nymela über ein der Situationskomik geschuldetes Paradoxon von beruhigender Heiterkeit. Ihr Vater atmete erleichtert auf und schaltete das Licht an. „Nymela? Oh liebes, hast Du mir einen Schrecken versetzt! Hieß es nicht, dass du erst morgen zu Besuch kämst? Mach doch beim nächsten Mal bitte wenigstens das Licht an, wenn du hereinkommst – und gib bestenfalls sogar vorher ein Zeichen von Dir“, keuchte er. „Ja, Paps. Bloß konnte ich mein Bett hier kaum erwarten. Und um ehrlich zu sein, geht mir das mit diesem Arthur, von dem ich euch neulich erzählt hatte, mittlerweile auch alles etwas zu schnell. Deshalb habe ich entschieden, nicht wie geplant bei ihm zu schlafen und bin heute Nacht direkt hier hergefahren. Du darfst deine Wumme übrigens gerne beiseitelegen. Ich bin kein Einbrecher, wie du siehst.“ Er nickte, grinste verschmitzt und legte das Luftgewehr auf die Kommode unmittelbar zu seiner linken. „Na dann. Schön, dass du da bist mein Schatz. Entschuldige bitte die Aufregung. Vom Abendessen ist leider nichts mehr übrig geblieben, doch im Kühlschrank befinden sich noch ein paar von Mamas berühmten Blaubeer-Bananenmuffins, insofern du Hunger haben solltest. Zwar von vorgestern, jedoch auch heute noch lecker!“
Nymela war erfreut, doch gab sich bescheiden, als sie in die Küche lief und das Geschirr spülen fortsetzte. „Klingt echt gut! Doch die will ich mir zuerst verdienen, Paps. Ich war gerade beim Abwasch.“ Ihr Vater beobachtete sie eine Weile mit allem Stolz, der seinen Augen möglich war zu erkennen, ehe er sprach: „Das hast du von deiner Mutter, mein Engel.“ Nymela schaute zur Seite und stutzte. „Was meinst du, Papa? Was habe ich von Mama?“
„Die Dankbarkeit sich selbst die kleinen Freuden der Welt zu verdienen. Und der Instinkt, dass du einen Ort, den du betrittst, zu einem besseren machen willst. Besser als du ihn vorgefunden hast. Deine Mutter ist genauso wie Du, was das angeht. Wenn sie vom Lauf des Lebens etwas zugeteilt bekommt, dann will sie zuerst für sich begründen können, dass sie es sich auch wirklich verdient hat. In etwa so wie du jetzt. Du spülst zuerst unser Geschirr von gestern Abend, bevor du dir Blaubeer-Bananenmuffins gönnst. Dabei wäre das nicht einmal nötig gewesen, mein Engel.“ Für einen Moment hielt ihr Vater inne und ließ seine Worte wirken. Nymela war es immer etwas unangenehm, wenn sie für Dinge wie diese, die sie eigentlich selbstverständlich erachtete, derartig gelobt wurde. Ihr Vater fuhr fort. „Du hattest von dem jungen Mann erzählt, den du gerade kennenlernst und bei dem du heute doch nicht übernachten wolltest. Wie war sein Name noch gleich?“ Nymela schaute erneut auf. „Arthur heißt er, Paps.“
„Du sagtest, dass dir mit ihm alles zu schnell ging, richtig? Ist das nicht im Prinzip genau dieselbe Sache, wie mit den Muffins und dem Abwasch, mein Engel? Vielleicht geht dir die Romanze mit ihm einfach zu schnell, da du dir die Aufmerksamkeit und all seine Zuwendungen erst noch verdienen möchtest.“ Nymela sagte einen Moment nichts, dachte über die Worte ihres Vaters nach und spülte dabei das letzte Geschirr sauber, ehe sie den Wasserhahn abdrehte, sich zu ihm wandte, lächelte und antwortete: „Kann schon gut sein, Paps. Wenn du mich fragst, dann ist das allerdings auch selbstverständlich. Liegt es nicht im Gesetz der Natur, dass die guten Zeiten nicht vom Himmel herab fallen, sondern von uns erst erschaffen werden müssen? Ich zumindest habe bisher noch niemanden getroffen, der wirklich glücklich aus sich heraus geschienen hat, wenn er im Leben alles geschenkt bekommen hat.“ Nymelas Vater legte die Stirn in Falten, räusperte sich und entgegnete: „Genau das meine ich. Du beeindruckst mich mit genau diesen Tugenden, die aus dir heraus sprechen, immer wieder aufs neue – genau wie deine Mutter es tut. Nichts im Leben ist wirklich selbstverständlich. Schon gar nicht deine Dankbarkeit. Die meisten Menschen nehmen lieber vom Lauf des Lebens, anstatt ihm etwas hinzugeben. Du machst das hingegen von Natur aus. Ich bin unglaublich stolz auf dich, mein Engel. Du bist ein Geschenk für die Welt. Jemand, der dem Chaos des Lebens mit einer eigenen Ordnung begegnet. Wenn dieser Arthur dir begegnet ist, deine Nähe sucht und dich in deinem Wesen zu erkennen und wertzuschätzen weiß, dann muss er ein guter Mann sein. Ich würde mich freuen einen lieben Mann an deiner Seite zu sehen.“ Nymelas Wangen färbten sich rosa fromm. „Danke, Papa! Du machst mich ja ganz verlegen.“ Sie zögerte einen Moment lang, trocknete das Geschirr ab und sortierte es ein. Schließlich öffnete sie den Kühlschrank und entnahm die Schale mit den Blaubeer-Bananenmuffins. Nach einem leidenschaftlichen Bissen beschloss sie die Unterhaltung aufzulösen und antwortete: „Das kann schon gut sein, dass er ein guter Mann ist, Paps. Doch was, wenn all seine voreiligen Avancen daher rühren, dass er in mir einen Weg sieht Ordnung in sein eigenes Chaos zu bringen? Was, wenn er sich selbst einfach nicht genug liebt und nicht imstande ist eine eigene Ordnung in seinem Leben zu begründen?“ Nymela umarmte ihren Vater. „Ich will ihn erst einmal besser kennenlernen. Den Status eines guten Mannes muss er sich erst einmal verdienen. Bevor ich ihn dir vorstelle, muss er schon etwas ganz Besonderes für mich geworden sein. Ich gehe jetzt schlafen, Paps. Bin total müde. Einen Muffin würde ich mir noch mit aufs Zimmer nehmen, wenn das in Ordnung ist?“ Er nickte, grinste und sprach schließlich: „Schlaf gut, mein Schatz. Und ja, das ist absolut in Ordnung!“
Nymela verabschiedete sich, lief die Wendeltreppen rauf und in ihr Zimmer. Endlich in ihrem Bett angelangt, genoss sie die letzten Happen ihres Blaubeer-Bananenmuffins und entschloss sich Arthur zu antworten.
„Hey, du. Ja, ich bin gut angekommen. Liege im Bett und musste gerade an dich denken, als ich mein Betthupferl (einen Bananenmuffin) vernascht habe. Schlaf gut! XOXO“
Und so drehte sich Nymela noch eine Weile im Gedankenkarrussel, ehe sie zwischen den Wolkenkissen ihres geliebten Polsterbettes einschlief, in den ersten Stunden dieses Dienstagmorgens.
Kapitel 10
Millennium
An einem jenseits der himmelblauen Weiten des Horizonts entlegenen Ort, der sich hoch oben, in einer Zone fernab aller Zeitgefüge und hinter den auch letzten weißen Wolkenbetten gelegen befand, schwebten einst zwei majestätisch schöne, große Falken in der Freiheit der ihnen ergebenen Lüfte. Nicht ein Wesen vermochte es so hoch oben zu fliegen; gar niemand war dem Antlitz der gleißenden Sonnenstrahlen jemals so nahe zugewandt gewesen wie sie! Dem Anschein nach hatte Gottes Natur nur ihnen diese Ebenen des Himmels zu eigen gemacht. Dies ließ sie eines gemeinsamen Glaubens bestärkt und in zweisamer Einheit vereidigt eins werden, sodass sie tagein, tagaus patrouillierende Kreise zogen, in den ihnen ergebenen Weiten ebenjenes ihrer mächtigen Schwingen ergebenen Reviers, welches sie mit allem Eifer verteidigten. So lag hier für die Klauen ihrer prächtigen, kräftigen Greife schließlich ein ihnen ganz eigenes Paradies untertan; ein Ort, der sich für niemanden sonst ohne weitere Hilfsmittel erreichbar fand – weder für die Menschen, noch für alle sonstigen der ihnen bis dorthin bekannt gewesenen, irdischen Wesenheiten. Eines schicksalhaften Tages jedoch bemerkten die beiden, zu ihrem Schrecken entsetzt, dass ein mysteriöses, geflügeltes Geschöpf in die hohen Weiten ihres entlegenen, heiligen Habitats vorgedrungen war. Auf seinem Federkleid zierte sich ein seltsam schönes Muster von rubinroten wie zutiefst blauen Farbschemata. Mit ausgebreiteten Flügeln glitt es in der schwerelosen Schwebe ihres ergebenen Reviers umher. So kam es, dass sich die Falken im Ehrgeiz verletzt aufmachten, um dem fremden Geschöpf zu folgen und ihm zu zeigen, dass sich in dieser Zone einzig Platz für sie allein wiederfand. Zum Staunen der beiden stieg der von mystisch schöner Anmut ummantelte Eindringling nach einigen Meilen der Verfolgungsjagd immer höher in den Weiten der immer dünner und kälter werdenden Lüfte empor – bald so hoch, dass selbst den zwei Falken der Atem ausgehen sollte; sie aufzugeben und wieder umzukehren hatten. Als die beiden zu dem seltsamen Wesen aufblickten, funkelte ihnen das hell strahlende Licht der reflektierenden Sonne über die Pracht von dessen wundersam leuchtendem Federkleid wie ein glänzender Edelstein entgegen, in dem sich die Freunde geblendet sahen. »Wer oder was bist Du?«, rief einer der beiden ehrfürchtig. Über ruhige und weite Flügelschläge flog die strahlende Kreatur langsam auf sie zu. Mit zunehmender Nähe erkannten sie, von welch majestätischer Größe sie in ihrer Gestalt beschaffen war. Auf transzendenter Ebene offenbarte sie sich in ihrer Erscheinung fast numinos; so wirkte sie doch überaus einschüchternd auf die Wahrnehmung der beiden Falken ein, da sie größer und kräftiger als jeder ihnen bekannte Vogel daher kam, doch dank ihres schillernd strahlenden Gefieders ebenso in einen Bann der Bewunderung zu ziehen wusste. »Ich bin der Phönix – Bote vom Anfang und Ende aller Gezeiten«, lautete die Antwort. »Ein Phönix? Im Namen der Götter! Soweit mir bekannt ist, seid Ihr in Eurem Ansehen unlängst einer Legende gleich; ein sagenumwobenes Wesen, dass seit allem Gedenken auf Erden Mythen umrankt und über das man seit jeher in Geschichten zu schreiben pflegt! Sagt, woher kommt Ihr und wo nistet Ihr, oh heiliger Phönix? Wieso nur haben wir Euch hier noch nie zuvor gesehen?«, fragte der andere der beiden Falken stutzig und hielt sich einen der Flügel schützend vor das Gesicht, um in all der übernatürlichen Erscheinung, die der strahlende Phönix abgab, nicht zu erblinden. »Meine Heimat liegt fernab dieser Weiten, an einem für die meisten auf Erden heimischen Geschöpfe zu Lebzeiten schier unerreichbaren Ort. Seht, ich stehe im Dienst der Symbolik, welche sich der unendlichen Schlaufe vom Gefüge der Zeiten ergibt; unsterblich, in der Schwebe zwischen dem Dies und Jenseitigen. Mein Wesen ist von omnipräsenter Natur; ich bin gleichsam überall wie nirgendwo und diene der Erde im Zeichen vom allgegenwärtigen Reich des heiligen Edens, dessen Botschaft sich im Pfad der Liebe findet. Also fürchtet euch nicht, denn ich komme in friedlicher Absicht.« Während der Phönix sprach, war er auch schon aufgebrochen, hatte die Wolkendecken durchschossen und befand sich im Sturzflug Richtung Erde. Die Falken ereiferten sich einige Weile in aller Mühe bei dem tapferen Versuch, seinem Tempo Stand zu halten und in näherer Reichweite hinter ihm zu gleiten, bis sie erschöpft die gestreckten Flügel sinken lassen mussten und den Phönix nur noch mit großem Abstand auf seiner Route verfolgen konnten. Er überquerte im Zuge seines Fluges sowohl Wüste als auch Meer, ehe sein Weg ihn in weiterer Ferne über die Dünen hin zu einem großen Hügel führte, wo sich eine Ansammlung von Menschen wiederfand, die dem kalendarischen Anlass der Wintersonnenwende zu Ehren ein Fest feierten.