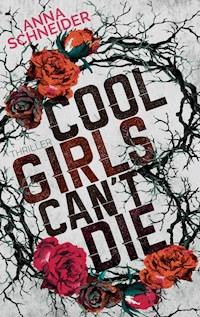9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Unverschämtheit, Ich zu sagen Das »Ich« ist politisch nicht im Trend. Wer sich zur individuellen Freiheit als Ideal bekennt, steht schnell im Verdacht des rücksichtslosen Egoismus. Zu Unrecht, meint die junge Juristin und Journalistin Anna Schneider. In ihrem Debattenbuch schwärmt und wirbt sie im Dialog mit großen Denkerinnen und Denkern des Liberalismus für die Freiheit, das unbeliebte Ideal. Sie prangert antiliberale Tendenzen im politischen Diskurs der Gegenwart an und sucht eine Erklärung für die Freiheitsskepsis, die sie den Deutschen diagnostiziert. Ihr Buch ist eine Einladung zur Feier des Individuums, eine Ode an die Freiheit des mündigen Subjekts, an das »Ich« im »Wir«. Denn ohne Ich, so Schneider, gibt es keine Freiheit, und ohne Freiheit kein Ich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Das »Ich« ist politisch nicht im Trend. Wer sich zur individuellen Freiheit als Ideal bekennt, steht schnell im Verdacht des rücksichtslosen Egoismus. Zu Unrecht, meint Anna Schneider. In ihrer Streitschrift schwärmt und wirbt sie für die liberale Idee, für das selbstbestimmte, freie Individuum, für die unabhängige »Einzelne«. Und sie führt aus, wie die liberalen Werte, auf denen unsere demokratische Ordnung beruht, vom identitätspolitisierten »Snowflake«, von Verbotsfolklore und Paternalismus bedroht werden. Gegen alle Versuche, Freiheit zu beschneiden, zu relativieren und neu zu definieren, sagt sie: »Freiheit ist Freiheit« und lädt ein zur Feier des Individuums.
Anna Schneider
Freiheit beginnt beim Ich
Liebeserklärung an den Liberalismus
Für mein zweites Ich, auf dass sie die Freiheit versteht, die ich meine.
Inhalt
Freiheitsgrade, oder: Was ich meine, wenn ich Freiheit sage
Freiheitserwachen, oder: Das liberale Ich ist keine Schneeflocke
Die Einzige, oder: Mean Girl Ayn Rand
Freie Radikale, oder: Vom (Un-)Sinn einer liberalen Partei
Literatur
Anmerkungen
Freiheitsgrade, oder:
Was ich meine, wenn ich Freiheit sage
Freiheit ist Freiheit. So einfach ist das. Einem freien Menschen kann es egal sein, was andere von ihm denken; mir ist es egal. Aber es amüsiert mich immer wieder aufs Neue, wie einfach es ist, Groll auf sich zu ziehen, wenn man nur ein bisschen aus der geistigen Mehrheitsreihe tanzt. Dazu genügt es schon, sich als Liberaler (oder, Gott behüte, als Libertärer) zu outen. Einfach mal laut »Freiheit ist Freiheit« sagen und ich garantiere, die Widerrede folgt auf dem Fuß: So gehe das doch nicht. Freiheit könne man nicht für sich selbst denken. Freiheit sei notwendig beschränkt. Freiheit funktioniere nur im Kollektiv. Nonsensaussagen überall. Und je öfter auch sogenannte Liberale mit dem Satz »Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt« um sich werfen, umso mehr denke ich mir: Die Freiheit des anderen endet dort, wo die Freiheit des Einzelnen beginnt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Definitionen liegt in der Perspektive. Entweder man geht immer und ganz grundsätzlich von der Freiheit des Individuums aus. Oder aber man betrachtet diese individuelle Freiheit als Bedrohung der Freiheit anderer. Ich bevorzuge Ersteres, weil Letzteres viel zu leicht als Freibrief für jede Art der Einschränkung herangezogen werden kann – und oft auch wird. Wer Freiheit in erster Linie als Gefahr definiert, negiert sie. Und an genau diesem Punkt steht die deutsche Debatte: Freiheit, so scheint es, muss zumindest mit einem Beipackzettel, wenn nicht gar mit einem Warnhinweis versehen sein, damit die Hasenherzen beruhigt sind. Willkommen in der Angstgesellschaft.
Ich sage es gleich vorweg: Freiheit ist tatsächlich nichts für Feiglinge. Sie ist eine Zumutung, mit der man sich selbst und den anderen fordert. Denn sie anzunehmen setzt gegenseitiges Vertrauen voraus: Vertrauen, dass der jeweils andere fähig ist, sich seines Kopfes und somit seiner (Gedanken-)Freiheit so zu bedienen, dass daraus etwas Positives entsteht. Dieses Vertrauen ist es, was den mündigen Bürger unter seinesgleichen überhaupt erst heranwachsen lässt. Wenn der Mensch nie lernt, von seiner Gedankenfreiheit Gebrauch zu machen, ist er nicht wirklich frei, für sich selbst zu wählen. Zunächst muss man sich also aus eigenen Stücken für die Unabhängigkeit entscheiden. Sei du selbst, sonst macht es keiner. Ich jedenfalls brenne für die Freiheit.
Denn Freiheit ist fantastisch. Sie bedeutet, von niemand anderem abhängig zu sein oder bevormundet zu werden, niemandes Willkür zu unterliegen und Entscheidungen für sich selbst, nach den eigenen Vorlieben und Vorstellungen, treffen zu können. Freiheit ist Mündigkeit, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Und Offenheit. Wer im Sinne der Freiheit lebt, trägt natürlich auch das Risiko, das mit seinem Handeln verbunden ist, nämlich das Risiko des möglichen Scheiterns – das ist, wenn man so will, die negative Seite der Medaille. Nimmt man allerdings die Verantwortung und Herausforderung, die Freiheit impliziert, an, merkt man schnell: Ohne Freiheit ist alles nichts, denn nur ein freier Geist kann ganz bei sich selbst sein. Und nur wer bei sich selbst ist, legt seine innersten Möglichkeiten frei. Eine offene Gesellschaft lebt von der Originalität, der Geisteskraft und der Spontanität des Individuums, nicht von der Trägheit, Stupidität und Mittelmäßigkeit der Masse, die den Einzelnen durch Vorschriften einschränkt und in seiner Entfaltung hemmt.
Es versteht sich von selbst, dass nicht in jedem Individuum ein Genie steckt, auf das die Welt gewartet hat. Ich bin mir zum Beispiel nicht ganz sicher, wie viele Paolo Coelhos die Welt noch verkraften kann. Doch schon die – eher nicht so große – Herausforderung, bessere Bücher zu schreiben als Coelho, spornt an; sie entfacht den kreativen Wettbewerb. Ich möchte nicht verschweigen, dass Menschen in Freiheit zu viel schlimmeren Dingen imstande sind als dazu, schlechte Bücher zu schreiben. Indem Freiheit dem Einzelnen ermöglicht, »nein« zu sagen, eröffnet sie ihm natürlich auch die Möglichkeit, Böses zu tun. Das Böse ist somit eine Funktion und mögliche Folge der Freiheit: Freiheit kann auch das Böse hervorbringen. Aber: Unfreiheit bringt nur das Böse hervor. Denn Freiheit setzt frei, ohne den Einzelnen von der Verantwortung für seine Taten zu entbinden. Wer durch sein Handeln die Trennlinie zwischen seiner Freiheit und der Freiheit des anderen überschreitet, hat – in einem Rechtsstaat – mit Konsequenzen zu rechnen. So erlaubt Freiheit Selbstmord, aber nicht Mord. Freiheit und das absolut Böse sind logisch inkompatibel.
An dieser Stelle lohnt ein kurzer Ausflug in die liberale beziehungsweise libertäre Ideengeschichte. Der Soziologe und Philosoph Friedrich August von Hayek bringt das Wesen der Freiheit folgendermaßen auf den Punkt: Freiheit ist die Abwesenheit von Zwang durch andere Menschen. Eine so knappe wie richtige Definition: Freiheit ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Noch präziser fasste es der Ökonom und Philosoph Murray Rothbard, der das System reiner Freiheit und also der liberalen Gesellschaft als eine Gesellschaft beschreibt, »in der (…) keines Menschen Eigentum an seiner Person oder materiellen Dingen belästigt oder verletzt wird und in der niemand in dieses Eigentum eingreift«.1 Er benennt damit die Essenz der Freiheit: Niemand gehört jemand anderem, jeder gehört einzig und allein sich selbst. Freiheit ist Selbsteigentum.
Was wir hier vor uns haben, ist der radikale Kern eines negativen Freiheitsbegriffs: die Abwesenheit von Zwang und Einschränkungen. Die Unterscheidung von negativer und positiver Freiheitskonzeption geht auf den Philosophen Isaiah Berlin zurück, der in diesem Zusammenhang zwischen der Freiheit »von etwas« von der Freiheit »zu etwas« unterscheidet. Erstere, also die negative Freiheit, hat den Vorteil, dass sie – wie eben ausgeführt – klar und deutlich ist. Die positive Freiheitskonzeption hingegen zielt auf die faktischen Möglichkeiten ab, derer es bedarf, um die eigenen Lebensentwürfe auch realisieren zu können. Es geht um das, was man in diesem seinen freien Bereich tun möchte – um Selbstentfaltung also. Diese sogenannte positive Freiheit geht von einem anderen Menschenbild aus: Der Einzelne gilt ihr nicht als sein eigener Herr, der nur durch natürliche Grenzen beschränkt wird (niemand kann etwa drei Meter hoch springen), sondern als Teil eines größeren Ganzen. In der Folge wird der Staat nicht als »Nachtwächterstaat« entworfen, vielmehr wird sein Tätigwerden zur Sicherung von Freiheitsrechten erwartet – und verlangt. Das macht die positive Freiheitskonzeption zu einem Fass ohne Boden, weil sie im Grunde grenzenlos ausgeweitet werden kann. So wird Freiheit als Begriff beliebig, eine Worthülse, in die man alles packen kann, was politisch erwünscht ist. Doch Freiheit ist kein Mittel zum Zweck, sie ist immer Selbstzweck.
So steht es in dem Manifest der liberalen Freiheitsidee, John Stuart Mills »Über die Freiheit«. Freiheit als Prinzip verlange Geschmacks- und Strebensfreiheit, liest man da; Freiheit, seinen Lebensplan dem eigenen Charakter entsprechend zu entwerfen, zu tun, was man wolle, vorbehaltlich der folgenden Konsequenzen und ohne sich von anderen Zeitgenossen stören zu lassen – solange ihnen nicht geschadet werde –, auch dann, wenn sie dieses Verhalten für »verrückt, verderbt oder falsch« halten sollten.2 »Die einzige Freiheit, die diesen Namen verdient, besteht darin, unser eigenes Wohl auf unsere eigene Weise zu verfolgen, solange wir dabei nicht die Absicht hegen, anderen das ihre zu nehmen oder ihre Bemühungen, es zu erlangen, behindern.«3 Diese Feststellung lässt sich leicht missverstehen, doch sie meint eben nicht dasselbe wie die oft bemühte Floskel »die Freiheit des Einzelnen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt«. Natürlich kann es passieren, dass die Freiheitsentfaltung des Einzelnen die Freiheit eines anderen begrenzt. Entscheidend ist, dass das aber nicht das Ziel des Einzelnen ist, sondern ein womöglich unschöner Nebeneffekt. Wenn jemand etwa auf eine begrenzte Ressource zugreift, die auch ein anderer nutzen will, mag das dessen Freiheit begrenzen – aber das ist nicht das Ziel. Mill sagt, der freie Mensch hat die Begrenzung der Freiheit des anderen nicht zum Ziel. Aber er sagt nicht, dass der freie Mensch auf eigene Ziele verzichten muss, weil er damit vielleicht andere einschränkt.
Niemand könne gezwungen werden, schreibt Mill weiter, »etwas zu tun oder zu unterlassen, nur weil es so für ihn besser wäre, ihn glücklicher machen würde oder weil es nach der Meinung anderer klug oder sogar richtig wäre (…).4 Über sich selbst, über seinen eigenen Körper und Geist ist der Einzelne souverän.«5 Mill ging es also einerseits darum, den Fürsorgestaat in möglichst enge Schranken zu weisen. Die Tugenden, die nur das Individuum in sich trägt, würden ansonsten von einem überbordenden Nanny-Staat erstickt. Doch andererseits – und das ist nicht weniger wichtig – schrieb Mill von der »Tyrannei der Mehrheit«: Mitte des 19. Jahrhunderts kam es in Großbritannien in mehreren Schritten zur Ausweitung des Wahlrechts, wodurch die Möglichkeit, sich demokratisch zu betätigen, für den Einzelnen wuchs. Genau diese frisch eroberte Macht des Volkes machte Mill skeptisch. »Das Volk, das die Macht ausübt, ist nicht immer dasselbe Volk wie das, über welches sie ausgeübt wird, und die ›Selbstregierung‹, von der die Rede ist, ist nicht die Regierung des Einzelnen über sich selbst, sondern jedes Einzelnen durch alle Anderen«6, schreibt Mill. Zudem bedeute der Wille des Volkes praktisch den Willen von des Volkes zahlreichstem oder aktivstem Teil, nämlich der Mehrheit.7 Also brauche es für das freie Individuum nicht nur »Schutz gegen die Tyrannei der Behörde«, es brauche auch »Schutz gegen die Tyrannei der vorherrschenden Meinung und des vorherrschenden Empfindens; gegen die Tendenz der Gesellschaft, mit anderen Mitteln als zivilrechtlichen Sanktionen ihre eigenen Ideen und Praktiken als Verhaltensregeln denen aufzuzwingen, die eine abweichende Meinung haben«.8
Erschienen im Jahr 1859, hat Mills Hauptwerk nichts an Aktualität eingebüßt. Schon hört man die Angstliberalen der Jetztzeit bei seinen Freiheitsdefinitionen krakeelen – doch auch das hat Mill vorhergesagt. »Selbstbestimmung gehört nicht zum Ideal der Sittlichkeitsapostel und Gesellschaftsreformer, sondern wird eher mit Neid von ihnen betrachtet als ein störendes und vielleicht sogar rebellisches Hindernis gegen die allgemeine Annahme dessen, was diese Reformer nach eigenem Urteil als das Beste für die Menschheit ansehen.«9 Wenn Freiheit nach all diesen Ausführungen also immer die Freiheit von etwas ist, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern Zwang überhaupt jemals gerechtfertigt werden kann. Kann er, würde Mill antworten. So gebiete es die Gerechtigkeit, allen Individuen ein Mindestmaß an Freiheit einzuräumen. Alle Individuen müssen, zur Not eben mit Gewalt, daran gehindert werden, irgendjemand anderem seine Freiheit zu nehmen.
Ich habe so meine Probleme mit dem Begriff Gerechtigkeit, weil er zu oft als Instrument der Gleichmacherei verwendet wird. Außerdem halte ich es mit dem Rechtswissenschaftler Hans Kelsen und möchte aus einem meiner liebsten Bücher, »Was ist Gerechtigkeit?«, zitieren: »Es ist klar, dass es eine gerechte, das heißt das Glück aller gewährleistende Ordnung nicht geben kann, wenn man mit Glück, dem ursprünglichen Sinne des Wortes gemäß, das subjektive Gefühl, das ist dasjenige meint, was ein jeder darunter für sich selbst versteht. Denn dann ist es unvermeidlich, dass das Glück des einen mit dem Glück des anderen in Konflikt gerät«10, schreibt Kelsen. Auch die Formel des englischen Philosophen Jeremy Bentham, der das größte Glück der größten Zahl zu seinem Leitprinzip erhebt, ist für Kelsen nicht anwendbar, »wenn unter Glück ein subjektiver Wert verstanden wird«.11 Zum Glück lässt sich die Notwendigkeit, den Handlungsspielraum des Einzelnen einzuschränken, auch begründen, ohne sich auf Gerechtigkeit zu beziehen: Nicht die Gesellschaft oder die Gerechtigkeit – oder welche scheinbar moralisch erhabene Instanz auch immer – verbietet dem Individuum zu töten, zu stehlen oder zu brandschatzen; das jeweilige Verbot ergibt sich direkt aus dem individuellen Recht des anderen Menschen auf sein Leben oder auf sein Eigentum. Wir haben es also nicht mit einer Beschränkung der Freiheit des einen zugunsten der Freiheit des anderen zu tun, sondern mit einer klaren Abgrenzung der jeweilig ebenbürtigen Rechte. Insofern ist das Diktum, Freiheit sei niemals absolut, ein Irrtum.
Damit zunächst genug der Ideengeschichte. Liberalismus als politische Weltanschauung, die die Freiheit des einzelnen Menschen in den Vordergrund stellt, erschöpft sich nicht darin, den Blick in die Vergangenheit zu richten und durchzubuchstabieren, was Freiheit einmal war. »Der Liberalismus ist keine abgeschlossene Lehre, er ist kein starres Dogma«12, schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises. Insofern ist es würdig und recht, im Nachdenken über die Freiheit die Offenheit walten zu lassen, die dem Liberalismus selbst als wesentliches Merkmal entspricht. Und dennoch werde ich regelmäßig hellhörig, wenn insbesondere Intellektuelle erklären, Freiheit müsse angesichts einer pandemischen Lage, des Klimawandels oder der Anforderungen einer sozial gerechten Welt neu gedacht werden. Denn was daraus meistens folgt, ist nicht das Neudenken der Freiheit, sondern das Arbeiten an ihrer Abschaffung. Wer dagegenhält und darauf pocht, dass die Grundzüge des individualistischen Freiheitsbegriffes eben nicht geändert werden müssen, weil sie an sich sehr super sind, sieht sich Vorwürfen eines »Vulgär-« oder »Hyperliberalismus« ausgesetzt.