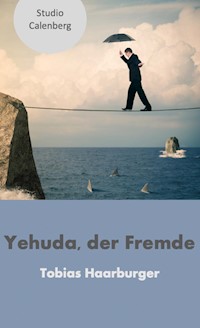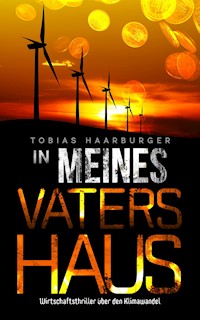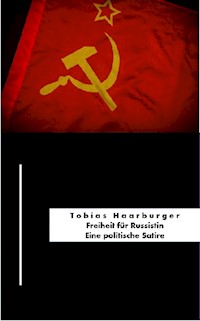
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Rossistan ist ein imaginärer Staat, eine ehemalige sozialistische Diktatur, in den Händen von Oligarchen und dem mächtigen Nachbarn. Rossistan liegt irgendwo in Südosteuropa. Das Land befindet sich am Rande des Verfalls. Dmitri Andrejewitsch Goldstein hat eine Idee, wie er eine Revolution anzetteln kann, und tatsächlich, es gelingt ihm. Die geniale Polina Kovalevskaya führt das Land in den Kapitalismus. Der große Nachbar schäumt. Sie wollen Rossistan in ihre Union integrieren. Ein Krieg der Manipulationen entbrennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Ähnliche
Freiheit für Rossistan
Titel SeiteTitel Seite
Tobias Haarburger
Freiheit für Rossistan
Eine politische Satire
Copyright: © 2021 Tobias Haarburger
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
.
Kapitel 1
Ich befinde mich in einer Zelle, in einer Gefängniszelle, um genau zu sein. Wenn kein Wunder geschieht, werde ich morgen früh um sechs Uhr erschossen. Die Präsidentin, die mich begnadigen könnte und das sofort tun würde und die meine enge Freundin geworden war, weilt außerhalb des Landes. Sie weiß nichts von meinem Schicksal. Der Vizepräsident, der sich bestimmt unwohl fühlt angesichts meiner Lage, in die er mich, untertänig wie er geworden war, gebracht hatte, vermag nichts zu unternehmen. Man munkelte etwas, wie mir von meinem mitleidigen Wärter zugeflüstert wurde, von einem Flug nach Irkutsk des Vizepräsidenten. Er wollte bei meiner Hinrichtung nicht im Lande sein.
Wie auch immer, ich hege die Hoffnung auf eine Begnadigung. Ich war schon immer etwas gutgläubig, das muss ich zugeben, aber ich warte nun, bis sich die Tür meiner Zelle öffnet und ich hinaus in die Freiheit und nach Hause kann. Ich sehne mich nach Ekatarina, die ich vom ersten Tage an Kitty nannte und nach unserem Kind, das wir beide so sehr lieben. Unser Töchterchen heißt Yam, wie das Meer. Als ich eintrat gab man mir ein Handtuch, Seife, eine Zahnbürste, Zahnpasta und frisches Bettzeug. Man legt Wert auf Sauberkeit in dieser Anstalt. Irgendwie trug auch das dazu bei, dass ich die Hoffnung nicht verloren habe.
In dieser Zelle bin ich alleine. Zu Beginn empfand ich das als angenehm. Wer weiß, auf wen man in so einem Gefängnis trifft, aber nun, nach einer Woche wird mir Fade, mir fehlt es zuzuhören und mir fehlt es überhaupt einen Menschen zu sehen. In den Hof darf ich an einem Tag in der Woche für eine Stunde. Wie soll man da frohen Mutes bleiben? Um ehrlich zu sein, so wie ich das triste Gebäude mit seinen mürrischen und teilnahmsloses Wärtern angetroffen habe, stellte ich es mir auch vor. Man lebt in einem engen Rhythmus in einem Gefängnis und vor allem ich lebe in quälender Monotonie. Vielleicht erzähle ich ihnen einfach was geschehen ist, das lenkt mich ab und verkürzt die Zeit, bis es sechs Uhr wird. Was ich mich jedoch Frage ist, wird mich Kitty noch einmal besuchen, wenn es doch nichts wird mit der Begnadigung? Nun gut…
Zunächst, warum bin ich überhaupt in dieser Zelle? Also…wir leben hier in einem Osteuropäischen Land, in Rossistan, um genau zu sein. Was ich gleich zu Beginn sagen will, denn das ist mir wichtig, ich bin ein Außenseiter und kann mich nur mit anderen Außenseitern einlassen. Was niemand vermutet ist, ich habe eine Scheu vor Menschen. Niemals sehe ich mich im Zentrum einer Ansammlung von Menschen. Ich gehöre zu jenen, die am Rande zu stehen pflegen und das Geschehen beobachten, das heißt, sie stellen sich von sich aus an den Rand und hören zu, es ist nicht so, dass sie dazu gezwungen würden. Das erwähne ich auch deshalb, weil dieser Charakter, der im Übrigen durchaus nicht selten ist, zu dem ganzen Verlauf meiner Geschichte etwas beiträgt. Wäre ich nicht so unauffällig und um diese Eigenschaft geht es, wäre die ganze Sache anders verlaufen, dessen bin ich mir sicher.
Um all das zu erleben, was mir widerfahren ist, muss man unauffällig, oder noch besser, nicht existent sein. Ich will nicht unbescheiden sein, aber ich war schon einigermaßen bekannt geworden in dem verrückten letzten Jahr, aber wirklich sichtbar, ich meine für alle Bürger, wurde ich erst, als ich vor dem Gericht erschien und das war vor einer Woche und sie sehen schon, es ging alles sehr schnell, was im Widerspruch zu den sonstigen Abläufen in der Volksrepublik Rossistan steht, in dem alles Leben erstarrt ist und jede Veränderung als verdächtig gewertet wird. Bis zu den Veränderungen jedenfalls, von denen ich berichten werde. Sie mögen es mir verzeihen, dass ich mich bisher kurz fasste doch befinde ich mich entgegen meiner eben gemachten Mitteilung in einer gewissen Nervosität. Es sind noch zwölf Stunden.
Mein Name ist Dmitri Andrejewitsch Goldstein. Ich bin, wie mein Name es vermuten lässt, Jude. Bis vor Kurzem versah ich meine Arbeit als Sekretär des Kabinetts der Regierung meines Landes. Ich wurde geachtet und kletterte Stufe um Stufe nach oben. Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt. Vor zwei Jahren begann ich als ein gewöhnlicher Assesor meine Laufbahn im Außenministerium. An der Universität unserer Stadt habe ich Jura studiert, oder das, was man hier dafür hält. Wir bekamen ein paar juristische Prinzipien mitgeteilt, etwas Römisches Recht und praktische Übungen wurden durchgeführt. Ich vermute der Regierung sind Anwälte, Staatsanwälte und Richter, die sich mit den Feinheiten der Rechtsprechung auskennen recht ungeheuer. Bisher jedenfalls, es hat sich ja vieles verändert.
Die Gründe für meine Hinrichtung, um noch einmal darauf zurück zu kommen, liegen durchaus in einem ernsten Vergehen, das muss ich eingestehen, wobei es nicht alleine mein Vergehen war. Ich brachte eine Entwicklung ins Rollen, die wiederum bestimmte Veränderungen auslöste und das ist eine harmlose Beschreibung dessen, was geschehen ist und wie ich eben schon sagte, Veränderungen gelten als prinzipiell verdächtig. Aber zu meiner Entlastung kann ich sagen, - Ich wurde hineingezogen, es waren alleine die Umstände - sie verstehen. Es sollte zum Besten unseres Landes sein.
Wenn ich nun aufs Neue so nachdenke, wird es, oder kann es nicht zu meiner Erschießung kommen. Das hat gewisse Gründe, über die ich jedoch nicht sprechen darf. Vielleicht überwiegt aber auch nur meine stetige Hoffnung, man kann es auch Naivität nennen, dass sich alles zum Guten wenden würde. Also ich werde sehen, wie alles kommt und bleibe vorerst bei meiner mir eigenen Heiterkeit.
Nicht dass sie denken ich wäre ein Staatsfeind, nein dafür bin ich viel zu feinfühlig. Gleichwohl sollte ich einen anderen Namen wählen und überlegte mich Michail Alexandrowitsch Bakunin zu nennen, was wegen der Bedeutung von Bakunins Wesen passend, aber nicht besonders klug wäre und einige Kümmernis meinerseits nach sich ziehen würde. Bakunin war ein großer Anarchist. In einem gewissen Sinne war ich das auch, wenn auch anders. Ich verwarf die Idee mit dem Bakunin. Man fürchtete Protest, ja das Regime war damals längst paranoid geworden, jedenfalls sein Generalstaatsanwalt, um es unumwunden auszudrücken, so dass man alleine wegen mir die Anarchie fürchtete, wegen mir, oder diesem imaginären Michail Alexandrowitsch Bakunin, den es nie gab, außer dem echten natürlich, wie albern und kleinmütig. Nun ja, zu diesem Zeitpunkt war ich zugegebenermaßen nicht mehr alleine. Ohne mein Zutun bekam ich Verbündete und das schlimmste war, sie kamen aus dem gefürchteten Ausland und ihre Anzahl nahm ständig zu. Mir war nicht wohl dabei, das können sie mir glauben. Wir sind hier auch nicht gerade eine Demokratie, sie dachten es sich wohl schon…das sollte ein Scherz sein, aber lassen wir es besser, es ist nicht der Moment Scherze zu machen.
Aber noch einmal zu mir: Wegen meiner Zurückhaltung, meiner Sorgfalt und der Tatsache, dass ich mich stets zurückzunehmen wusste, auch wegen meiner Stille und Loyalität, ja - Loyalität, wurde ich in den nur zwei Jahren meiner Anstellung mehrmals befördert. Zuletzt war ich mit sechsundzwanzig Jahren der Sekretär des Kabinetts, ich habe es, glaube ich schon erwähnt. Entschuldigen sie, ich bin einfach nervös. Und noch einmal, im Grunde genommen geschah wirklich alles ohne meine Absicht.
Ein Zufall, ein kleiner dummer Zufall, wie er sich jeden Tag ereignet und dem ich lange keine Bedeutung beimaß, löste alles aus. Übrigens warte ich auf meine Henkersmahlzeit. Würde sie nicht kommen, wäre das ein gutes Zeichen. Auch vernehme ich bisher nichts. In der Hoffnung es würde Schwierigkeiten bereiten und die ganze Sache aufschieben, habe ich mir ein ausgefallenes indisches Gericht, nämlich Fisch-Curry mit Idiappam und zum Nachtisch Gulab Jamun gewünscht. Soweit mir bekannt ist, gibt es in unserer tristen und farblosen Hauptstadt nicht ein indisches Restaurant. Natürlich ist es möglich man stellt mir in einem Blechteller eine Gemüsesuppe mit altem Brot hin, wie man es seit meiner Einweisung macht, was natürlich eine Enttäuschung wäre.
Also zurück… um dieses Land zu verstehen, möchte ich einen Satz zitieren, den ich bei Tolstoi gelesen habe, er lautet: Niemand ist zufrieden mit seinem Vermögen, aber jeder ist zufrieden mit seinem Verstand. Die Oligarchen und das ist nicht von Tolstoi, sondern von mir, besitzen bei uns ein großes Vermögen, aber wenig Verstand. Das klingt zugegebenermaßen nicht geistreich, sondern nach dem Missmut des kleinen Mannes, es trifft aber zu, weshalb ich das Tolstoi Zitat ja bemühe.
Die Volksrepublik Rossistan hatte bis zu den Verändrungen ein Machtzentrum, so nennt man das in Amerika, zu dem ich später noch kommen werde. Das bestand aus dem Präsidenten und Verteidigungsminister, mit Namen Yegor Ivanowitsch Wójcik, dem Vizepräsidenten und Finanzminister Nikolai Alexandrovich Stojanović, dem ersten Oligarchen, so nannte er sich tatsächlich, Milan Vesely und den beiden anderen Oligarchen, nämlich Oligarchin 2 Frau Boglárka Baráth und Oligarch 3, Zoran Korošec. Diese fünf Menschen entschieden über das Wohl und Wehe unseres ehemals stolzen Landes. Die anderen Ministerinnen und Minister, nahmen ehrfürchtig deren Anweisungen entgegen und begehrten niemals auf. Genau weil sie dieses, ohne jemals Missfallen zu erregen, zu tun bereit waren, hatte man sie auf ihre hohen Posten berufen. Verstehen durfte niemand von denen sein tägliches Geschäft.
Es herrschte im Übrigen eine strenge Ordnung in der Regierung, ich kann das durchaus bezeugen, jedenfalls herrschte diese Ordnung bis zu dem Augenblick, bis die von mir zufällig und unbedacht ausgelöste Revolution alles auf den Kopf stellte, die im Übrigen noch anhält und ich hoffe ich erlebe deren siegreiches Ende.
Das Alleinsein macht mir zu schaffen, um ehrlich zu sein. Einmal kam eine Maus in meine Zelle. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich über ihren Besuch gefreut habe. Sie flutsche unter der Tür zu meiner Zelle durch, einfach so. Ich warf mich geradezu auf den Boden, wir sahen uns an, prüften uns und die Maus näherte sich. Ich versuchte sie mit dem einzigen Stückchen Speck, das ich aus der Suppe vom Vortag fischte zu ermuntern zu bleiben. Alleine ich fürchte, diese Zelle war der Maus zu trostlos und außerdem verschmähte sie den Speck, was ja tief blicken lässt und etwas sagt, über die Kunst des hiesigen Cuisinier. Nach einer Stunde, in der mir die Maus ihre Gesellschaft zu Teil werden ließ, verließ sie meine Zelle schon wieder und entfernte sich wie sie gekommen war. Sie zog es wohl vor unter anderen Mäusen und nicht unter einem blassen Menschen zu sein. Vielleicht kommt sie einmal wieder. Andere Tiere, die mich besuchten, waren Ameisen, eine Wespe, Stechfliegen, es müssen zwei gewesen sein und kleine namenlose Käfer, die zu identifizieren ich nicht im Stande war.
Mein einziger Freund ist der Wärter Iwan Sergejewitsch Turgenew. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Er darf mir jedoch seinen Namen nicht verraten, was zu einer diesen dummen Regeln in diesem Gefängnis gehört, also nannte ich ihn nach Turgenew, denn die Literatur ist eine große Leidenschaft von mir und mein Turgenew trägt sein Haar ebenso vortrefflich gescheitelt und sein Bart passt ebenso harmonisch zu seinem ebenmäßigen Gesicht wie es bei dem Literaten der Fall war. Übrigens hoffe ich, dass es Turgenew sein wird, der mir die gute Nachricht über die Dispensierung meiner Erschießung und meiner Freilassung überbringen wird. Ich fühlte mich wohl dabei, wenn er es wäre.
An der Stelle, weil es gerade passt, fange ich vielleicht nun an meine Geschichte von Beginn an zu erzählen.
Kapitel 2
Es begann alles vor zwei Jahren. Unsere Hochzeit lag eine Woche zurück. Wir bezogen eine im dritten Stockwerk gelegene Wohnung, die für unsere Klasse vorgesehen war, hatten drei Zimmer und nahmen bei der Staatsbank den üblichen Kredit für die Einrichtung auf. Das Leben war geordnet in unserem Land.
Kitty war wie immer gut gelaunt als ich an einem herrlichen Frühsommertag nach Hause kam und ihr berichtete, man hätte mich für eine Auslandreise vorgesehen, was eine große Ehre und ein Beweis des Vertrauens war, das man in mich setzte. Die Regierung untersagte im Übrigen nicht grundsätzlich Reisen ins Ausland, namentlich in das Westliche, von dem eine große Anziehung ausging, doch wurden die Reisen mit hohen Steuern bedacht. Diese Steuern vielen bei einer Dienstreise nicht an, wie mir zu meiner Erleichterung gesagt wurde. Seit einem halben Jahr war ich im Diplomatischen Dienst und arbeitete in der Kulturabteilung des Außenministeriums. Sie werden sich fragen, wie man überhaupt zu so einer Laufbahn kommt, die ja nur privilegierten Vertrauten des Regimes offen steht.
Nun, mein Vater Andrej Mordechaiewitsch Goldstein gehörte, wenn auch auf der untersten Ebene, zu diesen Privilegierten. Mein Vater war der Fahrer des Oligarchen 3, sie erinnern sich, sein Name ist, oder war, inzwischen ist er verblichen, Zoran Korošec. Auch war mein Vater Kantor in unserer Gemeinde und Juden wurden von dem Regime durchaus geachtet. Zoran gehörte zu den jovialen, gutgelaunten Gaunern, die ihre Sache mit Humor betrachten und er war ein Mann schneller Entschlüsse. Natürlich wusste er von mir und meiner Schwester Sofia Andrejewitsch Goldsteina, die im Nachfolgenden aber keine Rolle spielt. Während der langen Autofahrten mit ihrem Volvo V70, Baujahr 2000, der ab und zu liegen blieb, was Zoran nicht aus der Ruhe zu bringen vermochte, unterhielten sie sich lange und oft mit Vergnügen.
Der Oligarch 3 war für den Kohlebergbau und die Kohlekraftwerke und überhaupt für die Energieerzeugung zuständig, was übrigens eine undankbare Angelegenheit war, da sich praktisch alles, die Rohrleitungen für die Fernwärme und die Stromverteilung in einem verlotterten Zustand befand. Zoran Korošec bekam, wie seine Kollegen auch, nicht viel über das Leben der gewöhnlichen Menschen mit, das heißt er bekam das mit, was mein Vater ihm berichtete. Also fragte er ihn nach den Preisen für Kartoffeln und Kohl, nachdem ihm gesagt wurde, dass dies die wichtigsten Nahrungsmittel wären.
Da seine Kinder Privatschulen in der Schweiz besuchten, fragte er meinen Vater wie der Schulunterricht wäre und da sie miteinander vertraut waren erzählte mein Vater offen wie alles wäre. Zoran hörte, dass die Lehrer ihre eigenen Parzellen bewirtschafteten, es an ihrer Qualifikation mangelte und die Schulbücher auseinandervielen. Er notierte sich Bildungswesen prüfen auf einem kleinen Zettel. So wurstig ging es in unserer Regierung zu. Zoran Korošec wusste aber auch, dass in Deutschland, dem ewigen und großen Vorbild, das heißt dem unerreichbaren Rivalen unseres Landes, die Toiletten in den Schulen in einem erbärmlichen Zustand waren und dass eine gewöhnliche Großstadt zehn Jahre dafür veranschlagte, sie zu renovieren.
Über diesen Umstand sprach er bei jeder Gelegenheit und obwohl es zutraf wurde ihm, weil es die Vorstellung des Volkes überstieg, genau das nicht geglaubt. Die Regierung musste sich im Klaren darüber sein, dass es so nicht ewig weiter gehen konnte, aber dazu später mehr. Als sich meine Schulzeit ihrem Ende zuneigte, lenkte mein Vater während der Rückfahrt aus einem Kohlerevier das Gespräch auf mich. Es hatte Zoran wie meistens Ungemach erwartet, die Wirklichkeit erwies sich aber als weniger dramatisch, so das Oligarch Nr. 3 bei guter Stimmung war.
»Zoran,« begann mein Vater beiläufig wie er stets ein Gespräch zu beginnen pflegte, »mein Junge muss zur Armee.«
»So? ist er schon so weit?« fragte Zoran mit seiner Bassstimme. Mein Vater schilderte die näheren Umstände, wann und wo ich mich zu melden hätte, denn das stand schon fest.
»Wir haben aber doch schon genug Soldaten, meinst du nicht?«
»Ja sicher und in der Armee ist es kalt und das Essen ist schlecht,« sagte Zoran auf seine freundliche und verständnisvolle Art und eine Brücke bauend. Sie mussten nicht viele Worte machen, um sich zu verstehen.
»Und auch die Luft ist schlecht, dort in der Armee«, sagte mein Vater den Humor von Zoran bestens kennend. Der lachte prompt laut auf und sein korpulenter Leib, der in einem grauen Anzug steckte, vibrierte vor Lachen.
»Ja die Luft ist schlecht, wiederholte er noch immer lachend,« und klopfte meinem Vater von hinten auf die Schulter.
So kam es, dass mir die unschöne Zeit in der Armee erspart blieb. Die Verbindung zu Zoran Korošec führte auch dazu, dass ich an der juristischen Fakultät angenommen wurde. Zoran tat all das nicht aus reiner Gutmütigkeit. Es machte ihm keine Mühe mich von der rauen Armee fernzuhalten und an der Universität unterzubringen. Was er Beabsichtigte entsprach seinem Verständnis von Loyalität aufgrund einer Abhängigkeit, einer Schuld, die es später zu begleichen galt. Ich befand mich mit dem Eintritt in die Universität und ohne ihm jemals begegnet zu sein, sozusagen in Zoran Korošecs Hand. Da dies für mich zunächst keine praktischen Auswirkungen hatte, machte ich mir nichts daraus.
Während meines Studiums bekam ich Zweifel an der Nützlichkeit, oder sagen wir besser Effizienz unseres Regimes, das uns so intensiv umsorgte und offenherzig umarmte, so dass man kaum Luft bekommt. Es ist jedenfalls unmöglich eigene Pläne zu haben und einen anderen Beruf auszuwählen, als den von einer Bildungsbehörde zugewiesenen, welche das natürlich zum Besten des Kandidaten macht. Man getraute sich nicht, diese ironischen Worte laut auszusprechen, nicht einmal in meinen Gedanken wagte ich das. Was die Regierung zu der sinnlosen Gängelei bewogen hat, die Berufe zuzuweisen, habe ich nie verstanden. Es sollte wohl ein Zeichen der Allmacht des Regimes sein.
Als ich im Zuge meines Studium der Jurisprudenz auf einige Unordnung der Sachverhalte in einem Verfahren stieß, das heißt, es gab ja so etwas wie eine Strafprozessordnung, wurde mir bewusst, dass in unserem Land nicht alle vor dem Gesetz gleich waren.
Ich las über juristische Grundsätze die zu bemühen sind und sofern man diese mit der Wirklichkeit in unserem Land verglich, ergaben sich große Zweifel an der Ausgewogenheit unseres Rechtssystems. Im Einzelnen hieß das, nicht jeder war vor dem Gesetz gleich. Es wurde unterschieden zwischen Parteikadern, wir werden von einer Einheitspartei regiert, wobei das auch nicht präzise ist, weil die Regierung aus den genannten Personen besteht. Allerdings diese Parteikader erfuhren großes Wohlwollen bei unseren Gerichten.
Hat die Regierung nicht die Pflicht für das Wohl des Volkes zu sorgen? Es konnte doch nicht ausreichend sein, das Volk nur hier und da einmal weniger zu drangsalieren. Die Regierung war der Ansicht viel für die Wirtschaft zu tun, was nicht völlig falsch war und ihr ein gewisses Ansehen gab, doch an eine wirkliche Modernisierung war nicht zu denken. Die Infrastruktur ist noch immer in einem erbärmlichen Zustand und die wenigen modernen Unternehmen sind nicht rentabel.
Rossistan lebte von der Landwirtschaft, von Ölraffinerien, der chemischen Industrie, die seit Jahrzehnten dieselben Grundstoffe herstellte, von einer kleinen Stahlindustrie und weiteren, klassischen Industriebereichen, die ohne Innovationen nur noch eine Zeitlang existieren konnten. Die aktive Wirtschaftspolitik der Regierung bestand darin, wenige große und teure sogenannte Leuchtturmprojekte zu realisieren. Das war mal ein neues Hotel in der Hauptstadt, ein kleiner Windparks, eine Photovoltaikanlage, oder andere Dinge, die aber nicht systematisch gefördert wurden. Die Ausbildung, die freie Berufswahl, die Modernisierung der Krankenhäuser, man könnte Seiten vollschreiben, kam nicht in Frage. Was wir im Überfluss hatten war Kohle, Braunkohle.
Das war das Rückgrat der Ökonomie dieses Landes, mit seinen 25 Millionen Einwohnern. Sie kennen die gesundheitlichen und ökologischen Folgen, ich brauche das nicht näher zu beschrieben. Die Regierung fürchtete wir würden von unserem großen Nachbarn geschluckt, was wohl irgendwann auch der Fall geworden wäre. Dieser Umstand trug wesentlich zu unserer Rückständigkeit bei.
Nach vier Jahren, nachdem ich mein Studium beendet hatte und Assessor geworden war, trat ich in die Kulturabteilung des Außenministeriums ein, wurde dort zu Beginn herum gereicht und bekam schließlich eine Funktion in der internationalen Abteilung für kulturellen Austausch und erhielt dort einen eigenen Schreibtisch mit einem grauen Telefonapparat mit einer Wählscheibe zugewiesen.
Bei dem ersten Gespräch mit dem Dezernenten für Personal des Ministeriums hatte ich, ohne eine Absicht damit zu verbinden erwähnt, dass ich Tolstoi, Puschkin und Turgenjew gelesen hätte, was wohl den Ausschlag für die internationale Abteilung für kulturellen Austausch gab. Der Dezernent schien mich wohl für besonders gebildet zu halten.
So, jetzt wissen sie alles über unser Land und das erste über mich. Verbündete hatten wir damals übrigens nicht.
Kaum hatte ich mich in der Stelle eingerichtet, bekam ich also den Auftrag in Berlin einer Zusammenkunft der Kulturattachés beizuwohnen. Was war der Grund dafür? Unsere Berliner Botschaft verfügte über keinen eigenen Attaché mit dieser Funktion und dem Botschafter, der im Übrigen keine Leuchte, sondern ein Cousin dritten Grades des Präsidenten und auch generell in seinem Büro wenig anzutreffen war, wie mir unter der Hand und mit einem Augenzwinkern berichtet wurde, hatte den wahren Hintergrund der Konferenz nicht mitbekommen. Denn, ich sage es vorneweg, das Ganze war ein Missverständnis, wobei dieser Terminus nicht wirklich zutreffend ist. Es war ein Versäumnis seitens der Botschaft Erkundigungen darüber einzuholen, worum es sich bei der Tagung handelte. Der Begriff Kulturattaché war das Synonym für die Geheimdienste, was mir ebenfalls lange verborgen bleiben sollte.
Ich packte also meinen kleinen Koffer, küsste Kitty und begab mich auf die Reise nach Berlin. Ich wählte auf Anraten meines Vorgesetzten eine andere, nicht unsere Fluglinie was, da ich einen flüchtigen Blick auf eine unserer Maschinen werfen konnte, ein weißer Ratschlag war. In Berlin holte mich ein Mitarbeiter der Botschaft mit Namen Mischa vom Flughafen ab und brachte mich in ein Hotel, das unserer Botschaft nahe lag. Nach einer Stunde holte er mich erneut ab, um mich zum Botschafter zu bringen.
»Was für ein junger Mann sie sind,« war dessen Reaktion, als er meiner ansichtig wurde, »ein Jüngelchen, ha ha…« Ich schwieg betreten. Der Botschafter, ein beleibter Mann, mit dickem Kopf, einer roten, gesprenkelten Nase und wurstigen Fingern, in den Sechzigern stehend, dessen Anzug ihm trotz seines Umfanges zu groß zu sein schien, mochte sich nicht lange mit mir beschäftigen, das heißt, ich war ihm lästig und er empfahl sich nach wenigen Minuten. Das geschah so, das er seine Mundwinkel weit nach unten zog, wodurch sich seine außerordentlich dicke Unterlippe nach vorne schob, was mich an einen Tiefseefisch erinnerte und er sagte knapp, ohne mich störenden Fragen zu examinieren:
»Wichtige Besprechungen warten auf mich. Viel Erfolg junger Mann.«
Damit erhob er sich, ging um mich herum, drehte kurz, gab mir die Hand, zupfte mich an der Wange und watschelte mit dem Gang der Übergewichtigen, in dem er seine Füße nach außen spreizte und seine Arme schlenkern ließ, aus seinem Büro und ließ mich stehen. Ich erwiderte nichts, als der Botschafter den Raum verließ, denn ich spürte eine Reizbarkeit in seinem Temperament. Später erfuhr ich von Mischa dem Fahrer, er habe den Botschafter beim deutschen Staatssekretär für Kulturfragen absetzt. Ich stutzte, er hatte nichts erwähnt und es hätte mich doch interessiert, was es dort zu besprechen gab. Sein plötzliches Verschwinden ersparte mir ein Abendessen mit ihm und gab mir eine unverhoffte Freiheit, während der drei Tage, die ich in Berlin verbringen sollte.
***
Ich hatte also einen freien Abend. Wie sollte ich den in der mir fremden, aber bewunderten Stadt verbringen? Hastig ging ich zum Fahrstuhl in meinem Hotel, in dem mich Mischa absetzte, legte meinen grauen Anzug ab, zog eine Stoffhose, eine Jeanshose oder eine aus Cord besaß ich nicht, streifte ein Blouson über, sie kennen es, es ist aus leichtem Stoff, hat Knöpfe und reicht genau bis zur Hüfte und ist auf dieser exakt waagerecht geschnitten.
Hin und wieder wurde genau dieses Blouson argwöhnisch angesehen, doch war mir im ersten Moment nicht klar, was der Grund dafür war. Mein braver Scheitel und mein bartloses, immer etwas blasses Gesicht, mochte dazu beigetragen haben, dass man mich für jemanden halten musste, der aus dem Osten Berlins, oder einer Stadt, die weit dahinter lag hielt. Ich machte mich auf und schlenderte durch verschieden Geschäfte in der Friedrichstrasse. Das mag ihnen jetzt fade erscheinen, doch Buchhandlungen zogen mich immer an. Ich stieß auf ein ganzes Kaufhaus, das offensichtlich eine Buchhandlung war. Viel Geld besaß ich nicht, nur das was man mir als Spesen für die Reise ausgehändigt hatte.
Meiner literarischen Neigung folgend, ging ich fasziniert durch die Gänge und die Stockwerke. Ich jubelte innerlich, als ich eine ganze Hälfte eines Stockwerkes mit Büchern unserer Sprache fand. Mein Blick viel schließlich auf eine Ausgabe von Friedrich Schillers »Die Räuber.« Denken sie was sie wollen, mich zog aber genau dieses Werk an. Ich hatte davon gehört und es nun in unserer Sprache kaufen zu können, bedeutet alles für mich. Ich erwarb es und gerade als ich mich von dem Verkäufer abwenden wollte, sagte er, offensichtlich meine Herkunft erkennend und fehlerfrei in meiner Sprache: »Im Deutschen Theater werden die Räuber zurzeit aufgeführt.«
»Oh, danke für den Hinweis, aber ich spreche nicht Deutsch.«
»Das macht nichts. Für Touristen wird der Text synchron übersetzt, sie bekommen einen Kopfhörer.«
Eilig ging ich die Straße hinunter zu meinem Hotel. Es war noch eine Stunde Zeit, bis die Vorstellung beginnen sollte. Schnell rief ich Kitty an, nahm wieder meinen Anzug zur Hand und eilte in das Theater.
Um was geht es in Schillers Räuber? Ganz kurz nur, es ist kompliziert und ich möchte sie nicht langweilen: Der Grundkonflikt, der sehr von Schiller abstrahiert ist und im Verborgenen liegt, vergleicht den Gegensatz zwischen dem demokratischen, dem freien Staat gegen den autoritären, den absolutistischen Staat. Natürlich ist das alles eine sehr komplizierte Metapher. Es geht um die Brüder Franz und Karl Moor, die in Tragik aber auch Aufrichtigkeit endet. Der demokratische Staat ist naiv und ziellos. In ihm ruht aber eine große Kraft, die sich in der Not entfaltet. Der autoritäre Start ist in einem ständigen Alarmzustand, einem ständigen Höhepunkt. Er kann nur aggressiv werden, oder verfallen.
Die Beschreibung des despotischen Systems, durch das die Menschen ihrer Rechte beraubt werden, als ließen sie sich nur durch Zwang und die Furcht der Strafe regieren, entfaltet die Wirkung, dass die Tyrannei und der Übermut darin, in die Untaten der Herrschenden mündet. Das hat die Folge einen Sklavengeist der gegeißelten und die Niederträchtigkeit der herrschenden hervor zu bringen. Jedes Gesicht wird mit Blässe zubedeckt und jedes Herz ist mit Mutlosigkeit erfüllt. Karl Mohr entzieht sich aller Ordnung. Er wird zum Anarchisten und findet, aus der Not heraus darin seine Befreiung, obwohl ihm klar wird, welches Unrecht auch er begeht. Von Franz, seinem Bruder geht alle Niedertracht aus. Der Vater ist ein hilfloser und gutgläubiger Mensch, der wie alle anderen in dem Stück zum Opfer des maßlosen Franz wird. Der hochbegabte Schiller litt unter der Despotie, die an der Karlsschule, einer Militärakademie, Kunstakademie und später einer allgemeinen Hochschule herrschte.
Schiller war der Dichter der Freiheit, die er in seinen Dramen und Schriften auf höchstem Niveau einforderte und er war inspiriert durch die Aufklärung die gegen den Absolutismus ankämpfte. Schiller war in der deutschen Literatur einzigartig. Mir war das allgemein bekannt und das Thema der Unfreiheit war genau das unseres Landes. Ich muss zugeben, als ich aus dem Theater kam, war ich elektrisiert, wie es noch nie der Fall war. Nun konnte man die Aussage des Stückes, den Kampf gegen die Unterdrückung nicht unmittelbar entnehmen, doch darin lag seine Stärke und seine Möglichkeiten…erregt rekapitulierte ich, was ich gesehen hatte.
Franz war Materialist, er hat keine Ideale. Die Natur hatte ihn schlecht behandelt, warum sollte er an das Gute glauben? Er fühlte sich in ein kaltes Universum geworfen, also folgte er mit kaltem Verstand alleine seinem Interesse, dass auf Herrschaft gerichtet ist: Ich will alles um mich hier ausrotten was mich einschränkt, dass ich nicht der Herr bin. Und dann Karl Moor: Er begehrt gegen die bürgerliche Ordnung und jedwede Ordnung auf und er versucht ein Anarchist des Guten zu sein und nimmt das böse dabei in Kauf. Wer wie Karl, seine Freiheit entdeckte, ist schließlich auch bereit Verantwortung für das zu übernehmen, was er getan hat. Freiheit und Verantwortlichkeit gehören zusammen. Die Übernahme dieser Verantwortlichkeit ist nicht gleichbedeutend mit jener für die Herstellung einer zerbrochenen Weltordnung.
Hektisch und mich in Eile befindend, betrat ich mein Hotel und öffnete das Buch, das ich gekauft hatte. Ich setzte mich wie ich war in einen Sessel und blätterte durch die Seiten. Viele Gedanken schossen mir durch den Kopf. Der Pathos der Freiheit… Idealismus ist die enthusiastische Art an den menschlichen Geist zu glauben. In den Räubern werden Brücken abgebrochen und die Frage entsteht, ist eine Rückkehr wieder möglich? Die Intellektualität Schillers ist der ideale Code, den niemand versteht, jedenfalls nicht unsere drögen Bewacher. Ich öffnete das Internet und las über Schiller.
Subordination hat er das Grundgesetz des Lebens an der Karlsschule genannt, fabelhaft. Als bedrückend aber empfand er im Rückblick die Erfahrungsarmut zu der Mann an der Schule verurteilt wurde. Das waren Sätze, die so präzise auf alles zutrafen, was sich in unserem Land abspielte, dass ich mir überlegte, wie ich das was ich las verteilen und vervielfältigen konnte. Durch Befehle und Gesetze waren wir von der Wirklichkeit abgeschnitten. Jeder hatte ein natürliches Widerstandsrecht gegen staatliche Herrschaft nur die Freiheit der Feder nicht aber die physische bewaffnete Gewalt konnte gutgeheißen werden. Ja, das war es. Physische Gewalt würde alles zunichte machen und würde auch brutal gebrochen werden.
Die Macht der Feder, das heißt die Macht des Geistes vermag aber niemand aufzuhalten. Ich habe mich in dem Augenblick wie ein Erweckter gefühlt. Unser Führung war so dümmlich, dass sie nichts verstehen würde, sollte man sie durch diese Kunst entblößen. Brauchte man den Tyrannenmord? Inwiefern war er überhaupt moralisch gerechtfertigt und wie praktisch durchzuführen, was wog schwerer die Schuld oder die Befreiung? Es gab im Übrigen nicht den einen bösartigen Tyrannen in der modernen Welt es gab eine Weltanschauung der sogenannten gelenkten Demokratie der minimalen und wohldosierten Teilhabe des Volkes am Reichtum zum Preise der Anpassung. Es gab eine stille Einvernahme die Überwachung über sich ergehen zu lassen und nicht aufzubegehren aber ein Mindestmaß an individueller Freiheit und ein bisschen Wohlstand zu erhaschen. Doch was war das bisschen Wohlstand, gegen das dauernde Gefühl der Unterdrückung, gegen die Knute der Herrschenden?
Man musste keine politische Theorie studiert haben, um das bedrückende des Strafsystems, der täglichen Beaufsichtigung, die den Geist töten kann und nichts als stumpfe Disziplin fordert zu erkennen. Die menschliche Natur bekommt einen verbogenen Charakter und neigt dazu sich den Umständen so gut wie es geht anzupassen, nur um nicht alle Hoffnung zu verlieren.
Ich fühlte mich nicht in der Lage eine Revolution auszulösen, oder gar anzuführen. Dazu fehlte es mir an Mut, Ideen und Charisma. Doch ich war entschlossen, das Buch, das heißt Schillers Drama an ein Theater unserer Hauptstadtmit einer Bitte zu übergeben. Es musste aufgeführt werden. Das Volk war reif seine Lage zu begreifen und es musste durch die Kraft der Worte einfach eine Unruhe unter den Manchen entstehen. Was ich besaß war ein Gegengift gegen die Verderbtheit der Herrschenden. Ich wurde so nervös, dass ich die ganze Nacht wach lag und die immer selben Gedanken kreisten vor mir. Wie war es plötzlich so gekommen? Die Literatur war es, die Literatur verstand ich wie kein anderer. Gegen Morgen schlief ich dann doch ein.
Kapitel 3
Die Tagung der Kulturattachés fand im deutschen Außenministerium statt. Noch kannte ich nicht den wahren Hintergrund des Treffens. Etwas schüchtern, ich mochte der jüngste und der am wenigstens Erfahrene sein, betrat ich den großen Saal. Es gab kein Programm. Man hieß die Teilnehmer willkommen und es sprach ein deutscher Beamter, dessen Funktion nicht näher genannt wurde.
Um ganz ehrlich zu sein, ich spreche zwar ganz gut Englisch, das gehörte zu meiner Ausbildung an der Universität, aber ich konnte das, was gesprochen wurde trotzdem nicht verstehen. Die Rede war wolkig und nichtssagend…wobei nur fast, muss ich einschränken. Denn unauffällig und es war mit Sicherheit als Botschaft gemeint aber ich begriff sofort was er meinte, erwähnte der Beamte den Artikel 20 des deutschen Grundgesetztes.
Darin heißt es: Das Widerstandsrecht ist ein Abwehrrecht des Bürgers gegenüber einer rechtswidrig ausgeübten Staatsgewalt mit dem Ziel der konservierenden Bewahrung oder Wiederherstellung der Rechtsordnung. Im engeren Sinn richtet sich das Widerstandsrecht auch gegen Einzelne oder Gruppen, wenn diese die Verfassung gefährden; es dient dann der Unterstützung der Staatsgewalt, etwa wenn diese zu schwach ist, die verfassungsmäßige Ordnung aufrechtzuerhalten.
Was, wie war das? Es gab in der Vorzeigedemokratie, die liberal war bis zur Selbstverleugnung ein Widerstandsrecht? Wie kam eine Regierung darauf so etwas ihren Bürgern zuzugestehen? Das konnte nur auf die Zeit der Diktatur in Deutschland zurückgehen.
Der Beamte sprach nicht mehr drüber, eigentlich zitierte er nur den Artikel, sogar ohne einen rechten Zusammenhang. Ich zog ein Notizheft aus der Innentasche meines Sakkos und schrieb die Ziffer des Artikels auf. konnte das etwas mit Kultur zu tun haben? Ja, bestimmt, oder nicht?
Nach der Rede folgte nichts mehr. Die ganze Sache schien darin zu bestehen, dass man sich an Tische setzte, oder an solchen stand und unterhielt. Alleine und ratlos verblieb ich ziemlich kerzengerade an einem Tisch und der Zeigefinger meiner rechten Hand steckte in dem Henkel einer Kaffeetasse und ich sah gedankenverloren in den Raum. Ein Schild, das ich am Eingang empfangen hatte, zeigte meinen Namen und ich erhielt einen Anstecker, der die Farben meines Landes wiedergab. Es trat jemand zu mir. Ich blickte auf sein Namenschild. Motti Aaronovich, Israel.
»Sie sind neu in dieser Runde?«, fragte er, während seine Hände in den Hosentaschen steckten. Motti Aaronovich mochte Mitte fünfzig sein. Sein Haar war dunkel, voll und wuschelig und um seinen Hals hing eine Schnur, die wiederum eine Brille hielt. Er hatte intelligente Augen, seine Stirn zeigte Falten und seine Körperhaltung war eher kraftlos, jedenfalls hingen seine Schultern. Er wirkte sympathisch auf mich.
»Ja, ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ich vertrete unseren Kulturattaché, der sich außerhalb des Landes befindet.« Ein Lächeln, das ich nicht zuordnen konnte, huschte über Mottis Gesicht. Er sagte nicht, ihr habt doch gar keinen Kulturattaché, sondern er sagte: »Ach ja, ich vergaß, wie war nochmal sein Name?« Ich saß unbedachterweise in der Falle. Nun nützt es nichts, mit einer neuen Schwindelei zu reagieren. Was alleine hilft, ist die Wahrheit.
»Ehrlich gesagt wir haben keinen Kulturattaché. Unsere Kultur muss nicht speziell vertreten werden, die spricht für sich selbst.«, fügte ich noch mit einem Anflug von Humor dazu. Diese gekonnte Pointe gefiel Motti. Er sagte:
»Kommen sie, ich möchte sie Jemandem vorstellen.« Er fasste mich am Ellenborgen und ich stand plötzlich vor dem Vertreter der USA, der sich mit einem Herrn aus dem Iran unterhielt. Beide nickten uns kurz zu und setzen ihr Gespräch fort. Zu meinem Erstaunen ging es um den Austausch von Menschen aus den jeweiligen Ländern.
»Sie wissen an wen sie sich wenden müssen, sollten sie einmal in dieser Lage sein«, sagte Motti, nickte den beiden Herren zu, als wolle er sagen, er käme gleich wieder und wir gingen weiter. Ich verstand nicht recht was er meinte.
»Sie reden mit dem Iraner … um was ging es denn da?«, fragte ich, nachdem ich wahrnahm, wie einvernehmlich die beiden miteinander umgingen. Motti sah mich mit einer leichten Verwunderung an. Wir standen vor einem Südafrikaner, der sich mit einem Chilenen unterhielt. Sie redeten über die Vorteile einer bestimmten Waffe, es war eine Laserwaffe, mehr konnte ich nicht aufschnappen.
»Darf ich vorstellen…?« Motti zog mich von Tisch zu Tisch. Schließlich setzten wir uns auf unbequeme weiche und niedrige Würfel. Es gab nichts anderes, das frei gewesen wäre.
»Kennen sie Professor Mordechai Aaronovich?«, fragte mich Motti, irgendwie auf den Kopf zu, während er sich nach vorne in meine Richtung neigte und sich vorsichtig nach beiden Seiten umwandte.
»Was macht er, ist er im Theater, oder Komponist, oder Schriftseller?« mehr fiel mir nicht ein. Ich verstand kein Wort. Motti nickte kurz und lächelte, offensichtlich akzeptierend, dass ich nicht bereit war über mehr Details zu sprechen und ließ sich, nun seinerseits merkwürdig naiv in der Annahme, dass ich wüsste von wem die Rede war, auf meine Verschleierung ein. Ich fragte mich, warum er überhaupt so viel Zeit mit mir verbrachte und auch weshalb er eine Art von Vertrauen zwischen uns vorauszusetzen schien. Motti sah mich mit seinen dunklen Augen an. Jetzt erst vielen mir die Furchen in seinem Gesicht auf.
»Sie sind Jude, nicht wahr?«, fragte Motti mit einem fordernden Unterton, wie ihn nur Israelis haben.
»Ja sicher, warum fragen sie das?«
»Warum? Ich bin Israeli.« Mehr sagte er nicht, aber er sprach in einem Ton, als würde das alles erklären, was erklärt werden musste.
»Professor Abrahamowitsch ist wichtig für uns. Ich möchte, dass sie ihn ansprechen.«
»Ansprechen, ich wieso?« Ich fügte noch hinzu: »Also was macht er genau?« Es wurde mir unheimlich.
»Was er macht? Er ist der einzige helle Kopf in ihrem Land. Sprechen sie mit ihm und sagen sie…« Motti überlegte. »Sagen sie ihm wir erwarten seine Unterstützung, ja da ist das Beste. Mehr brauchen sie nicht zu sagen, wir erwarten seine Unterstützung.« Natürlich war Abrahamowitsch auch Jude, also darum ging es? Es ging um eine Art von jüdischer Solidarität? Aber was sollte Abrahamowitsch tun? Er war doch Künstler, oder nicht?
»Ich bin mir nicht sicher, ob ihn das überzeugen wird. Den Juden geht es nicht schlecht, oder sagen wir den Juden geht es so schlecht wie allen anderen auch in unserem Land, jedenfalls werden wir als Juden akzeptiert.« Motti sah mich an, als würde ich kein Wort verstehen, was ja auch der Fall war.
»Sie wissen was das hier für eine Tagung ist?«, fragte er nun vorsichtig und rückte seinen Hocker näher zu meinem, was mir irgendwie bedrohlich erschien. Mir wurde nun klar, dass das hier keine Tagung der Kulturattachés sein konnte.
»Äh ja, das heißt nein, es geht um einen Austausch der Kulturattachés.« sagte ich in dem Wissen, dass mich das Blamieren würde. Motti sah, seine Augen verdrehend an die Decke. Dann flüsterte er mit einer Eindringlichkeit, die ich nie vergessen werde.
»Das ist das jährliche Treffen der Geheimdienste. Wir besprechen hier schwierige Fälle und vermeiden, dass es zu offenen Konflikten kommt, außerdem lernen wir uns kennen, um im Fall der Fälle einen Ansprechpartner zu haben. Hier will niemand den dritten Weltkrieg, verstehen sie?«
»Ja ich verstehe«, antwortete ich und bemühte mich irgendwie genauso zu flüstern, wie Motti weil mich das beeindruckte und in der Hoffnung meine völlige Unwissenheit zu überspielen.
»Es kam schon öfter vor, dass jemand hier hereinschneite und nicht wusste wo er war.« Motti lehnte sich zurück und verschränkte seine Arme.
»Nein, äh ja, das heißt, ich wusste es nicht, wie konnte ich das auch wissen?« Motti sah mich unentschlossen an, was mir peinlich wurde. Ich sah mich verstohlen um und blickte hinaus in den großen Saal, indem alle beisammenstanden und sich unterhielten. Alle diese Leute waren Agenten? Wo war ich hingeraten? Ich fühlte mich wie in einem Theater, es war künstlich, surreal. Ich schien mich am Rande der Finsternis zu befinden. Nach einem Moment des Schweigens fasste ich mich wieder und fragte:
»Und was hat es nun mit Professor Abrahamowitsch auf sich?« Motti schien mir nach einigem Zögern aufs Geratewohl hin zu vertrauen. Wer so naiv wie ich war und so gutgläubig in die Welt blickte wie ich es tat, konnte nichts Schlechtes im Schilde führen, mochte er sich sagen.
»Professor Abrahamowitsch ist Physiker. Er forscht an einer Brennstoffzelle, die wenn man sie mit Wasserstoff beaufschlagt einen Wirkungsgrad von 90% hat. Er nennt sein Projekt Ursus Arctos, das heißt Braunbär.« Für einen Moment fragte ich mich, ob mich Motti auf den Arm nehmen wollte. Er fuhr aber fort: »Die ersten Prototypen sind in Betrieb, sie funktionieren aber noch nicht, im Übrigen ist das Ganze für uns nur militärisch wichtig, U-Boot Antriebe, Motoren für Kampfpanzer, Drohnen und dergleichen.«
»Das klingt sympathisch,« warf ich erfreut und belustigt und noch immer unter dem Eindruck stehend, ich befände mich in einer Aufführung und meine Rolle dankbar spielend ein. »Woher wissen sie von dem Projekt Ursus Arctos?« Als ich das fragte, konnte ich mir ein albernes Lachen nicht verkneifen.
»Das tut ja wohl nichts zur Sache.« Motti schien von meiner Heiterkeit erbost zu sein. »Reden sie mit Mordechai Abrahamowitsch und ziehen sie ihn auf unsere Seite. Das System darf er nur für uns fertig entwickeln.«
»Entschuldigung, wer ist denn unsere Seite?«
»Sind sie nun Jude oder nicht? Wieso leben sie überhaupt in ihrem armen Land und nicht in Israel?« fragte Motti noch immer mit seinem zischenden Flüstern und hob dabei seine Augenbrauen. Ich wusste nicht was ich antworten sollte. In meiner Familie hatte man sich das einfach noch nie überlegt, doch jetzt, wo mich der israelische Agent so direkt fragte…
»Keine Ahnung, es war uns zu warm. Außerdem bleibt die ganze Familie einfach zusammen. Anders kommt man bei uns nicht durch.« Die zweite Antwort überzeugte Motti.
»Sind Sie nun Jude oder nicht?«, legte er in denselben Worten nach. »Hatten Sie keine Bar Mizwa, feiern Sie nicht Yom Kippur und Chanucka? Lesen Sie nicht die Halacha und im Talmud?« er zählte kurz und präzise alles auf was das Judentum ausmacht, einschließlich der Speiseregeln und er sprach über Jerusalem die Schönheit der Stadt die Schönheit ihre Farben den Tempelberg und die Klagemauer. Das weckte ganz neue und bisher unbekannte Gefühle in mir. So hatte ich das noch nie gehört.
Mein Vater war zwar wie gesagt Kantor, doch die Regeln nahmen wir nicht ernst. Wir aßen Schweinefleisch und die jüdischen Feiertage verbrachten wir wie alle anderen Juden bei uns auch, wir ignorierten sie. Aber nun, es brauchte nur die wenigen Worte von Motti Aaronovich und eine Ernsthaftigkeit und ein stilles Vertrauen trat zwischen uns. Wir sprachen lange, sehr lange über das Judentum länger als wir uns vorher unterhalten hatten.
Motti Aaronovich wusste offensichtlich, wie er mich gewinnen konnte. Diese Art der Einfühlsamkeit war exakt sein Spezialgebiet. Genau darin, nämlich Menschen zu überzeugen, sie für eine Sache zu gewinnen war seine Aufgabe. Später, in Israel erzählte er mir einmal wie lange er dafür psychologisch geschult worden war.
»Ok, nächstes Jahr in Jerusalem, alles klar?« Ich kannte diese Redensart von meiner Großmutter. Ich brauchte einen Moment, dann wiederholte ich: »Nächstes Jahr in Jerusalem.« Es war, als ob ich zum Militär eingerückt wäre. Motti hingegen schien meine vorherige Frage wer unsere Seite wäre noch immer verunsichert zu haben.
»Überlegen sie es sich. Die Sache ist ernst. Wenn sie einmal dabei sind, gibt es kein Zurück mehr.«
»Es gibt nichts zu überlegen«, antworte ich. »Ich bin dabei.« Motti reichte mir seine Hand und ich nahm sie feierlich entgegen.
»Denken sie nach, ich melde mich in einigen Tagen bei Ihnen.« Ich stutze, für mich war ja alles klar.
»Wie genau soll ich Mordechai Abrahamowitsch ansprechen, ich meine, wie wird der ganze Ablauf sein, was soll er tun, soll er nach Israel auswandern?« Motti Aaronovich, der sich schon erhoben hatte setzte sich noch einmal und breitete seine Pläne aus. »Mordechai Abrahamowitsch lebt in einem goldenen Käfig in einer modernen und vornehmen Forschungseinrichtung des Militärs. So etwas werden sie in ihrem Land noch nicht gesehen haben. Deshalb brauchen wir sie. Von uns aus kommen wir nicht an ihn heran.«
»Das hört sich an wie in einem Groschenroman.«
»Stimmt, aber es ist die Wirklichkeit. Früher waren solche Leute erst einmal im Gulag, um sie weich zu kochen. Man hat ihm wahrscheinlich versprochen er können ausreisen, sofern er Erfolg hat. Das wollen wir vorziehen.« Motti lächelte bitter und blickte mir in die Augen. Am Ende sagte er:
»Achten sie auf ihre Regierung. Die verstehen keinen Spaß.«
»Also gut, in einigen Tagen,« sagte ich am Ende. Wir hatten bestimmt zwei Stunden gesprochen. Von meiner idealistischen Anwandlung mit Schiller und der Freiheit über den Intellekt des Menschen ahnte Motti nichts.
Beladen mit meinen schwierigen Aufgaben reiste ich zurück. Ich der ich sonst stets heiter und fröhlich war, trat ernst und schweigsam vor Kitty und sie fragte mich sorgenvoll was geschehen wäre. Ich sagte es ihr, ich sagte ihr beides und Kitty lachte erst, dann wurde ihr klar auf was ich mich da eingelassen hatte und sie schwieg eine Stunde lang.
Und nun muss ich ihnen erzählen, dass eine Veränderung in mir eintrat. Ich machte den Prozess, durch den alle jungen Erwachsenen durchlaufen. Doch bei mir machte die Entwicklung einen Sprung, was sicherlich mit den beiden Aufgaben zu tun hatte, von denen ich mir die eine aufgehalst hatte und die zweite, die mir von Aaronovich, der mich gekonnt eingewickelt hatte angetragen wurde.
Junge Erwachsene werden zunehmend verträglicher, gewissenhafter und emotional stabiler, je älter sie werden. So war es auch bei mir. Aber etwas kam hinzu, das ich vorher nicht bei mir gekannt habe. Mir viel bisher alles in den Schoß. Ich wurde protegiert und mein natürlich nur gewöhnliches Talent hatte ausgereicht, dass ich die Schule und die Universität ohne eine große Mühe hinter mich gebracht habe. Was war also die Veränderung?
Ich wurde ehrgeizig. Natürlich hatte meine Ernennung zum Assessor, mein traumhafter Berufseinstieg im Ministerium, meine Heirat mit Kitty, die ich über alles liebe und allgemein das älter werden, die Entwicklung meiner Persönlichkeit beeinflusst. Mir waren die üblichen Faktoren, die den Ehrgeiz ausmachen, auch einerlei. Leistung, Erfolg, Anerkennung, Einfluss, Führung, Wissen oder Macht, das hat mich alles nicht interessiert. Was mich mit einer Plötzlichkeit antrieb war, dass ich etwas zur Freiheit meines Landes beitragen wollte.
Eine Art von Größenwahn ist entgegen meiner Natur. Irgendwie passten diese Ambitionen nicht zu mir, aber trotzdem…diese Idee hatte mich erfasst und ich konnte Tag und Nacht an nichts anders Denken und wie gesagt, ich habe einen Ehrgeiz gespürt die Sache zumindest zu beginnen und auf den Weg zu bringen. Mehr als das konnte ich sowieso nicht tun. Alles andere musste sich aus den Bürgern, oder den Umständen heraus entwickeln. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich mich als Außenseiter sehe. Ich bin nicht der Typ, der irgendwo im Zentrum steht.
Freunde habe ich kaum, nur meine immer gut gelaunte Kitty habe ich und wie kann ein so zurückhaltender Typ wie ich es bin, sich so eine Sache vornehmen? Ich musste es so machen, dass mir meine Bescheidenheit helfen würde denn der Vorteil, der darin liegt, ist meine Unauffälligkeit, ja meine Unsichtbarkeit. Mir war klar, dass man das nicht eben mal so überstreift, ich meine den Mut und die Selbstverständlichkeit, mit der man so eine Sache angeht. In mir war aber ein Zwang entstanden, es zu tun. Aus einem theoretischen Idealismus heraus, weil ich sah wie rückständig unser Land war?
Nein, weil ich die Unfreiheit unserer Bürger selbst gespürt habe, bei meinem Vater, bei meinen Kameraden. Bei allen sah ich die Vorsicht, mit der sie durch ihr Leben gingen. Nur nicht auffallen, nur still und angepasst sein. Das war der Charakter dieser Bevölkerung geworden und das hat empörte mich. Ich dachte an Schiller: Von seinem Herzog entdeckt zu werden, nur wenn er weiter an seinen Dramen schreiben würde, konnte Schiller in den Kerker bringen. Er war einem Tyrannen ausgeliefert.
Unseren Präsidenten kannte ich nicht, wusste nicht ober er so ein bösartiger Narzisst wie der Herzog von Württemberg, Karl-Alexander war, der mit seinem kleinen Ländchen dem Größenwahn verfallen war und Versailles nachbauen wollte und dutzende anderer Verrücktheiten angezettelt hat.