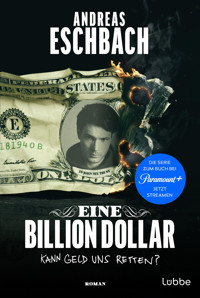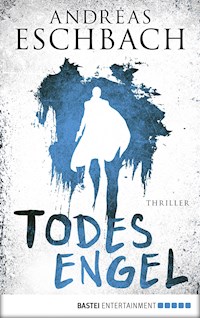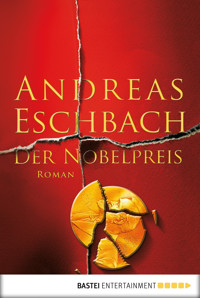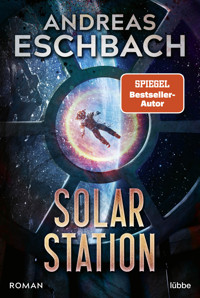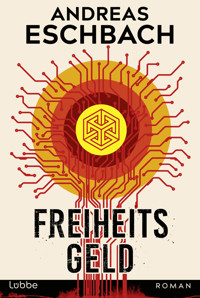
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Europa in nicht allzu ferner Zukunft. Die Digitalisierung ist weit fortgeschritten, Maschinen erledigen die meiste Arbeit, während ein bedingungsloses Grundeinkommen, das sogenannte »Freiheitsgeld«, dafür sorgt, dass jeder ein menschenwürdiges Leben führen kann. Als der Politiker, der das Freiheitsgeld eingeführt hat, tot aufgefunden wird, wirkt es zunächst wie ein Selbstmord. Doch dann wird der Journalist ermordet, der einst als sein größter Gegenspieler galt. Ahmad Müller, ein junger Polizist, ist in die Ermittlungen um beide Fälle involviert - und sieht sich mit übermächtigen Kräften konfrontiert, die im Geheimen operieren und vor nichts zurückschrecken, um eine Aufklärung zu vereiteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Europa in nicht allzu ferner Zukunft. Die Digitalisierung ist weit fortgeschritten, Maschinen erledigen die meiste Arbeit, während ein bedingungsloses Grundeinkommen, das sogenannte »Freiheitsgeld«, dafür sorgt, dass jeder ein menschenwürdiges Leben führen kann. Als der Politiker, der das Freiheitsgeld eingeführt hat, tot aufgefunden wird, wirkt es zunächst wie ein Selbstmord. Doch dann wird der Journalist ermordet, der einst als sein größter Gegenspieler galt. Ahmad Müller, ein junger Polizist, ist in die Ermittlungen um beide Fälle involviert – und sieht sich mit übermächtigen Kräften konfrontiert, die im Geheimen operieren und vor nichts zurückschrecken, um eine Aufklärung zu vereiteln.
Über den Autor
Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 in Ulm, ist verheiratet, hat einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr.
Er studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Von 1993 bis 1996 war er geschäftsführender Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma.
Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hoch begabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman »Die Haarteppichknüpfer«, der 1995 erschien und für den er 1996 den »Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland« erhielt. Bekannt wurde er vor allem durch den Thriller »Das Jesus-Video« (1998), der im Jahr 1999 drei literarische Preise gewann und zum Taschenbuchbestseller wurde. ProSieben verfilmte den Roman, der erstmals im Dezember 2002 ausgestrahlt wurde und Rekordeinschaltquoten bescherte. Mit »Eine Billion Dollar«, »Der Nobelpreis« und zuletzt »Ausgebrannt« stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Thriller-Autoren auf.
Nach über 25 Jahren in Stuttgart lebt Andreas Eschbach mit seiner Familie jetzt seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne.
ANDREASESCHBACH
FREIHEITSGELD
ROMAN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © 2022 by Andreas Eschbach
Diese Ausgabe 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Einband-/Umschlagmotiv: © mazhuzha – adobe.stock.com; iuneWind – stock.adobe.com; Hanna_zasimova – stock.adobe.com
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2815-7
luebbe.de
lesejury.de
Prolog
Ende August 2063
Nicht nachdenken, machen, sagte Zoe gern, und: Wer vorher lang überlegt, traut sich nachher nicht mehr.
Das fiel ihm ein, als er sich durch das aufgeschnittene Drahtgitter zwängte, um seiner Freundin zu folgen, die schon hoch über ihm kletterte, hurtig wie eine Akrobatin. Hinauf! Ganz nach oben!
Hätten sie sich nicht etwas anderes aussuchen können als ausgerechnet das Ulmer Münster? Zu Hause, in Zoes Bett, als sie darüber geredet hatten, hatte es wie eine großartige Idee geklungen. Der höchste Kirchturm der Welt! Wahnsinn. Einhunderteinundsechzig Meter, das klang nicht nach viel, wenn man unten auf dem Platz stand und hinaufschaute. Aber von hier oben – Junge, Junge!
»Schnell!«, rief Zoe von oben. »Die Sonne geht gleich auf!«
»Schon unterwegs«, ächzte er und schob sich an den dicken Gittern vorbei, die verhindern sollten, dass jemand das machte, was sie hier machten: die Spitze des Turms erklimmen.
Er trug ja den Rucksack mit der ganzen Ausrüstung – klar, dass er nicht so schnell vorankam, oder? Außerdem hatte er feuchte Hände – gefährlich, gefährlich! –, und seine Knie fühlten sich ein bisschen zittrig an.
Nicht hinabschauen! Klang wie ein guter Rat, war aber undurchführbar. Er musste ja die Perspektive bestimmen, um alles aufzunehmen. Wenn sie das schon durchzogen, dann sollte es auch gut aussehen. Er hielt keuchend inne, als er die erste der Metallsprossen erreicht hatte, die zur Turmspitze hinaufführten. Zoe turnte über ihm herum, hatte sich an der obersten Sprosse eingehakt, machte Dehnübungen.
»Wahnsinn!«, rief sie zu ihm herab. »Das wird noch besser, als ich’s mir vorgestellt hab. Wir werden weltberühmt, was sagst du dazu?«
»Super«, ächzte er und hakte sich ebenfalls fest, um die Hände frei zu haben für die Steuerung der Videodrohne.
»Mann, und in zwei Monaten sind wir achtzehn und kriegen das volle Freiheitsgeld! Was machen wir denn dann?« Sie strahlte da oben, strahlte wie ein Stern.
»Wird uns bestimmt was einfallen.« Er hatte es geschafft, sich den Rucksack vom Rücken zu zerren, holte die Drohne heraus, entfaltete sie und ließ sie aufsteigen. Über sein Pod kontrollierte er, was sie sah.
»Wir könnten nach Paris fahren, auf den Eiffelturm«, überlegte Zoe. »Dreihundert Meter! Doppelt so hoch wie der hier, stell dir vor!«
Sah gut aus. Die Straßenbeleuchtung auf den Hauptstraßen da unten war noch an, der Himmel graublau, im Osten leuchtete es rötlich. Er atmete tief durch. Jetzt bloß nicht das Pod fallen lassen!
»Okay«, rief er. »Hast du den Peiler an?«
Zoe nestelte an ihrer Jacke herum. »Läuft!«
Man merkte es sofort. Im selben Moment, in dem sie den Peilsender einschaltete, richtete sich die Videodrohne auf sie aus, hielt sie präzise im Fadenkreuz. Er würde gar nichts machen müssen, nur hinterher das Ding wieder einsammeln.
»Die Sonne!«, jubelte Zoe. »Ich fang an, sobald ihr Licht die Turmspitze berührt, okay?«
»Ja, Aufnahme läuft«, rief er zurück und wischte sich rasch die Hände an seiner Jacke ab. Kühl war es für einen Morgen im August. Lag wahrscheinlich an der Höhe. »Mach einfach.«
Er merkte, wie er ruhiger wurde, jetzt, wo alles so lief, wie sie es geplant hatten. Die Drohne orientierte sich an Zoes Peiler, sorgte automatisch dafür, dass sie gut im Bild war. Und sie nahm alles in SuperReal Plus auf, in höchster Bildqualität.
Die Sonne kroch höher. Das, was bis eben noch ausgesehen hatte wie ein dunkelgraues Meer, verwandelte sich in ein Labyrinth rotbrauner Dächer. Die Donau glänzte geheimnisvoll.
Zoe hatte sich mit einem dünnen, grellgrün ummantelten Stahlkabel an der obersten Sprosse gesichert. Das Kabel trug bis zu drei Tonnen, das würde garantiert nicht reißen. Und die Software der Drohne konnte dieses spezielle Grün in Echtzeit herausrechnen; er würde hinterher höchstens noch ein paar Schatten wegretuschieren müssen. Kleinigkeit.
»Jetzt!«, rief Zoe. »Ich spring dann!«
»Alles klar.«
Er konnte nicht anders, er musste den Blick vom Pod nehmen und hochschauen. Er musste mit eigenen Augen verfolgen, wie sich Zoe von dem alten, grauen Stein der Kirchturmspitze abstieß und nach draußen schnellte, weit und mit ausgebreiteten Armen, sodass es einen Moment lang aussah, als schwebe sie über der Stadt.
Dann aber fiel sie natürlich, das Stahlseil straffte sich, und sie knallte mit brutaler Wucht gegen die Steine, die fest gefügt seit Jahrhunderten gen Himmel ragten. Er zuckte zusammen von dem dumpfen Schlag.
»Alles okay?«, fragte er.
»Ja, ja«, keuchte sie. »Was ist? Wie ist es geworden?«
Er setzte den Bildlauf mit zittrigen Fingern ein Stück zurück, betrachtete die Aufnahme. »Gut«, sagte er. »Das wird echt gut.«
»Sag ich doch.« Sie angelte nach den Sprossen, kletterte wieder in dieselbe Position wie vorhin. »Ich spring einfach weiter, oder?«
»Ja, klar.« Er räusperte sich. »Wär auch gut, du beeilst dich. Der Hintergrund verändert sich verdammt schnell.«
Sie lachte. »Ist doch gut so. Das ist die Challenge!«
Das Video, das sie machten, war nämlich für die Free-from-all-Challenge gedacht, die derzeit in den Netzen lief. Das Prinzip war einfach: Man sprang so in die Höhe, dass es für einen Moment schien, als unterläge man nicht mehr der Schwerkraft. Das wiederholte man mehrmals – so oft wie möglich – und montierte die einzelnen Aufnahmen dann zu einem Video, in dem es aussah, als schwebe man in der Luft.
Es gab bereits eine Menge solcher Videos, aber die meisten waren eher langweilig: Hunderte, auf denen jemand scheinbar mit angezogenen Beinen eine Treppe herabschwebte. Und ähnlich banales Zeug.
Der bisherige King der Challenge war ein Typ aus den USA, den man über einen komplett gedeckten Tisch hinweg schweben sah – absoluter Wahnsinn! Es gab auch ein Making of dazu, in dem er zeigte, wie er das gemacht hatte: Er hatte sich mithilfe eines Trampolins, das nicht im Bild war, sage und schreibe siebenundvierzigmal über den Tisch katapultiert, und er hatte nach jedem Sprung alles, was dabei an Gläsern und Geschirr kaputtgegangen war, ersetzt und haargenau wieder so aufgestellt wie vorher, und das so akkurat, dass man es überhaupt nicht bemerkte.
Das war das Video, das es zu schlagen galt. Zoe wollte aussehen, als schwebe sie, allen physikalischen Gesetzen zum Trotz, um die Spitze des Ulmer Münsters herum.
Nach ihrem dritten Sprung konnte er nicht mehr hinaufschauen, verfolgte nur noch auf seinem Pod, wie es aussah. Sie machte das unglaublich gut. Wie sie die Arme ausbreitete, eine Tänzerin in der Luft, locker, unbeschwert, der Gravitation entrückt …
Aber eben immer nur für einen winzigen Moment. Dann ging es wieder nach unten und WOMM! ZACK! gegen die Turmspitze, dicht über den Wasserspeiern.
»Das wird gut«, sagte er, als sie, nach dem siebten oder achten Sprung, eine Weile keuchend verharrte. Es strengte sie an. Sie hatte das geübt, allerdings an einer Bretterwand in der Turnhalle ihrer Schule. Gegen Holz zu prallen war gnädiger als gegen Stein.
»Du wirst jede Menge blaue Flecken haben nachher«, unkte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Egal.«
Jetzt spähte er doch hinab, hatte plötzlich das Gefühl, dass man sie schon entdeckt hatte, dass sie beobachtet wurden … Nein, war nicht so. Da unten liefen zwar ein paar Gestalten über den Münsterplatz, aber niemand sah hoch.
»Gut, weiter«, sagte Zoe, mehr zu sich selbst. »Nicht nachdenken, machen.« Kletterte wieder hinauf, holte kurz Luft und sprang erneut hinaus ins Leere.
Dass sie sich das traute! Er prüfte unwillkürlich sein eigenes Haltekabel, schwarzgrau, gewöhnlich, aber stabil genug, dass man ein Auto hätte dranhängen können.
Zoe sprang, machte in der Luft Posen wie ein Engel in ihrer bauschigen, bunten Jacke, knallte gegen den Turm, kletterte wieder hoch und sprang erneut.
»Wie viele waren das jetzt?«, wollte sie irgendwann wissen.
»Dreiundzwanzig«, sagte er, so erschöpft, als sei er selber gesprungen. »Das reicht dicke. Sind echt gute dabei. Hammer.«
»Einen noch, hmm? Vierundzwanzig ist ’ne runde Zahl. Die Weihnachtszahl.«
Er schüttelte den Kopf, spürte seine Knie, die wie Pudding waren und mit denen er wieder da runterklettern sollte. »Nee, komm, lass gut sein. Was wir haben, reicht. Die Sonne ist jetzt eh zu hoch.«
»Einen noch«, beharrte Zoe und kletterte zurück nach oben.
»Zoe! Bitte.«
Sie grinste so hinreißend frech, wie er sie am liebsten sah, hauchte einen Kuss in die Kamera, die Zoe mit roboterhafter Zuverlässigkeit in der Mitte des Bildes hielt. Dann schwang sie vor, zurück, vor, zurück … und stieß sich noch einmal ab.
Es war nicht das grellgrüne Kabel, das riss, sondern die uralte Sprosse, an der sie es befestigt hatte. Zoe flog hinaus, weit, viel zu weit, die Arme ausgebreitet, Entsetzen im Gesicht, als sie begriff, was geschah.
Nichts konnte ihren Sturz in die Tiefe aufhalten. Einhunderteinundsechzig Meter. Und die Drohne, die ihrem Peilsender treu folgte, raste hinterher und filmte alles, bis zum Aufschlag.
Zoes Freund und Komplize, der es mitangesehen hatte, war danach außerstande hinabzuklettern. Weinend und zitternd klammerte er sich an die Sprosse, an die er sich gebunden hatte, bis man ihn entdeckte und ein Feuerwehrmann kam, um ihn zu holen. Er war es, der den Polizisten sagte, um wem es sich bei der total entstellten Leiche des Mädchens handelte: Um Zoe Havelock, die Urenkelin des ehemaligen Bundeskanzlers und späteren EU-Präsidenten Robert Havelock, der knapp dreißig Jahre zuvor das System des Freiheitsgelds in der Europäischen Union eingeführt hatte.
Die Polizei beschlagnahmte die Drohne und das Video, aber die Aufnahme ihres Sturzes geriet trotzdem irgendwie ins Netz. Noch ehe der September des Jahres 2063 anbrach, hatten es mehr als eine Milliarde Menschen gesehen.
Kapitel 1
Dienstag, 26. Februar 2064
Auf der Rückfahrt ins Revier kamen sie an einer schier endlos langen Häuserfront mit seltsam blinden, schießschartenartigen Fenstern vorbei.
»Wir sind ja schon an der Oase«, sagte Clemens Nakowski, von den Kollegen bisweilen Naki genannt. »Wo die ganz reichen Leute wohnen.«
»Zu denen wir nie gehören werden,« seufzte Ahmad Müller und musterte die Fassaden, die sie passierten. Obwohl es schon dunkelte, war kein einziges der Fenster erleuchtet. »Dass das jemandem gefällt …? Sieht doch aus wie eine Burg. Oder wie ein Gefängnis.«
»Hier sollten sie uns mal prüfen lassen«, moserte Clemens. »Aber nein, uns hetzt man auf die kleinen Fische, bei denen eh nichts zu holen ist.«
Clemens war gefrustet. Sie hatten den ganzen Tag damit verbracht, Leute zu überprüfen, die der Computer der Steuerhinterziehung verdächtigte, und in keinem einzigen Fall hatte sich der Verdacht bestätigt; jedes Mal hatte sich eine plausible Erklärung für die Abweichungen von der Norm gefunden. Ahmad fand das gut, hieß es ja, dass die Bürger gesetzestreuer waren, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Aber Clemens brauchte handfestere Erfolgserlebnisse, um abends zufrieden zu sein.
Er schaltete das Radio ein. »Rügen«, sagte ein Sprecher. »Ivana Quayle, reichste Frau Europas, hat heute das Robbenschutzgebiet eingeweiht, das auf ihre Initiative und mit ihrer finanziellen Unterstützung –«
»Was ist ’n heute los?«, ächzte Clemens und drehte das Gerät entnervt wieder ab.
Ahmad musste lachen. Eigentlich war ihr Tag angenehm verlaufen. Zwei der zu überprüfenden Frauen hatten, als die Verdachtsmomente ausgeräumt waren, mit ihnen geflirtet, eine sogar richtig heftig. Da wäre mehr drin gewesen, wenn Ahmad etwas für One-Night-Stands übriggehabt hätte. Ein älterer Mann, Witwer und ehemaliger Geschichtsprofessor, hatte ihnen einen Vortrag über die Geschichte des frühen 21. Jahrhunderts gehalten und wie es überhaupt zur Einführung des Freiheitsgeldes gekommen war. Interessant, wenn er auch zum Schluss arg wie ein Verschwörungstheoretiker geklungen hatte. Und eine Frau hatte ihnen selbst gebackenen Kuchen serviert, während Clemens und Ahmad ihre Konten und Belege geprüft hatten, und der hatte köstlich geschmeckt. Natürlich durften sie derartige Aufmerksamkeiten eigentlich nicht annehmen. Aber, he, in dem Fall wäre das wirklich eine Sünde gewesen!
»Wir sollten uns nicht von einem Computer vorschreiben lassen, wen wir prüfen und wen nicht«, grummelte Clemens. »Früher haben wir uns auch auf unsere Nase verlassen, und war das etwa schlecht?«
»Ähm … ja, war es«, sagte Ahmad und fuhr sich mit beiden Händen durch den Bart. Höchste Zeit, den mal wieder in Form zu schneiden. »Statistisch sind Leute mit ungewöhnlichen Namen viermal so häufig kontrolliert worden wie der Durchschnitt. Und Leute mit gewöhnlichen alten Namen so gut wie gar nicht.«
»Du musst grade reden, Herr Müller.«
»Ich bin ja der, der prüft. Aber frag mal meinen Großvater, wie oft die Steuerpolizei gekommen ist, wenn man zufällig Rami Massoud heißt. Irgendwann hat er extra eine Flasche Schnaps gekauft, um den Prüfern was anbieten zu können, ehe sie enttäuscht wieder abziehen mussten.« Die Flasche hatte Großvater immer noch; als im Alter fromm gewordener Muslim trank er keinen Alkohol mehr.
»Okay. Ist ja eigentlich auch besser, wenn sich ein Verdacht nicht bestätigt.« Clemens spähte aus dem Fenster. »Sag mal, wie fährt der Wagen überhaupt?«
Ahmad beugte sich ebenfalls nach vorn. »Wieso? Wenn man vom Waldfriedhof reinfährt, ist das …«
Er verstummte. Sie sahen es beide: In einer schwach erleuchteten Seitengasse standen zwei Männer, einer von ihnen hatte einen offenen Aktenkoffer auf dem Deckel eines Mülleimers liegen und eine Tüte mit weißem Pulver in der Hand.
Dann waren sie vorbei. Ahmad griff nach dem Steuerhorn des Wagens, schaltete die Automatik ab und brachte das Gefährt abrupt am Straßenrand zum Stehen.
Clemens sah ihn mit großen Augen an. »Hast du das auch gesehen?«
»Ja«, sagte Ahmad.
»Drogen, oder?«
»Sah ganz so aus.«
»Hier?« Clemens griff nach dem Funkgerät, zögerte dann aber, es einzuschalten. »Wäre Sache der Streife, aber bis die hier sind …?«
Ahmad nahm ihm das Funkgerät aus der Hand, legte es zurück. »Komm. Das erledigen wir selber. Wird keiner was dagegen haben, wenn wir heute doch noch einen Punkt machen. Und du kannst dann wenigstens gut schlafen.«
Sie stiegen aus, rückten die Brustpanzer unter ihren Mänteln zurecht, zückten ihre Waffen und hielten ihre Ausweise griffbereit. Dann überquerten sie die dunkle Straße raschen Schritts und näherten sich der Seitengasse. Ziegelboden, uralt. Ein Torbogen über dem Eingang, grünstichig und verwittert, das Tor dazu fehlte. Eine der Wände verputzt, Schimmel kroch daran hoch. Ganz am Ende der Gasse eine funzelige Pendellampe, die den Bereich um die Mülltonnen beleuchtete.
Sichern, einen Blick wechseln, und los. »Halt, Polizei!«, rief Clemens mit erhobener Waffe. »Stehenbleiben. Hände so, dass ich sie sehen kann.«
Die beiden Männer zuckten zusammen, hoben die Arme und rührten sich nicht mehr.
»Das ist ein Missverständnis«, rief der mit dem Koffer.
»Werden wir sehen«, sagte Clemens und nickte Ahmad zu, sich um den anderen zu kümmern, den Kunden. Der war ein irgendwie eckiger Typ, breitschultrig, trug einen blassen Großvatermantel. Ahmad packte ihn am rechten Oberarm, hielt ihn fest. Seine Hand war in solchen Situationen so gut wie ein Schraubstock.
»Mein Name ist Antonis«, erklärte der mit dem Koffer. »Gabriel Antonis. Ich hab eine Lizenz. Wenn Sie mir erlauben, in meine Brusttasche zu greifen, kann ich sie Ihnen zeigen.« Er hatte etwas Sauber-Adrettes an sich, wie Mamas Liebling, war gepflegt gekleidet und frisch frisiert. Trug ein modern gemustertes Hemd mit irisierend hellblauen Knöpfen, wie Ahmad sie noch nie gesehen hatte.
»Einen Moment«, sagte Clemens, zog den Scanner heraus und durchleuchtete ihn damit. Kein Metall in der Jacke. »Gut, zeigen Sie her.«
Der Mann holte einen Ausweis heraus, reichte ihn Clemens.
»Hier steht, Sie haben ein Kontor im Schirbini-Zentrum«, las der ihm vor. »Was zum Henker machen Sie dann hier?«
Der adrette Mann zuckte mit den Schultern. »Ich mache auch Hausbesuche. Dienst am Kunden.«
»Hausbesuche, soso.« Clemens gab ihm den Ausweis zurück, steckte die Waffe weg und deutete auf den Koffer. »Und das da ist dann wohl Ihr Bauchladen?«
»Alles zertifizierte Ware«, verteidigte sich der Mann und holte einige der Tütchen mit zumeist schneeweißem Pulver darin heraus. »Sehen Sie? Jede Packung ist versiegelt. Sie können das Hologramm prüfen.«
»Schon gut«, wiegelte Clemens ab. Da sie keine Streifenpolizisten waren, hatten sie keine entsprechenden Prüfgeräte bei sich. »Was ist mit den gesetzlich vorgeschriebenen Informationen?«
»Hier, alles da.« Der Drogenhändler zog längliche Faltblätter hervor. »Informationen über Zusammensetzung, Wirkung, empfohlene Dosis, Höchstdosis, Ratschläge zur Anwendung, Grad der Suchtgefahr, Kontraindikationen, sonstige Hinweise. Unten die Notrufnummer, genau nach Vorschrift. Und« – er zückte gelbe Zettel – »der allgemeine Ratgeber zur Suchtvermeidung vom Gesundheitsamt.«
Clemens sah ein paar der Broschüren durch, las die Namen der zumeist synthetischen Drogen vor. »›Weiße Nonne‹. ›High Flyer‹. ›Knockout.‹ ›PIHKAL‹. ›Gonzo Plus‹.« Den Rest sah er nur durch, verglich ihn mit den Etiketten auf den Plastikbeuteln. Schließlich gab er die Zettel zurück, warf Ahmad einen enttäuschten Blick zu. »Sieht alles legal aus.«
»Ist alles legal«, betonte der Händler. »Wenn wir in meinem Kontor wären, könnte ich Ihnen meine Zeugnisse zeigen.«
»Haben Sie auch klassische Drogen?«, fragte Clemens mit einem merklich mehr als beruflichen Interesse. »Marihuana? Koks? So was in der Art?«
»Ja, klar, aber leider nicht bei mir.« Der Händler zückte eine Visitenkarte, hielt sie Clemens hin. »Auf der Rückseite stehen meine Öffnungszeiten.«
»Naki!«, mahnte Ahmad.
Clemens schrak ein bisschen zusammen, steckte die Karte aber ein. »Ach ja«, fiel ihm ein. »Ich müsste dann noch Ihren Steuerstatus prüfen.«
Der Händler zog seufzend den Pod heraus, holte seinen Steuercode auf den Schirm und hielt ihn Clemens hin. Der prüfte mit seinem Gerät, nickte. »Alles in Ordnung. Tja, dann … dann entschuldigen Sie die Störung!«
Der Händler lächelte gezwungen. »Schon gut. Sie tun ja nur Ihre Pflicht.«
»Naki«, mahnte Ahmad. »Den Kunden müssen wir auch überprüfen!« Das kleine Einmaleins der Steuerfahndung: Es genügte nicht, wenn der Verkäufer ordnungsgemäß Steuern zahlte; das, was er verkaufte, musste auch mit ordnungsgemäß versteuertem Geld gekauft werden.
»Ach so«, sagte Clemens. »Ja, klar.« Er wandte sich dem Kunden zu. »Wenn ich bitten dürfte.«
Im selben Moment brach Chaos aus wie eine Explosion. Der Mann, den Ahmad bis eben festgehalten hatte, wollte sich mit urtümlichem Keuchen losreißen, wodurch sich aber Ahmads Griff nur noch verstärkte. Im nächsten Augenblick blitzte in der Linken des Mannes eine Messerklinge auf, mit der er umgehend zustach, mit enormer Wucht und so angesetzt, dass er Ahmad unterhalb seines Brustpanzers traf, tief in den Bauch.
Der Schmerz war wie ein Blitzschlag, setzte Ahmad sofort außer Gefecht. Der Mann riss sich los und rannte, Clemens nach einer Schrecksekunde hinterher, laut schreiend. Ein Schuss fiel, ein zweiter.
Aber das bekam Ahmad nur wie durch einen Schleier mit. Er war gegen die Ziegelwand gekippt, sank langsam daran hinab, die Hände auf den Bauch pressend, und alles, was er sah, war, wie Blut zwischen seinen Fingern hervorquoll.
Oh nein!, schoss es ihm durch den Kopf. Nicht da! Ich wollte doch noch mindestens fünf Kinder zeugen …!
Dann wurde es dunkel um ihn.
Kapitel 2
Mittwoch, 27. Februar 2064
»Der wichtigste Vorteil einer Gated Community ist, wie schon der Name sagt, der damit verbundene Schutz«, erklärte die Managerin, während sie sie zu ihrer künftigen Wohnung führte.
Sie folgten ihr, und Valentin registrierte zufrieden, dass Lina ganz von selbst nach seiner Hand gegriffen hatte. Klar, sie waren erst kurz verheiratet und immer noch ziemlich verliebt, aber daran lag es nicht. Lina hielt sich an ihm fest, weil sie das alles hier ein bisschen überwältigte.
»Die Gewalt, die Verbrechen, all das bleibt draußen«, fuhr die Frau fort. »Das gesamte Gelände wird durch unseren Wachdienst gesichert, alle Besucher und auch alle Lieferanten werden genauestens überprüft. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben vor Einbrüchen oder vor Überfällen; dergleichen kommt hier drinnen nicht vor. Hier in der Oase leben Sie in Sicherheit – und in Luxus, versteht sich.«
Damit schloss sie die Tür auf und machte eine einladende Handbewegung: Sie mögen vorangehen.
Das taten sie, und Valentin, der schon Bilder der Oasen-Wohnungen gesehen hatte, schmunzelte zufrieden, als er hörte, wie Lina nach Luft schnappte.
»Valentin!«, hauchte sie, völlig überwältigt von dem, was sie sah: ein riesiges Apartment mit Wohnzimmer, Terrasse, großem Bad, sogar einem Ankleideraum! Alles schon ausgestattet mit Möbeln vom Feinsten. Und einem TV-Gerät, das neueste Modell.
»Falls Ihnen irgendein Möbelstück nicht gefallen sollte oder falls es nicht zu dem passt, was Sie mitbringen, sagen Sie mir einfach Bescheid, dann lagern wir es ein«, erklärte die Managerin. Sie ging voran ins Schlafzimmer, zeigte auf das matratzenlose Bettgestell und sagte: »Bis zu Ihrem Einzug am Samstag bekommen Sie selbstverständlich noch eine Matratze dazu, fabrikneu, versteht sich.«
»Toll«, sagte Valentin, um auch mal was zu sagen. Er spähte auf die Visitenkarte, dieses wunderbar altmodische Ding: Das erste Mal, dass ihm jemand so etwas in die Hand gedrückt hatte. Tadala Vogt hieß die Frau. Sie hatte ungewöhnlich dunkle Haut, ausgeprägt afrikanisch wirkende Gesichtszüge, aber geglättete, modisch geschnittene Haare, und sie wirkte irgendwie unfassbar tüchtig, wie jemand, der alles im Griff hatte.
Musste man vermutlich auch, wenn man so ein Ding wie diese Oase leitete.
Sie traten gemeinsam auf den Balkon hinaus. Es war kühl heute, Regen lag in der Luft, und die grauen Wolken schienen bis auf die Bauten herabzuhängen, die von innen gesehen wie ein Schutzwall wirkten gegen die böse Welt da draußen. Der Innenbereich sah größer aus, als Valentin es sich vorgestellt hatte; das war ein richtiger Park mit Bäumen und Büschen, Spazierwegen, Sitzbänken und Teichen, auf denen Enten schwammen und ihren geheimnisvollen Beschäftigungen nachgingen. Das war eine ganze kleine Welt für sich hier drinnen!
»Ihre Nachbarn rechter Hand arbeiten übrigens auch in der Krankenpflege, allerdings draußen, im Klinikum«, erklärte die Managerin. Dann zählte sie berühmte Leute auf, die schon in der Community gelebt hatten oder noch lebten; lauter Namen, die man kannte, vor allem den von Altpräsident Robert Havelock. »Früher hat man ihn oft irgendwo in den Grünanlagen angetroffen«, erzählte sie und seufzte. »Aber seit dem Tod seiner Urenkelin lebt er sehr zurückgezogen.«
Sie nickten. Natürlich hatten sie davon gehört. Und das Video gesehen, schrecklich.
»Nun, andererseits ist er auch schon sehr alt«, fügte sie hinzu. »Er muss so um die, hmm, fünfundneunzig sein.«
Sie fing sich und fuhr fort, die Annehmlichkeiten zu schildern, die ihnen zur Verfügung stehen würden. Valentin kannte das bereits von seinem Vorstellungsgespräch, aber Lina klappte der Unterkiefer herunter: ein Schwimmbad mit freiem Eintritt zu jeder Tageszeit. Ein Friseursalon. Ein richtiger Arzt und eine Apotheke mit eigenem Personalizer. Eine Modeboutique. Ein Supermarkt mit exklusiven Angeboten. Ein kostenloses Parkhaus, sofern sie einen Wagen besaßen (besaßen sie natürlich nicht, aber wer weiß, eines Tages?). Ein Hausmeister, der, falls gewünscht, auch Besorgungen außerhalb erledigte. Einen Kleiderreinigungsdienst. Einen Kinderhort.
»Der Hort wird vor allem von Kindern aus den umliegenden Vierteln besucht, weil in der Oase nur wenige Kinder leben«, erläuterte die Managerin weiter. »Ferner haben Sie Anspruch auf eine Wohnungsreinigung pro Woche und eine Mahlzeit pro Tag aus dem Community-Restaurant, die Ihnen entweder in die Wohnung geliefert wird oder die Sie im Restaurant selber zu sich nehmen können, ganz wie Sie wünschen. Sie müssen nur jeweils rechtzeitig Bescheid sagen.«
Sie zog ihren Pod hervor, ein luxuriöses Butly, und lächelte wie eine Fee, die gerade dabei war, Geschenke zu verteilen. »Und damit Sie das alles tun können, würde ich Ihnen jetzt gerne den Skill dafür auf Ihre Pods geben. Wohlgemerkt, Sie sind nun mit Ihrer Biometrie registriert und können die Oase jederzeit betreten, auch ohne Ihren Pod. Aber mit dem Skill geht alles einfacher. Sie können damit Ihr ganzes Leben in der Oase bequem organisieren.«
Valentin holte seinen Pod heraus, ließ sich den Skill draufwischen und sah, wie Lina zögerte, ihren herauszuholen. Sie hatte immer noch das zerkratzte No-Name-Gerät, das sie irgendwann als Kind gekriegt hatte, ein billiges Personal Organization Device aus dem Centi-Markt: Höchste Zeit, ihr ein schickes neues Teil zu besorgen!
Die Managerin ließ sich nichts anmerken, sondern überspielte Lina den Skill genauso routiniert. Dann sagte sie: »Im Vorgriff auf Ihren Einzug am Samstag habe ich mir erlaubt, Ihnen heute einen Tisch im Community-Restaurant zu reservieren. Damit Sie die bevorstehende Veränderung angemessen feiern können.«
»Wahnsinn!«, hauchte Lina, die noch nicht viele Restaurants von innen gesehen hatte in ihrem Leben.
»Ach, eine Sache noch«, fiel der Managerin ein. Sie sah Valentin an. »Sie werden in der Zone A arbeiten, wenn ich recht informiert bin?«
»So ist es«, sagte Valentin nicht ohne Stolz.
»Es gibt drei Übergänge aus der B-Zone in die A-Zone. Einer befindet sich im Außenbereich, zwischen Supermarkt und Schwimmbad, die beiden anderen, für Regentage gedacht, jeweils in den umliegenden Gebäuden. Sie müssen also nur dem Gang weiter folgen, den wir gekommen sind, und dann ins Erdgeschoss hinabsteigen.«
Valentin nickte. »Alles klar. Werd ich finden.«
»Sie dagegen«, fuhr die Frau an Lina gewandt fort, »werden leider keinen Zutritt zur A-Zone haben. So sind die Regeln.«
Lina lachte. »Macht nichts. Ich werd allein hundert Jahre brauchen, um mich an das hier alles zu gewöhnen!«
Valentin sah seine Frau an, wie sie strahlte vor Glück und so schön war wie noch nie.
Das mit den zwei Zonen war schon gut eingerichtet so. Lina war glücklich, und das war die Hauptsache.
Sie durfte nur nie erfahren, was es ihn kosten würde.
Lina hatte das Gefühl, alles nur zu träumen, als sie durch den Park zum Restaurant schlenderten, durch die kühle, feuchte, nach geschnittenem Gras duftende Luft. Sie hatte nicht gewusst, dass es solchen Luxus gab, es nicht einmal geahnt. Klar, gehört hatte sie, dass es reiche und weniger reiche Leute gab, nach wie vor, aber wo und wie die lebten, darüber hatte sie sich nie den Kopf zerbrochen. Ihr Vater schon, ja, aber das allein war Grund genug gewesen, das Thema zu ignorieren.
Und nun sollte sie, Lina Jouvens, kaum 20 Jahre alt, dazugehören? Wie war denn das möglich? Gut, die Oase hatte Valentin engagiert, er würde als Personal Trainer und als Krankengymnast arbeiten, eine relativ seltene Kombination – aber wurde die tatsächlich so gut bezahlt, dass sie sich das alles hier leisten konnten?
Valentin lachte nur, als sie ihm diese Bedenken offenbarte, und drückte sie im Gehen an sich. »Die Oase, das ist im Grunde eine Firma, verstehst du? All die Gebäude rings um das Areal, die Anlagen, das Gelände und so weiter, die gehören dieser Firma, und die vermietet die Wohnungen an Leute, die es sich leisten können. Die Firma zahlt mir ein gutes Gehalt, aber die ganzen zusätzlichen Leistungen, die sind kein Gehalt, sondern einfach im Mietverhältnis inbegriffen und werden darum nicht so besteuert wie mein Gehalt. Dadurch kommt es die Firma nicht so teuer, wie es aussieht.«
Linas Blick fiel auf einen Mähroboter, der nahezu lautlos und mit seiner dunkelgrünen Hülle auch nahezu unsichtbar über ein Rasenstück glitt. Ja, bestimmt wurde hier die meiste Arbeit von Robotern gemacht und kostete dadurch nicht ganz so viel, wie man meinte.
Wie zur Bestätigung entdeckte sie noch einen anderen Roboter, der überstehende Triebe an einem Gebüsch abschnitt und aufsammelte.
Valentin hatte bestimmt recht mit seiner Erklärung. Er hatte meistens recht in solchen Dingen.
Sie gelangten an den Supermarkt, der seltsam verspielt aussah. Altmodisch aus dunkelroten Ziegeln erbaut, mit kleinen Fenstern und Rundbögen, wirkte er wie ein zu groß geratenes Hexenhäuschen, das sich unter üppig wuchernden Bäumen zu verstecken suchte. Vor dem Eingang bot ein Ständer wahrhaftig noch ein paar richtig gedruckte Zeitungen und Zeitschriften feil, von denen Lina nur die Morgenpost kannte.
»Schau dir das an!«, entfuhr es ihr. »So was hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wenn überhaupt je.«
Valentin schmunzelte. »Sie hat es ja vorhin angedeutet, hier in der Oase leben hauptsächlich ältere Leute. Ich schätze, noch eine Generation, dann wird das niemand mehr kaufen.«
Sie blieben einen Moment stehen und betrachteten den Ständer, als sei er eine Art historisches Denkmal. Die meisten Schlagzeilen drehten sich um Ivana Quayle, die berühmte Milliardärin und Vorsitzende der Europäischen Naturschutzstiftung, die in der Ostsee ein Robbenschutzgebiet eingeweiht hatte, für das sie aus eigener Tasche etliche hundert Millionen Euro gespendet hatte. Auf den Fotos sah sie aus wie ein Model, eine kühl wirkende, hochgewachsene Blondine mit unergründlich blickenden dunklen Augen.
»Oje, schau mal da«, sagte Valentin und zeigte ihr eine Zeitschrift auf der anderen Seite des Ständers, die mit einem Bericht über Altpräsident Havelock aufmachte: So nahe geht ihm der Tod seiner Urenkelin noch immer!, lautete die Schlagzeile.
»Eklig«, meinte Lina. »Vielleicht ganz gut, wenn es solche Publikationen mal nicht mehr gibt.«
»Ja, gruselig, wie die das breittreten.« Valentin zog sie mit sich, und so gingen sie dann weiter. Bis zum Restaurant waren es nur noch ein paar Schritte.
»Das war wegen dieser Challenge, nicht wahr?«, erinnerte sich Lina. »Free from all oder so hieß die.«
»Ja. War hinterher ziemlich schnell vorbei, glaube ich.«
Das Restaurant befand sich im selben Gebäude, das auch das Hallenbad beherbergte. Von den Tischen am Fenster blickte man auf das Außenbecken, das um diese Jahreszeit aber noch abgedeckt war.
Als sie die Tür passierten und einen Vorhang aus schwerem Stoff, empfingen sie verheißungsvolle Düfte – und ein recht beleibter Mann mit einem lustig gezwirbelten Schnurrbart. Er trug eine schneeweiße Kochjacke und sprühte aus jedem seiner zahlreichen Knopflöcher vor guter Laune.
»Guten Tag, guten Tag, Sie müssen Herr und Frau Jouvens sein«, begrüßte er sie. »Frau Vogt hat Sie angekündigt und meiner Aufmerksamkeit anempfohlen, wie man so sagt. Also, ich darf mich vorstellen – mein Name ist Lorenz Winter, ich bin der Küchenchef hier und möchte Sie heute verwöhnen, so gut ich kann. Der Einzug in eine Community wie unsere Oase ist schließlich etwas, das man gar nicht genug feiern kann.«
»Klingt gut«, meinte Valentin und deutete eine Verneigung an.
Lina wusste nichts zu sagen; die ganze Atmosphäre des Restaurants überwältigte sie: der kostbar aussehende Holzboden, die vornehm gedeckten Tische, auf denen Gläser, Teller und Besteck glitzerten, die schweren Vorhänge, die mit dunkelblauem Stoff bespannten Wände, an denen Gemälde hingen, echte, wie es den Anschein hatte.
Der Küchenchef geleitete sie zu einem schönen Zweiertisch direkt am Fenster. Lina setzte sich, sah hinaus und hatte einen irritierenden Moment lang das Gefühl, dass sie sich hier im Inneren eines uralten, erkalteten Vulkans befanden, in dem die Vegetation, durch die Kegelwände vor der Außenwelt geschützt, üppig gedieh. Das musste an dem seltsamen Licht liegen, sagte sie sich.
»Das hier war übrigens der Lieblingsplatz unseres Altpräsidenten«, erklärte Winter und sah Lina an. »Genau da, wo Sie sitzen. Leider kommt er schon lange nicht mehr, sondern lässt sich das Essen bringen. Aber viele Jahre lang, doch, da saß er mittags immer hier. Das war … schön.«
»Oh«, entfuhr es Lina, und sie ärgerte sich, dass sie nichts Klügeres darauf zu sagen wusste.
Valentin räusperte sich, meinte: »Ist generell nicht so viel los, oder?«
Tatsächlich waren nur wenige der Tische besetzt. Ein altes Paar saß am anderen Ende der Fensterfront, in der Nähe der Theke trank ein Mann ein Bier und war in eine Lektüre auf seinem Pod vertieft, mehr war nicht los.
»Das wechselt«, erklärte Herr Winter. »Heute haben wir nicht viele Gäste im Restaurant, das stimmt, aber ein paar werden noch kommen, in einer halben Stunde oder so. Gestern hätten Sie da sein müssen! Da war was los.« Er rieb sich die Hände. »Aber das macht nichts, so habe ich mehr Zeit für Sie. Womit kann ich Ihnen denn eine Freude machen? Wie wär’s zu diesem Anlass mit Steaks aus echtem Fleisch?«
»Echtes Fleisch?«, wiederholte Lina. »Was heißt das?«
Der Küchenchef hob die Hände. »Nun – man versteht darunter Muskelgewebe von Tieren wie Schweinen, Rindern, Schafen und so weiter.«
»Sie meinen – Tiere, die man tötet, um sie zu essen?«
Er lächelte verbindlich. »Junge Frau, bis in die Dreißigerjahre war das noch absolut üblich. Fragen Sie Ihre Großeltern.«
Ihr schauderte, und sie blickte hilfesuchend zu Valentin hinüber. Der merkte, wie ihr zumute war, und sagte: »Ähm … wir wären auch mit etwas, hmm, weniger Extravagantem zufrieden.«
»Ah, verstehe, verstehe. Nun, wie wäre es mit dem entgegengesetzten Ende der Skala? Vegetarische Küche, die beste, die es gibt, also indisch? Darf es indisch sein? Wir hätten heute ein exzellentes Dal mit diesem und jenem, und dazu selbst gemachte Chapati.«
»Au ja«, sagte Lina rasch.
»Zweimal«, ergänzte Valentin.
Sie überließ es Valentin, mit dem Küchenchef auszudiskutieren, was sie dazu trinken würden – die beiden einigten sich auf einen würzigen Rosé aus Sardinien –, schaute solange hinaus. Sie sah zwei Tauben, die miteinander turtelten. Beruhigend, dass das noch genauso aussah wie bei den Tauben, die sie als Kind beobachtet hatte.
»Das wird dir alles grade ein bisschen viel, oder?«, fragte Valentin, als der Küchenchef wieder fort war.
Lina seufzte. »Ich musste an daheim denken, an das Motivationsposter, das sich Papa gebastelt hat, als ich acht war oder so. Das allererste Bild, das er aufgeklebt hat, war eins von einem Lokal, das fast so ausgesehen hat wie das hier. Und er hat mir versprochen, wenn er es mal geschafft hat, dann geht er mit uns in ein ganz feines Restaurant, und dann feiern wir ganz groß!« Sie presste kurz die Hände vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken. »Aber er hat’s ja nie geschafft, bis heute nicht. Und trotzdem sitz ich hier!«
»Oje«, meinte Valentin. »Ich glaub, an deiner Stelle wär ich jetzt auch fertig.«
Ihr Vater hatte Linas ganze Kindheit hindurch fast das gesamte Freiheitsgeld der Familie in seine Firma investiert, einen Onlineversand für Flugdrachen-Bausätze, der trotz seines Gegenstands nie »abgehoben« – so die Wortwahl ihres Vaters –, sondern immer nur Verluste und noch mehr Verluste eingefahren hatte. Mal hatte es an falschen Kalkulationen gelegen, mal hatte es Schadenersatzprozesse gegeben, jedenfalls hatte Lina ihre Kindheit in einer Armut gelebt, die sie nicht verstanden hatte. Ganz lange hatte sie geglaubt, das müsse eben so sein, dass man hungrig ins Bett ging und jedes Kleidungsstück trug, bis es einem vom Leib fiel.
»Und dann hat er immer mehr Bilder aufgeklebt«, erinnerte sie sich, »von riesigen Jachten, von Villen, von Luxusautos, von Schlössern, von Champagnerflaschen, von diamantbesetzten Armbanduhren und so weiter, und so weiter. Er hat sich immer als künftigen Milliardär gesehen! Sein großes Vorbild war dieser … wie hieß er?« Sie hielt inne, musste überlegen. »Der Typ, der mal versucht hat, den Mars zu besiedeln.«
Valentin nickte. »Ich weiß, wen du meinst. Aber ich komm grad auch nicht auf den Namen.«
»Jedenfalls, ein Foto von dem klebte genau im Mittelpunkt. Direkt über dem Restaurant.«
Lina holte tief Luft, sah sich um, versuchte, die Ängste abzuschütteln, die sie befallen hatten. Das war alles vorbei. Das betraf sie nicht mehr. Es war schön hier, nun konnte sie es sehen. Wirklich schön.
»Ich krieg einfach immer Panik, wenn’s mir richtig gut geht«, bekannte sie. »Weißt du ja.«
Valentin nickte. Am Anfang hatte sie lange nicht glauben können, dass er sie wirklich wollte: Anlass für viele schlimme Streits um im Grunde nichts.
Das Essen kam. Sah umwerfend aus, absolut traumhaft, und roch mehr als verheißungsvoll. Lorenz Winter kam eigens, um sie noch einmal in der Oase willkommen zu heißen und ihnen einen guten Appetit zu wünschen.
»Auf dich und deinen unglaublichen Job«, sagte Lina, als sie anstießen. »Ich verspreche, dass ich es genießen werde, hier zu leben, und auch wenn ich es vielleicht nicht auf Anhieb kann – ich werde es lernen. Jawohl, ich werde es lernen, den Luxus zu lieben!«
Der Mann schwitzte über sein ganzes, feistes Gesicht. Zog immer wieder am Kragen seines Hemdes. Rieb sich nervös die Handflächen an den Hosenbeinen ab. Schnaufte. Keuchte fast.
Ahmad hatte ihn in die Enge getrieben. Er hatte sämtliche Dokumente vor ihm ausgebreitet, die sie gefunden hatten. Dokumente, die bewiesen, dass sie alles wussten über das Schwarzgeld, die geheimen Konten in der Karibik, die Guthaben in Kryptowährungen, alles.
»Und?«, fragte er. »Geben Sie es zu?«
Der Mann antwortete nicht. Seine Blicke zuckten hin und her; er sah fast aus wie eine Ratte, die verzweifelt einen Ausweg aus einer Falle sucht.
Dann packte er Ahmad am Arm, zog ihn zur Seite, weit genug, dass die anderen sie nicht mehr hören konnten, und flüsterte: »Sagen Sie … kann man das nicht anders regeln?«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Ahmad zurück, der im ersten Moment wirklich nicht begriff, worauf der Mann hinauswollte.
Der Mann wischte sich mit der Hand über die schweißglänzende Stirn. »Wenn ich Ihnen hunderttausend Euro gebe … in US-Dollar, in Bitcoin, wie immer Sie wollen … und Sie vergessen das alles einfach?«
Ahmad sah ihn ungläubig an. »Wie bitte?«
»Hunderttausend!«, wiederholte der Mann. »Und bedenken Sie: steuerfrei! Bei den heutigen Sätzen heißt das, es wäre effektiv fast das Zehnfache. Da hätten Sie doch was davon! Oder wollen Sie ewig angewiesen bleiben auf dieses Almosen des Staats, das sich großspurig Freiheitsgeld nennt …?«
Ahmad starrte den Mann, auf dessen Gesicht jeder Schweißtropfen glänzte wie ein Stern am Himmel, fassungslos an. Er hatte einen Eid abgelegt, hatte geschworen, Recht und Gesetz zu verteidigen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, die Integrität der Europäischen Union, die Menschenrechte. Von daher war klar, dass er auf das Angebot des Mannes nicht eingehen durfte. Nicht einmal darüber nachdenken durfte er …
Doch er schwankte, war wirklich in Versuchung. So viel Geld! Was er damit machen konnte …!
Stöhnend fuhr er hoch, selber in Schweiß gebadet, und alles tat ihm weh. Fuhr hoch und musste sich lange umsehen, ehe er begriff, dass der Mann nur ein Traum gewesen war, eine Erinnerung an einen ganz, ganz alten Fall, einen seiner ersten. Die Wirklichkeit, das war das Krankenzimmer, in dem er lag, alleine in dem schummrigen Halbdunkel, das die Anzeigen, Displays und Lämpchen der Geräte erzeugten, an die er angeschlossen war.
Nach und nach fiel ihm alles wieder ein. Die Kontrolle, der jähe Stich in den Unterbauch, alles war wieder da. Er war verletzt worden, und ziemlich schwer, so hundeelend, wie er sich fühlte – aber er lebte noch. Erleichtert sank er zurück in die Kissen, hörte seinem Atem zu, der sich langsam wieder beruhigte.
Er hatte das Geld damals nicht genommen, nein.
Aber vielleicht, dachte er, hätte er es nehmen sollen …!
Die Erinnerung an den Vorfall verfolgte ihn bis in seine Träume, ließ ihn nachts vor Ärger aufwachen. Vor Ärger – und vor Angst!
Dieser Moment, in dem er nach dem Messer gegriffen hatte. Wie früher. Alter Reflex. Verdammt.
Klar, der blöde Bulle hatte ihn festgehalten wie ein Schraubstock. Aber ein blitzschneller Rumms mit dem Ellbogen ins Gesicht hätte es auch getan. Oder mit dem Kopf.
Hoffentlich hatte er ihn wenigstens erwischt. Wenn er starb, ein Problem weniger.
Aber der Händler!
Verdammte Sache. Wenn rauskam, dass er … Wenn das oben bekannt wurde … Dann adieu, schöne Konten in den Steueroasen! Adieu, Traum vom ›dolce vita‹, wenn er erst mal ausgestiegen war!
Unruhige Nächte. Verschwitzte Laken. Sorgen. Und er hasste Sorgen!
Endlich der Morgen. Der Himmel grau wie sein Gemüt. Er musste etwas tun, half alles nichts.
Her mit dem Pod. Telefonskill. Die Nummer war nicht gespeichert, die kannte er auswendig.
»Hallo? Ich bin’s. Ich brauch ’ne Adresse. Schreib mit. Der Name ist Antonis. Gabriel Antonis.«
Kapitel 3
Montag, 3. März 2064
Der Montag nach ihrem Einzug war Valentins erster Arbeitstag.
Das Wochenende hatten sie mehr oder weniger damit verbracht, in ihrer neuen, großen Wohnung herumzublödeln und Sex zu haben, auf der grandiosen neuen Matratze. Sie hatten sich das Mittagessen liefern lassen, und dann hatten sie einander immer wieder gesagt, dass sie jetzt aber wirklich mal auspacken müssten, bloß, arg weit waren sie damit nicht gekommen. Als Valentin sich am Montagmorgen, ausreichend früh, mit einem langen Kuss von Lina verabschiedete, war die Wohnung nach wie vor ein großes, herrliches Durcheinander.
Es regnete ein bisschen und war kühl. Valentin nahm trotzdem den Weg durch den Park, einfach so. Weil es ein tolles Gefühl war, durch diese Anlage zu schlendern und sich sagen zu können, dass man von nun an hierhergehörte.
Den Übergang zu finden war kein Problem: Wenn man am Eingang des Restaurants vorbeiging, kam man eine Wegbiegung später an eine große, weiß lackierte Absperrung mit einem Drehgitter. Valentin hielt seinen Pod an den Sensor, aber das Gitter blieb gesperrt, und auf dem Display erschien die Meldung: Bitte warten. Persönliche Kontrolle ist erforderlich.
Valentin rümpfte beunruhigt die Nase. Wieso das jetzt? Da stimmte doch was nicht!
Nach ein paar Minuten tauchte jemand auf, ein großer, glatzköpfiger Kerl in einer schwarzen Uniform. Er hatte mächtig breite Schultern, und es schien ihm zu gefallen, dass seine wie poliert aussehenden Stiefel beim Gehen knallige Geräusche machten.
Er studierte die Anzeige auf dem Display auf seiner Seite des Gitters. »Valentin Jouvens, ist das richtig?«, fragte er dann.
»Ja«, sagte Valentin und fügte hinzu: »Man hat mir gesagt, das geht automatisch.«
»Ist nur beim ersten Mal nötig«, gab der Wachmann brummig zurück. Er deutete auf die Sensoreinheit. »Wenn Sie bitte Ihren rechten Daumen auf das Feld drücken würden?«
Valentin tat es, wenn auch unwillig. »Eigentlich hat man unsere gesamte Biometrie schon erfasst, als wir letzten Mittwoch zum ersten Mal da waren.«
»Für die B-Zone«, sagte der Mann gleichmütig. »Die A-Zone ist datenmäßig abgetrennt, aus Sicherheitsgründen.« Er tippte auf seinem Display herum, das Gitter schaltete sich mit einem deutlich hörbaren Klicken frei. »Okay, alles klar. Sie können passieren.«
Valentin ging durch das Drehgitter, das sich hinter ihm sofort wieder verriegelte. Der Wachmann versuchte sich an einer Art Lächeln und meinte: »Einen schönen Tag noch.«
»Danke«, sagte Valentin und ging weiter. Das Hochgefühl, das ihn bis gerade eben erfüllt hatte, war wie weggeblasen.
Das war also nun die A-Zone. Okay. Sah ganz ähnlich aus wie die B-Zone, nur dass die Wege verschlungener zu sein schienen, die Büsche und Bäume dichter, die ebenerdigen Wohneinheiten größer. Er folgte den Wegweisern und den Navigationshinweisen seines Pods und fand zielsicher zur Niederlassung der Firma »Stay Young«, einem eleganten Bau in Orange und Braun, mit viel Glas, eingebettet in die umliegende Grünanlage.
Und er war sogar pünktlich!
Die Türen öffneten sich von selber. Ein frischer, zitroniger Duft kam ihm entgegen – und Damira Almassy, seine Chefin. Als hätte sie auf ihn gewartet.
Nun, vielleicht hatte sie das auch. Jedenfalls begrüßte sie ihn mit einem breiten Lächeln und einem geradezu begeistert klingenden: »Ah, der Herr Jouvens, das ist aber schön!«
»Guten Morgen, Frau Almassy«, erwiderte Valentin, unwillkürlich geschmeichelt. Sie hatte so eine Art an sich, dass man auf Anhieb das Gefühl bekam, ein hochgeschätzter Mitarbeiter zu sein.
Okay, möglich, dass das nur ein angelernter psychologischer Dreh war. Aber selbst wenn, hatte sie sich immerhin die Mühe gemacht, ihn zu erlernen.
Sie sah nicht groß anders aus als bei ihrer letzten Begegnung Anfang des Jahres, als er den Anstellungsvertrag unterschrieben hatte: top gekleidet in durchgehend schwarze Markenklamotten, passend zu ihrem dunklen Typ, die langen, dunkelbraunen Haare glatt nach hinten gekämmt, wo sie von einer perlenbesetzten Klammer zusammengehalten wurden. Ein knallroter Lippenstift betonte ihren Mund, ihre buschigen, ausgeprägten Augenbrauen sahen nachgefärbt aus, und ihr enormes Dekolleté war schon fast waffenscheinpflichtig.
Kein Nachteil, fand Valentin. Zumal sie es sich leisten konnte.
Sie zeigte ihm erst mal das Studio: den großen Trainingsraum, in dem etliche TV-Geräte liefen, die Duschen, die Umkleide für die Klienten, die für die Mitarbeiter, das kleine Trainingsstudio neben ihrem Büro. »Für besondere Fälle«, sagte sie auf eine Art, die ein bisschen seltsam klang.
Er bekam einen passenden Trainingsanzug mit dem »Stay Young«-Logo drauf und zog sich gleich um. Das sah alles gut aus, fand er, und sein Hochgefühl kehrte zurück, zumindest zum Teil.
Außerdem war er total fit. Sonst hatte er nicht viel vorzuweisen im Leben, in der Schule nur mittelprächtige Noten, nichts Besonderes geleistet – aber körperlich, da war er in Bestform. Daran gab es keinen Zweifel.
Das ergaben auch die Tests, die sie gleich nach dem Umziehen an ihm machte. Von ihrem Büro aus führte eine Tür in eine Art medizinisches Labor, und dort nahm sie eine Blutprobe und eine Atemprobe und schickte ihn mit einem Becher in die Toilette für eine Urinprobe. Und als die Geräte fertig waren mit ihren Analysen, stellte die Chefin fest: »Alles bestens. Bessere Werte kann man gar nicht haben.«
»Tja«, sagte Valentin und lächelte geschmeichelt.
Sie machte sich ein paar Notizen, wollte wissen, was er gegessen und wann er das letzte Mal Sex gehabt hatte, und dabei meinte sie immer wieder: »Sehr gut. Sehr gut.«
Schließlich lernte er auch seine Kollegin kennen: Rebecca Althaus hieß sie, war eine leicht mäuschenhafte Erscheinung, eine Spur älter als er. Sie trug ihre strohblonden Haare so kurz, als wolle sie den Luftwiderstand optimieren, und abgesehen von »Guten Tag« und »Rebecca, angenehm« sagte sie nicht viel.
»Das Grundprinzip ist, dass Frau Althaus sich um die weiblichen Klienten kümmert und Sie sich um die männlichen«, erklärte Frau Almassy, als es darum ging, das Programm für den Tag zu besprechen: Damit, erfuhr Valentin, würde künftig jeder Arbeitstag beginnen.
Und dann die große Überraschung: Sein erster Klient war niemand anders als der Schlagerstar Hauke Bruhns! Das verschlug Valentin schier die Sprache. Als Kind hatte er dessen Lieder nachgeträllert, hatte keine Sendung verpasst, in der er aufgetreten war. Seine großen Hits hätte er immer noch mitsingen können, Lieder wie »Immer was los!« oder das legendäre »Er bekommt, was er verdient, und er verdient, was er bekommt«. Und den Mann sollte er jetzt beim Training begleiten? Junge, Junge.
»Er hat es mit dem Rücken, seit einem Sturz vom Fahrrad«, erklärte die Chefin ihm. »Sie müssen ihn also an den entsprechenden Geräten anleiten und genau im Blick behalten, dass er sich richtig bewegt. Er hat erst mit dem Rückentraining angefangen, sprich, das ist von der Muskulatur her heikel, und ich sag’s Ihnen gleich: Sollte der Mann einen Bandscheibenvorfall kriegen, während Sie dabei sind, werde ich Sie öffentlich auspeitschen müssen!«
Einen Moment lang war es Valentin, als meine sie das ernst, und er schnappte nach Luft. Dann bemerkte er ihr dünnes Grinsen und sagte: »Alles klar. Das krieg ich hin.«
Trotzdem war er ganz schön aufgeregt, während er auf den Sänger wartete. Irgendwie glaubte man gar nicht, dass es die Leute, die man als Kind im Fernsehen bewundert hatte, wirklich gab.
Dann kam er. Hauke Bruhns, sichtlich gealtert, ja, fast aufgedunsen. Zu viel Alkohol, diagnostizierte Valentin bei sich. Immer noch die fesche Haartolle, aber nicht mehr golden, sondern schon mit Silber durchwirkt, und die goldbraune Haut kam nicht vom Sonnenlicht, sondern aus der Tube.
Aber der Mann war gut drauf. Schüttelte ihm die Hand und meinte: »Nennen Sie mich Hauke, okay? Und erwarten Sie nicht, dass ich Ihnen helfe, ein Klavier irgendwohin zu tragen! Ich kann’s höchstens spielen, mehr nicht.«
Valentin schluckte den Impuls hinunter, ihm zu erzählen, dass er als Achtjähriger mal um ein Autogramm angestanden, es am Schluss aber dann doch nicht gekriegt hatte. Wäre unprofessionell gewesen. Also konzentrierte er sich darauf, den Schlagersänger mit der Lumbar-Extensions-Maschine arbeiten zu lassen. Das war ein modernes Gerät, auf dessen Display sich der Kraftverlauf newtongenau verfolgen ließ; wenn man die Beckenrolle richtig setzte, den Gurt sorgfältig anzog und sich auch sonst exakt an die Anleitung hielt, konnte gar nichts schiefgehen.
Während Bruhns den Oberkörper in dem Takt, den die Leuchtanzeige vorgab, vor und zurück bewegte und dabei ins Schnaufen kam, spähte Valentin hinüber zu seiner Kollegin, die eine Klientin an der Butterfly-Maschine trainierte. Ihm fielen fast die Augen aus dem Kopf, als er sah, wer das war: Niemand anders als die berühmte Schauspielerin Carola Reis! Die lebte also auch hier in der Oase? Wahnsinn.
Und sie sah in echt tatsächlich genauso sexy aus wie im Fernsehen. Valentin holte tief Luft. Sein neuer Job war ja noch toller, als er es sich ausgemalt hatte!
»Meister?«, meldete sich Bruhns amüsiert. »Ich kann ja verstehen, dass Sie lieber da rüber gucken, aber ich wär jetzt mit meinen Wiederholungen durch und hätt nichts dagegen, in ’nem anderen Foltergerät weiterzumachen.«
Als der Schlagersänger wieder fort war, schickte Frau Almassy Valentin selber zum Trainieren, danach in die Dampfdusche und in den Ruheraum, mindestens bis elf Uhr. »Ihr großer Tag ist am Mittwoch, da will ich Sie in Topform haben«, sagte sie. »Denken Sie dran, von den Werten und den Mengen, die wir erzielen, hängt Ihr Bonus ab – und meiner auch. Wir sind sozusagen Verbündete!«
Da war jemand. Ahmad kämpfte sich aus dem Nebel empor, in dem er schwebte, und sah, dass es Franka war: Wie schön!
»Hallo«, sagte er.
Sie lächelte auf ihn herab, aber nicht so richtig. »Was machst du denn für Sachen?«, wollte sie wissen.
Sie sah besorgt aus. Sehr besorgt. Ahmad versuchte, auch zu lächeln. »Bringt der Beruf so mit sich.«
Ihr Mundwinkel zuckte nach oben. »Blöder Beruf, den du dir da ausgesucht hast, findest du nicht?«
Ahmad wollte ihr erklären, dass er diesen Beruf ergriffen hatte, um für Gerechtigkeit zu sorgen und dafür, dass es allen Menschen gut ging, und dass das sein Weg war, etwas Sinnvolles anzufangen mit seinem Leben, und außerdem und noch viel dringender wollte er ihr sagen, dass er sie liebte … und er wollte sie fragen, was dieser seltsame Klang in ihrer Stimme zu bedeuten hatte, woher der auf einmal kam, aber ehe er all das tun konnte, wurden seine Augenlider schwer, so schrecklich schwer. Er sank zurück in den Nebel, ohne etwas dagegen tun zu können, und dämmerte wieder weg.
Als er das nächste Mal erwachte, war auch wieder jemand da: Großvater. Das vertraute Gesicht mit dem dichten Schnurrbart und der uralten runden Brille lächelte ihn an.
Ahmad bekam einen Schreck, hatte Angst, dem alten Mann Kummer zu bereiten; das hatte er doch nie gewollt!
»Sidi«, entfuhr es ihm, und er wollte ihm erklären, dass er sich keine Sorgen zu machen brauche, nur wollten ihm die Worte dazu nicht einfallen.
Aber dann sah er, dass sein Großvater sich überhaupt keine Sorgen machte, im Gegenteil, er war die Ruhe selbst. »Schlaf«, sagte er. »Ich sitze hier einfach noch ein Weilchen.«
Gut zu wissen, dachte Ahmad und dämmerte wieder weg.
Irgendwann kam er wieder zu sich, kriegte mit, wie sein Großvater in der Tür stand und mit einer Krankenschwester sprach, sie nach einem Gebetsraum fragte.
»Im Erdgeschoss«, hörte er sie sagen. »In dem Gang links neben der Rezeption.«
»Ich danke Ihnen«, sagte Großvater und verschwand.
Später öffnete Ahmad die Augen und starrte auf eine Zeitung, die Großvater direkt vor ihm entfaltet hielt, seine geliebte Morgenpost. »Freiheitsgeld bald weltweit?«, lautete die Schlagzeile, darunter stand: »Fortschritte bei den Verhandlungen über die Einführung der digitalen Weltwährung Solidar.«
Das schreiben sie jeden Monat aufs Neue, dachte Ahmad träge und schlief wieder ein mit dem Gefühl, schon Jahre hier zu liegen, Ewigkeiten.
Nachdem Valentin gegangen war, setzte sich Lina erst einmal zurück auf ihren Stuhl, schloss die Augen und versuchte, zu sich zu kommen. Sie horchte auf das leise, kaum wahrnehmbare Geräusch der Heizung, fühlte die gemütliche Wärme, die sie verbreitete. Tat tiefe Atemzüge. Ruhige, tiefe Atemzüge.
Dann öffnete sie die Augen langsam wieder, und es war alles noch da. Die Wohnung. Die neuen Möbel. Ihre Kisten. Das war alles wirklich.
Und doch war das alles wie ein Traum. Ein Traum, aus dem sie jeden Moment aufzuwachen fürchtete.
Sie holte ihr Pod, rief ihr Konto ab. Da war es, tatsächlich, immer noch: ihr Freiheitsgeld für den Monat März. Der volle Betrag. Und ihr Vater würde es ihr nicht wegnehmen, ihr nicht abschwatzen, nicht »leihen« können …
Sie war frei, mit anderen Worten. Endlich.
Unheimlich.
Sie sprang auf, eilte zu den Kisten, suchte und fand ihren alten Tablet-Computer. Ein Erbstück von ihrer Großmutter, voller kindischer Aufkleber, das Glas zerkratzt, aber … ihr eigen. Rasch trug sie es zu dem schmalen Schreibtisch, schob ihn ein Stück zur Seite, weg vom Fenster; sie wollte eine Wand vor sich haben, an der sie ein ganz altmodisches Pinnbrett befestigen würde und einen Kalender und eine Landkarte und was sie sonst noch brauchte für ihr Buch. Ihr Buch, jawohl! Sie würde endlich ihr Buch schreiben! Ihr ganzes Leben lang träumte sie schon davon, und jetzt, hier, würde sie die Möglichkeit haben, sich diesem Kindheitstraum zu widmen!
Sie holte den Ständer, stellte den Computer hinein, sodass der Bildschirm leicht nach hinten geneigt war, schaltete ihn ein und aktivierte die Projektion des Tastenfelds. Die oberste Tastenreihe war arg lichtschwach, aber das machte nichts; die Hauptsache war, dass es funktionierte: Wenn sie den Finger auf eines der Felder legte, erschien der zugehörige Buchstabe auf dem Schirm.
Sie konnte beginnen.
Und konnte es doch nicht. Dabei wusste sie, was sie schreiben wollte: die Geschichte ihrer Kindheit. Wie die Besessenheit ihres Vaters die ganze Familie in die Armut getrieben und dort gehalten hatte, trotz des Freiheitsgelds. Wie sie darunter gelitten hatte und wie es sie bis auf den heutigen Tag prägte. Wenn die Drachen fliegen sollte das Buch heißen, zumindest war das der Arbeitstitel, wie man sagte.
Sie hätte einfach drauflosschreiben können, aber irgendwie ging es nicht.
Lina seufzte, holte ihren billigen alten Pod, rief die Post ab. Immer noch keine Nachricht von ihrer besten Freundin Davorka. Die war vor drei Wochen Hals über Kopf mit ihrem Mann nach Süditalien gefahren, zu seinen Verwandten dort; hatte sich nur mit einer kurzen Nachricht abgemeldet und seither nichts mehr von sich hören lassen! Sehr ungewöhnlich, so spontan war Davorka sonst nie, und wer kümmerte sich jetzt eigentlich um ihre kranke Mutter?
Im Grunde hätte Lina einfach nur jemanden gebraucht, dem sie all das hier erzählen konnte. Sie rief den Telefonskill auf und Davorkas Nummer, aber sie erreichte wieder nur ihre Sprachbox.
Sie legte den Pod weg, sah sich um. Nein, sie konnte unmöglich schreiben, solange die Wohnung noch so aussah! Im nächsten Moment ärgerte sie sich über diesen Gedanken: Das war so typisch Frau, geradezu ein Klischee! Aber das zu denken half ihr auch nicht. Wahrscheinlich wurde man eben so, wenn man eine Mutter wie die ihre hatte, eine, die blindlings alles mitmachte, was ihr Mann sich ausdachte.
Und wenn sie sich ablenkte? Sie schaltete das TV-Gerät ein, dieses unglaublich riesige Teil mit allen Schikanen, das einen schier erschlug mit seinem Bild … und schaltete es gleich wieder ab. Nein, das war es auch nicht.
Sie musste vor allem diesen Eindruck von Unwirklichkeit loswerden, dieses Gefühl, nur in einem Traum zu leben. Und um »runterzukommen«, wie Davorka gern sagte, half einem nichts so gut wie Putzen und Aufräumen.
Also gut. Sie holte einen Eimer mit Wasser und Tücher und machte sich daran, erst mal die Schrankfächer auszuwischen. Obwohl die im Grunde sauber waren. Es ging mehr um … eine Art Inbesitznahme: Feucht wischen, trocken wischen – erst dann gehörte es ihnen wirklich!
Dann räumte sie ein. Viel hatten sie ja nicht. Wäsche, Geschirr aus der Tauschbörse, ein paar Bücher aus der Bücherbox. Andenken, die offen ins Regal kamen. Zwei Tischdecken. Der Kerzenständer, der mal ihrer Großmutter gehört hatte: Wo sie wohl Kerzen dafür herkriegen konnten? Ah, die Schuhe. Die kamen in die Garderobe, genau wie der olle Strohhut, von dem sie sich nicht trennen konnte.
Als sie den Strohhut auf das oberste Regalfach der Garderobe legte, bemerkte sie, dass er an irgendeinen Widerstand stieß. Da sie nicht groß genug war, um so hoch hinaufzublicken, holte sie einen Stuhl, erkletterte ihn, tastete nach ganz hinten und zog hervor, was sie ertastet hatte.
Es war ein Stofftier. Ein süßer kleiner Hund aus grauem Plüsch, mit Schlappohren, dunklen Knopfaugen und niedlichen braunen Flecken an der Schnauze und am Körper.
Lina starrte das Spielzeug an und fühlte sich, als habe sie der Blitz getroffen.
Es war wie ein Schock, die an für sich schlichte Wahrheit zu erkennen, dass Valentin und sie ja nicht die Ersten in dieser Wohnung waren. Dieses Stofftier musste einem Kind der Leute gehört haben, die vor ihnen hier gelebt hatten, und sie hatten es beim Auszug vergessen.
Bei dem Auszug, der noch keine zwei Wochen her war, denn vorher war es nicht möglich gewesen, die Wohnung zu sehen.
Lina musterte die dunkelbraunen Glasaugen des Stoffhunds und fragte sich, ob er jetzt wohl arg vermisst wurde. Was mochte aus der Familie vor ihnen geworden sein?
Und vor allem: Warum waren sie gegangen?
Kapitel 4
Montag, 3. März 2064
Valentins erster Tag verging rasch. Mittags kam ein Roboter angerollt und brachte einen Imbiss aus dem Restaurant; Frau Almassy hatte Valentin eine spezielle Diät verordnet, mit Rote-Bete-Salat, frischen Sprossen und Bratlingen. Viele Bewohner der A-Zone kamen und trainierten selbstständig. Zwischendurch musste Valentin durchfegen und nasse Handtücher einsammeln, es wurde nicht langweilig.
Um 15 Uhr 30 hatte er dann seinen ersten Termin als Krankengymnast, bei keinem Geringeren als Altpräsident Havelock in dessen Wohnung. Und als wäre er deswegen nicht nervös genug gewesen, schärfte ihm Frau Almassy auch noch ein: »Der Präsident ist nicht mehr gut zu Fuß, aber er ist unser wichtigster Klient! Also machen Sie mir keine Schande. Lesen Sie ihm jeden Wunsch von den Augen ab und erfüllen Sie ihn.«
Die Sonne blinzelte durch die Wolken und ließ die Bäume leuchten, als Valentin, das Pad mit den medizinischen Akten seines prominenten Kunden in der Hand, quer durch die A-Zone marschierte, auf der Suche nach dem Eingang zur Havelockschen Wohnung. Sein Finger kribbelte, als er den herrlich altmodischen Klingelknopf drückte: Das war echtes Messing, oder?
Mit einem Summen sprang die Tür auf. Valentin trat hindurch, rief: »Guten Tag, Herr Havelock. Hier ist Ihr Krankengymnast.«
»Ich bin im Wohnzimmer«, hörte er eine leise, aber erstaunlich klare Stimme, deren Klang ihm vertraut vorkam, und das, obwohl er zur Zeit von Havelocks EU-Präsidentschaft noch nicht einmal geboren war. »Einfach geradeaus und durch die Tür mit dem Milchglaseinsatz.«