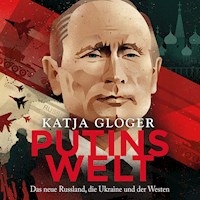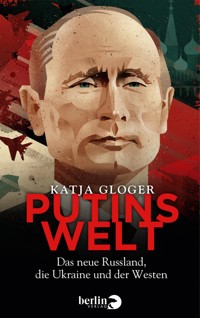13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine junge Deutsche namens Sophie, die, als 17-Jährige nach Moskau geschickt, zur Zaren- und Gattenmörderin wird und als Katharina II. Weltgeschichte schreibt; ein Koffer voller Bilder, die gestohlen werden, was sich als ihre Rettung erweist; eine mondäne Schauspielerin, von den Boulevardblättern gefeiert, die aus Liebe nach Russland emigriert, um dort dem grausamen Lagersystem zum Opfer zu fallen; ein Berufsrevolutionär, der aus einer Moabiter Gefängniszelle heraus Kontakte in höchste Kreise pflegt; eine belagerte, verhungernde Stadt, in der bei eisiger Kälte ein Orchester Beethovens Neunte spielt und damit Hitler widersteht – Katja Gloger erzählt von der eng verwobenen Geschichte der Deutschen und der Russen, die tragisch ist und auch schön. Beide Länder waren einander Verheißung – und zu oft führten solche Utopien ins Verderben. Die Autorin wirbt für einen vorurteilslosen Blick auf Russland und erinnert an die besondere Verantwortung, die die Deutschen Russland gegenüber tragen. In jedem Kapitel wird deutlich, wie die deutsch-russische Geschichte die Gegenwart prägt. Darüber hinaus hat Katja Gloger persönliche Gespräche mit Staatsmännern, Historikern und mit Menschen geführt, die Krieg und Verfolgung erlebten – und heute für Versöhnung kämpfen. Eine junge Deutsche namens Sophie, die, als 17-Jährige nach Moskau geschickt, zur Zaren- und Gattenmörderin wird und als Katharina II. Weltgeschichte schreibt; ein Koffer voller Bilder, die gestohlen werden, was sich als ihre Rettung erweist; eine mondäne Schauspielerin, von den Boulevardblättern gefeiert, die aus Liebe nach Russland emigriert, um dort dem grausamen Lagersystem zum Opfer zu fallen; ein Berufsrevolutionär, der aus einer Moabiter Gefängniszelle heraus Kontakte in höchste Kreise pflegt; eine belagerte, verhungernde Stadt, in der bei eisiger Kälte ein Orchester Beethovens Neunte spielt und damit Hitler widersteht – Katja Gloger erzählt von der eng verwobenen Geschichte der Deutschen und der Russen, die tragisch ist und auch schön. Beide Länder waren einander Verheißung – und zu oft führten solche Utopien ins Verderben. Die Autorin wirbt für einen vorurteilslosen Blick auf Russland und erinnert an die besondere Verantwortung, die die Deutschen Russland gegenüber tragen. In jedem Kapitel wird deutlich, wie die deutsch-russische Geschichte die Gegenwart prägt. Darüber hinaus hat Katja Gloger persönliche Gespräche mit Staatsmännern, Historikern und mit Menschen geführt, die Krieg und Verfolgung erlebten – und heute für Versöhnung kämpfen. »Dieses Buch macht unsere gemeinsame Geschichte verständlich.« Sigmar Gabriel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Meiner Familie und unseren Freunden mit russischer Seele.
Dankbar, dass ich von ihnen lernen darf.
ISBN 978-3-8270-7957-7
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2017
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Cover & Impressum
Zitat
Vorwort
»Ich habe an die Türen der Geschichte geklopft, und sie taten sich auf«
Den Osten im Blick: Konturen, Kontakte
Im Land der »wilden Moskowiter«
»Segelt, denn niemand weiss, wo es endet«
»… etwas grössres erkennen lernen …«
Sie belohnte ihre Freunde, und ihre Gegner bestrafte sie nicht
»Zierliche Mädchen tranken mutig aus Wodkaflaschen«
Die Erfindung der russischen Seele
»Dekomposition« oder: Diegekaufte Revolution
»Russlandfieber« oder: Gefährliche Seelenverwandtschaften
Sterne, an den Himmel genagelt
»Ein tolles Volk. Sie sterben wie sie tanzen«
Unheilvolle Sonderwege
Blokada: Die Blockade der Erinnerung
Baldins Koffer
Tödliche Falle
Wenn die Russen kommen
Mythos Ostpolitik: Das Missverständnis
»Wir sollten im Westen nicht so tun, als würden wir nicht in Interessensphären denken«
Die Russlanddeutschen: Auffällig unauffällig
Die Waffen des Bewusstseins
Anmerkungen
Literatur
Bildnachweis
»Wir wollen Freiheit.«
Wiktor Schklowskij,
Zoo oder Briefe nicht über die Liebe
Vorwort
Wer in Moskau weilt, dieser schon wieder sowjetisch sauberen Stadt, stößt in Sichtweite der goldenen Kuppeln des Kreml auf ein mächtiges Monument. Es sprengt alle Maßstäbe, auch die des guten Geschmacks: Da steht auf gewaltigem Sockel ein Segelschiff, ein Hüne darauf, er ähnelt Zar Peter dem Großen. Bald sind die Segel gesetzt, und der Zar weist Russland den Weg nach: Westen.
Auch das neue Russland hat Segel gesetzt. Wladimir Putin schickt sein Land auf eine gefahrvolle Reise, sie führt in eine ganz andere Welt. Alternativlos soll der Kurs sein, den Russland nun in eine postwestliche Zukunft einschlägt – alternativlos wie sein Präsident. Dieses Russland verlässt den Westen.
Um im Bild zu bleiben: Am Ufer bleiben die Deutschen zurück, eher ratlos. Man macht sich Vorwürfe, streitet und fragt: Hat man Russland wirklich verstanden? Oder hatte man sich in Illusionen verliebt? Tragen doch die Deutschen eine besondere Verantwortung gegenüber Russland.
In keinem anderen westlichen Land wird so leidenschaftlich um Russland und seine Zukunft gerungen wie in Deutschland. In keinem anderen Land finden sich so viele »Russland-Versteher«. Deutsche und Russen – Russen und Deutsche: zwei Länder, zwei Völker, die seit tausend Jahren voneinander nicht lassen können. Diese Beziehung bestimmt das Schicksal Europas; sie schrieb Weltgeschichte – im Guten wie im sehr Bösen. Sie war – und ist – von Gegensätzen und Widersprüchen geprägt: von Vorurteilen und Furcht, auch von Hass. Aber auch von tiefer Freundschaft und gegenseitiger Bewunderung, gar Verklärung. Noch immer macht man eine Seelenverwandtschaft aus. Und heißt es nicht, einen russischen Dichter missbräuchlich zitierend, mit dem Verstand sei Russland nicht zu begreifen? »An Russland kann man nur glauben!«
Man kann sein Herz an Russland und seine wunderbaren Menschen verschenken, vielleicht muss man es sogar. Den Verstand aber, den darf man dabei keinesfalls verlieren.
Dieses Buch möchte Einblicke geben in unsere faszinierende gemeinsame Geschichte, die tragisch ist und auch schön. Es soll dazu beitragen, Russland zu entschlüsseln und zu verstehen. Es berichtet davon, wie wir vor tausend Jahren als erfolgreiche Fernhändler zueinander fanden – damals, als die Ostsee unser Weltmeer war. Es erzählt von mutigen deutschen Entdeckern in den endlosen Weiten Sibiriens und natürlich von Katharina der Großen, Russlands deutscher Kaiserin, dieser außergewöhnlichen Frau mit dem feinen Gespür für die Nuancen des Möglichen. Es führt an die Frontlinie des Kalten Krieges, als Deutschland geteilt und die DDR das westlichste Land des Ostens war. Es erzählt von Krieg und Frieden, von Siegen und Niederlagen, von Schuld und Sühne. Wie wir uns aneinander berauschten, die russische Seele und das deutsche Wesen suchend, zwei sich missverstanden fühlende Kulturnationen mit dem Anspruch, dass an ihnen die Welt genese.
Russland – ein Traumland, »das an Gott grenzt«, wie es Rainer Maria Rilke verklärte. Ein Land voller romantischer Utopisten, unverdrossen an der Zukunft bauend.
Doch lange teilten Deutsche wie Russen eine Furcht vor der Freiheit, erlagen der Versuchung autoritärer Modernisierer. Fanden sie sich doch in tiefer Verbundenheit auch gegen die vermeintlichen Verführungen des modernen Westens. Dabei führten deutsch-russische Sonderwege immer ins Unheil. Während des Ersten Weltkriegs ermöglichte die kaiserliche deutsche Regierung dem Berufsrevolutionär Wladimir Lenin die Rückkehr aus dem Exil nach Russland. Der von ihm angezettelte Staatsstreich – die Oktoberrevolution – führte Russland in ein Jahrhundert des Terrors. Ein anderer deutsch-russischer Sonderweg endete in einer Kriegsallianz zweier Massenmörder, Hitler und Stalin.
Eine Erzählung über Deutsche und Russen muss den Blick in den Abgrund der Vergangenheit richten, diese unaussprechliche Schuld. Was man nicht sehen will und doch sehen muss. Lange lagen die ungezählten Verbrechen der Deutschen im Vernichtungskrieg gegen die Völker der Sowjetunion im Schatten der deutschen Erinnerung. Doch auch die Menschen in Russland konnten nicht lernen, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Auch in Putins Russland bleibt die brüchige Wahrheit unter pompös inszenierten Siegesmythen begraben.
Auf vielen Reisen durch das wunderbare Land, das Russland, an das ich mein Herz verlor, lernte ich immer wieder Menschen kennen, die mir – auch noch die Kinder und Enkel – vom Krieg berichteten, den realen Schlachtfeldern und denen der Erinnerung. Wie sie die Deutschen hassten und ihnen dann doch verziehen, barmherzig mit ihrer ganzen feinen russischen Seele. Nicht ich, die Deutsche, durfte sie um Verzeihung bitten. Im Gegenteil: Sie reichten mir die Hand. Ihnen gilt meine Dankbarkeit. Und die Hoffnung, dass wir uns eines nicht so fernen Tages, trauernd und offenen Herzens, gemeinsam unserer Geschichte stellen können.
Daher steht zu Beginn dieses Buches die Würdigung eines Mannes, dem es zufiel, die Welt friedlich zu verändern: Michail Gorbatschow. Lange verstanden wir nicht, dass er in seinem eigenen Land an dem scheiterte, was wohl wirklich unmöglich war. Seine Perestroika stellte sich als letzte sowjetische Utopie heraus. Und doch: Er ermöglichte die deutsche Einheit und in gewisser Weise auch die europäische Einigung. Ein Mann von Skrupel, glaubte Michail Gorbatschow fest an eine gemeinsame deutsch-russische Zukunft. Dieses Jahr 1989, das schon ferne Vergangenheit scheint, es bleibt mit ihm verbunden, ein Jahr des Friedens und der Wunder. Tage, die zeigten, was möglich sein kann. Und dass alles auch wieder zerfallen kann.
»Ich habe an die Türen der Geschichte geklopft, und sie taten sich auf«
Michail Gorbatschow, ein Mann von Skrupel, ermöglichte die deutsche Einheit. Ihm fiel es zu, die Welt zu verändern. Über einen, der sich zu grenzenloser Freundschaft entschloss – und auch von mächtigen Männern des Westens grenzenlos enttäuscht wurde. Eine Würdigung.
Eigentlich war dieser Donnerstag, der 9. November 1989, ein vergleichsweise normaler Arbeitstag für Michail Gorbatschow. Für den Nachmittag war die allwöchentliche Sitzung des Politbüros anberaumt, des immer noch mächtigen Entscheidungsgremiums. Eher Routine – wenn man in Moskau überhaupt noch von Routine sprechen konnte. Vier Jahre zuvor, im März 1985, hatten die greisen Männer im Politbüro mit einer revolutionären Entscheidung den vergleichsweise jungen Michail Gorbatschow zum »GenSek« ernannt. Der selbstbewusste Gorbatschow, damals 54 Jahre alt und für Landwirtschaft zuständig, sollte das Unmögliche vollbringen: die Stabilität des Systems wahren und zugleich tief greifende Reformen wagen; vor allem an der bröckelnden ökonomischen Front. »Alles war marode, das ganze System. Es konnte so nicht weitergehen«, lautete Gorbatschows schlichte Analyse über den wahren Zustand der nuklearen Supermacht Sowjetunion. Sein Land war bestenfalls noch ein Koloss auf tönernen Füßen, in dem fast jeder zweite Rubel des Staatshaushalts für das Militär ausgegeben wurde und es noch nicht einmal mehr gelang, funktionierende Kühlhäuser für Kartoffeln zu bauen.
Er begann eine Reise ins Ungewisse. Uskorenie: Beschleunigung durch Wirtschaftsreformen; Glasnost: Transparenz und Meinungsfreiheit und schließlich Perestroika: der grundlegende gesellschaftliche Umbau. Auf diesen drei Säulen sollte eine runderneuerte Sowjetunion stehen. Innenpolitisch sollte sie eine Reform des Sozialismus und der verknöcherten kommunistischen Partei einleiten, außenpolitisch die Block-Konfrontation des Kalten Krieges überwinden. Gorbatschow musste zu Abrüstungsvereinbarungen kommen und die Wirtschaftsbeziehungen zur kapitalistischen Welt ausbauen. Die knappen Ressourcen mussten dringend vom militärischen auf den zivilen Bereich umgeleitet werden – sonst drohte der ökonomische Zusammenbruch.
»Neues politisches Denken« nannte Gorbatschow das außenpolitische Konzept, das den Abschied von der verknöcherten Ideologie einleiten sollte: »Der Gedanke, dass Krieg die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln sein soll, ist hoffnungslos veraltet.«[1] Sicherheit war kein Nullsummenspiel mehr, sondern nur noch gemeinsam zu erreichen.
Jung, dynamisch, durchaus charmant und eine schöne Frau an seiner Seite, die Agrarsoziologin Raissa Gorbatschowa, war Gorbatschow zum Darling des Westens geworden. Mit US-Präsident Ronald Reagan hatte er sich nach anfänglichem Krach während eines Gipfels in Reykjavik zusammengerauft und sich innerhalb weniger Monate im Dezember 1987 auf ein historisches Abrüstungsabkommen geeinigt: den INF-Vertrag über die Abschaffung der nuklearen Mittelstreckenraketen.[2] »Die Sowjets sind ja menschliche Wesen«, stellte man in Washington erstaunt fest. Gorbatschow sei ein echter »Agent des Wandels«.[3]
Gorbatschows Ziel, die Beendigung des Kalten Krieges, erforderte eine grundlegende Veränderung der Beziehungen zu den USA. Dies aber war ohne eine wie auch immer geartete Lösung der »deutschen Frage« nicht möglich, so Gorbatschows Berater Anatolij Tschernjaew: »Die ›deutsche Frage‹ war der Schlüssel zur Schaffung der für die Perestroika erforderlichen äußeren Bedingungen.«[4] In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte Gorbatschow selbst die Bedeutung der deutsch-sowjetischen Beziehungen unterstrichen: Von ihnen »hängt viel ab, sowohl für Europa als auch, ohne zu übertreiben, für die ganze Welt«.[5]
Der INF-Vertrag bahnte den Weg: Er sah den Abzug von US-Mittelstreckenraketen in Europa vor. Damit wurde auch ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg zu einer möglichen strategischen Verständigung mit der Bundesrepublik beseitigt – die in der Bundesrepublik stationierten amerikanischen Pershing-2-Raketen, die als direkte Bedrohung der sowjetischen Sicherheit betrachtet wurden.[6]
In Bezug auf die Bundesrepublik und ihren Kanzler Helmut Kohl hatte sich Michail Gorbatschow allerdings das Recht auf einen gewissen Argwohn genommen. Er wartete mehr als drei Jahre mit der Kontaktaufnahme auf höchster Ebene. Er hatte Kohl mit kalkulierter Missachtung gestraft, nachdem der ihn in einem Interview 1986 faktisch mit dem Nazi-Hetzer Joseph Goebbels verglichen hatte.[7] Das hatte ihm Gorbatschow lange nicht verziehen. Außerdem: Kohl sei ein Mann der Amerikaner. Und eine besondere »intellektuelle Leuchte« sei er auch nicht gerade.[8]
Andererseits: Er wollte sich eine mögliche neue Deutschlandpolitik keinesfalls von seinem Intimfeind, SED-Chef Erich Honecker, durchkreuzen lassen.[9] Längst lebte Honecker »in einer anderen Welt«. In der DDR habe man Perestroika schon seit Jahren umgesetzt, behauptete der! Honecker hatte das entscheidende Diktum in Gorbatschows neuer Politik nicht verstehen wollen: Moskau würde sich nicht mehr in innere Angelegenheiten der sozialistischen Bruderstaaten einmischen. »Jetzt sind alle gleich«, hatte Gorbatschow bereits 1985 erklärt.[10] Militärische Interventionen à la Breschnew waren schlicht keine Option mehr.[11]
Gorbatschow suchte den Westkontakt: Er empfing Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher und Franz Josef Strauß; las Genscher die Leviten: Die Bundesrepublik unterstütze die »militante« Politik der USA.[12] In seinem Gespräch mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1987 schloss Gorbatschow allerdings die Wiedervereinigung Deutschlands nicht mehr aus. Die Geschichte werde entscheiden, sagte er, irgendwann.[13]
Wenig später präsentierte der sowjetische Deutschlandexperte und Militärhistoriker Wjatscheslaw Daschitschew einen ungeheuerlich scheinenden Vorschlag: Ein vereintes, allerdings neutrales Deutschland diene den sowjetischen Interessen am besten. Man beschuldigte ihn des »Defätismus.«[14] Unklar ist, ob Gorbatschow das Papier Daschitschews kannte oder gar begrüßte – jedenfalls setzte er sich über die germanisty hinweg, die Deutschlandexperten im Zentralkomitee um Valentin Falin, die seine Leute wegen ihrer knallharten Positionen zur Unantastbarkeit des europäischen Status quo ironisch auch »Die Berliner Mauer« nannten.[15] Er entschloss sich zur Freundschaft, und er nahm es persönlich. Während eines ersten Besuchs Helmut Kohls in Moskau am 28. Oktober 1988 brach das Eis. Dort war der Kanzler ganz »Bürger Kohl«, ein Kind des Krieges. Da saßen sie im Katharinensaal des Kreml, begleitet nur von ihren Beratern Anatolij Tschernjaew und Horst Teltschik. Da gab es kein ideologisches Geplänkel, da sprachen zwei Männer über »psychologische Elemente«, wie es Kohl nannte. Sie sprachen über die Gräuel des Krieges, ihre Familien, die Toten, die Lehren aus der Geschichte. Damals habe er gespürt, dass er Kohl vertrauen könne, sagte Gorbatschow später. Und bald waren die beiden per Du.[16]
Die frenetischen Begrüßungen während seines ersten Staatsbesuchs in der Bundesrepublik im Juni 1989 überraschten und rührten Gorbatschow. Die Westdeutschen bejubelten seine Frau Raissa und ihn, schenkten Blumen, reichten ihm ihre Kinder für ein Erinnerungsfoto. Die Westdeutschen waren ganz anders, als er selbst geglaubt hatte. Auch Gorbatschow war lange ein Gefangener der eigenen Propaganda.[17]
Man mag es naiv nennen oder romantisch, sentimental oder gar selbstmörderisch – doch er hatte sich entschlossen, den Ozean des Misstrauens zu queren. Auch den Deutschen gegenüber vertrat er, wie er sagte, die universellen »allgemeinmenschlichen« Werte. Er hoffte auf andere Politiker guten Willens mit der Bereitschaft zu vertrauen – vor allem in der Bundesrepublik.
So wie der Schlüssel zur deutschen Einheit in Moskau lag, führte Moskaus Weg nach Europa über Bonn und Berlin.
Außerdem versprach sich Gorbatschow dringend notwendige wirtschaftliche Unterstützung von den Westdeutschen. Während Kohl bei Gorbatschows Staatsbesuch 1989 abends mit Blick auf den Rhein über den »Fluss der Geschichte« und die deutsche Einheit räsonierte, die so sicher kommen werde, wie der Rhein zum Meer fließe, fragte Gorbatschow nach deutscher Hilfe für die faktisch zahlungsunfähige Sowjetunion und auch nach Unterstützung, falls es zu Versorgungsschwierigkeiten in Moskau und Leningrad käme.[18]
Zugleich leistete er sich kühnste Visionen: Die von ihm propagierten »allgemeinmenschlichen Werte« sollten die Klammer für eine Annäherung der beiden Militärblöcke Nato und Warschauer Pakt bilden, die in fernerer Zukunft vielleicht sogar verschmelzen könnten, irgendwie. So ähnlich jedenfalls hatte es Gorbatschow am 6. Juli 1989 in einer Rede vor dem Europarat in Straßburg skizziert. Sein Bauplan für das später so oft beschworene und nie gebaute »Gemeinsame Europäische Haus« folgte dem Gedanken der Konvergenz: Er sah ein vereintes Europa vor, einen gewaltigen Wirtschaftsraum vom Atlantik bis zum Ural. Ein neues, sozusagen gesamtdemokratisches Europa unter Einschluss einer reformierten Sowjetunion. »In diesem Europa sehen wir unsere eigene Zukunft.«[19]
»Die Menschen in Russland verstanden, dass wir uns versöhnen mussten«
Es gehört zur Tragik des Michail Gorbatschow, dass die Politiker des Westens – und in seinem eigenen Land – bald andere Pläne für Europas neue Ordnung hatten. Während er noch in bester Absicht an den Erfolg einer Reform der Sowjetunion glaubte, hatte man im Westen schon registriert, wie groß der Widerstand gegen ihn war. Und wie mächtig die Zentrifugalkräfte, die er in den Sowjetrepubliken freigesetzt hatte: Dort hatten sich nationale Unabhängigkeitsbewegungen formiert. In ihrem Windschatten segelnd, witterten Parteichefs, Funktionäre und Geheimdienstgeneräle ihre große Chance: durch »nationale« Unabhängigkeit von Moskau selbst Macht und Kontrolle über Ressourcen zu gewinnen, Milliardenprofite einzustreichen.
Ob in einzelnen Sowjetrepubliken wie im Baltikum[20] oder Georgien, ob in Moskau, Polen, der Tschechoslowakei und in der DDR – überall demonstrierten Zehntausende friedlich. Woche um Woche, Monat um Monat. Vom unbeugsamen Bürgerwillen auf friedliche Veränderung und Dialog hatte sich Gorbatschow ja auch Anfang Oktober 1989 in Ost-Berlin überzeugen können. Zwar musste er zum 40. Jahrestag des Bestehens der DDR öffentlich noch gute Miene zur inszenierten Parteitristesse machen. Aber natürlich waren ihm die begeisterten »Gorbi, Gorbi«-Rufe selbst junger SED-Aktivisten nicht entgangen, ihre Plakate. Er kannte auch die an ihn gerichteten Bitten der DDR-Bürgerbewegung, kein zweites »Tiananmen« zuzulassen.[21]
Er werde ihn öffentlich nicht brüskieren, aber auch kein Wort der Unterstützung für Honecker vorbringen, hatte Gorbatschow vor seiner Abreise erklärt. »Ich unterstütze die Republik und die Revolution.«[22] Hinter den Kulissen aber haderte er heftig mit Honecker, der ihm oberlehrerhaft vorgehalten hatte, dass – ganz anders als in der DDR – in sowjetischen Geschäften sogar Salz und Streichhölzer fehlten. Wütend bezeichnete Gorbatschow ihn später als mudak, als »absoluten Vollidioten«,[23] der nicht verstehen wolle, was in seinem eigenen Land passiere – nichts anderes als der unaufhaltsame Zusammenbruch des SED-Regimes: »Der Drang der Deutschen nach Wiedervereinigung war unbezwingbar.«[24]
Wie die anderen Warschauer-Pakt-Staaten war auch die DDR »auf sich allein gestellt«. Weder Berlin 1953 noch Budapest und Warschau 1956 würde sich wiederholen und auch nicht Prag 1968. In seiner Ost-Berliner Rede am 6. Oktober 1989 hatte sich Gorbatschow festgelegt. Dabei hatte er ausgerechnet den slawophilen Dichter Fjodor Tjutschew zitiert: »Zur Einheit … wird man mit Eisen nur und Blut getrieben. … Doch wir versuchen es mit Liebe – wer recht hat, wird die Zukunft dann entscheiden.«[25] Und wer zu spät käme? Verweigerer würden sich selbst bestrafen: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.«[26] Nur einen Monat später fiel die Mauer.
Noch fast dreißig Jahre später blieben die deutsche Wiedervereinigung und die in den Jahren darauf folgende Osterweiterung von Nato und EU Gegenstand bitterer Vorwürfe aus Moskau. Der Westen, allen voran die USA, habe ein festes Versprechen gebrochen, die Nato werde nicht nach Osten erweitert, erläuterte auch Präsident Wladimir Putin seinen ausländischen Besuchern in teilweise quälend langen Monologen jedes Mal aufs Neue. Doch Nato und EU seien immer weiter nach Osten vorgerückt. Russland habe den Deutschen doch die Wiedervereinigung ermöglicht, ja, gar geschenkt. Konnte man da nicht zu Recht Verständnis für die »Rückkehr der Krim in den Bestand der Russischen Föderation« erwarten: »Ich glaube daran, dass mich die Europäer verstehen, vor allem die Deutschen.«[27]
Auch Michail Gorbatschow äußerte sich immer wieder voller Bitterkeit: Der Westen habe sich zum Sieger des Kalten Krieges erklärt, Russlands Schwäche ausgenutzt. Die USA hätten begonnen, ein »Mega-Imperium« zu errichten, und das Monopol auf Führung in der Welt erhoben. Vielleicht würden sie sich die Hände reiben, »wie toll man die Russen über den Tisch gezogen« habe. Über eine Ausdehnung der Nato gen Osten sei nie gesprochen worden. Und in der harten deutschen Reaktion auf die russische Annexion der Krim sah Gorbatschow gar den Versuch, eine neue Teilung Europas zu erreichen.[28]
Er gab einer tiefen Enttäuschung Ausdruck, die er sich lange nicht eingestehen wollte. Immer bestand er darauf, dass Russen und Deutsche Freunde seien. Für ihn war die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands zwar ein Geschenk der Geschichte – deren Verlauf aber hatte er mit seiner Perestroika erheblich beschleunigt. Ich hatte Michail Gorbatschow 1990 als junge Korrespondentin des Stern in Moskau kennengelernt. Im Laufe der Jahre hatten wir immer wieder miteinander gesprochen. Der Frage nach seinem Verhältnis zu Helmut Kohl wich er stets aus: Man mache keinen Gegner Kohls mehr aus ihm, sagte er, schon gar nicht nach dessen Tod im Juni 2017. Es war, als ob er sich das Gefühl deutscher Zuneigung und Dankbarkeit um jeden Preis erhalten wolle. Aber natürlich wusste Gorbatschow: Nicht er, sondern Helmut Kohl gehörte zu den Gewinnern des Kalten Krieges. In gewisser Weise war es ein Sieg auf seine Kosten.
Der Preis des Ruhms: Michail Gorbatschow 2013 in seinem Moskauer Büro. (1)
Nichts von dem war zu erahnen an jenem Donnerstag, dem 9. November 1989. Bundeskanzler Helmut Kohl war auf Arbeitsbesuch in Polen; auf die Fragen des Gewerkschaftsführers Lech Wałęsa nach der Lage in der DDR und einem möglichen »Abriss« der Mauer antwortete er, ein derartiger Ablauf sei unwahrscheinlich.[29] Allerdings beriet in Ost-Berlin der Ministerrat über eine neue Reiseverordnung für die Bürger der DDR. Auf eine diesbezügliche beunruhigte Anfrage des sowjetischen Botschafters in der DDR hieß es aus Moskau, Grenzregelungen seien Angelegenheit der DDR. Das Politbüro der KPdSU erörterte die Wirtschaftslage sowie die Einberufung des Volksdeputierten-Kongresses. Die DDR stand nicht auf der Tagesordnung. Wohl auch, weil man erst eine Woche zuvor am Moskauer »Alten Platz« über die Lage im deutschen Bruderstaat gesprochen hatte: Demonstrationen, die katastrophale Wirtschaftslage, eine mögliche Wiedervereinigung. Wie sollte die Sowjetunion darauf reagieren? Außenminister Eduard Schewardnadse flirtete mit einer revolutionären Idee: »Wir sollten ›die Mauer‹ selbst abbauen.«[30] Aber das hatte wohl niemand der anwesenden älteren Herren wirklich ernst genommen.
Als die Mauer am 9. November 1989 infolge einer schicksalhaften bürokratischen Fehlentscheidung gegen 23.30 Uhr – um 1.30 Uhr Moskauer Zeit – dann wirklich fiel, war Michail Gorbatschow längst zu Bett gegangen. Da bahnte sich ein Ereignis von weltgeschichtlichem Rang an – aber niemand weckte ihn. Es sei nicht nötig gewesen, sagte er uns während eines langen Gesprächs in Moskau: »Ich erfuhr die Details am anderen Morgen, das war früh genug. Denn unsere Position war von Anfang an klar – ganz egal, welches Geschrei es auch gegeben haben mag. Wir konnten diese Mauer nicht mehr halten. Wir wussten: Mit einem geteilten Deutschland kann man in Europa nicht leben, mit einer Zeitbombe. Die Menschen in Russland verstanden, dass wir uns versöhnen mussten. Nicht trotz, sondern gerade wegen des Krieges; dass man einander verzeihen muss. Wir haben unsere Toten beerdigt.«[31]
Michail Gorbatschow hatte seine Toten beerdigt, die Geister der Vergangenheit. Doch er vergaß nie. »Ich habe alles gesehen«, sagte er.
». . . dass es Menschen gibt, die man Deutsche nennt«
»Wie Jesus Christus« sei er auf die Welt gekommen, witzelte seine Tochter Irina einmal, geboren am 2. März 1931 auf dem Stroh in der Vorratskammer einer Bauernkate im winzigen Dorf Priwolnoje in der weiten Steppe im tiefen russischen Süden, quasi am Fuße des Kaukasus. Seine Eltern lebten ein armes Kolchosenleben, das sich kaum von der Leibeigenschaft unterschied. Die ersten Worte, die er lernte, waren ukrainisch – seine Mutter war eine Ukrainerin. Als kleines Kind überlebte er Stalins Zwangskollektivierung. Während des Großen Hungers 1933 starb fast jeder zweite Bewohner des Dorfes, darunter auch drei der fünf Geschwister seines Vaters. Die Zwangsrequirierung des letzten Saatguts, die Verzweiflung, das stumme Hungersterben. Die Wahrheit war zu schrecklich, um ausgesprochen zu werden. Beide Großväter, einer von ihnen Vorsitzender der Kolchose, gerieten in Stalins Terrormaschine. Sie wurden wegen »Trotzkismus« und »Sabotage« verhaftet und zum Holzfällen nach Sibirien deportiert. »Die Nachbarn besuchten uns nicht mehr, nur noch nachts. Unser Haus war das Haus eines Volksfeinds.«[32]
Ein Foto zeigt den Fünfjährigen mit seinen Großeltern, spindeldürr, mit raspelkurzem blondem Haar, so groß und ernst die Augen. Barfuß steht das kleine Kind im Schlamm.[33]
Seine erste Begegnung mit den Deutschen war eine kindlich-süße, erzählte er uns: »Einmal, ich war noch klein, da nahm mich mein Vater mit in ein Nachbardorf, eine Siedlung der Russlanddeutschen; setzte mich auf den Pferdewagen, wir fuhren los. In einem kleinen Geschäft verkaufte man Lebkuchen in Hasen- und Bärenform, sie waren dick mit weißem Zuckerguss verziert, und sie schmeckten wunderbar. Damals habe ich zum ersten Mal erfahren, dass es Menschen gibt, die man Deutsche nennt. Ich beschloss, dass es gute Menschen waren.«
Der Junge war zehn Jahre alt, als der Krieg begann. Per Lautsprecher wurde die Rede des sowjetischen Außenministers Wjatscheslaw Molotow auf der Dorfstraße übertragen. Bald kamen die berittenen Boten des örtlichen Wehrkreiskommandos, sie brachten die Einberufungsbescheide für die Männer des Dorfes. Im August 1941 musste auch Gorbatschows Vater Sergej an die Front. Aus Priwolnoje wurde ein Dorf der Greise, Frauen und halb verhungerten Kinder, die bereits im klirrend kalten Winter 1941 kaum etwas zu essen oder zum Anziehen hatten.
Man hörte, dass die Wehrmacht in einigen Städten zum Teil überschwänglich empfangen wurde.[34] Im August 1942 besetzten deutsche Infanterietruppen das Dorf. Die Deutschen plünderten Priwolnoje, holten sich das Vieh, fällten die Obstbäume in den kleinen, privaten Gärten. Seine Mutter musste Zwangsarbeit leisten. In der kleinen Hütte der Familie Gorbatschow quartierte sich ein deutscher Soldat ein, er hieß Hans und schien ein freundlicher Mann.
Bald verbreiteten sich furchtbare Nachrichten über Massenerschießungen in den Städten des Kreises Stawropol,[35] in Krasnodar, Kislowodsk, Mineralnye Wody … Allein hier, im Vorland des Kaukasus, ermordeten die Deutschen und ihre Helfershelfer Zehntausende Menschen, die meisten von ihnen Juden, aber auch behinderte Kinder, sogenannte Partisanen und Kommunisten, die Funktionsträger.
Bis Priwolnoje drangen die Gerüchte über die kleinen Lastwagen, in denen die Menschen mit Gas umgebracht wurden. »Schwarze Raben« nannte man sie oder duschegubki, die Seelentöter. Die Einsatzgruppe D von SD und SS sowie ihre ukrainischen und »volksdeutschen« Hilfstruppen mordeten mit diesen mobilen Gaskammern.
Seine Mutter hatte panische Angst vor den Deutschen – aber auch vor den eigenen Leuten, den Denunzianten und Stalins Häschern. Sie hörte aber auch von einer bevorstehenden »Aktion« der Wehrmacht gegen die Familien von Kommunisten. Sie war für den 26. Januar 1943 geplant. Davon wäre auch Gorbatschows Familie betroffen gewesen. Seine Mutter versteckte ihren Sohn in einem Stall einer nahegelegenen Schweinefarm hinter dem Dorf: »Doch am 21. Januar 1943 befreiten sowjetische Truppen Priwolnoje.«[36] Er hatte Glück, zu überleben.
Sie waren befreit, aber alles war zerstört, geplündert, Vieh und Lebensmittel geraubt, die Häuser verbrannt. Sie hausten in Lehmhütten; die Frauen spannten sich vor die Pflüge und zogen sie durch den tiefen Schlamm. Michail Gorbatschow überlebte mit einer Handvoll Mais am Tag. Schließlich machte sich seine Mutter auf den Weg. Sie musste ihren Jungen allein zurücklassen, sie hatte keine Wahl. Erst nach 15 Tagen kehrte sie zurück. Sie hatte einen Anzug und ein Paar Stiefel ihres Mannes gegen einen Sack Mais eintauschen können.
Seinen Vater, der bereits offiziell für tot erklärt worden war, sah Michail Gorbatschow zum ersten Mal 1944 für zwei Tage wieder: »Alle Kleider hatte ich aufgetragen. Wir hatten nichts. Wir haben selbst notdürftig Stoff gewebt. Die Sandalen hatte ich selbst gemacht, aus eingeweichter Baumrinde. So stand ich also da.« Er sagte: »Und dafür haben wir gekämpft?«[37]
Die Erfahrung absoluter Gewalt, dieses Ausgeliefertsein, prägte auch Gorbatschows Kindheit. Er machte eine klassische sowjetsozialistische Karriere, arbeitete sich hoch vom Mähdrescherfahrer zum Absolventen der Juristischen Fakultät der Universität Moskau, stieg vom einfachen Parteimitglied zum Generalsekretär mit nahezu unbegrenzter Macht auf. Er glaubte an den Sozialismus, dieses Ideal des Friedens, der Gerechtigkeit. Er war ein schestidesjatnik, einer aus der Generation der »Sechziger«. Sie wollten an den Prager Frühling 1968 anknüpfen und durch gesellschaftliche Öffnung einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz erreichen. Die »Sechziger« waren keine Dissidenten wie etwa jene sieben Mutigen, die am 25. August 1968 auf dem Roten Platz ein Transparent mit der Aufschrift »Für eure und unsere Freiheit« entfalteten. Aber auch die »Sechziger« wollten endlich freier atmen.
Jahrzehnte existierten für Gorbatschow zweierlei Deutsche. Es gab »Unsere« und: »Nicht Unsere«, die Westdeutschen. Lange vertrat Michail Gorbatschow die »offizielle« Sicht auf die Westdeutschen: die Bundesrepublik als düsterer Hort revanchistischer Kräfte mit Hang zum Militarismus. 1975 besuchte er als Mitglied einer Delegation zum 30. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal die Bundesrepublik, es war seine zweite Westreise. Damals war er Parteichef des Gebietes Stawropol, eine der sowjetischen Kornkammern. Eine nicht ganz unwichtige Position, aber weit weg von den Schalthebeln der Macht in Moskau. Beim Kauf von Souvenirs stritt er mit einem Frankfurter Tankstellenbesitzer über die Ursachen der deutschen Teilung. Damals zumindest machte er die Westmächte verantwortlich, nicht Stalin.[38] Die Teilung Deutschlands schien Gorbatschow eine logische Folge des Krieges, der Preis, den die Deutschen für die Sicherheit der Sowjetunion zahlen mussten.
Eine erste Annäherung gelang ihm mithilfe der Ostdeutschen. Eine Studentengruppe aus der DDR kam Anfang der siebziger Jahre zu Besuch nach Stawropol. Man traf sich im örtlichen Restaurant, trank, sang Lieder. »Es war die DDR, die für uns Russen zum Tor zu den Deutschen wurde«, schrieb er, »die erste Schritte zur menschlichen Versöhnung ermöglichte.«[39]
Auf der Suche nach dem »Möglichen in der Sphäre des Ungewöhnlichen«
Am 10. November 1989, einen Tag nach dem Fall der Mauer, fasste Gorbatschows engster außenpolitischer Berater Anatolij Tschernjaew die historische Dimension der Ereignisse in seinem Tagebuch zusammen: »… hier ist das Ende von Jalta, das Finale für das Stalin’sche Erbe und für die Zerschlagung von Hitler-Deutschland … Das ist, was Gorbatschow ›angerichtet‹ hat. Er hat sich als wahrhaft groß erwiesen, weil er den Gang der Geschichte gespürt und ihr geholfen hat, einen ›natürlichen Lauf‹ zu nehmen.«[40]
Und auch wir, westdeutsche Korrespondenten in der Sowjetunion, wurden in den kommenden Monaten überall im Land freudig begrüßt und beglückwünscht zum Fall der Mauer. Es sei wie mit Geschwistern, erklärte man uns: Auch ein Volk könne auf Dauer nicht getrennt bleiben. Sicher hätten die Deutschen aus dem Krieg gelernt, es sei schließlich auch eine Frage der historischen Gerechtigkeit; und manchmal rührte uns diese Herzensfreundlichkeit zu Tränen.
Nur ein knappes Jahr später war Deutschland wiedervereinigt – und das in der Nato. Es glich einem Wunder. Großdiplomatie, Gorbatschow und Kohl umhüllt vom »Mantel der Geschichte«. Russen und Deutsche schienen auf dem Weg »privilegierter Zusammenarbeit« in eine gemeinsame, friedliche Zukunft, in der Deutschland die Sowjetunion ab- und unterstützen könnte. Man wähnte sich in der Tradition Bismarcks, sah die deutsch-sowjetischen Beziehungen als »Stützpfeiler« des zukünftigen gesamteuropäischen Hauses.[41] Doch wie man im Lauf der Jahre aus Akten und Erinnerungen rekonstruieren konnte, hat dieses Bild mit den Fakten nur wenig zu tun. Denn weniger Gorbatschow als vielmehr US-Präsident George Bush und Bundeskanzler Helmut Kohl bestimmten die neue geostrategische Agenda. Gorbatschow unterschätzte die Dynamik des Prozesses und die Einigkeit zwischen Helmut Kohl und George Bush, dem der Kanzler allemal mehr vertraute als ihm, dem Russen. Der Ordnungsanspruch der USA galt ganz Europa. Wie polterte Präsident George Bush im Laufe der Verhandlungen: »Zum Teufel damit. Wir haben die Oberhand gewonnen und nicht sie. Wir können nicht zulassen, dass die Sowjets eine Niederlage in einen Sieg ummünzen.«[42]
Helmut Kohl sah es kaum anders. Glasklar dessen Urteil, das er später in nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Gesprächen über Gorbatschow fällte, ganz Machtpolitiker: Die Schwäche Moskaus sei ursächlich gewesen für den Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur in der DDR: Nicht »der Heilige Geist sei über die Plätze in Leipzig gekommen und habe die Welt verändert«, sondern der »Bimbes« sei ausschlaggebend gewesen; Gorbatschow habe erkennen müssen, dass er das Regime nicht halten konnte.[43]
Für die USA, die Nato und Kanzler Kohl galt es in diesen Monaten nach dem Wunderjahr 1989, so rasch als möglich unwiderrufliche Fakten zu schaffen.[44] Die deutsche Wiedervereinigung in der Nato war das Ziel, nicht Erhalt der DDR oder einer wie auch immer gearteten Konföderation.[45] Auch wenn Außenminister Hans-Dietrich Genscher im Überschwang von einem gemeinsamen Europa von Lissabon bis Wladiwostok und einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur schwärmte: Der Stärkung der Nato war das Ziel, nicht ihre Auflösung oder gar die Verschmelzung der beiden militärischen Blöcke. Gorbatschow glaubte, die Deutschen wollten ein neutrales Deutschland, blockfrei. Doch eine deutsche Neutralität lehnten die USA und die Bundesregierung immer ab. Das maximale Zugeständnis des Westens war die Erklärung von London 1990, in der sich die Nato-Mitglieder bereit erklärten, die Nato zu entdämonisieren. Über den Prozess der »Entfeindung« – einen Gewaltverzicht – solle sie sich in eine »politische Organisation« transformieren.
Die deutsche Frage stellte Gorbatschow vor eine doppelte Herausforderung: Von einer raschen Lösung hing nicht nur das für ihn entscheidende strategische Verhältnis zu den USA ab, sondern auch das ökonomische und damit letztlich auch das politische Überleben der Sowjetunion. »Wir können uns die Einheit kaufen, und zwar mit Geld«, hieß es in einem Bericht der BRD-Botschaft in Moskau im Januar 1990 nach Bonn. »Sicherheitspolitische Konzessionen würden wahrscheinlich gar nicht nötig.«[46] In der Tat: Kredite und Hilfszusagen an die Not leidende Sowjetunion wurden die schärfste Waffe im Ringen um die Wiedervereinigung in der Nato. Der damalige stellvertretende US-Sicherheitsberater und spätere Verteidigungsminister Robert Gates formulierte die Strategie später unnachahmlich amerikanisch-kühl so: »Wir wollten die Sowjets so bestechen, dass sie Deutschland verlassen würden.«[47]
Während der Verhandlungen über die Wiedervereinigung zeigte sich die Bundesregierung großzügig. Mitte Februar 1990 schickte sie Lebensmittel, Schuhe und Bekleidung im Wert von 220 Millionen Mark in die Sowjetunion. Als der Sowjetunion Mitte Mai 1990 der Staatsbankrott drohte, der sowjetische Außenminister um einen 20-Milliarden-Mark-Kredit bat und auch deutsche Banken, die größten Gläubiger der Sowjetunion, Alarm schlugen, schickte Kohl seinen Berater Teltschik sowie die Vorstandsvorsitzenden der Deutschen und der Dresdner Bank nach Moskau. Kohl erkannte eine historische Gelegenheit: »Jetzt gilt es«, instruierte er Teltschik, »alle Chancen zu nutzen und keine zu versäumen.« Die Mission der Banker war so geheim, dass in der Sondermaschine der Bundeswehr noch nicht einmal eine Passagierliste geführt werden durfte. Umgehend leistete die Bundesregierung eine Kredit-Bürgschaft von fünf Milliarden Mark.[48]
Die Hoffnung auf langfristige ökonomische Unterstützung und ein umfassendes Handelsabkommen mit den USA war wahrscheinlich einer der entscheidenden Gründe dafür, dass Michail Gorbatschow am 31. Mai 1990 während des Gipfeltreffens in Washington zur Überraschung aller Beteiligten unerwartet der Wiedervereinigung Deutschlands in der Nato faktisch zustimmte. So schockiert waren die Mitglieder der sowjetischen Delegation, dass sie sich auf dem Rasen vor dem Weißen Haus heftig gestikulierend stritten. Sein Vertrauter Anatolij Tschernjaew sprach später von »spontanen Äußerungen«, dann wieder äußerte er die Vermutung, Gorbatschow habe das Verhältnis zu Bush nicht strapazieren wollen.[49] Teilnehmer der US-Delegation gingen davon aus, Gorbatschow sei bei der Formulierung der gemeinsamen Erklärung schlicht auf dem falschen Fuß erwischt worden.[50] Möglicherweise hatte sein Zugeständnis auch damit zu tun, dass er sich im Westen wohlverstanden fühlte. Dort schätze man die Größe dessen, »was er geschaffen hat«, so Tschernjaew, »und bei uns – geschlossene Unflätigkeit«.[51] Gorbatschow begründete sein inkohärentes Vorgehen mit ziemlich wolkigen Worten: »Politik aber ist hin und wieder die Suche nach dem Möglichen in der Sphäre des Ungewöhnlichen.«[52] Seine fast flehentliche Bitte um Finanzhilfen in Höhe von bis zu 20 Milliarden Dollar lehnten die USA ab.
Gorbatschows Washingtoner Zugeständnis bedeutete den entscheidenden Durchbruch für den Westen. Nur einen Monat später erhielt Kohl auf dem Gipfel am rauschenden Kaukasus-Bach in Archys auch Gorbatschows Einverständnis zur uneingeschränkten Souveränität eines wiedervereinigten Deutschland in der Nato. Für seine Kritiker ein ungeheuerlich unprofessioneller Akt »politischen Masochismus«.[53] Gorbatschow erhielt zwölf Milliarden Mark zur Finanzierung des sowjetischen Truppenabzugs aus der DDR, dazu einen zinslosen Kredit von gerade einmal drei Milliarden Mark für die sowjetische Regierung. Wenig später ließ ihn auch die internationale Gemeinschaft mit seiner Bitte um umfangreiche Finanzhilfe kühl abblitzen.[54]
Es entwickelte sich ein merkwürdiger Widerspruch: Einerseits, sozusagen auf der persönlichen Ebene, begrüßten viele Menschen in der Sowjetunion die deutsche Wiedervereinigung. Aber der Verlust der DDR, »Kronjuwel« eines einst scheinbar so mächtigen Imperiums, symbolisierte andererseits zugleich die totale Kapitulation vor dem Westen. Es schien, als kippe Gorbatschow den glorreichen sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg endgültig auf den Kehrichthaufen der Geschichte, verschleudere nationale Würde gegen ein paar Dollar, D-Mark und verlogene Schmeicheleien. Was bliebe dann noch von einem sowjetischen Leben, von all den Opfern? Nur noch Erinnerungstrümmer.
Gorbatschow habe sich unter Alkohol setzen, beeinflussen und ausnutzen lassen, hieß es quasi amtlich im Jahr 2016, als Schulklasse um Schulkasse durch die Ausstellung »Russland – meine Geschichte« am Moskauer Manege-Platz geführt wurde. Legenden von Verrat und Betrug, Material für nützliche Dolchstoßlegenden: Ständig hätten die angeblichen Partner aus dem Westen die Sowjetunion erniedrigt und betrogen.[55] Dass er die DDR am Ende auch noch in einer »Geschenkverpackung«[56] an die BRD überreicht haben soll, gehört wiederum zur Dolchstoßlegende vom Verrat Gorbatschows an der Sowjetunion.
Eine konsistente Deutschlandstrategie entwickelte Gorbatschow nicht, auch das gehört zur Geschichte seines Scheiterns. Er lavierte, probierte, vielleicht ließ er sich von den Ereignissen zu sehr treiben. Er hätte entschlossener, konsequenter und wohl auch vernünftiger handeln können, weniger selbstgefällig. Doch mit der Lösung der deutschen Frage fiel innerhalb kürzester Zeit die erdrückende »ökonomische und moralische Last der Konfrontation« mit dem Westen von der Sowjetunion ab.[57] Für das Land eröffneten sich bis dahin unvorstellbare Möglichkeiten und Chancen auf eine Verbesserung der ökonomischen Lage und eine demokratische Entwicklung. Diese Chancen wurden nicht genutzt. So wie Erich Honecker zum Totengräber der DDR wurde, fanden sich die Totengräber der Sowjetunion vor allem in der damaligen Sowjetunion. Dort markierte das annus mirabilis 1989 nicht nur das Ende einer Supermacht – es bedeutete auch die Befreiung einer Machtelite von Angst, Schuld, Einschränkungen und Ideologie, von jeglicher Loyalität zu ihrem Land.[58] Nicht die vermeintliche Verschwörung angeblich feindlicher Westler führte zur Implosion der Sowjetunion, sondern die eigenen strukturellen Schwächen und unendliche Gier. Bald krallte sich eine neue Elite an die Macht, die in Wahrheit die alte Elite geblieben war. Reformunwillig nahm sie sich ein ganzes Land als Beute.
Die Nato-Osterweiterung: Gebrochene Versprechen?
Seitdem muss die Mär angeblich gebrochener Versprechen in der Frage der Nato-Osterweiterung als innenpolitischer Tranquilizer und außenpolitisches Totschlagsargument herhalten. Sie diente Putin zur Legitimation des Georgienkrieges 2008 und der Annexion der Krim 2014. Das Problem dabei ist nur: Während der Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung gab kein westliches Staatsoberhaupt eine feste Zusicherung oder ging gar eine juristisch bindende Verpflichtung ein, dass sich die Nato nicht nach Osten ausdehnen werde. Formale Zusicherungen in Bezug auf die Nato betrafen allein das Staatsgebiet der damaligen DDR, für das ein Verbot der Stationierung ausländischer Truppen vereinbart wurde.
Gorbatschow forderte nie eine schriftliche Vereinbarung. Er stellte auch keine Klarheit über die nicht ganz unwichtige Frage her, was eigentlich unter »Osten« zu verstehen sei – das Staatsgebiet der DDR oder auch das Territorium des Warschauer Paktes? Mal erklärte er, dass Deutschland gleichzeitig Mitglied des Warschauer Paktes und der Nato sein könne; dann wieder überlegte er eine Mitgliedschaft der Sowjetunion in der Nato oder erging sich in luftigen Andeutungen. Offenbar hoffte er lange auf ein neutrales Gesamtdeutschland. Hatte ihm nicht die ostpolitische Legende der SPD, Egon Bahr, bei einem Besuch erläutert, in der Bundesrepublik wolle »praktisch niemand« die Wiedervereinigung beschleunigen und dass sich die Nato keinesfalls auf Mitteleuropa ausweiten dürfe?[59] Die Deutschen würden sich dem Gedanken der Blockfreiheit im Rahmen einer gesamteuropäischen Sicherheitsordnung nähern – seiner Vision eines gemeinsamen europäischen Hauses.[60] Vielleicht glaubte er wirklich, ihm werde das Unmögliche gelingen.
Wahr ist aber auch: Die taktisch begründeten Sondierungen gewiefter Politiker, darunter US-Außenminister James Baker und auch Helmut Kohl, konnten in Moskau sehr wohl den Eindruck einer vagen Zusage erwecken, die Nato werde sich nach der deutschen Wiedervereinigung nicht nach Osten ausdehnen. Um dem Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion entgegenzukommen, aber auch um möglichen Forderungen nach einem neutralen Status Deutschlands entgegenzutreten, positionierte sich Außenminister Hans-Dietrich Genscher im Januar 1990 mit einer Rede an der Evangelischen Akademie in Tutzing: »Eine Ausdehnung des Nato-Territoriums nach Osten, d. h. näher an die Grenze der Sowjetunion heran, wird es nicht geben. Diese Sicherheitsgarantien sind für die Sowjetunion und ihr Verhalten bedeutsam.«[61] Auch die Einlassung von US-Außenminister James Baker nur wenige Tage später in Moskau, die Nato eventuell »nicht um einen Zentimeter«[62] nach Osten zu erweitern, konnte – und sollte – Gorbatschow in mehrere Richtungen interpretieren. Auch Kohl selbst sicherte Gorbatschow zu, was wie ein Bekenntnis zur Position Genschers und Bakers klang – aber nicht war: »Natürlich könne die Nato ihr Gebiet nicht auf das heutige Gebiet der DDR ausdehnen.«
Gegenüber westlichen Gesprächspartnern äußerte Hans-Dietrich Genscher mehrmals strikt vertraulich, es gelte sicherzustellen, dass die Nato territorial nicht näher an die Grenze der Sowjetunion heranrücke. Neben ihm waren offenbar der britische Außenminister Douglas Hurd[63] und der französische Staatspräsident François Mitterrand zu einem entsprechenden Angebot an Gorbatschow bereit. Für eine kurze Zeit Anfang 1990 schloss sich auch US-Außenminister James Baker dem Gedanken an – unklar, ob aus rein taktischen Erwägungen oder mangels besserer Alternative. Als Gorbatschow während des Gesprächs mit dem texanischen Banker erklärte, eine Erweiterung der Nato sei »unakzeptabel«, antwortete Baker: »Dem stimmen wir zu.« Das konnte man in Moskau durchaus als Zusicherung interpretieren.[64]
Am 24. Februar 1990 setzte US-Präsident George Bush möglichen westlichen Avancen ein realpolitisches Ende: Es werde keine substanziellen Kompromisse in Bezug auf die Nato geben, erklärte er dem Kanzler in Camp David. Die Sowjetunion sei nicht in der Lage, die Beziehungen Deutschlands zur Nato zu diktieren, befand Bush.[65]
Seinem engsten außenpolitischen Vertrauten Anatolij Tschernjaew zufolge waren für Gorbatschow die strategischen Beziehungen zu den USA von übergeordneter Bedeutung, nicht die Frage der deutschen Wiedervereinigung in der Nato. Am 4. Mai 1990 schrieb er ihm: »Michail Sergejewitsch! … Es ist völlig offensichtlich, dass Deutschland in der Nato sein wird. Und wir haben keinerlei wirkliche Hebel, uns dem entgegenzustemmen. … Ob Schützenpanzer oder Haubitzen der Bundeswehr an der Oder-Neiße oder der Elbe oder sonstwo stehen werden, das beeinflusst die reale Sicherheit der Sowjetunion nicht. Wir müssen uns mit diesem Fakt abfinden.« Weiter führte Tschernjaew aus: »Überlegungen, dass in der Folge auch Polen Mitglied der Nato würde und die Grenzen des Blocks an die sowjetischen Grenzen vorrücken, auch dies sind Überlegungen von gestern, aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges.« Eine nukleare Abrüstung sei »mit einer Politik der Erpressung« nicht zu erreichen. Und mit einem neuen Wettrüsten könne die Sowjetunion ökonomisch nicht mithalten: »Wir benötigen unsere Reserven für die Perestroika.«[66]
Wahrscheinlich wollte Gorbatschow nach allen Seiten offen bleiben. Er war so selbstbewusst zu glauben, er könne den Prozess lenken. Die strukturelle Ambivalenz seiner Politik aber richtete sich wenig später gegen ihn selbst.
Jahrzehnte später wagte Gorbatschow einen Blick zurück. Vielleicht habe auch er während seiner Zeit im Kreml an jener »Krankheit« gelitten, die er jetzt bei seinem Nachfolger Wladimir Putin diagnostizierte: »Übergroßes Selbstvertrauen.« Putin, sagte Gorbatschow, sehe sich gleich hinter Gott. »Vielleicht sogar neben ihm.«[67]
Am Ende, im Dezember 1991, als die Sowjetunion von seinem Intimfeind, dem russischen Präsidenten Boris Jelzin, abgewickelt wurde, konnte es gar nicht schnell genug gehen. Innerhalb von 24 Stunden sollte Gorbatschow seine Wohnung und die Präsidentenresidenz räumen. Seine Immunität wurde aufgehoben, öffentliche Auftritte wurden untersagt. »Ich hatte Ausreiseverbot. Und meine Pension schrumpfte zeitweise auf umgerechnet zwei Dollar.«[68]
Eine offizielle Verabschiedung für den Friedensnobelpreisträger gab es nie.
»Er gab uns die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen«
In der von ihm gegründeten Gorbatschow-Stiftung lagert sein Archiv, hier fanden letzte Getreue Arbeit und ein Einkommen. Um Schindluder mit seinem Namen zu verhindern, ließ er die Bezeichnungen »Gorbi« und »Gorby« sowie das rote Feuermal auf seinem Schädel als Handelsmarken registrieren. Man benannte eine bolivianische Orchideenart nach ihm, Maxillaria gorbatschowii, und eine britische Rose nach seiner verstorbenen Frau Raissa. Er gründete die Umweltschutzorganisation »Green Cross International«, die ohne Einfluss blieb. Als er mit dem Charme des Unbelehrbaren 1996 für das Amt des russischen Präsidenten kandidierte, erhielt Michail Gorbatschow 0,51 Prozent der Stimmen. Als er sich einmal kritisch über Putin äußerte, ließ der ihm ausrichten, er solle den Mund halten.[69]
Nie erreichte er die Qualität eines notorischen Elder Statesman wie etwa Helmut Schmidt oder eines geschäftstüchtigen Weltenretters wie Bill Clinton, noch wurde ihm der späte Ruhm eines Helmut Kohl zuteil. Im Ausland verdiente Gorbatschow mit Büchern und Vorträgen; er vermarktete seinen Namen mit Werbung für Pizza Hut und Louis Vuitton, es war nicht immer eine glückliche Wahl.
Im eigenen Land erst angefeindet, dann vergessen, blieb Michail Gorbatschow die vertraute, dankbare Zuneigung der Deutschen[70] – auch wenn sein Name in all den Reden während des europäischen Traueraktes für Helmut Kohl nicht fiel. Der »Vater der Einheit« kaufte das Hubertus-Schlössl in Rottach-Egern am Tegernsee, dort zog seine Tochter Irina ein; seine beiden Enkelinnen leben in Berlin. Seine gesundheitlichen Probleme ließ er meist in deutschen Krankenhäusern behandeln.
Wir trafen ihn zu einem Gespräch in den Räumen seiner Stiftung in Moskau. Er nahm sich mehrere Stunden Zeit, manchmal schien er müde. Sichtbar gealtert, hatte er mehrere Operationen hinter sich, Rücken, die Schlagader, er kämpfte mit einer Diabetes. Oft schwieg er lange – als ob er in sich hineinhorchen würde. »Manchmal gehe ich die Treppe herunter und vergesse, warum«, sagte er.
Er hatte gerade sein wohl persönlichstes Buch veröffentlicht: Alles zu seiner Zeit.[71] Hatte dafür seine Kindheitserinnerungen diktiert und über die Vergänglichkeit des Ruhms reflektiert. Vor allem aber war es ein Buch der Trauer. Nie überwand er den Tod seiner Frau Raissa, der Liebe seines Lebens. Auch sie ein Kind des Krieges und des Terrors, jener grenzenlosen sowjetischen Gewalt, die ein ganzes Land prägte.
Er fühlte sich schuldig an ihrem Leiden und ihrem Tod. »Ich hätte sie schützen müssen«, sagte er uns. Sie litt unter den Anfeindungen und der öffentlichen Häme, die ihrem Mann entgegenschlugen. Während des Putschversuchs im August 1991 gegen Gorbatschow erlitt sie einen kleinen Schlaganfall. Sie konnte nicht sprechen, die rechte Hand war gelähmt, später folgten Netzhautblutungen und Depressionen. Unter dem Eindruck des Putschversuchs verbrannte Raissa Gorbatschowa 52 Liebesbriefe; er selbst 25 Notizbücher mit dienstlichen Aufzeichnungen. Sie hatte Angst, sie könnten in fremde Hände gelangen. Als er 1992 aus der Präsidentenwohnung auszog, entdeckten Gorbatschows Mitarbeiter überall Abhörgeräte. Die ganze Wohnung war voll davon.
Als Raissa Gorbatschowa an Leukämie erkrankte, wurde sie über drei Monate in Münster behandelt. Es war zu spät. Sie starb am 20. September 1999.
Er selbst wollte damals nicht mehr weiterleben. Er zwang sich dann doch dazu, und dies hatte auch mit der Anteilnahme der Deutschen am Schicksal seiner Frau zu tun. Körbeweise Briefe an sie gingen damals in der Uniklinik Münster ein. Er hat es den Deutschen nie vergessen.
Und doch – es nagte an ihm. Die Hybris der Politiker im Westen, ihre Kaltschnäuzigkeit und Härte, ja, auch die seines Freundes Helmut Kohl: »Als ob alles ihr Verdienst gewesen sei. Als ob alles – auch die deutsche Wiedervereinigung – ohne Russland möglich gewesen sei«, sagte er mit ein wenig Bitterkeit. »Manchmal hatte ich den Eindruck, einige im Westen wollten mich an der Nase herumführen, und vielleicht haben sie mir in Wahrheit nie wirklich vertraut. Ich vertrat für sie wohl die falschen Ideale.«[72]
Sein eigenes Land aber ist inzwischen in die Zeit vor ihm zurückgekehrt. Überall um ihn herum richten sich die Menschen wieder einmal in der trügerischen Sicherheit eines autoritären Systems ein. »Er gab uns die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen«, sagt die Moskauer Politologin Lilija Schewzowa. »Doch wir nutzten diese Chance nicht. Gorbatschow hatte kein Glück mit uns – doch er war ein Glücksfall für uns. Es wird noch lange dauern, bis wir dies verstehen.«[73]
Letztlich zwang sich Michail Gorbatschow dazu, ein »glücklicher Reformer« zu sein. »Ich habe die Macht nie um der Macht willen angestrebt, und vielleicht kann man sagen: Ich hatte Glück«, sagte er uns an jenem Moskauer Nachmittag in seinem Büro. »Ich habe an die Türen der Geschichte geklopft, und sie taten sich auf.«[74]
Er öffnete uns die Welt. Wer kann das schon von sich sagen.
Den Osten im Blick: Konturen, Kontakte
Vor gut tausend Jahren begegneten die Vorfahren der Deutschen und Russen einander als erfolgreiche Fernhändler. Die Ostsee war ihr Weltmeer. Handel brachte sie zusammen – doch die Kontroverse um den »wahren« christlichen Glauben prägte auch das frühe deutsch-russische Verhältnis.
Welch ein Skandal! Ein Showdown, nie dagewesen! Eine junge, man könnte sagen russische Frau stand im Mittelpunkt einer der größten politischen Krisen des Mittelalters, Hauptperson einer Intrige allerersten Ranges, die über Jahre für Gesprächsstoff an Europas Adelshöfen sorgte.[1] Sie wagte Ungeheuerliches, diese gerade erst erwachsen gewordene Frau aus dem fernen Reich der rhos, die aber römisch-deutsche Königin und Kaiserin war. Eupraxia hieß sie, die »gut Handelnde«; sie hörte auch auf den »westlichen«, althochdeutschen Namen Adelheid. Eine reiche Prinzessin aus dem mächtigen Kiewer Reich, einer Dynastie von internationaler Bedeutung, war sie aus machtpolitischen Gründen im Sommer 1089 mit dem römisch-deutschen Kaiser Heinrich IV. verheiratet worden.[2] Dem glanzvollen Ereignis im Dom zu Köln war ihre Krönung zur Königin vorausgegangen. Die Ehe galt als eines der ersten politischen Zweckbündnisse zwischen Ost und West.
Zu diesem Zeitpunkt rang Kaiser Heinrich IV. mit Papst Gregor VII. um die Vormachtstellung im Reich. Der mit allen nur erdenklich schmutzigen Mitteln geführte Machtkampf ging als »Investiturstreit« in die Geschichte ein: Exkommunikationen, Verschwörungen und Hochverrat, Propaganda, Sex und Lügen; die politische Demütigung mit dem Gang des Kaisers nach Canossa und seiner kurzzeitigen Unterwerfung unter den Papst; Auftragsmorde, Rebellionen und Kriege – und mittendrin sie, Kaiserin Eupraxia. Denn nach dem Zerwürfnis mit ihrem offenbar gewalttätigen Mann wagte sie es, sich öffentlich gegen ihn zu stellen und ihn der »moralischen Verderbtheit« zu bezichtigen. Als Tabubrecherin wider Willen exponierte sich die damals 25-jährige Frau aus Kiew in einem politischen Machtkampf, wie wohl keine Kaiserin vor ihr – und lange keine nach ihr.
Auf der Synode von Piacenza trat Eupraxia als Belastungszeugin des Papstes gegen ihren Mann im März 1095 vor eine große Menschenmenge; Tausende waren gekommen. Sie soll von Vergewaltigung berichtet haben und darüber, wie ihr Mann sie der Prostitution preisgegeben habe; schließlich habe sie fliehen müssen, um sich vor weiteren Übergriffen zu retten. Es mag Propaganda gewesen sein, eine inszenierte Schauergeschichte oder die Wahrheit[3] – als Zeugin der Anklage lieferte Eupraxia dem Papst das entscheidende Argument für das »Ketzertum« ihres Mannes. Heinrich IV. wurde erneut exkommuniziert – es bedeutete sein politisches Ende. »Vom deutschen Kaisertum war nicht mehr die Rede, es war gestürzt, sein Träger in einem Winkel Italiens verschollen.«[4]
Das öffentlich zelebrierte Ende einer ost-westlichen kaiserlichen Ehe war der erste Höhepunkt einer Beziehungsgeschichte, die vor gut tausend Jahren begann. Deutsche und Russen, Russen und Deutsche – von Anfang an war ihr Verhältnis von Gegensätzen und Widersprüchen geprägt. Immer schwankte es zwischen Annäherung und Abwehr, Freundschaft und Feindschaft, Faszination und Fremdheit. Voneinander lassen konnten sie nie.
Sie stolperten aus dem Halbdunkel sagenumwobener Vergangenheit in die Geschichte Europas hinein, Deutsche und Russen. In diesem Halbdunkel der Vergangenheit entstanden die späteren Deutschen als multiethnischer Mischmasch: Nachfahren von Germanen, Kelten, allerlei römischen Siedlern und Legionären, aber auch von Völkern und Siedlerverbänden aus dem Osten – urslawischen Stämmen nämlich, die bis ins frühe Mittelalter aus den Ebenen des osteuropäischen Tieflands nach Westen gezogen waren.[5]
Stämme, die in Gebieten heimisch wurden, die »Wagrien« und »Polabien« hießen und heute Teile Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins umfassen; auch im heutigen Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und selbst am Main siedelten Slawen. Die Etymologie der Namen unzähliger deutscher Städte und Dörfer belegt dies. Der Stadtname Lübeck etwa geht auf die sieben Kilometer vom heutigen Stadtzentrum gelegene slawische Burgsiedlung »Liubice« aus dem 9. Jahrhundert zurück, möglicherweise: Siedlung der Leute des L’ub.[6] »Vielleicht wollen wir es nicht wahrhaben, vielleicht haben wir es verdrängt, und unter den Nazis wurde es zu einem absoluten Tabu. Doch in uns Deutschen steckt viel Slawisches«, so der Landesarchäologe Schleswig-Holsteins, Claus von Carnap-Bornheim.[7]
Geografie schrieb ihre gemeinsame Geschichte: Verknüpfte im Süden die Donau als Verkehrsweg schon seit Jahrtausenden West und Ost, bildeten die von Nord nach Süd verlaufenden Flüsse im Osten Europas zunächst Barrieren.[8] Doch seit dem 8. Jahrhundert[9] zogen mit der Erschließung des Ostseeraums auch der europäische Norden und Osten nach. Seegängige Schiffe befuhren die Ostsee, erste Städte entstanden an ihren Ufern. Ihre festen Handelsstationen mit Marktrechten wurden anfangs von Skandinaviern und Slawen dominiert. Es begann jener Prozess, der den Norden mit dem Osten Europas zu einem strukturierten, multiethnischen Großraum[10] mit der Ostsee als »Weltmeer« verband. Ein Raum, dominiert von Vertretern eines durchaus fortschrittlichen Wirtschaftsmodells, das Risikobereitschaft und hohe Investitionen erforderte, Vielsprachigkeit und diplomatisches Geschick: der transkontinentale Handel.
Gemeinsame ökonomische Interessen brachten Fernhändler und lokale Eliten zusammen. Die Händler brauchten Sicherheit und Verlässlichkeit für ihre Geschäfte, etwa sichere Durchfahrt auf Fernhandelsstraßen und Flüssen oder Zollerleichterungen. »Dass sich daraus politische Allianzen und neue Herrschaftsstrukturen entwickelten, ist der historische Fortschritt, der eine gemeinsame Geschichte im Ostseeraum und damit auch von Deutschen und Russen überhaupt ermöglichte.«[11]
So begann die Geschichte der Deutschen und der Russen als Geschichte zweier neugieriger Nachzügler, hungrig auf die Eroberung einer neuen, grenzenlosen Welt.
Zu den wichtigsten Handelszentren dieses wachsenden gigantischen »Interaktionsraums zwischen Rhein und Wolga«[12] gehörte eine Stadt an einer damals von skandinavischen Normannen beherrschten Bucht im Norden des heutigen Schleswig-Holstein: Haithabu. Logistisch günstig an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsrouten gelegen und zugleich nahe an Ost- wie Nordsee, behauptete sich Haithabu fast 300 Jahre lang als 1500 Einwohner große Metropole und Hauptumschlagplatz für den internationalen Handel zwischen Skandinavien, Westeuropa, dem Nordseeraum, dem Baltikum und dem fernen Kiewer Reich.[13]
Im frühen Mittelalter hatten die Normannen ihren Blick auf den weiten Raum im Osten und Süden jenseits der Ostsee gerichtet. Kaufleute und Krieger, erfahren in Schiffsbau und Nautik, mehrsprachig und risikobereit, suchten sie einen vergleichsweise schnellen und sicheren Weg, um Handelsbeziehungen »zu den Griechen« aufzunehmen. Der Weg führte von der Ostsee zum Schwarzen Meer und von dort aus in die damals mächtigste und reichste Stadt des Orients: Konstantinopel. In den slawischen Quellen die »Waräger von jenseits des Meeres«[14] genannt, drangen die Normannen über die verzweigten Flusssysteme des Wolchow, den Ilmen- und den Ladogaee sowie den Dnjepr vor: 860 belagerten sie mit ihrer Flotte sogar Konstantinopel. Weiter im Osten befuhren sie den heute russischsten aller russischen Flüsse, die Wolga. Gelangten über das gewaltige Mündungsdelta ins Kaspische Meer und erreichten von dort aus die islamische Welt. Dort, in Mittelasien,[15] lagen die Silberminen, aus denen der kostbare Rohstoff für das wichtigste Zahlungsmittel der Zeit gewonnen wurde. Funde von Klappwaagen aus dem Kalifat von Bagdad und von arabischen Dirham-Münzen in Schweden[16] belegen Weite und Intensität des damaligen Fernhandels, der über die russischen Flusssysteme abgewickelt wurde.
Sie kamen als Eroberer, auf rasche Beute und dauerhafte Tributzahlungen aus. Mit befestigten Stützpunkten sicherten die Waräger im 9. Jahrhundert ihre Herrschaft über die slawischen Stämme. Dazu gehörte auch die am mittleren Dnjepr gelegene Siedlung Kiew.[17] Warägerfürsten und ihre Gefolgschaften wurden sesshaft, slawisierten sich. Aus skandinavischen Namen wurden slawische, es entstand eine Kultur- und Wirtschaftsgemeinschaft. Man nannte sie: die Kiewer Rus.
Noch heute wird über die Herkunft des Namens »Rus« gestritten, es ist noch immer ein Politikum. Wer waren ihre Bewohner – Nachkommen beutegieriger Skandinavier oder doch ein »eigenes« slawisches Volk? Als wahrscheinlich gilt die Entwicklung nach der »Normannenthese«: Rus, so die »Normannisten«, sei die slawische Form des alten finnischen Wortes Ruotsi, Rotsi – Ruderer. Ursprünglich Bezeichnung der slawischen Ureinwohner für die Normannen, habe sich der Begriff im Lauf der Zeit auf die gesamte Bevölkerung übertragen.[18]
»Antinormannistische« russische Historiker empörten sich hingegen schon im 18. Jahrhundert über die angebliche Demütigung eines großen Volkes. Später befahl der Iossif Stalin – ein Georgier – die politisch nützliche Wahrheit: Das russische Volk habe sich eigenständig entwickelt.[19]
Die Kiewer Rus wuchs zu einem »bedeutenden europäischen Staat«,[20] zum ersten echten Herrschaftsgebiet auf späterem russischem Boden. Als mächtiger Vielvölkerverbund umfasste sie alle ostslawischen Stämme.[21] Im 12. Jahrhundert erstreckte sich ihr Territorium bis an die heutige russisch-finnische Grenze. In diesem Sinne ist die Kiewer Rus die Wiege des späteren russischen wie des späteren ukrainischen und auch des weißrussischen Staates. Die Fürsten des reichen Handelsstaates knüpften auch dynastische Verbindungen nach Westen – die Verheiratung der jungen Fürstentochter Eupraxia gehörte dazu.
Die Kiewer Rus exportierte vor allem ihre Ressourcen – all das, was in diesem gewaltigen, menschenleeren Raum im Überfluss vorhanden schien. Aus den Wäldern kamen Honig und das für die Kirchenliturgie hochbegehrte Bienenwachs, Zobel- und Eichhörnchenfelle. Zu den schönsten Funden der Archäologen aus dieser Zeit gehören die »Kiewer Eier«, die in der orthodoxen Osterliturgie genutzt wurden. Aus glasiertem Ton hergestellt und mit feinem Muster verziert, gerade einmal vier Zentimeter hoch, fanden sie ihren Weg von Kiew nach Haithabu.
Im Gegenzug wurden hochwertige Güter importiert, Fertigwaren wie Schwerter, Textilien oder Geschirr. Einen Hinweis darauf geben Zollbestimmungen der damaligen Zeit: So verfügten die Bestimmungen des Kapitulars von Diedenhofen schon 805 ein Waffenexportverbot in die Siedlungsgebiete der Menschen, die sich Rozzi nannten oder Rhos.[22]
Schon am Anfang der gemeinsamen Geschichte stand also eine im weitesten Sinne deutsch-russische Modernisierungspartnerschaft, in der Innovation und Technologien gegen Rohstoffe getauscht wurden.
Zu den begehrtesten »Handelswaren« aus dem Osten aber gehörten im gesamten Mittelalter: Menschen.
Die Geschichte des europäischen Sklavenhandels ist ein lange vernachlässigtes, gar verdrängtes Thema. Bis heute verweigern auch Historiker in Russland und Osteuropa bisweilen »apodiktisch« die Auseinandersetzung; noch immer fehlt auch ein länderübergreifender Diskurs über Ausmaß und Legitimierung der Netzwerke des mitteleuropäischen Menschenhandels.[23] Das lateinische Wort sclavus – »Slawe« – wurde offenbar ab dem 10. Jahrhundert zunehmend in der Bedeutung »Sklave« gebräuchlich. »Sklavenhandel«, so der Leipziger Osteuropa-Historiker Christian Lübke, »wurde zu einem Motor der grenzübergreifenden ökonomischen Entwicklung«.[24]
Sie wurden unter Aufsicht der weltlichen Macht auf den öffentlichen Marktplätzen großer Handelsstädte wie wohl auch Prag verkauft. Sklaven mussten »heidnisch« sein, also nicht christlich getauft. Sie sollten aber auch keine Muslime sein, denn viele wurden nach Cordoba verkauft, bis ins 10. Jahrhundert islamischer Vorposten im Süden Europas. Dort dienten die saqaliba – Slawen – als Eunuchen bei Hofe, im Militär und in der Landwirtschaft.[25] Die jungen Männer sollen dafür in eigens eingerichteten Zentren in Frankreich kastriert worden sein.
Die »unchristlichen« Gebiete östlich der Elbe wurden zum Jagdgebiet. Der Verkauf von Slawen – Sklaven – sowie der Freikauf von Kriegsgefangenen gegen Lösegeld war vom 8. Jahrhundert bis in die frühe Neuzeit hinein[26]big business. Offenbar waren vor allem auf Menschenhandel spezialisierte[27] russische Händler dick im lukrativen Geschäft;[28] der »russische Marktplatz« (ruzaramarcha) nahe dem heutigen Grein an der Donau galt als bedeutender Umschlagplatz des transkontinentalen Sklavenhandels.[29]
Von dem erschreckend alltäglichen Geschäft profitierten auch staatliche und kirchliche Akteure. Es handelte sich sowohl um »klassischen« Sklavenhandel als auch um Gefangennahme – etwa von Seeleuten – die dann gegen Lösegeld freigekauft wurden.[30] Bis Ende des 17. Jahrhunderts sollen mindestens zwei Millionen Menschen aus dem Osten Europas auf die Sklavenmärkte West- und Südeuropas und am Schwarzen Meer verschleppt worden sein.[31]
Nach Ostland: Deutsche Siedler und selbsternannte Ritter Gottes
Langsam nur änderte sich der Blick auf den Menschen, wurde »Wert« durch eine gewisse »Wertschätzung« ersetzt. Dies hing mit dem Prozess der »Vergetreidung« Europas zusammen. Mit zunehmender Urbanisierung stieg ab dem 11. Jahrhundert der Bedarf nach Getreide für die rasch wachsende Bevölkerung im Westen Europas, auch im Reich nördlich der Alpen, wo Hunderte Städte wuchsen. Die Nachfrage nach Land stieg, bald kolonisierten von »der Landnot bedrückte«[32] verarmte Bauern das dünn besiedelte Land östlich der Elbe. Im Laufe einiger Generationen drängten Hunderttausende »nach Ostland«, in das Land der Slawen, die in Gebieten lebten, die heute Ostmitteleuropa und das Baltikum umfassen. Mit den Bauern zogen Handwerker und Kaufleute. Sie rodeten Wälder, legten Sümpfe trocken, bauten Brücken. Sie brachten neue Techniken der Landbestellung, Sensen, Räderpflüge und Wassermühlen. Als Innovationsträger lebten die Neusiedler in mehr oder weniger friedlich konkurrierender Koexistenz mit den ansässigen Slawen.[33]
Mit dem steten Treck der Neusiedler begann vor rund 800 Jahren eine politische und wirtschaftliche Neuorientierung in Ostmitteleuropa. Mit Stadtgründungen kamen die Freiheiten des Stadt- und Marktrechtes, und auch die meisten Bauern waren frei. Verwaltet nach Magdeburger und Lübischem Recht entwickelte sich in den Städten eine Vorstufe von Zivilgesellschaft.
»Stadtluft macht frei« – dieser Grundsatz machte den entscheidenden Unterschied im Prozess des europäischen nation-building. Für die Menschen in Russland galt er nie. Nach dem Mongolensturm tatarischen Herrschern zu Tribut verpflichtet und in orthodoxer Abgrenzung vor den christlichen »Lateinern«, verpassten die russischen Fürstentümer die großen europäischen Umwälzungen des 13. Jahrhunderts, als Vergetreidung und Urbanisierung einen gewaltigen sozialen, ökonomischen und politischen Modernisierungsschub brachten. Auch in diesem Sinne wagt der Osteuropa-Historiker Christian Lübke eine durchaus trennende Einschätzung, wenn es um die Zugehörigkeit Russlands zu Europa geht. Russland gehört zum Osten Europas. Osteuropa aber unterscheidet sich von Mittel- und Westeuropa: »Wir müssen konstatieren: Es verläuft eine Kulturgrenze zu Russland.«[34]
Doch die zunächst friedliche Besiedlung wandelte sich Ende des 12. Jahrhunderts in brutale Eroberung: Mit der Ausrufung von Kreuzzügen nach Osten[35] wurde die Kreuzfahrer-Ideologie auch auf das östliche Europa übertragen. Gewaltsam bekehrte – oder mordete – man die ansässigen slawischen »Heiden«, nahm sich ihr Land. Riesige Landstriche – einschließlich des späteren Preußen – wurden mit Feuer und Schwert kolonisiert. Besonders aktiv war dabei der »Orden der Brüder vom Deutschen Hospital Sankt Mariens in Jerusalem«, der Deutsche Orden, der sich ursprünglich der Krankenpflege in Jerusalem gewidmet hatte. Mit ausdrücklicher Erlaubnis von Kaiser und Papst eroberten die Ritter des Deutschen Ordens und des später mit ihm vereinigten »Ordens der Schwertbrüder« die gesamte Ostseeküste von Danzig über Riga bis Tallinn. Die Gebiete des späteren Ostpreußen sowie Lettland und Estland bildeten den mächtigen deutschen »Deutschordensstaat«, fünfmal so groß wie die Schweiz.
Im 19. Jahrhundert geisterte das Bild der tapferen deutschen Ritter als opferbereite christliche Kulturträger im barbarischen – sprich slawischen – Osten durch die deutsche Geschichtsschreibung. Im Ersten Weltkrieg, als die deutschen Truppen unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff im Sommer 1915 mit der Besetzung großer Teile des Baltikums ihren bislang größten Sieg an der Ostfront errungen hatten, wurden drei Millionen Menschen in Litauen und Kurland unter deutsche Militärverwaltung gestellt: Im Land »Ober Ost« wollte Ludendorff seine deutsche Utopie eines ordentlichen Militärstaates im Osten verwirklichen. Die Stereotype von unzivilisierten, im Grunde gefährlichen Menschen im Osten setzten sich nach dem Ersten Weltkrieg in der deutschen Elite fort, verknüpften sich mit den verklärenden Bildern der deutschadeligen »Heimat« Ostpreußen. Dieses »verborgene Vermächtnis« machten sich die Nationalsozialisten zunutze. Sie deuteten Projektionen, Ängste und Sehnsüchte zum »deutschen Auftrag im Osten« um, von Hitler schließlich als »Ostpolitik« auf die völkervernichtende Spitze getrieben.[36]
Von der Küste des heutigen Baltikums drangen die Ordensritter, die »Lateiner«, in die russischen Großfürstentümer Nowgorod und Pskow, Pleskau, vor. Dort, auf dem noch zugefrorenen Peipussee nahe der Stadt Pleskau, kam es im April 1242 zu einer Schlacht, die als erste Begegnung eines »deutschen« und eines »russischen« Heeres gedeutet wurde. Sie endete mit einer vernichtenden Niederlage der Ordensritter: »Man sah das Eis nicht mehr, denn es war von Blut bedeckt.«[37]