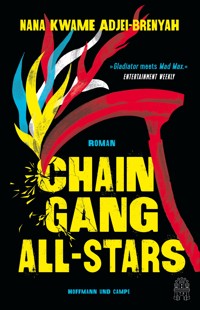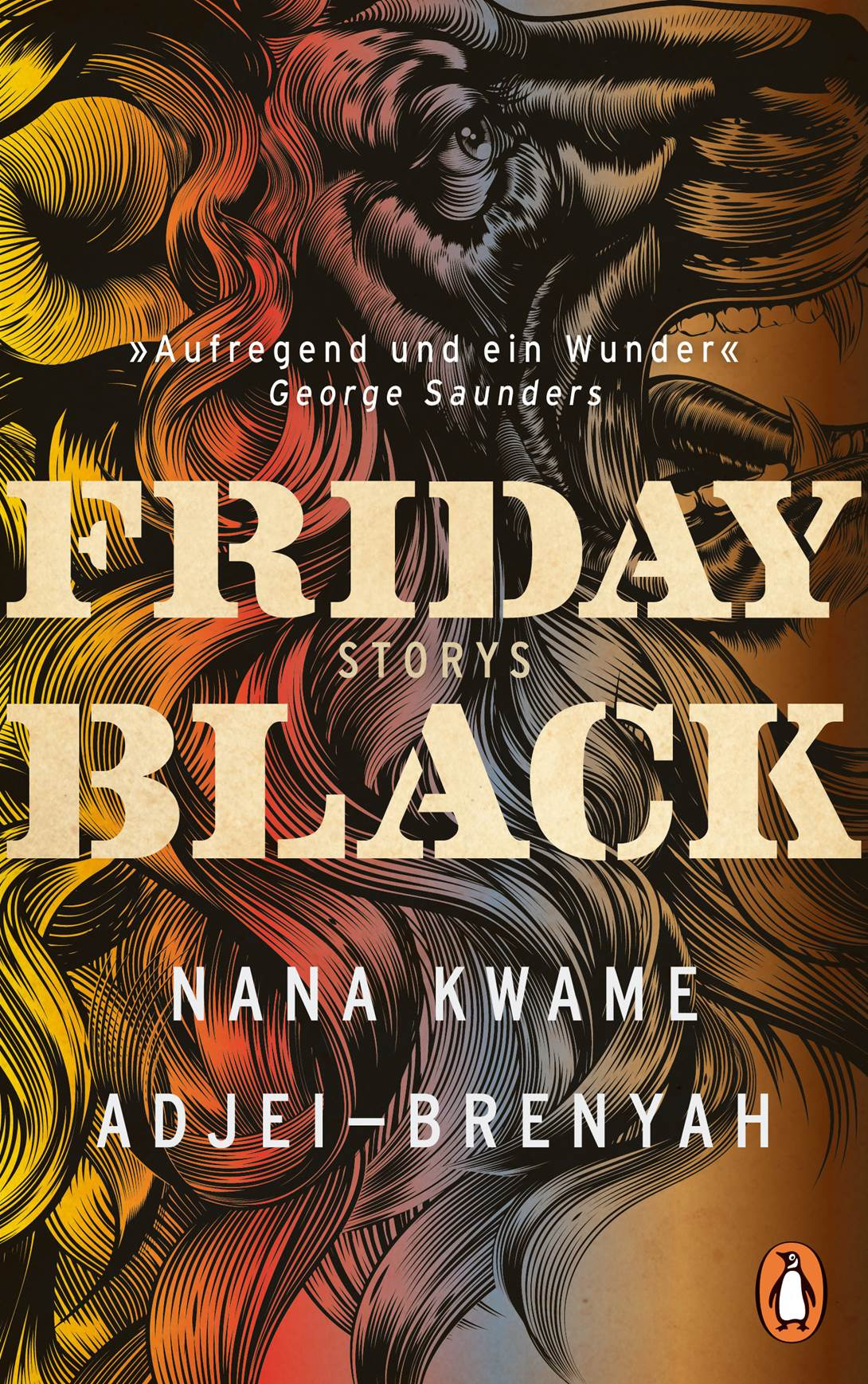
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
»Aufregend und ein Wunder« George Saunders
»In ›Friday Black‹ wird von einer Zukunft erzählt, die schon morgen beginnen könnte. Eine neue und radikal frische Stimme in der US-Literatur.« stern – SWR-Bestenliste Juli/August 2020.
In zwölf verstörenden Storys erzählt Nana Kwame Adjei-Brenyah von Liebe und Leidenschaft in Zeiten von Gewalt, Rassismus und ungezügeltem Konsum. Wie fühlt es sich an, im heutigen Amerika jung und schwarz zu sein? Welche Spuren hinterlässt alltägliche Ungerechtigkeit? In einer unkonventionellen Mischung aus hartem Realismus, dystopischer Fantasie und greller Komik findet der US-Amerikaner eine neue Sprache für die brennenden Themen unserer Zeit. Ein selten kraftvolles, mitreißendes und ungewöhnliches Debüt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Ähnliche
Nana Kwame Adjei-Brenyah ist die junge, aufsehenerregende Stimme unserer Zeit. In seinem Debüt, zwölf aufwühlend politischen Storys, erzählt der US-Amerikaner von einer Welt, in der Weiße Schwarze diskriminieren und Schwarze Latinos. In der Menschen genetisch optimiert werden und Schüler aus Frust über das Leben einen Amoklauf begehen. Er erzählt von Gewalt, Rassismus, ungezügeltem Konsum und zeigt uns, was es heißt, im heutigen Amerika jung und schwarz zu sein. Mit einer unkonventionellen Mischung aus hartem Realismus, dystopischer Fantasie und greller Komik findet Adjei-Brenyah eine überraschend neue Sprache für die brennenden Themen unserer Zeit.
NANA KWAME ADJEI-BRENYAH, Sohn ghanaischer Eltern, wurde 1990 in Spring Valley, New York, geboren, studierte Fine Arts und unterrichtet heute Creative Writing an der Syracuse University. Sein Debüt »Friday Black«, ein New York Times-Bestseller, errang den PEN-Jean Stein Book Award 2019, stand auf der Shortlist für den Dylan Thomas Prize 2019 und auf der Longlist der Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction. Universal Pictures hat sich die Filmrechte an der Titelgeschichte seines Debüts gesichert.
»Aufregend und ein Wunder«
George Saunders
»Ein unfassbares Debüt, das eine neue und wichtige amerikanische Stimme ankündigt«
The New York Times
»Pechschwarz, brutal und trotzdem über weite Strecken witzig«
Vogue
»Adjei-Brenyah verhandelt die Themen Gewalt, Ungerechtigkeit und ungezügeltes Konsumverhalten satirisch und mit brutaler Ehrlichkeit.«
Chicago Tribune
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und facebook
Nana Kwame Adjei-Brenyah
FRIDAYBLACK
Storys
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel
Die Originalausgabe erschien 2018
unter dem Titel Friday Black
bei Houghton Mifflin Harcourt.
Das diesem Buch vorangestellte Motto entstammt dem Song »Blessed« des US-amerikanischen Rappers Schoolboy Q, feat. Kendrick Lamar, aus dem Album »Habits & Contradictions«, erschienen 2012 bei Top Dawg Entertainment.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © der Originalausgabe 2018
Nana Kwame Adjei-Brenyah
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Buch wurde vermittelt durch: DeFiore and Company Literary Management, Inc.
und Andrew Nurnberg Associates London
Covergestaltung: Sabine Kwauka
nach einer Idee von Mark Robinson
Coverabbildung: Chris Gorgio/Getty Images
Autorenfoto: Levene/Guardian/Eyevine/Inter Topics
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25737-8V002
www.penguin-verlag.de
Für meine Mom, die gesagt hat:
»Wie kann dir langweilig sein?
Wie viele Bücher hast du geschrieben?«
Anything you imagine you possess.
Kendrick Lamar
Die Finkelstein Five
Fela, das Mädchen ohne Kopf, kam auf Emmanuel zu. Ihr Hals schartig und blutüberströmt. Sie schwieg, doch sie schien darauf zu warten, dass er etwas unternahm, irgendwas.
Plötzlich klingelte sein Handy, und er wachte auf.
Er holte tief Luft und fuhr die Schwarzheit in seiner Stimme auf einer Skala von eins bis zehn auf 1,5 herunter. »Hallo, wie geht’s Ihnen? … Ja, ja, ich hab mich neulich nach dem aktuellen Stand meiner Bewerbung erkundigt. … Gut, okay. Freut mich zu hören. Ich werde da sein. Wunderschönen Tag noch.« Emmanuel stand aus dem Bett auf und putzte sich die Zähne. Im Haus war es still. Seine Eltern waren schon zur Arbeit gefahren.
An jenem Morgen ging es, wie jeden Morgen, schon bei der ersten Entscheidung, die er traf, um seine Schwarzheit. Seine Haut war von einem dunklen, regelmäßigen Braun. In der Öffentlichkeit, wo ihn die Leute sahen, war es unmöglich, seine Schwarzheit auch nur annähernd auf 1,5 herunterzuschrauben. Wenn er eine Krawatte und gute Schuhe trug, immerfort lächelte, in Zimmerlautstärke sprach und die Hände eng und ruhig am Körper herabhängen ließ, konnte er seine Schwarzheit auf 4,0 verringern.
Auch wenn Emmanuel froh war, das Vorstellungsgespräch bekommen zu haben, hatte er deshalb doch ein schlechtes Gewissen. Die meisten Leute, die er kannte, beklagten noch immer das Finkelstein-Urteil: Nach einer Beratung, die ganze achtundzwanzig Minuten gedauert hatte, war George Wilson Dunn von einer Geschworenenjury, die sich aus seinesgleichen zusammensetzte, von jeglicher Straftat freigesprochen worden. Er hatte vor Gericht gestanden, weil man ihm vorwarf, fünf schwarze Kinder vor der Finkelstein-Bücherei in Valley Ridge, South Carolina, mit einer Kettensäge enthauptet zu haben. Weil die Kinder draußen herumgelungert und nicht, wie es von produktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu erwarten gewesen wäre, in der Bücherei gesessen und gelesen hätten, hatte das Gericht entschieden, es sei verständlich, dass Dunn sich von diesen fünf jungen Schwarzen bedroht gefühlt und folglich das Recht auf seiner Seite gehabt hatte, als er seine Hawtech-Pro-18-Zoll-48-Kubikzentimeter-Kettensäge von der Pritsche seines Ford F-150 holte, um sich selbst, die in der Bücherei ausgeliehenen DVDs und seine Kinder zu schützen.
Der Fall hatte das ganze Land aufgewühlt und war so ziemlich das Einzige, worüber alle redeten. In den Nachrichten drehte sich alles um Finkelstein. In einem Teil der Radio-Welt trauerten Sprecher öffentlich um die Kinder, die in ihren Augen Heilige waren; im anderen gab es Leute wie Brent Kogan, den stets ruppigen, rechthaberischen Moderator von What’s the Big Deal?, der bei einer Podiumsdiskussion im Internet gesagt hatte: »Ja, ja, sie waren Kinder, aber auch verdammt noch mal Nigger.« Die meisten Nachrichtensender lagen irgendwo dazwischen.
Am Tag der Urteilsverkündung hatten sich Emmanuels Familie und Freunde, Menschen von unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe, gemeinsam vor dem Fernseher versammelt und das Ganze auf einem Sender verfolgt, der mit den Kindern, allgemein als die Finkelstein Five bekannt, sympathisierte. Es gab Pizza und Getränke. Als das Urteil verkündet wurde, spürte Emmanuel ein Knacken und Knirschen in seiner Brust. Es brannte. Seine Mutter, die als eine der quirligsten und glücklichsten Frauen in der Nachbarschaft galt, warf einen Plastikbecher voll Cola durchs Zimmer. Als der Becher zu Boden fiel und die Limonade aufspritzte, starrten die Leute Emmanuels Mutter an. Mrs. Gyan so zu erleben, hieß, dass es real war: Sie hatten verloren. Emmanuels Vater zog sich in einen stillen Winkel zurück und wischte sich die Augen trocken, und Emmanuel spürte, wie sich das Knirschen in seiner Brust in ein kaltes Nichts verwandelte. Auf der Fahrt nach Hause fluchte sein Vater. Seine Mutter schlug aufs Lenkrad, woraufhin die Hupe ertönte. Emmanuel holte tief Luft und sah seine Hände auftauchen und verschwinden, wieder auftauchen und verschwinden, während der Wagen an Ampeln vorbeiglitt. Das Nichts, das er verspürte, spülte in kalten Wellen über ihn.
Doch jetzt, wo man ihn zu einem Vorstellungsgespräch bei Stich’s eingeladen hatte, einem Laden, der auf Pulloverklassiker spezialisiert war und sich als »innovativ mit einem Gespür für Tradition« bezeichnete, konnte Emmanuel noch an was anderes denken als an die Leichen der Kinder mit ihren durchtrennten Hälsen, klitschnass von dickflüssigem, pulsierend hervorschießendem Blut. Nun überlegte er, was er anziehen sollte.
In einem diffusen Akt der Solidarität stieg Emmanuel in die locker sitzende Cargohose, die er bei einem Campingausflug getragen hatte. Dann zog er seine Lackleder-Space-Jams an, deren Schnürsenkel sich noch immer sauber und straff über die schwarze Lasche spannten. Er nahm ein längst ausrangiertes schwarzes Kapuzenshirt und tauchte in dessen Tunnel ein. Als letzten Akt der Solidarität setzte er eine graue Baseballkappe auf, ähnlich denen, die zwei der Finkelstein Five bei ihrer Ermordung getragen hatten – ein Umstand, den George Wilson Dunns Verteidiger vor Gericht immer wieder betont hatte.
Emmanuel trat in die Welt hinaus, seine Schwarzheit stabil bei 7,6. Er kam sich vor wie Evel Knievel oben auf der Rampe. Im Einkaufszentrum wollte er sich nach etwas umsehen, das er zum Vorstellungsgespräch anziehen konnte, etwas, das ihn mindestens auf 4,2 herabstufen würde. Er zog seine Kappe nach vorn, damit der Schild seine Augen verschattete. Dann ging er hinauf zur Canfield Road, wo er einen Bus nehmen würde. Der Kies knirschte unter seinen Turnschuhen. Es war schon eine Ewigkeit her, dass seine Schwarzheit auch nur annähernd 7,0 betragen hatte. »Ich will, dass dir nichts passiert. Du musst wissen, wie man sich bewegt«, hatte sein Vater zu ihm gesagt, als er noch klein war. Emmanuel hatte angefangen, die Grundlagen seiner Schwarzheit zu lernen, noch bevor er schriftlich dividieren konnte: zu lächeln, wenn er wütend war, zu flüstern, wenn er am liebsten geschrien hätte. Damals in der Middleschool, nach einem Ausflug in den Zoo, wo man ihn beschuldigt hatte, einen Stoffpanda aus dem Souvenirladen gestohlen zu haben, hatte er zu Hause in der Einfahrt seine letzte Baggy Jeans verbrannt. Mit starrem Blick hatte er dabei zugesehen, wie sich der Jeansstoff vor seinen Augen kräuselte und zu Asche zerfiel. Als sein Vater nach draußen kam, dachte Emmanuel, er würde ihm eine Standpauke halten. Doch er hatte bloß still neben ihm gestanden. »Das ist eine wichtige Lektion«, hatte sein Vater gesagt. Gemeinsam hatten sie ins Feuer geschaut, bis es sich aufgezehrt hatte.
An der Bushaltestelle war viel Betrieb. Emmanuel spürte, wie sich die Blicke auf ihn richteten und die Handtaschen von ihm wegbewegten. Er dachte an George Wilson Dunn. Stellte sich vor, wie der Mann lächelnd vor ihm stand, die Kettensäge fauchend in seinen Händen. Emmanuel beschloss, etwas Gefährliches auszuprobieren: Er drehte die Kappe nach hinten, sodass der Schatten des Schilds seinen Nacken bedeckte. Er spürte, wie seine Schwarzheit fiebrig auf 8,0 sprang. Die Leute verstummten. Sie bemühten sich, superfreundlich, doch zugleich distanziert zu schauen, als wäre Emmanuel ein Tiger oder ein Elefant, dem sie in einem Zirkuszelt zusahen. In der Menge tat sich ein Weg für ihn auf.
Im nächsten Moment stand er neben der Sitzbank. Einer jungen Frau mit langem braunem Haar und einem Mann mit Sonnenbrille auf dem Mützenschild fiel plötzlich ein, dass sie woanders hinmussten. Eine ältere Frau blieb sitzen, und Emmanuel setzte sich neben sie auf den gerade frei gewordenen Platz. Die Frau sah ihn an. Sie zeigte ein schwaches Lächeln. Ihr Blick, der allgemeines Desinteresse verriet, brachte sein Herz zum Singen. Er drehte seine Kappe wieder nach vorn und spürte, wie seine Schwarzheit auf noch immer beträchtliche 7,6 sank. Kurz darauf kehrte die Braunhaarige zurück und setzte sich neben ihn. Sie lächelte, als hätte man ihr gesagt, wenn sie dieses verzweifelte, großäugige Lächeln beendete, würde Emmanuel ihr das Hirn wegpusten.
»Tatsache ist, dass George Wilson Dunn Amerikaner ist. Amerikaner haben das Recht, sich zu schützen«, sagt der Verteidiger mit tönender, betörender Stimme. »Haben Sie Kinder? Jemanden, den Sie lieben? Die Anklage hat versucht, Ihnen schaurige Worte wie ›Gesetz‹, ›Mord‹ und ›Soziopath‹ um die Ohren zu hauen.« Zeige- und Mittelfinger des Verteidigers krallen sich wiederholt in die Luft, um anzuzeigen, dass er zitiert. »Ich stehe hier, um Ihnen zu sagen, dass es bei diesem Prozess um nichts davon geht. Es geht vielmehr um das Recht eines amerikanischen Bürgers, zu lieben und sein eigenes Leben und das seiner hübschen kleinen Tochter und seines gut aussehenden jungen Sohnes zu schützen. Also frage ich Sie, was bedeutet Ihnen mehr: das vermeintliche ›Gesetz‹ oder Ihre Kinder?«
»Einspruch«, sagt die Staatsanwältin.
»Einspruch abgelehnt«, erwidert die Richterin und betupft ihre feuchten Augenwinkel. »Bitte fahren Sie fort, Herr Anwalt.«
»Danke, Euer Ehren. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich liebe meine Kinder mehr als das ›Gesetz‹. Und Amerika liebe ich mehr als meine Kinder. Darum geht es bei diesem Prozess: Liebe, mit einem großen L. Und Amerika. Das ist, was ich heute hier verteidige. Mein Mandant Mister George Dunn glaubte, in Gefahr zu sein. Und wissen Sie was, wenn Sie etwas glauben, irgendwas, dann ist das alles, was zählt. Glauben. In Amerika haben wir die Freiheit zu glauben. Amerika, unser herrlicher souveräner Staat. Zerstören Sie das hier nicht.«
Der Bus hielt. Emmanuel sah eine Gestalt zur Haltestelle rennen. Es war Boogie, einer seiner besten Freunde aus Grundschulzeiten. Als sie Mrs. Fold hatten, in der vierten Klasse, hatte Emmanuel bei den Geschichtsprüfungen immer zu Boogies Arbeiten hinübergelinst und bei Matheprüfungen seine eigenen Papiere so hingelegt, dass Boogie seine Antworten sehen konnte. Seit er Boogie kannte, hatte der nie was anderes getragen als übergroße T-Shirts und ausgebeulte Jogginghosen. Als sie zur Highschool gingen, hatte Emmanuel im Gegensatz zu Boogie gelernt, seine Schwarzheit zu zügeln. Emmanuel war Boogie gegenüber, der für seine Streitereien mit Mitschülern oder Lehrern bekannt war, unauffällig auf Abstand gegangen. Inzwischen hatte er ihn fast vergessen, aber wenn er an Boogie dachte, dann voller Mitleid für ihn und seine stagnierende Persönlichkeit. Boogie war immer nur er selbst. Doch heute trug er eine schwarze Hose, glänzende schwarze Schuhe, ein weißes Hemd mit Knöpfen und eine schmale rote Krawatte. Seine Kleidung drückte in Verbindung mit seiner sandbraunen Haut seine Schwarzheit auf 2,9 herunter.
»Manny!«, rief Boogie, als der Bus zum Stillstand kam.
»Was geht, Bro«, erwiderte Emmanuel. Früher hatte er seine Schwarzheit in Gegenwart von Boogie immer hochgefahren. Heute war das nicht nötig. Die Leute schoben sich an ihnen vorbei in den Bus. Emmanuel und Boogie klatschten sich ab und hielten sich umklammert, sodass sie, die Hände zwischen sich, mit den Brustkörben aneinanderstießen, und ihre Finger klappten beim Zurückziehen der Hände an die Handflächen.
»Was läuft so bei dir?«, fragte Emmanuel. »Was gibt’s Neues?«
»Jede Menge, Mann. Jede Menge. Ich bin endlich aufgewacht.«
Emmanuel stieg in den Bus, zahlte seine 2,50 Dollar und setzte sich weit nach hinten. Boogie ließ sich auf dem freien Platz neben ihm nieder.
»Tatsache?«
»Ja, Mann. Ich war in letzter Zeit echt beschäftigt. Ich will ganz viele von uns zusammentrommeln, Mann. Wir müssen uns zusammenschließen.«
»Echt«, erwiderte Emmanuel geistesabwesend.
»Das meine ich ernst, Bro. Wir müssen zusammenrücken. Das muss jetzt laufen. Du hast’s ja gesehen. Jetzt weißt du, dass sie sich einen Scheißdreck um uns scheren. Das haben sie doch gezeigt.« Emmanuel nickte. »Wir müssen uns alle zusammenschließen. Wir müssen verdammt noch mal aufwachen. Ich hab genamed. Ich stelle ein Team auf. Bist du dabei, oder was?«
Emmanuel blickte sich um, um zu sehen, ob irgendjemand sie gehört hatte. Anscheinend nicht, dennoch bereute er seine Nähe zu Boogie. »Du machst doch nicht echt dieses Naming?« Er sah, wie das Lächeln aus Boogies Gesicht verschwand, und achtete darauf, dass sein eigenes Gesicht ausdruckslos blieb.
»Na klar.« Boogie knöpfte die linke Manschette seines Hemds auf und zog den Ärmel hoch. Auf der Innenseite seines Unterarms prangten drei verschiedene Zeichen. Jedes von ihnen stellte deutlich erkennbar eine 5 dar, in die Haut geritzt und geschnitten. Nachdem klar war, dass Emmanuel sie gesehen hatte, ließ Boogie seinen Ärmel wieder hinuntergleiten, knöpfte die Manschette aber nicht wieder zu. Leiser sprach er weiter. »Weißt du, was mein Onkel neulich zu mir gesagt hat?«
Emmanuel wartete ab.
»Er hat gesagt, wenn du im Bus sitzt und der müde Mann neben dir lehnt sich irgendwie rüber und benutzt deine Schulter wie’n Kissen, dann sagen alle, du sollst ihn wecken. Sie wollen dir einreden, dass der Mann aufwachen und sich ’nen anderen Schlafplatz suchen muss, weil du keine verdammte Matratze bist.«
Emmanuel brummte, um zu zeigen, dass er Boogies Worten folgte.
»Aber wenn er allein dasitzt und schläft und dich nicht stört, ist es angeblich was anderes. Und wenn sich jemand an den Schlafenden ranmacht, der ihn abzocken will, weil er schläft, weil er hundemüde ist, dann wollen dir alle einreden, dass du denken sollst: ›Ist doch nicht mein Problem, das hat doch nichts mit mir zu tun‹, während man ihm die Taschen durchwühlt oder noch was Schlimmeres anstellt. Dieser Mann, der da im Bus sitzt und schläft, der ist dein Bruder. Das hat mein Onkel gesagt. Du musst ihn beschützen. Ja, vielleicht musst du ihn wecken, aber während er schläft, bist du für ihn verantwortlich. Dein Bruder, auch wenn du ihm noch nie im Leben begegnet bist, ist deine Angelegenheit. Kapiert?«
Emmanuel brummte wieder bestätigend.
Zwei Tage nach dem Gerichtsurteil war der erste Bericht aufgetaucht. Einem älteren weißen Paar, beide in den Sechzigern, war von einer mit Ziegelsteinen und rostigen Metallrohren bewaffneten Gruppe der Schädel eingeschlagen worden. Zeugen sagten aus, die Mörder seien sehr schick gekleidet gewesen: Fliegen und Sommerhüte, Manschettenknöpfe und High Heels. Während des Doppelmords habe die Gruppe/Bande immer wieder im Chor gerufen: »Mboya! Mboya! Tyler Kenneth Mboya«, den Namen des ältesten Jungen, der vor der Finkelstein-Bücherei umgebracht worden war. Am nächsten Tag wurde eine ähnliche Geschichte bekannt. Drei weiße Schülerinnen waren mit Eispickeln umgebracht worden. Ein Schwarzer und eine Schwarze hatten Löcher in die Schädel der Mädchen geschlagen, als wollten sie dort nach Diamanten graben. Berichten zufolge riefen sie während des Mordes immer wieder: »Akua Harris, Akua Harris, Akua Harris.« Wieder wurden die Täter als »unter den gegebenen Umständen recht elegant« beschrieben. In beiden Fällen waren die Mörder unmittelbar nach der Tat verhaftet worden. Das Paar, das die Schülerinnen umbrachte, hatte sich direkt vor dem Überfall die Zahl 5 in die Haut geritzt.
Den ersten beiden Fällen folgten weitere Prügelattacken und Morde. Jedes Mal brüllten die Täter den Namen eines der Finkelstein Five. In den Nachrichten wurden die Namers zu den Terroristen der Stunde. Die meisten Täter wurden von Polizisten getötet, bevor man sie zum Verhör aufs Revier bringen konnte. Die Verhafteten sagten nichts außer dem Namen des Kindes, den sie als Mantra für ihre Gewalttat benutzt hatten. Keiner schien sich verteidigen zu wollen.
Die bei Weitem berühmteste Namerin war Mary »Mistress« Redding. Es hieß, Mistress Redding habe bei ihrer Verhaftung an der linken Hand einen blutbefleckten weißen Seidenhandschuh getragen, dazu einst blitzend weiße Schuhe mit zehn Zentimeter hohen Absätzen und ein A-Linien-Kleid von so heftigem Rostrot, dass die Polizisten kaum glauben konnten, dass es ursprünglich makellos weiß gewesen war. Stundenlang antwortete Redding mit einem einzigen Namen auf alle Fragen. »Warum haben Sie es getan?« – »J. D. Heroy.« – »Er war noch ein Kind! Wie konnten Sie bloß?« – »J. D. Heroy.« – »Mit wem arbeiten Sie zusammen? Wer ist Ihr Anführer?« – »J. D. Heroy.« – »Bereuen Sie Ihre Tat?« – »J. D. Heroy.« – »Was bezwecken Sie mit dem Ganzen?« – »J. D. Heroy.« Redding war zusammen mit einer Gruppe verhaftet worden, die einen Jugendlichen ermordet hatte, in ihren Rücken war ein Streifen von zehn 5en geritzt, der bis zu ihrem linken Schenkel hinunterreichte, darunter eine, die bei ihrer Verhaftung noch frisch war und blutete. Berichten zufolge war ihr nach einem mehrstündigen Verhör nur ein einziger Satz entschlüpft. »Hätte ich noch Worte in mir, säße ich nicht hier.«
Emmanuel erinnerte sich, wie in den Nachrichten von dem blutigen Phänomen berichtet worden war: »Heute Abend«, sagte eine Sprecherin, »wurde ein weiteres unschuldiges Kind erbarmungslos von einer Bande Schläger verprügelt, die erneut alle der afrikanischen Diaspora anzugehören scheinen. Was meinen Sie dazu, Holly?«
»Na ja, in den Straßen sagen viele Leute, und ich zitiere: ›Ich hab Ihnen gesagt, dass die sich nicht zu benehmen wissen! Wir haben es Ihnen gesagt.‹ Darüber hinaus kann ich bloß bekräftigen, dass diese Gewalt schrecklich ist.« Die Co-Moderatorin schüttelte angewidert den Kopf.
Der Name jedes einzelnen der Finkelstein Five war zu einem Fluch geworden. Wenn niemand in der Nähe war, sagte Emmanuel sie gern vor sich hin: Tyler Mboya, Fela St. John, Akua Harris, Marcus Harris, J. D. Heroy.
»Das ist erst der Anfang«, erklärte Boogie. Er zog ein kleines Teppichmesser hervor. Emmanuel hätte fast aufgeschrien, aber Boogie sagte: »Keine Sorge, ich benutze es nicht. Nicht hier. Ich zieh’s nicht bis zum Ende durch – noch nicht.« Emmanuel sah, wie Boogie zum zweiten Mal seinen Ärmel aufrollte und, in geübter Präzision, mit fünf schnellen Schnitten eine kleine 5 in seinen linken Arm ritzte. Die Haut riss zu einem roten Rinnsal auf, das sich sammelte und dann an seinem Arm hinabfloss.
Boogie griff über Emmanuel hinweg und zog an der gelben Schnur. Es machte bing, und die Haltewunsch-Anzeige leuchtete auf. Vor dem Market Plaza drosselte der Bus das Tempo.
»Ich ruf dich nachher an, Manny. Wir brauchen dich.«
»Alles klar. Ich hab noch dieselbe Nummer«, sagte Emmanuel, als der Bus hielt.
Boogie ging zur hinteren Tür. Er drehte sich um, lächelte Emmanuel an und brüllte dann so laut er konnte: »J. D. Heroy!« Der Name hallte noch von den Fenstern zurück, als Boogie einer Weißen die Faust ans Kinn rammte. Sie gab keinen Laut von sich und sackte auf ihrem Platz zusammen. Er holte wieder aus und boxte der Frau ein zweites Mal ins Gesicht. Dann ein drittes Mal. Es klang, als würde ein Nagel in weiches Holz geschlagen.
»Hilfe!«, schrie jemand, der in der Nähe der Frau saß. »Verpiss dich, Arschloch«, brüllte jemand anders, als Boogie zur hinteren Tür hinaussprang und davonrannte. Niemand folgte ihm. Emmanuel zog sein Handy aus der Tasche und wählte die Notrufnummer. Während er anrief, trat er auf die Menge zu, die sich rings um die Frau gebildet hatte. Ihre Nase war gebrochen und blutete. Das Blut floss stetig und war voller Bläschen. Wieder spürte Emmanuel ein Ticken und Knirschen in der Brust. Er biss auf die Zähne und schloss die Augen. Er stellte sich die Farbe Himmelblau vor.
»Hallo. Ich sitze im Bus, hier wurde eine Frau verletzt. … Ja, wir sind in der Myrtle Avenue, direkt am Market Plaza. … Ja, sie ist ziemlich schwer verletzt.« Er spürte, wie ihm Angst entgegenschlug. Er hatte neben Boogie gesessen und war bei 7,6 gewesen. Der Bus stand am Straßenrand, und eine kleine Gruppe von Fahrgästen bildete einen Wall um die Frau. Die anderen Fahrgäste warfen Emmanuel finstere Blicke zu. Er stellte sich vor, wie die Polizisten durch die Bustüren stürmen und die vielen Finger schlagartig in seine Richtung zeigen würden. Er stellte sich die Kugel vor, die nicht mal eine Sekunde brauchen würde, um in sein Gehirn zu dringen. Er hatte noch nie was gestohlen; er stand nicht mal besonders auf Pandas. Er stieg aus, ignorierte das Gemurmel und bemühte sich, die Frau mit dem lädierten Gesicht nicht anzusehen. Er ging ein paar Straßen weiter zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle.
Im Einkaufszentrum war es wie immer. Eltern liefen von Laden zu Laden; ihre Kinder mühten sich ab, um mit ihnen Schritt zu halten. Drei Sicherheitsleute verfolgten Emmanuel von dem Augenblick an, in dem er das Einkaufszentrum betrat. Immer wenn er langsamer ging oder stehen blieb, verfielen die Wachleute in ein Gespräch oder taten so, als lauschten sie an ihren Walkie-Talkies wichtigen Informationen. Normalerweise trug Emmanuel, wenn er dort einkaufen ging, Blue Jeans, die nicht zu ausgebeult oder eng waren, und ein schönes Hemd mit Kragen. Er lächelte dann übers ganze Gesicht und schlenderte umher, wobei er die Ware in einem Laden, egal was es war, höchstens zwölf Sekunden betrachtete. Emmanuels übliche Schwarzheit im Einkaufszentrum betrug glatte 5,0. Gewöhnlich folgte ihm nur ein einziger Wachmann.
Er betrat einen Laden, der Rodger’s hieß. Dort wählte er ein eierschalenblaues Hemd mit Knopfleiste aus und gab es der Kassiererin. Sie nahm seine Karte und zog sie durch den Scanner. Dann faltete sie sein Hemd zusammen und steckte es in eine Plastiktüte.
»Ich brauche eine Quittung«, sagte Emmanuel und bedankte sich, als sie ihm den dünnen weißen Zettel reichte. Er ließ ihn in die Tüte mit seinem Hemd gleiten. Als er sich dem Eingang/Ausgang des Ladens näherte, spürte er, wie ihn jemand am Handgelenk zog. Er drehte sich um und sah einen hochgewachsenen Mann, an dessen Hemd ein Namensschild befestigt war.
»Haben Sie das Hemd gekauft, Sir?« Die Stimme des Mannes klang scharf und herablassend, wie die eines grausamen Lehrers oder eines Schurken aus einer Kindersendung. Sofort spürte Emmanuel, wie die Gewohnheit ihm auftrug, betont freundlich zu sein, zu lächeln und nicht zu brüllen. Doch er schob die Gewohnheit beiseite und riss sich los.
»Ja, so ist es«, sagte Emmanuel, seine Stimme so laut, dass sich die anderen Kunden umdrehten und ihn anstarrten.
»Haben Sie eine Quittung für das gekaufte Hemd?«
»Ja, hab ich.«
»Kann ich die Quittung für das gekaufte Hemd bitte mal sehen?«
»Na ja, ich kann sie Ihnen schon zeigen«, begann Emmanuel. »Oder vielleicht fragen Sie die Kassiererin, die mich gerade gebongt hat.« Er stieß den Finger in Richtung Kasse. Spürte, wie seine Schwarzheit auf 8,1 stieg. Er war wütend, leidenschaftlich und frei. Als die Kassiererin aufblickte und sah, was los war, hob sie die Hand und wedelte mit den Fingern.
»Hmm, haben Sie nun eine Quittung oder nicht?«
Emmanuel starrte den Mann an. Dann gab er ihm die Quittung. Dieses Gespräch hatte er schon oft geführt. Nicht mehr ganz so oft, seit er gelernt hatte, seinen Wert auf unter 6,0 herunterzuschrauben.
»Man kann nicht vorsichtig genug sein«, sagte der Mann und gab ihm die Quittung zurück. Emmanuel wartete nicht auf eine Entschuldigung. Er drehte sich um, verließ den Laden und spürte, wie er in den Augen der Einkaufenden ringsum wieder auf 7,6 sank.
Als Emmanuel zur Bushaltestelle zurückging, folgten ihm zwei andere Sicherheitsleute, aber in solchem Abstand, dass es aussah, als gingen sie bloß in dieselbe Richtung wie er. Emmanuel blieb stehen, um sich den Schuh zu binden, und einer der Wachleute sprang hinter eine dekorative Topfpflanze, während der andere pfeifend in die Luft starrte. Sie folgten ihm zur Bushaltestelle am Südausgang, doch als er sich unter den Dachvorsprung setzte, kehrten sie ins Einkaufszentrum zurück.
Emmanuel fand einen Fensterplatz. Niemand saß neben ihm. Als der Bus losfuhr, klingelte sein Handy. Er sah, dass es dieselbe Nummer war wie bei dem Anruf am Morgen. Er drückte den grünen Knopf auf dem Display und fuhr seine Stimme unverzüglich auf 1,5 herunter.
»Hallo. Sie sprechen mit Emmanuel.«
»Hallo, ich hab heute früh wegen eines Vorstellungsgesprächs angerufen, das wir mit Ihnen führen wollten.« Die Stimme des Mannes klang voll und rau.
»Ja, ich freue mich darauf. Morgen um elf, richtig?«
»Na ja, es verhält sich folgendermaßen und … ich sag’s nur ungern, aber ich dachte, ich könnte Ihnen Zeit ersparen. Sie heißen Emmanuel Gyan, stimmt’s?«
»Ja, genau.«
»Also, Emmanuel, es ist so, und Mist, ich hab das Ganze nicht voll durchdacht, aber die Stelle ist wohl schon vergeben.«
»Wie bitte?«
»Also, die Sache ist die, wir haben hier schon diesen Jamaal, und dann ist da auch noch Ty, der ist Halbägypter. Ich finde, das wäre des Guten zu viel. Wir sind keine urbane Marke. Verstehen Sie, was ich meine? Und da dachte ich, es ist …«
Emmanuel brach den Anruf ab und holte tief Luft. Wieder klingelte das Handy. Er starrte aufs Display; es war eine Nachricht von Boogie: »22:45 im Park«.
»Mister Dunn.« Der Verteidiger stolziert zum Angeklagten. »Was haben Sie an dem fraglichen Abend getan, bevor Sie den fünf Leuten begegneten, die Ihrer Aussage zufolge auf Sie losgegangen sind?«
»Also.« George Wilson Dunn sieht seinen Verteidiger und dann die Geschworenen an. »Ich war mit meinen Kindern in der Bücherei. Mit beiden. Tiffany und Rodman. Ich bin alleinerziehender Vater.«
»Ein alleinerziehender Vater mit seinen Kindern in der Bücherei. Und was ist passiert, bevor Sie nach draußen gingen?« Der Verteidiger blickt interessiert, als wäre ihm all das neu.
»Also, Vater sein ist das Wichtigste auf der Welt für mich. Und wenn man der Vater zweier Kinder wie Tiffany und Rodman ist, weiß man nie, was einem bevorsteht. Als wir an dem Abend bei den DVDs nach irgendwas gesucht haben, das wir uns am Wochenende ansehen könnten, sagt Tiffany plötzlich, sie geht nicht mehr zur Schule, weil sie fett und hässlich ist, und auf einmal hab ich diesen Ärger am Hals. Und sie ist die Ältere, sie macht mir sonst nicht so viele Probleme. Aber so ist das mit Kindern. Es kommt wie aus dem Nichts. Sie hat vorher nie irgendwas in diese Richtung gesagt, und plötzlich muss man etwas zurechtrücken, weil sie sonst eine Pennerin oder Crackhure wird.«
»Das ist irrelevant, Euer Ehren«, sagt die Staatsanwältin von ihrem Stuhl aus.
»Einspruch stattgegeben, fahren Sie mit Ihrer Geschichte fort, Mister Dunn.«
»Das ist die Geschichte«, sagt Dunn. »Also muss ich mir aus heiterem Himmel was einfallen lassen, das ich meiner einzigartigen Tochter sagen kann, um sie wieder auf Kurs zu bringen. Und die ganze Zeit ist mein einzigartiger Sohn mucksmäuschenstill und sagt nicht ein Wort, das macht mir fast noch mehr Sorgen als alles andere. Ich liebe den Jungen, aber er ist verrückt. Und als wir die Bücherei verlassen wollen, sag ich zu Tiffany, dass sie schön ist und Daddy sie liebt, dass sich das nie ändern wird. Und wissen Sie, was sie da sagt? Sie sagt: ›Okay‹, als wäre alles wieder in Ordnung. Als wollte sie bloß hören, dass ich das sage. Und ich kann aufatmen. Plötzlich stößt mein anderes Kind, Rodman, einen Wagen um, der in ein Regal kracht, sodass um die hundert DVDs auf den Boden poltern. Aber so ist das mit Kindern, wissen Sie. Das jedenfalls ist passiert, bevor ich nach draußen ging.«
»In Ordnung, und als Sie draußen waren?«, fragt der Verteidiger mit warmem Lächeln.
»Als ich rauskam, wurde ich angegriffen. Und ich hab mich und meine beiden Kinder geschützt.«
»Und war Ihr Handeln an dem fraglichen Abend von der Liebe zu Ihren Kindern und Ihrem gottgegebenen Recht motiviert, sich und diese Kinder zu schützen?«
»So ist es.«
»Keine weiteren Fragen, Mister Dunn.«
Emmanuel begrüßte seine Eltern mit einem Lächeln, als sie nach Hause kamen. Die ganze Familie aß zusammen, doch Emmanuel sprach kaum ein Wort. Hinterher sagte sein Vater, er sei stolz auf ihn, egal wie das Vorstellungsgespräch laufen werde, doch er solle eine Krawatte tragen und sich bemühen, langsam zu sprechen. »Du machst das schon«, sagte er.
Als seine Eltern schliefen, schlüpfte Emmanuel unter die Dusche. Anschließend kämmte er sein Haar und zog dann frische Unterwäsche und Socken an. Eine gebügelte hellbraune Hose. Er schlang einen braunen Ledergürtel um seine Taille. Dann zog er das eierschalenblaue Hemd an. Er band die Schnürsenkel seiner guten Schuhe.
Emmanuel schlich sich aus seinem Zimmer und aus dem Haus. Er schloss die Seitentür so leise wie möglich und war in der Garage. An einer Wand, von der die Farbe abblätterte, lehnte ein Baseballschläger aus Aluminium. Er starrte ihn an. Seit er aus dem Bus gestiegen war, hatte die reibende, knackende Wärme nicht aufgehört, in seiner Brust zu wirbeln. Er hatte das Gefühl, als könnte der Schläger alles heilen, wenn er ihn sich einfach schnappen und in den Park mitnehmen würde. Er ging darauf zu, überlegte es sich dann aber anders, verließ sein Zuhause mit leeren Händen und begab sich zum Marshall Park.
»Mister Dunn, bitte erzählen Sie vom Abend des 13. Juli.«
George Dunn sitzt verschwitzt und reumütig im Zeugenstand. Reumütig auf eine Es-tut-mir-wirklich-leid-dass-mein-rechtmäßiges-Handeln-diesen-ganzen-verdammten-Rummel-ausgelöst-hat-Art.
»Also, ich war bei meinen beiden Kindern – Tiffany und Rodman –, als ich vor der Bücherei eine Bande lachen und Gott weiß was machen sah.«
»Fühlten Sie sich bedroht, Mister Dunn?«
»Na ja, zuerst nicht, aber dann fiel mir auf, dass alle fünf schwarze Sachen trugen, als wollten sie einen Raubüberfall begehen.«
»Wollen Sie damit sagen, dass es die Kleidung dieser jungen Leute war, die für Sie und Ihre Familie eine Bedrohung bedeutete?« Auf diesen Augenblick hat die Staatsanwältin seit Wochen gewartet.
»Nein, nein. Natürlich nicht. Es lag daran, dass einer, der Größte von ihnen, mir irgendwas zugebrüllt hat. Ich hatte Angst um meine Kinder – Tiffany und Rodman. Das war alles, was ich denken konnte: Tiffany, Rodman. Ich musste sie schützen.« Mehrere Geschworene nicken nachdenklich.
»Und was hat Mister Heroy Ihnen zugebrüllt?«
»Ich glaube, er wollte mein Geld haben – oder meinen Wagen. Er hat ›Gib mir‹ gesagt und dann noch irgendwas anderes.«
»Und wann hatten Sie das Gefühl, dass Ihr Leben bedroht war?«
»Ich hatte nicht vor zu warten, bis mein Leben an mir vorüberzieht. Oder das von Tiffany oder Rodman. Ich musste handeln. Ich hab’s für meine Kinder getan.«
»Und was haben Sie getan?«
»Ich hab meine Säge geholt.« Dunns Augen leuchten. »Ich hab getan, was ich tun musste. Und wissen Sie was … ich hab es genossen, meine Kinder zu beschützen.«
Die Geschworenen starren ihn aufmerksam an, geradezu atemlos. Fasziniert und aufgeregt.
Der Abend war kühl. Unter einem unspektakulären Himmel spürte Emmanuel die Geschichte der Finkelstein Five an seinen Fingern, in seiner Brust und in jedem seiner Atemzüge. Er stellte sich vor, wie George Wilson Dunn als freier Mann die Stufen des Gerichtssaals hinabstieg und die Kameras blitzten. Emmanuel drehte sich um und kehrte in die Garage zurück, wo der Schläger auf ihn wartete. Er stammte aus seiner Little-League-Zeit. Emmanuel hatte Second Baseman gespielt. Damals war der Schläger für ihn zu groß gewesen, zu schwer. Jetzt war er gerade richtig. Er nahm ihn und ging in den Park. Ich bin inzwischen wach; irgendwas in der Richtung hatte Boogie im Bus gesagt.
»Du siehst aus wie der junge Hank Aaron, Bro«, sagte Boogie, als sich Emmanuel näherte. Neben Boogie standen ein Biologielehrer von der Middleschool, den Emmanuel als Mr. Coder in Erinnerung hatte, sowie ein Mädchen namens Tisha, die Boogies Freundin war, und ein kleiner Mann mit Brille. Mr. Coder und der Bebrillte trugen jeweils Dreiteiler, marineblau und rabenschwarz. Ihre Augen wirkten kalt und leblos. Tisha trug ein fließendes gelbes Kleid und einen festlichen Hut mit einer Art Schleier, der vorn herabhing. Ihre linke Hand steckte in einem eleganten weißen Handschuh. Boogie trug dasselbe weiße Hemd und dieselbe schmale rote Krawatte wie am Morgen. Bande. Das war das Wort, das sie verwenden würden.
»Mein Bro Manny hatte die richtige Idee«, sagte Boogie, nachdem sie kurz ihre Namen ausgetauscht hatten. »Heute ziehen wir es bis zum Ende durch. Du weißt hoffentlich, wie man mit dem Ding zuschlägt.« Boogie ging in Schlaghaltung und schwang einen imaginären Schläger vor und zurück wie Ken Griffey Jr. Dann bog er sich einem unsichtbaren Fastball entgegen, den er auf die billigen Plätze hämmerte. Emmanuels Körper spannte sich an. Boogie lachte und lief eine winzige Runde. »Bis zum Ende«, sagte er, während er die Bases umkurvte.
»Sie haben sich also Ihre Kettensäge geschnappt. Was ist als Nächstes passiert?«
»Der Große, er war so groß, er muss Basketballspieler oder so was gewesen sein, der sagt, eine Heckenschere macht ihm keine Angst, und geht auf mich los.«
»Der unbewaffnete J. D. Heroy ging also auf Sie los, obwohl Sie eine Kettensäge in der Hand hatten – völlig grundlos.«
»Genau.«
»Was ist als Nächstes passiert?«
»Wrumm, ich zog meine kleinen Kinder, Tiffany und Rodman, hinter mich, um sie, wrumm, wrumm, zu beschützen.«
»Was genau heißt das?«
»Dass ich meine Säge aufheulen ließ und mich ans Schneiden machte.«
»Sie machten sich ans Schneiden? Bitte, Mister Dunn. Bitte, drücken Sie sich genauer aus.«
»Wrumm. Ich hab diesem Basketballspieler, wrumm, sauber den Kopf abgetrennt.«
»Und dann?«
»Dann haben sich noch drei auf mich gestürzt. Sie wollten über mich herfallen.«
»Und als diese Kinder auf Sie zugerannt sind, was haben Sie da gemacht? Haben Sie daran gedacht zu flüchten? In Ihren Pick-up zu steigen und wegzufahren?«
»Also, ich hab nachgesehen, ob Tiffany und Rodman unversehrt sind, und hab dann dafür gesorgt, dass es so bleibt. Ich war so besorgt um meine Kinder, dass ich an Flucht nicht gedacht hab.«
»Und wie haben Sie ›dafür gesorgt‹, Mister Dunn?«
»Ich hab mich ans Schneiden gemacht.« George Dunn stellt pantomimisch dar, wie er mehrmals die Anlasserschnur einer Kettensäge zieht.
»Sie haben fünf Kinder verstümmelt.«
»Ich hab bloß meine Kinder geschützt.«
Emmanuel war überrascht zu sehen, dass er als Einziger der Gruppe eine Waffe dabeihatte. Er verspürte einen seltsamen Stolz.
»Und wo knöpfen wir sie uns vor?«, fragte Mr. Coder.
»Genau hier. Wir warten in Tishas Wagen auf ein Paar, das herkommt, um es im Auto zu treiben. Das ist der richtige Ort dafür«, sagte Boogie. Er kniff Tisha in die Seite.
»Ich will wissen, wen wir namen«, sagte Tisha und schlug Boogies Hand spielerisch weg. »Das ist wichtig.« Sie legte einen ernsten Unterton in ihre Stimme.
»Und was ist mit Fela St. John?«, fragt die Staatsanwältin schließlich.
»Welche war das?«, will George Dunn wissen.
Die Staatsanwältin lächelt, und ihre Augen leuchten entschlossen. »Die Siebenjährige. Die Cousine von Akua und Marcus Harris. Was ist mit dem siebenjährigen Mädchen, das Sie mit einer Kettensäge enthauptet haben?«
»Für mich sah die viel älter als sieben aus«, antwortet Dunn.
»Natürlich. Für wie alt haben Sie sie gehalten, als Sie die Säge durch ihren Hals gezogen haben?«
»Vielleicht dreizehn oder sogar vierzehn.«
»Vielleicht dreizehn oder vierzehn. Und Sie sind auf Sie zumarschiert – Sie sind ihr nachgerannt und haben sie ermordet. Die Berichte zeigen, dass Sie sie als Letzte umgebracht haben und sie ein Stück weit weg von den anderen gefunden wurde. Mussten Sie sie verfolgen? Wie schnell ist sie gelaufen?«
»Sie ist nirgends hingerannt. Sie wollte mich überfallen, genau wie die anderen.«
»Die siebenjährige Fela St. John wollte Sie überfallen, einen erwachsenen Mann, der gerade mehrere ihrer Freunde und Verwandten ermordet hatte. Und irgendwie wurde ihre Leiche an einer ganz anderen Stelle entdeckt. Finden Sie, das ergibt einen Sinn? Klingt das für Sie nach einer Siebenjährigen?«
»Sie sah wie mindestens dreizehn aus.«
»Klingt das für Sie nach einer Dreizehnjährigen, Mister Dunn?«
»Heutzutage weiß man nie«, sagt Dunn.
»Fela«, sagte Emmanuel. »Fela St. John.« Er sah die Nachrichtenbilder vor sich, auf denen sie ihre Sonntagskleidung trug: ein leuchtend gelbes Kleid und bunte Spangen im Haar. Dann die Fotos, die ins Internet gestellt worden waren: ihr kleiner Körper ganz voller Blut, ohne Kopf.
»Okay. Wir müssen jetzt einfach warten«, sagte Boogie. Er ging auf Tishas Wagen zu. Die Gruppe folgte ihm. »Wenn sie loslegen, rennen wir hin, schlagen das Fenster ein und zerren sie raus. Kein Firlefanz. Wir ziehen das richtig durch.«
Sie mussten nicht besonders lang warten. Die beiden schienen noch jung zu sein, Emmanuel sah sie nur kurz, als sie mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz bogen. Sie parkten, und schon bald wiegte sich ihre silberne Limousine. Das Einzige, was Emmanuel mit Sicherheit wusste, war, dass einer von beiden braunhaarig und der oder die andere blond war.