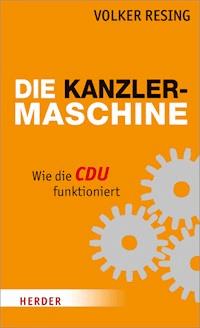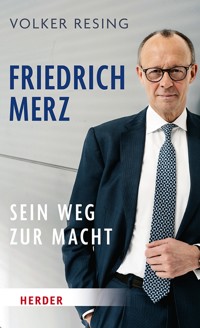
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Verlag HerderHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Friedrich Merz – Wie tickt unser neuer Bundeskanzler? Er polarisiert, er inspiriert, und er kämpft: Friedrich Merz hat den beispiellosen Sprung von der politischen Bühne ins Wirtschaftsleben und wieder zurück geschafft. Nun steht er an der Spitze Deutschlands – als Bundeskanzler führt er das Land mit konservativen Werten, wirtschaftlicher Kompetenz und dem Versprechen auf Erneuerung. Doch wer ist der Mann, der als Gegenentwurf zu Angela Merkel gilt und nun die politische Richtung unseres Landes bestimmt? Welche Vision verfolgt er? Und was bedeutet seine Kanzlerschaft für die Zukunft? Volker Resing, einer der besten journalistischen Kenner der CDU und ihres Führungspersonals, liefert in dieser aktuellen Biografie spannende Einblicke in Friedrich Merz' Werdegang: von seinen ersten politischen Schritten bis zu seinem ehrgeizigen Comeback. Mit exklusiven Einblicken, Insiderwissen und persönlichen Interviews – auch mit Merz selbst – zeichnet der Autor ein fundiertes und lebendiges Porträt dieses außergewöhnlichen Politikers. »Vorbei an Ressentiments und Klischees bahnt Volker Resing seinen Lesern den Weg zur Person Friedrich Merz. Speziell die Wirtschaftspolitik des CDU-Mannes wird hier lebendig und in angemessener Komplexität beschrieben.« Mariam Lau, DIE ZEIT »Reich an Kenntnis und Erkenntnis beschreibt Volker Resing die politische Vergangenheit von Friedrich Merz. Seine kluge Analyse macht klar: Der lange Weg des jetzigen CDU-Vorsitzenden war selten geebnet – so wie es die letzten Meter zum Kanzleramt auch nicht sind.« Wulf Schmiese, stv. Leiter ZDF Hauptstadtstudio »Präzises Porträt. Ein Must-Read.« Rasmus Buchsteiner, POLITICO
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Volker Resing
FRIEDRICH MERZ
Sein Weg zur Macht
Die Biografie
Impressum
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025Alle Rechte vorbehaltenwww.herder.de
Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagmotiv: © Andreas Pein / laif
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN (Print): 978-3-451-07241-3ISBN (EPUB): 978-3-451-83614-5
Inhalt
Einführung: »Gute Nacht, Friedrich!«
Die grüne Krawatte mit den Punkten sieht für heutige Augen schon etwas retro aus. Das blau gestreifte Hemd mit dem erdfarbenen Sakko soll uns den Politiker auf seinem Waldspaziergang als lockerer vorstellen und zumindest farblich passend gekleidet zu den grünen Tannen und sanften Höhenzügen im Hintergrund. Friedrich Merz hat 1994, als er nach dem Ausflug ins Europaparlament zum ersten Mal in den Bundestag wollte, einen kleinen Videofilm für seinen Wahlkampf in seiner Heimat aufgenommen. Der Clip versucht, mit den Vorurteilen über das Sauerland humorvoll umzugehen.
»In Bonn sagen sie, im Sauerland gebe es nur Jäger und Förster«, so steigt der Film ein. Dann ziehen eben solche in Waidmannskluft an dem Bundestagskandidaten vorbei. »Hallo Friedrich«, rufen sie ihm zu. Am Schluss des Filmchens bittet der damals 38-jährige Merz darum, bei der Bundestagswahl die CDU und ihn als Spitzenkandidaten zu wählen. Vor diesem Abspann aber gibt es noch die Schlusspointe. »In Bonn heißt es, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht.« Dann lugt im Video ein Fuchs hinter einem Baumstamm hervor und sagt: »Gute Nacht, Friedrich!« Er spricht mit der Stimme von Helmut Kohl.
Wer heute diesen Clip im Internet sucht, findet die ergänzte Version von 2021. Darin taucht am Schluss plötzlich der neue Merz auf, oder besser gesagt, der alte. Zum zurückliegenden Bundestagswahlkampf hat er den Film erneut aufgelegt und um seinen heutigen Aufruf erweitert. »Seit 1994 hat sich viel verändert«, erklärt uns nun der leicht ergraute und lächelnde Kandidat im blauem Hemd und ohne Krawatte. Er bittet um erneute Zustimmung zu seiner Person und der CDU. Das Schlussbild: Merz mit fünf Jägerinnen statt mit fünf Jägern wie 1994.
Ist das nun Selbstironie oder doch auch etwas peinlich? Es ist vor allem sehr offensiv, und damit vielleicht typisch Merz. Er weiß, er kann seine Vergangenheit nicht abstreifen. Bei Merz existiert so viel an Biografie, die Ballast und Antrieb zugleich sein kann. Tatsächlich gibt es Friedrich Merz nicht ohne diese Botschaft: Ein fast 70-Jähriger glaubt, mehr zur Zukunft beitragen zu können als alle jüngeren Bewerber. Allein darin liegt schon eine gewisse Provokation, eine Ansage. Dabei schwingt natürlich auch die Frage mit, ob er denn nicht schon 2002 der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre, oder 2005 – oder eben 2021. Denn Merz war schon immer auf jeweils eigene Weise mit dabei. Und am liebsten vorn.
Die erste Erwähnung von Friedrich Merz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung(FAZ) datiert auf den 29. Juli 1989. Da stand die Mauer noch, Helmut Kohl war Bundeskanzler und Steffi Graf und Boris Becker hatten gerade wieder Wimbledon gewonnen. Die chinesische Demokratiebewegung war im Juni brutal niedergeschlagen worden. Der sowjetische Machthaber Michail Gorbatschow hatte Bonn besucht und in Leipzig gab es nach den Friedensgebeten in der Nikolaikirche erste Festnahmen durch das DDR-Regime.
Am 18. Juni 1989 hatten die Wahlen zum Europäischen Parlament stattgefunden, doch offenbar waren sie angesichts der anderen Ereignisse nicht so wichtig, denn erst Ende Juli vermeldete die FAZ in einer Spalte auf Seite 5, welche Abgeordnete aus Deutschland in das dritte direkt gewählte Parlament in Straßburg einziehen würden.
Unter den 32 Parlamentariern, die die CDU entsenden konnte, war auch der junge, noch weitgehend unbekannte 33-jährige Jurist Friedrich Merz, der bereits als Amtsrichter in Saarbrücken und im vorpolitischen Raum in Bonn als Syndikus beim Verband der Chemischen Industrie gearbeitet hatte. In der Liste der Abgeordneten finden sich nur zwei weitere Namen, die später auch Bekanntheit erlangten. Keiner von ihnen ist mehr aktiv in der Politik.
Friedrich Merz hingegen will 36 Jahre später, im Jahr 2025, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. In dieser Zeitspanne fand nicht nur die Wiedervereinigung statt, sondern auch der Anschlag auf das World Trade Center und der Aufstieg Chinas zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht. Klimawandel, Digitalisierung und Globalisierung verändern die Welt. Zwischen seinem Einstieg in die Politik und der kommenden Bundestagswahl hat Merz in seiner eigenen aktiven Zeit neben Helmut Kohl mit Gerhard Schröder, Angela Merkel und Olaf Scholz vier Kanzler in unterschiedlichen Funktionen und in unterschiedlicher Nähe und Distanz erlebt.
Eine vergleichbar lange und zugleich unerwartbare politische Karriere, die am Ende mindestens bis zur Kanzlerkandidatur reicht, hat es zumindest in der Bundesrepublik so noch nicht gegeben. Sie gewinnt zudem ihr besonderes Charakteristikum dadurch, dass Merz – je nach Rechnung – rund zehn Jahre der Politik, der politischen Öffentlichkeit und politischen Mandaten weitgehend den Rücken zugekehrt hat. Unter anderem war er in dieser Zeit bei BlackRock, einem amerikanischen Unternehmen, das seinem Namen entsprechend bei manchem düstere Fantasien hervorruft.
Merz bezeichnet die Zeit als eine der schönsten Erfahrungen seiner beruflichen Laufbahn. In den zwölf Jahren als Wirtschaftsanwalt habe er ein Drittel seiner Zeit nicht in Deutschland verbracht und die Hälfte der Zeit nicht Deutsch gesprochen, erklärt er im Gespräch mit dem Autor dieses Buches. Das habe auch seinen Blick auf Deutschland verändert. Maximale Entfremdung also von der Berliner Blase. Seit 2018 versucht Friedrich Merz ein Comeback auf der bundespolitischen Bühne, ein Vorgang, der ebenfalls seinesgleichen sucht.
Wer ist dieser Friedrich Merz, der einerseits schon so lange in der Politik ist, dass er ins Geschichtsbuch passt, der andererseits aber erst seit rund sechs Jahren auf der politischen Bühne zurück ist, sodass er als Neuling noch Lernkurven drehen muss und Jüngeren wie ein Unbekannter aus einer fremden Welt erscheinen mag? Es gibt kaum einen Politiker, der seit so langer Zeit so unmittelbar Reaktionen und Emotionen auslösen kann, so viel Zustimmung und Ablehnung erfährt, der in vergleichbarer Weise zu einer Projektionsfläche geworden ist für bestimmte politische Inhalte und Ideen. Was ist der Mythos Merz und inwieweit entspricht die reale Person ihrem eigenen Klischee?
Zu den Zuschreibungen gehören grob zusammengefasst: die des Provinzlers aus dem Sauerland, die des spießigen Konservativen, der – was Frauen- und Familienbild angeht – hinterm Mond lebe, und vor allem – irgendwie entgegengesetzt – die des Globalisten und Wirtschaftsliberalen, der weltweit unterwegs ist, bei großen Unternehmen Millionen gemacht hat und für das Soziale und die normalen Menschen kein Gefühl habe. Friedrich Merz hat ein Buch mit dem Titel Mehr Kapitalismus wagen geschrieben, auf dem Cover posiert er wie ein Wirtschaftsboss. Der Pilot Merz, der mit seiner Privatmaschine zur Hochzeit von Christian Lindner nach Sylt fliegt, ist dafür ein anderes Abziehbildchen. Doch ist er wirklich die späte Rache der Kohl-Ära, die aus den 1980er-Jahren nun plötzlich in der Gegenwart auftaucht? Und wie viel Anti-Merkel steckt in Merz?
Wenn Friedrich Merz Kanzler werden sollte, durchkreuzt er die Generationenfolge. Helmut Kohl war Jahrgang 1930, er wurde abgelöst von Gerhard Schröder, Jahrgang 1944, gefolgt von Angela Merkel, Jahrgang 1954, dann Olaf Scholz, Jahrgang 1958. Und nun Friedrich Merz? Zurück zum Jahrgang 1955? Wir werden die Boomer nicht los, sie würden das Land weiter prägen, beklagt sich der taz-Journalist Matthias Kalle in einem Beitrag mit einer besonderen Kohortenanalyse. In der Boomer-Generation werden in etwa die besonders großen Jahrgänge 1955 bis 1969 zusammengefasst. Danach kommt die sogenannte Generation X, gefolgt von den Millennials.
Friedrich Merz sei, so schreibt Kalle, »ein Boomer, wie er im Buche steht«. Es seien diese omnipräsenten Boomer, immer mit einer Spur Arroganz der Macht am Leib, die der Generation X den Weg nach oben versperrten. Als politischen Vertreter der angeblich zu langweiligen, zu milden und braven Generation X macht Kalle CDU-Politiker Hendrik Wüst (Jahrgang 1975) aus, der zwar auch Kanzler werden wolle, es aber nicht laut genug sage, geschweige denn kämpfe. Friedrich Merz hingegen wäre schon seit 30 Jahren gern Kanzler – und das wissen auch alle. Und nun sei er schon Kanzlerkandidat, man müsse davon ausgehen, dass er Kanzler werde, wahrscheinlich sogar mindestens zwei Legislaturperioden lang.
Der Soziologe Heinz Bude hat das Buch Abschied von den Boomern geschrieben, dabei ist es in Wahrheit eine Anzeige von Präsenz. Bude ist Jahrgang 1954, natürlich selbst Boomer, wie Merz, Merkel, und Scholz. »Sie sind geschult, mit einer unklaren Situation umzugehen«, sagt er über seine Generation und gibt eine Art analytische Klammer für die drei, die eben genau das verbindet. Die jeweils unklare Situation hat sie ins Kanzleramt gebracht – und Merz bislang zumindest an die Schwelle. Merkel wäre ohne die tiefe CDU-Krise nach 16 Jahren Helmut Kohl und die Spendenaffäre nicht ins Amt gekommen, Olaf Scholz wäre nicht Kanzler geworden, wäre die Union in der Folge von 16 Jahren Angela Merkel nicht unsortiert gewesen. Und Merz? Auch er kann nur als Krisengewinnler ins Amt kommen, als Ordner einer zutiefst unklaren und wirtschaftlich dramatischen Situation; nach einer gescheiterten Ampelkoalition, die versucht hatte, »Fortschritt« als dubiose Bindekraft einer neuen Regierung zu formulieren, die über gravierende unterschiedliche politische Vorstellungen und Ideologeme hinweg zusammenfinden wollte.
Im Festsaal der Brauerei in der schmucken Kleinstadt Apolda herrschte das, was man gemeinhin nicht in Südthüringen, sondern in Bayern vermutet: Bierzeltstimmung. Das Volk hockte auf Bänken, eine Blaskapelle spielte auf. Und weil Aschermittwoch war, im Frühjahr 2024, servierten Kellnerinnen zum Gerstensaft schmackhaftes Matjesfilet mit Kartoffeln. Katholische Vorschrift und religiöser Brauch im ansonsten doch recht atheistisch geprägten Osten. Den politischen Aschermittwoch hatte sich die Freistaat-Union vom großen süddeutschen Vorbild abgeschaut, in einer Zeit, als Thüringen noch fest in CDU-Hand war. Lang ist es her.
Friedrich Merz trat auf die Bühne, nachdem die Kreisvorsitzenden und der Landesvorsitzende Mario Voigt gesprochen hatten. Im Herbst würden Landtagswahlen sein. Es war offenbar eine Steigerung der rhetorischen Kanonade vorgesehen, eine christdemokratische Stimmungseskalation schien sich anzubahnen. Doch was passierte, war etwas anderes. Nachdem Voigt gegen die Ampel argumentiert, gegen die Grünen gegiftet und gegen die Linken-Regierung unter Bodo Ramelow ausgeteilt, aber auch im AfD-Schreckgespenst Björn Höcke den Hauptfeind ausgemacht hatte, trat ein anderer Merz auf, als viele im Saal es erwartet hatten.
Im thüringischen Apolda hatte CDU-Chef Friedrich Merz drei zentrale Botschaften für sein Publikum: Die AfD ist des Teufels, zur Not muss man auch mit den Grünen regieren. Und schließlich: Die Zukunft wird hart. Alle werden mehr arbeiten müssen, es gebe weniger Geld zu verteilen, und für die Sicherheit Deutschlands brauche es enorme Investitionen. Das sind die unbequemen Formulierungen des eigentlich vom Volk so geliebten Klartext-Merz. Mancher im Saal hätte doch gern das Gegenteil gehört: Die Grünen sind des Teufels, die AfD ist nicht ganz so schlimm, und es wird schon alles gut, wenn die CDU regiert.
Stattdessen aber diese Merz’schen Zumutungen – nur garniert mit wenigen Schenkelklopfern. Es war eine Art Test für einen möglichen Merz-Wahlkampf. Die grundsätzliche Sympathie für seine Person trug ihn durch den Abend in Apolda. Nur bei seiner Milde mit den Grünen gab es Buhrufe. Er nehme das in Kauf, sagte Merz seinem Publikum. Aber mit ihm gebe es keine falschen Versprechungen, dabei bleibe er, auch wenn das die Stimmung drücke. Es war wirklich eine Fastenpredigt, die Merz da in Apolda am Aschermittwoch hielt. Mancher verschluckte sich fast beim Matjes. Es gibt immer wieder kleine und größere Veranstaltungen mit ihm, bei denen er eben nicht genau das serviert, was manche sich als Menü wünschen. Auch das ist Merz.
»Einen wie Friedrich Merz wählen die Deutschen bei schönem Wetter nicht zum Kanzler.« Das sagt ein enger Wegbegleiter des CDU-Vorsitzenden, der ihn lange und gut kennt. Merz’ wirtschaftlicher Erfolg löst Skepsis statt Bewunderung aus, typisch deutsch vielleicht. Seine geschliffene Rede und Schlagfertigkeit, im Prinzip bewundernswert, sorgen aber für Distanz und Abstand. Sein bürgerlich-korrektes Auftreten ist kein unmittelbarer Sympathiebringer, wirkt auf manche eher arrogant. Doch, so sagt es der Merz-Kenner, wenn die Krise groß ist, wenn die Menschen Sorge um Wohlstand und Sicherheit haben und die Alternative unmöglich erscheint, wenn dieses »Doch« groß genug ist, dann könnte es anders kommen. Dann könnten die Deutschen im Unbequemen das Notwendige sehen und so jemanden wie Merz wählen.
Mensch Merz: Das »Gesamtkunstwerk«
In der elterlichen Familie von Friedrich Merz gibt es eine besondere Sortierung. Die Mutter hat braune Augen, so wie ihr ältester Sohn Friedrich und die jüngste Tochter. Der Vater hingegen hat blaue Augen, so wie die beiden anderen Kinder. Diese Ähnlichkeiten seien aber nicht nur äußerlich gewesen, so erzählt es der heutige CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat einmal. Vielmehr habe es auch eine innere Verbundenheit gegeben.
Friedrich Merz wurde 1955 in Brilon als ältestes von vier Kindern geboren. Sein Vater Joachim Merz kam aus Breslau und war Richter am Landgericht in Arnsberg. Seine Mutter Paula Merz entstammte einer bekannten Briloner Familie. Ihr Vater war der Briloner Bürgermeister Josef Paul Sauvigny. »Wir waren die Kinder unserer Mutter«, beschreibt er das familiäre Verhältnis für sich und seine bereits verstorbene Schwester. Die beiden anderen seien Kinder des Vaters gewesen.
Das sei keine Spaltung zwischen den Braunäugigen und den Blauäugigen gewesen, sondern nur eine Unterscheidung, die sich immer mal wieder im Alltag gezeigt habe, berichtet Merz im Podcast mit Matze Hielscher. »Die Braunäugigen haben bei uns vielleicht ein bisschen mehr gefeiert als die Blauäugigen.« Auch seien die Braunäugigen zufälligerweise Linkshänder gewesen. Die Mutter sei immer für die Kinder da gewesen. Es habe die klassische Rollenverteilung gegeben. Der Vater habe viel gearbeitet, nur am Wochenende war er richtig präsent, ein rationaler und auch etwas nüchterner Typ.
Wer ist Friedrich Merz? Was hat ihn geprägt? Welche Persönlichkeit und welchen Charakter hat der Mann, der vielleicht bald Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird? Er selbst sagt, dass man die Prägekraft des Elternhauses gar nicht überschätzen könne. Friedrich Merz ist ein Familienmensch und die Tatsache, dass die Öffentlichkeit gar nicht allzu viel darüber weiß, unterstreicht dies. Merz ist nicht nur eine öffentliche Figur, sondern auch eine Privatperson mit ausgeprägtem Privatleben. Das hört sich selbstverständlich an, ist es aber im heutigen Politikbetrieb keineswegs mehr. Bei vielen Jüngeren verschwindet die Grenze sehr viel stärker. Auch enge Vertraute waren noch nicht zu Besuch im Haus im Sauerland, Merz bemüht sich, die Welten auseinanderzuhalten.
Als er sich gleich zu Beginn der Coronapandemie zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter mit dem Virus infizierte, war seine größte Sorge, dass er seine Eltern nicht besuchen konnte. Am 7. Januar 2024 wurde Joachim Merz 100 Jahre alt, zur gleichen Zeit fand im bayerischen Seon die traditionelle Klausurtagung der CSU-Landesgruppe statt. Kein unwichtiger Termin, immerhin galt es, im Jahr vor der Bundestagswahl noch den Unions-Kanzlerkandidaten zu bestimmen. Hier gleich zum Jahresauftakt mit dem Mitbewerber Markus Söder schöne Bilder zu produzieren und mit den Akteuren zu reden, wäre nicht unklug gewesen. Doch Merz sagt ab.
»Mein Vater wird 100 Jahre alt. Die ganze Familie ist zu Besuch. Die Familie geht in diesem Jahr vor«, erklärte er dem Münchner Merkur. Allerdings hat seine eigene Familie über die Jahre hinweg durchaus auch unter dem Beruf des Vaters und vielen Abwesenheiten gelitten. Besonders der Sohn habe mit der Rolle gehadert, das haben die Eltern immer mal wieder berichtet. Eine Pendelbeziehung nach Berlin war auch nicht geplant, denn als die Kinder geboren wurden, war die Hauptstadt noch der Wohnort der Familie, nämlich Bonn.
Der Vater Joachim Merz entstammt einer evangelischen Soldatenfamilie aus Breslau. Er wurde mit 17 Jahren in die Wehrmacht eingezogen und verbrachte viereinhalb Jahre in Georgien in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Nach dem Krieg sei der Jurist als einer der ersten in der amerikanischen Besatzungszone als Richter eingesetzt worden, um in Arnsberg NS-Prozesse durchzuführen, berichtet ZEIT-Journalistin Mariam Lau. Merz habe als junger Mann die Akten des Vaters studiert und sei auch deswegen Jurist geworden, schreibt sie.
Die Geschichte von Fritz Bauer, dem hessischen Generalstaatsanwalt der Frankfurter Auschwitzprozesse, habe Friedrich Merz fasziniert. Und Lau resümiert die Bedeutung der persönlichen Geschichte für das politische Leben. Der CDU-Chef findet alles, was ihm wichtig sei, »schon in seiner Familiengeschichte angelegt«. Später verlässt Vater Merz aus Verärgerung über die Politik von Angela Merkel die CDU, sein Sohn bleibt.
In der Familie der Mutter gibt es auch die andere Seite der Geschichte, den Großvater mit Nazivergangenheit. Josef Paul Sauvigny war von 1917 bis 1933 als Mitglied der Zentrumspartei Bürgermeister der Stadt. Laut Briloner Heimatbuch soll er 1931 ein Friedenstreffen mit dem katholischen Geistlichen Franz Stock davor bewahrt haben, von Nazigruppen gestört zu werden. Stock gehörte der katholischen Jugendbewegung an und hat später als Gefängnisseelsorger im besetzten Paris Verfolgte vor dem sicheren Tod bewahrt.
Nach 1933 passte Josef Paul Sauvigny sich an und wurde zu einem Unterstützer und Beförderer der Naziideologie. Er trat der SA, der NSDAP und weiteren Naziorganisationen bei. Patrik Schwarz schreibt 2004 in der taz, Sauvigny sei Täter, nicht nur Mitläufer gewesen. Dem Enkel wird damals vorgeworfen, sich nicht ausreichend von seinem Großvater distanziert zu haben. Es kursieren wohlwollende Zitate von ihm über Großvater und Bürgermeister. Doch waren Merz zunächst nicht alle Fakten über den Vater seiner Mutter bekannt. »Für seinen Opa kann keiner was«, schreibt Schwarz.
Die Kindheit und Jugendzeit von Friedrich Merz waren keineswegs so unbeschwert, wie es sich vermuten ließe. Der erste schwere Einbruch war eine leichte Tuberkulose-Erkrankung. Zur Behandlung wurde der Zehnjährige für sechs Monate in ein Internat gegeben, eine Zeit, die er als »ganz schrecklich« beschreibt. Er habe um die Ereignisse einen »Kokon« gesponnen, um die Erinnerung nicht mehr so nah an sich heranzulassen, sagt er in dem Podcast. Doch die Zeit in dem von Nonnen geführten Kinderheim sei »nicht schön« gewesen, auch an die dort gefeierte Erstkommunion denke er nicht gern zurück. Wenn man die Fotos von damals anschaue, sehe man, dass es ihm nicht gut ging.
In der Pubertät taten sich wieder gravierende Probleme auf. Merz war ein schlechter Schüler, blieb sitzen, musste die Schule wechseln und war als Störer bekannt. Früh fing er das Rauchen an, auch Alkohol sei damals wichtig gewesen. In der letzten Reihe im Klassenzimmer spielte der Pennäler Merz während des Unterrichts Karten.
Erst waren es Streiche, dann auch eine trotzige Antihaltung gegen Autoritäten. Es sei eine große gesellschaftliche Umbruchszeit gewesen, berichtete Merz später in einem Interview. Im Kielwasser der städtischen Protestbewegungen habe auch auf dem Land eine antiautoritäre Stimmung geherrscht. »Verspätet und diffus« sei das, was man 68er nennt, im Sauerland angekommen. »Wir wollten uns nicht mehr alles von den Alten sagen lassen«, so Merz. Der Schüler arbeitete auf dem Bau, den Vater hat das geärgert. Dann solle der Friedrich doch eine Maurerlehre machen, habe er gesagt. Doch die Mutter setzte durch, dass er es noch mal auf einer anderen Schule versuchen sollte.
Mit Mühe und Not habe er Abitur gemacht, berichtet er. Es habe damals bei ihm und seinem Freundeskreis eine »große Gleichgültigkeit« geherrscht, kein Leistungswillen. »Wir wollten Spaß haben und unsere Partys feiern.« Mehr nicht. Auch vom Weltgeschehen habe er wenig mitbekommen. Die Familie habe erst spät einen Fernseher gehabt und die Zeitung habe er nicht gelesen. Er beneide seine Frau darum, dass sie aus ihrer Schulzeit mehr herausgeholt habe, sagt Friedrich Merz heute. »Ich bin froh, dass meine Kinder anders zur Schule gegangen sind, als ich das getan habe.« Es ist also eine durchaus gebrochene erste Lebensphase, die vielleicht schon den späteren Lebenshunger und auch vielleicht einen nachholenden Ehrgeiz erklärt. »Bürgerlich bin ich erst geworden, als ich Vater wurde«, sagt Merz.
Nur langsam begann er, sich für Politik zu interessieren. Der Wahlkampf 1972 mit Willy Brandt habe ihn politisiert, er sei in die CDU eingetreten, berichtet er im »Hotel Matze«-Gespräch. Die Kritik an den Ostverträgen und die Aufgabe des Gedankens der Wiedervereinigung haben ihn umgetrieben. Zusammen mit Freunden gründete Merz die Junge Union im neu geschaffenen Hochsauerlandkreis. Vor allem habe er Freude an der Debatte gehabt und daran, Leute zu überzeugen. Schon am Anfang seiner politischen Betätigung stand der hervorragende Redner Merz. Auf einem Kreisparteitag hält er eine Kandidatenrede für einen Bewerber der Jungen Union und verdrängt damit den Alteingesessenen. Die Freundschaft zu den Mitstreitern von damals hält bis heute an.
Vor dem Studium absolviert Friedrich Merz noch den Wehrdienst. Eine Zeit, die er auch für sich persönlich nicht nur positiv bewertet. Jahre später bekennt er in einer eher lustig gemeinten Anfrage der WELT, der Beginn des Wehrdienstes am 30. Juni 1975 sei ein »einschneidendes Erlebnis« gewesen, immerhin habe er seine damals halbwegs langen Haare zum Dienstbeginn kürzen müssen. Erst vor Kurzem hat er schon als CDU-Chef die Artillerieschule in Idar-Oberstein besucht. Es sei »ein bisschen wie nach Hause kommen«, schrieb er auf Instagram. Denn fast 50 Jahren zuvor sei er dort auf einem Fahnenjunker-Lehrgang gewesen.
Seit 1981 ist Friedrich Merz mit Charlotte Merz, geborene Gass, (Jahrgang 1961) verheiratet. Charlotte Merz ist die Tochter eines saarländischen Rechtsanwalts. Sie lernte ihren künftigen Mann während des Studiums kennen. Als sie schwanger wird, ist sie noch unverheiratet und hat ihr Studium nicht abgeschlossen. Ganz so bürgerlich geht es schon damals auch in bürgerlichen Familien nicht mehr zu. Der gesellschaftliche Wandel, den die Politik und insbesondere auch die CDU dann in den späten Kohl-Jahren verarbeiten und adaptieren musste, war im Hause Merz längst angekommen.
Ihr Jurastudium schließt Charlotte Merz mit Kind ab und wird immer auch berufstätig sein. Später zieht die Familie zurück ins Sauerland, dort wird sie Direktorin des Amtsgerichts. »Kind – Examen – Kind – Examen – Kind«, so beschreibt Friedrich Merz Mariam Lau seine erste Zeit mit der jungen Familie. In diesen frühen Jahren gibt Ehefrau Merz ihrem Mann den Freiraum für die politische Karriere, indem sie sich mehr um die Familie kümmert. »Sie hätte auch ›Nein‹ sagen können, hat sie aber nicht«, sagt Merz im Podcast »Hotel Matze« zum innerfamiliären Entscheidungsprozess, um das damals schon partnerschaftliche Verhältnis der beiden zueinander zu beschreiben.
Das Kennenlernen war eine feucht-fröhliche Angelegenheit. Sie erinnere sich noch an jede Sekunde dieser entscheidenden Party, berichtet Charlotte Merz in einem Interview in der WELT im Jahr 2000. Auf dem Balkon habe sie Friedrich Merz neben einer Frau sitzen gesehen und gedacht, schade, dass der schon vergeben ist. Später stellte sich heraus, der Friedrich war noch zu haben. Liebe auf den ersten Blick sei es gewesen. Sie seien beide Romantiker, sagt sie. »Ich liebe meinen Mann als Gesamtkunstwerk.«
Im Jahr 2000 ist Friedrich Merz gerade zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden und seine Frau gibt noch einen unbeschwerten Einblick in das Familienleben. Es gebe viel Nähe und Gemeinsamkeiten. Der ähnliche Humor würde sie verbinden. Tennis, Konzerte, Theater, Oper und gemeinsame Tanzkurse nennt sie. Doch zeichnet sie keineswegs nur das Bild einer Heile-Welt-Familie. »Wir haben es auch schon geschafft, uns mehrere Tage zu streiten«, berichtet Charlotte Merz. Den größeren Dickkopf habe ihr Mann. Bei Streit mit den Kindern sei es aber Vater Friedrich, der eher ausgleichend wirke. Sie hingegen sei die Strengere und für das Unangenehme zuständig. Als Erziehungsziel gibt sie die Selbstständigkeit der Kinder an. Die drei Kinder stehen alle auf eigenen Füßen, sind erfolgreich und haben eigene Familien. Charlotte und Friedrich haben inzwischen sieben Enkel und genießen das Großelterndasein.
Charlotte Merz ist die wichtigste Beraterin des Politikers Merz, so wird es immer wieder auch von Wegbegleitern gesagt. Er selbst betont, sie hätten auch eigene Themen, seien nicht nur auf die Politik fixiert. Wo auch immer er ist, beide telefonieren jeden Abend um zirka 23 Uhr miteinander. Das sei in den Jahrzehnten ihrer Ehe höchstens 20 Mal ausgefallen, wird er später einmal gegenüber der Chefredakteurin von BILD, Marion Horn, berichten.
Charlotte Merz stammt aus einem evangelischen Elternhaus. Doch für das Paar sei das unerheblich gewesen, berichtet sie. Geheiratet habe man »ökumenisch« in der Stiftskirche St. Arnual in Saarbrücken, die seit der Reformation evangelisch ist. »Wir streiten nicht über Glaubensfragen«, sagt sie. Auch die Ehe von Friedrich Merz’ Eltern war gemischt-konfessionell, was damals durchaus noch ungewöhnlich war. Der Vater konvertierte spät noch, nachdem seine streng protestantischen Eltern gestorben waren, zum katholischen Glauben. Begleitet hat ihn der damalige Propst der Pfarrei St. Petrus und Andreas in Brilon, Karl-Heinz Wiesemann, der spätere Bischof von Speyer.
Die Kinder von Charlotte und Friedrich Merz wachsen evangelisch auf. »Wir sprechen über Gott und unseren Glauben«, erzählt die Mutter. Sie sei ein gläubiger Mensch. In der Gemeinde hat sie sich als stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums engagiert. Vor dem Essen wird gebetet. Der Pfarrer am Tegernsee erzählt, man sähe den Merz, wenn er da sei, in der Messe. Der gemeinsam geteilte religiöse Horizont sei für sie etwas Verbindendes, sagt Friedrich Merz. »Es wäre mir schwer gefallen, eine Frau ganz ohne kirchlichen Hintergrund zu heiraten.« Im Interview mit BUNTE erklärt er auch, dass ihn der Zustand der katholischen Kirche sehr beschwere. Das sei als Vorsitzender der CDU, die tief verwurzelt sei im christlichen Menschenbild, auch eine politische Sorge. Er beklagt die fehlende Reformbereitschaft und die mangelnde Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Der Synodale Weg sei eine »verpasste Chance« gewesen.
Friedrich Merz spricht nicht so häufig über das »C«, er gehört nicht zu denen, die öffentlich auch über ihren persönlichen Glauben viele Worte verlieren. Beim Katholikentag in Erfurt 2024 war er als Vorsitzender der CDU nicht zu einer inhaltlichen Veranstaltung eingeladen und somit nicht Teil des offiziellen Programms. Das untermalt auch einen Entfremdungsprozess von Kirche und Politik. Aber auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung hielt er bei einem Empfang am Rande der kirchlichen Großveranstaltung eine besondere Ansprache, bei der er auch die Differenzen ansprach, die sich aus einer christlichen Verortung für die CDU ergeben. Etwa in der Außenpolitik solle man nicht mehr zwischen »wertegeleiteter« und »interessengeleiteter« Herangehensweise unterscheiden. Unsere Interessen seien vom jüdisch-christlichen Wertefundament durchdrungen, so Merz. »So eine Rede haben wir lange nicht gehört«, sagte ein eher Merz-kritischer Verantwortlicher in der Partei spontan im Saal, nachdem er Merz zugehört hatte.
Wer ist Friedrich Merz jenseits des Politikers? Verschiedene Klischees machen die Runde. Sein Reichtum mache ihn abgehoben, heißt es. Dass er mit dem eigenen Flugzeug zur Hochzeit von Christian Lindner geflogen ist, wurde zum Symbolbild dieser Charakterisierung. Fliegen, das sei ein Jugendtraum gewesen, erzählt Merz. Doch er konnte den Flugschein erst mit 53 Jahren machen, weil er seiner Frau versprochen hatte, zu warten, bis die Kinder aus dem Haus sind. Und später konnte er es sich auch finanziell leisten. Heute fliegt er mit der eigenen Maschine gern auch morgens zu Terminen nach Berlin. Das sei für ihn die schönste Stunde des Tages.
Er habe viel Glück gehabt im Leben, deswegen wolle er auch etwas zurückgeben, erklärt er. Als er 50 wurde, gründete er mit seiner Frau zusammen eine Stiftung. Das kleine Unternehmen fördert Schulen und Bildungsprojekte in der Region. Der SPIEGEL-Journalist Nils Minkmar hat sich das vor Ort angeschaut. In Arnsberg-Neheim, im sogenannten Möhneturm, ist der Sitz der Friedrich und Charlotte Merz Stiftung. Der Fokus ihrer Arbeit sei örtlich begrenzt, erklärt ihm die Geschäftsführerin Anne Plett. Das Ehepaar Merz würde die Arbeit aufmerksam begleiten. Termine der Stiftung hätten Vorrang bei beiden. Die Stiftung sei »klein und fein«. Und Minkmar resümiert, der Spott sei zu einfach. Nicht besonders viele deutsche Politiker würden einem einfallen, die, nachdem sie zu Vermögen gekommen sind, so etwas machten.
Wer auf der Suche ist nach den Orten, an denen sich Friedrich Merz richtig wohlfühlt, außerhalb des Sauerlands, der muss nach Bayern fahren, ins Tegernseer Tal in die Gemeinde Gmund. Dort gibt es einen Platz mit einer Büste des zweiten Kanzlers der Republik, Ludwig Erhard. Der Wirtschaftsminister des Wirtschaftswunders hatte am Ackerberg eine Villa, in der er bis zu seinem Tod 1977 zeitweise wohnte. Auf dem Bergfriedhof in Gmund liegt Erhard begraben. Auch Friedrich Merz und seine Familie haben ein verstecktes Haus in der Gemeinde am Tegernsee. Der Münchner Merkur will dazu wissen, dass es schon länger in Familienbesitz sei. Man freue sich in Gmund, wenn man bald möglicherweise zwei Kanzler als Mitbürger verzeichnen könne, heißt es.
Der Rückzugsort hat eine wichtigere Bedeutung für Merz. Immer wieder gibt es dort Treffen mit Freunden und Weggefährten, um über die aktuelle politische Lage zu sprechen. Ein langjähriger Tegernseer Nachbar und Freund ist Tom Enders, früherer Vorstandschef von Airbus und heute Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er teilt mit Merz die Leidenschaft fürs Fliegen und das Interesse für die transatlantischen Beziehungen. Ein anderer Vertrauter erzählt, dass es im »kleinen Ferienhaus« war, wo Friedrich Merz immer wieder fast schon bedrängt worden sei, erneut aktiv in die Politik einzusteigen. »Merz war lange abwehrend«, berichtet ein ihm nahestehender Wirtschaftsmann. Man traf sich zum Grillen im Garten oder auch auf dem nächstgelegenen Golfplatz, immer wieder kam das Gespräch auf das Thema. »Es gab nicht das eine Gespräch, den einen Moment, sondern es war ein Prozess, an dessen Ende dann aber die Erkenntnis stand, er muss zurückkommen, zurück in die erste Reihe der Politik.« Nur privat ist also das Tegernseer Domizil in gewisser Weise dann doch nicht.
Was ist mit dem Vorwurf, Merz habe ein Frauenproblem? Charlotte Merz weist ihn zurück, sie ärgere sich über solche Zuschreibungen, weil sie schlicht nicht stimmen würden. »Er hat nie auf Frauen herabgeschaut und legt Wert auf Augenhöhe.« Dies würde auch ihre Ehe und das gemeinsame Leben belegen, sagt sie. Er habe ihre Karriere zunächst als Richterin und dann als Direktorin immer gefördert. »Eine Hausfrauenehe war für uns nie ein Thema«, so erklärt sie der BUNTEN. Als Belege für das »Frauenproblem« werden wahlweise relativ schlechte Umfragewerte in der Gruppe junger Frauen angeführt oder vermeintlich unbedachte Äußerungen, die sein veraltetes Rollenbild belegen sollen. So hat er etwa im Herbst 2024 erklärt, Frauen müssten sich bei einem Taxifahrer mit Palästinenser-Tuch mehr Sorgen machen als Männer. Diese könnten mit mehr Respekt rechnen als Frauen. Kritiker sehen hier eine frauen- und ausländerfeindliche Konnotation, andere sagen, er würde schlicht beschreiben, was viele Frauen tagtäglich erlebten.
In der CDU hat Friedrich Merz 2023 gegen den erbitterten Widerstand etwa von Ex-Ministerin Kristina Schröder (CDU) vom Thinktank R21 die Frauenquote durchgesetzt, was sie als falsch verstandene »Gleichstellungspolitik« ansah. Viele Frauen in der Partei hingegen, wie etwa die frühere Ministerin Julia Klöckner (CDU), verteidigten die Frauenquote und waren Merz für seinen Einsatz dankbar. Zuletzt hat der CDU-Vorsitzende eine paritätische Verteilung der Kabinettsposten abgelehnt. »Wir tun damit auch den Frauen keinen Gefallen.« Auch der Satz rief Kritikerinnen wie Skeptiker auf den Plan.
Der schärfste Angriff, der in dieser Sache im Netz kursiert und unter anderem auch von einer SPD-Bundestagsabgeordneten und den Jungsozialisten (Jusos) verbreitet wurde, lautet, Merz habe zusammen mit anderen im Bundestag gegen ein Gesetz gestimmt, das Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellt. In einem »Faktencheck« des nicht der Unionsnähe verdächtigen Portals »Correctiv.org« wird diese Behauptung als falsch entlarvt und die Hintergründe werden erläutert. Merz habe nicht gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt, vielmehr habe er, so »Correctiv«, 1996 für ein entsprechendes Gesetz gestimmt, welches Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellen sollte. Doch dieses Gesetz scheiterte im Bundesrat am Widerstand der SPD-Länder wegen der darin enthaltenen Widerspruchsklausel. Eine Gesetzesvariante ohne diese Klausel lehnte Merz zusammen mit anderen 1997 ab. Das Gesetz trat dennoch in Kraft. Er habe die Gefahr durch Falschbeschuldigungen »zerstrittener Eheleute« gesehen, so erklärte es Merz laut »Correctiv«. Heute würde er dennoch anders entscheiden.
Die Kieler Bildungsministerin und stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Karin Prien muss Friedrich Merz immer wieder verteidigen. Sie gilt als prominente Vertreterin des liberalen Flügels ihrer Partei und Merz als ihr Gegenüber. »Er ist sicher konservativ, aber eben nicht rückwärtsgewandt. Politisch inhaltlich sehe ich kein ›Frauenproblem‹, es wird ihm aber immer wieder zugeschrieben«, so Prien im Interview für dieses Buch. »Die politische Debatte leidet heute an einer persönlich diffamierenden und moralisierenden Polarisierung, die sachliche Differenz nicht zulässt«, so Prien, da gebe es nur noch schwarz und weiß, gut und böse. Das führe dann zu derart überzogenen Zuschreibungen und Klischees.
Prien kennt Merz schon lange. Als die Studentin den bereits erfolgreichen jungen Juristen erstmals traf, waren sie beide schon in der CDU und hatten dennoch in einigen Fragen unterschiedliche Auffassungen. Gestört hat das nicht. Gemeinsam waren sie Teilnehmer einer Bildungsreise nach Washington. »Ich war beeindruckt von seinem schon damals ausgeprägten geopolitischen Verständnis und seiner Weltgewandtheit«, erzählt sie. Sie erinnert sich an lange Gespräche an der Hotelbar mit Cocktail Margarita. »Vielleicht war er aus meiner Sicht damals schon sehr selbstgewiss, aber er hatte Stil.« Und das gelte bis heute.
Am schwierigsten ist es vielleicht, sich dem Vorwurf der Arroganz zu nähern. Manche beschreiben die Körpergröße von Merz (1,98 Meter) als Grund dafür, dass es manchmal wirke, er spreche »von oben herab« mit einem. Andere sagen, er sei mehr an Themen und Sachfragen interessiert als an Menschen, deswegen wirke er bisweilen auch mal empathielos. Andere wiederum sagen, sein Interesse und seine Aufmerksamkeit auch für das Persönliche seien auffällig. Wenn bei Mitarbeitern ein privates Lebensschicksal passiere, wenn es Sorgen in den Familien gebe, sei er höchst sensibel, erinnere sich daran und melde sich auch und frage nach. Charlotte Merz sagt, was sie besonders an ihrem Mann schätze, sei, dass er mit allen Menschen gut auskomme, »von unserem Postboten bis zum Vorstandsvorsitzenden«.
Vielleicht zeichnet Friedrich Merz sich durch eine ungewöhnliche Mischung aus hoher Professionalität und auch kühler Organisiertheit aus und zugleich durch eine große Emotionalität, zu der auch mehr oder weniger intensive Gefühlsausbrüche gehören. Im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo in der Talkshow »drei nach neun« erklärte er sein Verhalten nach der Veröffentlichung eines Artikels durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in der FAZ im Juni 2023. Wüst hatte in seinem Beitrag für eine klare Verortung der CDU in der politischen Mitte geworben. Merz verstand das als Kritik an seinem Führungsanspruch und einer konservativeren Ausrichtung der CDU und wollte wohl spontan hinschmeißen und alles aufgeben. Ihm sei eben auch im Arbeitsumfeld Loyalität sehr wichtig, er selbst sei loyal und er wünsche sich das in der Partei auch von anderen. Alles andere würde die Arbeit unnötig erschweren. Ob diese große Empfindlichkeit eine Stärke oder eine Schwäche sei, wolle er gar nicht bewerten.
Friedrich Merz sagt im Gespräch mit dem Autor dieses Buches über sich: »Ich bin in meiner Arbeit, in allem, was ich tue, sehr angewiesen auf gute persönliche Beziehungen. Ich brauche einen emotionalen Zugang zu den Menschen, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Ich kann mit reiner Rationalität, mit dem kompletten Abtrennen der Beziehungsebene, schwer umgehen.«
Da ist Friedrich Merz eben doch mehr wie seine Mutter und nicht wie der Vater, der strenge Richter. Er ist zumindest in seiner zweiten Lebenshälfte »viel harmoniebedürftiger«, als viele das vermuten.
Der Aufstieg: »Eine andere Liga«
Der Neuling: Mit Kohl im Bundestag
Bundespräsident Richard von Weizsäcker prägte 1992 den Begriff der »Parteienverdrossenheit«. Nach der Euphorie ergriff in den Jahren nach der Wiedervereinigung eine Lähmung das Land, eine Mischung aus Triumph, Katerstimmung und Saturiertheit nach den zurückliegenden welthistorischen Großereignissen. Viele notwendige innere Reformen blieben liegen und die Politik hätte sich neu erfinden müssen, stattdessen verlor man sich im Klein-Klein und im Gezänk.
Prominente Persönlichkeiten verfassten ein Manifest mit dem Titel »Weil das Land sich ändern muss«, unter anderem war es von Altkanzler Helmut Schmidt und dem Ökonomen Meinhard Miegel, aber auch der ZEIT-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff unterzeichnet worden. In seinen Erinnerungen beschreibt der damalige Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU im Bundestag, Wolfgang Schäuble, die Stimmungslage: »Der Ton wurde rauer.« Zur »Atmosphäre giftiger Auseinandersetzung« mit der Oppositionspartei SPD sei eine objektive Krisensituation im Land hinzugekommen. Das Ansteigen von Staatsverschuldung und Erwerbslosenquote habe die allgemeine Nervosität verstärkt. »In der Mitte der Legislaturperiode zwischen 1990 und 1994 gingen daher nur wenige davon aus, dass die Regierung Kohl noch einmal bestätigt werden würde.«
In dieser Situation entschied sich Friedrich Merz, von Brüssel nach Bonn zu wechseln. Seit 1989 war er Abgeordneter im Europaparlament, die Legislaturperiode auf EU-Ebene dauert fünf Jahre. Eine erneute Kandidatur wäre in das Jahr 1994 gefallen, in dem auch die Bundestagswahl stattfand. Der Zeitpunkt für einen Wechsel war also günstig. Der Bundestagsabgeordnete im Hochsauerlandkreis, Ferdinand Tillmann, der den Wahlkreis seit 1972, sechs Wahlperioden lang, im Bundestag vertreten hatte, wollte aufhören. Das war die Chance für Friedrich Merz. Tillmann selbst hätte Merz nie herausgefordert. Er war bei ihm studentische Hilfskraft gewesen, ihm also verbunden. Durch die Tätigkeit für Tillmann hatte er schon sehr früh einen Einblick in den parlamentarischen Betrieb und das Abgeordnetendasein gewonnen. In einer Kampfabstimmung gegen einen anderen Neuling entschied er die Nominierung für sich. Merz habe »den Saal gerockt«, wie Zeitzeugen dem Autor Daniel Goffart berichteten.