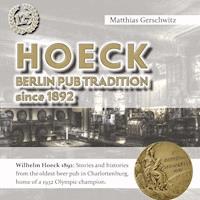Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frischfleisch war ich auch mal. Dies ist kein sentimentaler Rückblick auf die Vergänglichkeit der Jugend, sondern eine Hommage an das Leben. Matthias Gerschwitz mischt biographische und fiktive Splitter mit Gedanken zu aktuellen Themen. In 23 Kapiteln rund um »älter werden« und »jung bleiben«, um Haare, Wurst und Fernsehen, um homo- und heterosexuelle Menschen sowie um Comedy, Reisen und Zwischenmenschliches nimmt er die Leserinnen und Leser humorvoll-augenzwinkernd - aber auch ein wenig nachdenklich - mit auf eine Reise durch den Wandel der Zeiten. »Gerschwitz stellt [...] erneut seine Virtuosität unter Beweis, nachdenklich Stimmendes leicht und unterhaltend zu formulieren - ohne auch nur einen Fußbreit inhaltlicher Tiefe preiszugeben.« (Solinger Tageblatt) www.matthias-gerschwitz.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Das Fleisch ist willig, aber der Geist … der Geist!«
Matthias Gerschwitz
Inhalt
Vorwort
Aller Anfang ist schwer
Abstieg in die Vergangenheit
Was ist Glück? – Der Versuch einer Beschreibung
Tanzstundenkind
Waren Sie schon mal in Bielefeld?
Zwei Helle schauen in die Röhre
Wiedersehn macht Freude!
Fremde Zungen
Die Investitionsphase ist vorbei
Haarige Zeiten
Die serienmäßige Lust
Das Tuten der Anderen
Fünfzig ist das neue Dreißig
Hotel Viagra
Mein Brieffreund
Eine Leiche zum Dessert
Mit links
Zwei Sauerbraten auf dem Weg in die »Großen Acht« von Radio Zwischendurch
Retro rules!
Die flache Weltkugel oder das Prinzip fleischloser Wurst
Reisen bildet
Versetzt!
Frischfleisch war ich auch mal
Vorwort
»In Würde altern? ›In Anstand jung bleiben‹ heißt die Devise«, lässt der Schweizer Kabarettautor Werner Wollenberger die Titelheldin seines von der Kabarettistin Ursula Herking so unvergleichlich interpretierten Textes »Institut de Beauté Olivia Kosmetova« ausrufen, als ihr eine befreundete Schauspielerin von einem neuen Rollenangebot berichtet. Und sie setzt nach: »Selbstverständlich kannst Du die ›Ophelia‹ spielen. Zweiundsechzig ist doch heute kein Alter mehr für eine Frau!«
Recht hat sie! Zweiundsechzig ist heute wirklich kein Alter mehr für eine Frau. Nur – ob man in diesem Alter noch angemessen die »Ophelia« spielen sollte – immerhin die Geliebte des dänischen Prinzen Hamlet –, darf in Frage gestellt werden. Zwar legt sich der englische Dichterfürst nicht explizit auf das Alter seiner Figur fest, jedoch schätzen sie Literaturexperten auf ein Alter zwischen sechzehn und fünfundzwanzig Jahren – also weit, weit von zweiundsechzig entfernt. Auf der Suche nach einer glaubwürdigen Begründung führt der Weg allerdings stante pede zu einer anderen großen Kabarettistin, Helen Vita. Sie moderierte 1990 einen Vortrag mit den folgenden Worten an: »Für das nächste Chanson müssen Sie sich vorstellen, dass ich sechzehn Jahre alt bin!« Das unausweichlich folgende große Gelächter kommentierte sie nur mit: »Lachen Sie nicht! Letztes Jahr ging das noch, da war ich einundsechzig Jahre alt, da musste man nur die Zahlen umdrehen!«
Die Ära, als Frauen dem 3K-Prinzip – Kirche, Küche, Kinder – huldigen mussten, ist lange vorbei … und nicht nur Frauen versichern sich heute mit Sprüchen wie »Lieber würzig mit vierzig als ranzig mit zwanzig«, dass jedes Alter, speziell das eigene, die besten Jahre seien. Es müssen die besten Jahre sein! Hießen Senioren im Marketingsprech sonst Silver Agers oder sogar Best Agers? Und werden deshalb mit Angeboten überhäuft, die noch vor wenigen Dekaden für unmöglich gehalten worden wären?
Mit siebzig Jahren die Welt umsegeln? Gerne.
Mit fünfundsiebzig Jahren zum Trekking nach Tibet? Bitte sehr.
Mit achtzig Jahren nach Dubai? Kein Problem.
Oder, wie eine Berliner Autohändlerin und Rennfahrerin, auf den Spuren von Clärenore Stinnes per Auto die Welt umrunden? Warum nicht? Selbst die Tatsache, dass die Tochter des einflussreichen deutschen Unternehmers bei ihrem Aufbruch zu ihrer zweijährigen Tour 1927 erst sechsundzwanzig Jahre alt war, die genannte Autohändlerin bei ihrer Abfahrt 2014 allerdings schon siebenundsiebzig Lenze zählte, ist vernachlässigbar. Im Frühjahr 2017 wird sie nach rund 80.000 zurückgelegten Kilometern wieder in Berlin eintreffen. Im Alter aktiv zu bleiben, gehört zum guten Ton. Aber wird das gesellschaftlich auch anerkannt, wenn man nicht prominent ist? Und vor allem: Hält man sich selbst daran?
Auf der anderen Seite steht die Erkenntnis, dass man mit fünfzig nur schwerlich eine neue Arbeitsstelle findet oder als gereifte Ehefrau Gefahr läuft, durch eine jüngere Nachfolgerin ersetzt zu werden. Oder in der schwulen Welt schon mit fünfunddreißig Jahren zum alten Eisen gehört. Ist es da verwunderlich, dass nicht wenige schwule Männer niemals älter, und erst recht nicht älter als neunundzwanzig werden – zumindest in ihrer virtuellen Selbstdarstellung? Frauen gegenüber hingegen ist es ein Kompliment, ihnen ungeachtet ihres wahren Alters immer wieder zum Erreichen des neununddreißigsten Lebensjahres zu gratulieren – natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sie dieses Lebensjahr bereits tatsächlich hinter sich gelassen haben. Und die Werbung tut ein Übriges: Die Haarpflegemarke »Plantur 39« zum Beispiel wird offiziell als Haarpflege für Frauen ab vierzig beworben. Honni soit qui mal y pense …
»Eine Frau kann mit neunzehn entzückend, mit neunundzwanzig hinreißend sein, aber erst mit neununddreißig ist sie absolut unwiderstehlich. Und älter als neununddreißig wird keine Frau, die einmal unwiderstehlich war!«
(Coco Chanel)
Wer die Kunst, jung zu bleiben, beherrschen will, sollte sich erst einmal seines tatsächlichen Alters entsinnen. Die französische Schriftstellerin und Feministin Simone de Beauvoir, langjährige Lebensgefährtin Jean-Paul Sartres, hat das so formuliert: »Altern heißt, sich über sich selbst klar zu werden«, denn Jugend ist nichts Ewiges, sondern etwas Vergängliches. Erst dann lohnt es sich – wie es so schön heißt – »so alt zu sein, wie man sich fühlt.«
Die folgenden Geschichten, Anekdoten und Gedanken – teils biographisch, teils dem Leben abgeschaut, teils trotz allem reine Fiktion – mögen zur Selbstfindung und zur Reflexion über den Wandel der Zeiten, dem sich niemand verschließen kann, beitragen. Und der vergnüglichen Unterhaltung dienen. Schließlich sind es ja immer nur die Anderen, die älter werden …
Aller Anfang ist schwer
Aller Anfang ist schwer: Rom wurde bekanntlich nicht an einem Tag erbaut, die Erschaffung der Welt dauerte – je nach Quellenlage – sieben Tage, und man munkelt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches, dass in Berlin niemand die Absicht habe, einen Flughafen zu eröffnen.
Und mein Anfang?
Ich hatte zwei erste Male innerhalb von sechs Wochen – und beide gingen schief. Nun wird dem ersten Mal ja nachgesagt, dass es keine Garantie auf Gelingen gebe – wie heißt es so schön: »Beim ersten Mal, da tut’s noch weh …« – aber wenn es gleich zwei Mal daneben geht, macht man sich doch so seine Gedanken. Im Nachhinein betrachtet ist aber trotz dieses Umstandes aus mir etwas geworden. Vielleicht sogar erst deshalb? Tröstlich ist es auf jeden Fall.
Der Exkurs in meine Jugend beweist, dass die Aussage Bertolt Brechts in der Ballade von der sexuellen Hörigkeit stimmt: »Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben«. Da meine ersten Male aber abends bzw. nachts stattfanden, müsste es dann hier wohl eher heißen, dass man das Lob der Nacht nicht vor dem nachfolgenden Tag anstimmen dürfe. Aber sei’s drum. Ich entsinne mich noch des verständnislosen Gesichts meiner Mutter, die morgens um sieben Uhr die Haustür verschlossen, den Schlüssel von innen im Schloss steckend und mich schlafend im Bett – aber unerklärlicherweise frische Brötchen in der Küche vorfand. Ich habe sie lange nicht über die Zusammenhänge aufgeklärt. Schließlich war das ja das zweite erste Mal und hatte mit einem Herrn der Schöpfung stattgefunden. Bei solchen Neuigkeiten fällt man eben nicht mit der Tür ins Haus, sondern verschließt sie leise und schleicht auf Zehenspitzen ins Schlafgemach.
Nach zwei ersten Malen war mir aber trotzdem noch nicht klar, wie es weitergehen werde. Deswegen gab es nach dem ersten ersten Mal weitere, wenn auch letztlich nur an einer Hand abzählbare heterosexuelle Versuche, bevor ich endgültig der Stimme der Natur folgte, die ich allerdings erst spät vernommen hatte. Die Sexualaufklärung der frühen siebziger Jahre hatte noch sehr zu wünschen übrig gelassen und war, wenn überhaupt, ausschließlich auf Heterosexualität ausgerichtet. In meinem Gymnasium nicht einmal das. Auch meine Eltern sprachen niemals mit mir über Sexualität. Ich bezog meine Kenntnisse aus einem kleinen Bändchen mit dem ahnungsvollen Titel Woher kommen die kleinen Buben und Mädchen?, erstmals im Jahr 1961 von dem Pädagogen und Psychotherapeuten Kurt Seelmann veröffentlicht, aber wirklich aussagekräftig war auch dieses Buch nicht. Zu verschämt und verklemmt war die Zeit. Daher konnte die erwähnte Stimme der Natur zunächst gar nicht zu mir vordringen.
Insofern zeigt mein Lebensweg, dass Homosexualität keine Krankheit, keine Prägung und keine Folge fehlerhafter Erziehung ist. Man wurde in dieser Zeit mit solch existenziellen Problemen alleine gelassen und musste den Weg selbst suchen. Daher vergingen Jahre, bis ich mir selbst eingestand, anders als die Anderen zu sein – und noch länger dauerte es, bis ich mich tatsächlich outete; Jahre, die ich, wie so viele Homosexuelle vor und auch noch nach mir, einer vorherrschenden realitätsfremden Meinung opfern musste. Trotzdem bin ich nicht daran gescheitert, denn ich hatte das Glück, von meinen Eltern jenseits der Sexualaufklärung zu Selbstbewusstsein und Stärke erzogen zu werden, Eigenschaften, die mir auch im Umgang mit der Sexualität halfen. Und das war damals wohl eher seltener die Regel, sonst gäbe es heute nicht immer noch so viele verkrampfte Tabuisierungen.
Aller Anfang ist schwer – so auch beim Coming-Out. Die Reaktionen waren genauso vorhersehbar wie überraschend. Meine Eltern waren sprach- und hilflos, die meisten meiner Geschwister nicht einmal verwundert. Nur aus einer familiären Ecke hörte ich: »Meine Söhne sind für Dich tabu!«, was das Verhältnis schlagartig zu einem Eisblock gefrieren ließ. Die Frage meiner Mutter: »Was sollen denn die Nachbarn sagen?«, ließ ich nur ein einziges Mal zu. Was die Nachbarn zu sagen hatten, war mir herzlich egal. Die Kommentare im Freundeskreis reichten von »Ja und?« bis zu »Wenn das so sein sollte, tut mir das sehr leid für Dich, aber dann können wir nicht mehr befreundet sein«. Dem letztgenannten Wunsch bin ich sehr gerne nachgekommen.
Aber Anfänge beschränken sich nicht nur auf Sexualität. Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr fällen unendlich viele Menschen Entscheidungen, die sie wieder an einen Anfang bringen. Eine neue Beziehung, ein neuer Job, eine neue Umgebung. Der Beginn eines Lebens ohne einen geliebten Menschen, die plötzliche Verantwortung für ein Vermächtnis, der immer neue Kampf gegen Diskriminierung, Ignoranz und Vorurteile. Dank meiner Erziehung zu Selbstbewusstsein und Stärke lernte ich früh, zu mir zu stehen und mich zu wehren. Selbst heute muss ich mir noch gelegentlich homophobe Beleidigungen – zumeist von Männern – anhören, aber ich kann ihnen mit meinem Erfahrungsschatz begegnen und dem Gegenüber locker entgegenhalten, dass ich wohl mit mehr Frauen geschlafen habe als er mit Männern. Interessanterweise zeichnet sich als Reaktion auf diese Einlassung zumeist ein großes Fragezeichen auf der Stirn des Kontrahenten ab, was seine beschränkte intellektuelle Kapazität offenlegt. An dieser Stelle muss ich dem ansonsten hochgeschätzten Johann Wolfgang von Goethe widersprechen, der 1815 in einem Sonett behauptete: »In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister«. Geistige Beschränkung ist alles andere als meisterhaft.
Aller Anfang ist schwer: Rom wurde bekanntlich nicht an einem Tag erbaut, die Erschaffung der Welt dauerte – je nach Quellenlage – sieben Tage, und man munkelt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches, dass in Berlin niemand die Absicht habe, einen Flughafen zu eröffnen. Aber wäre nicht die Absicht, etwas beginnen zu wollen, bereits der erste Schritt auf dem Weg? Der griechische Dichter Hesiod wusste lange schon vor unserer Zeit: »Vor das Gedeihen jedoch haben die ewigen Götter den Schweiß gesetzt. Lang und steil ist der Pfad dorthin und schwer zu gehen am Anfang. Kommst du jedoch zur Höhe empor, wird er nun leicht, der anfangs so schwer war«, heißt es in seiner Schrift Werke und Tage aus dem siebten Jahrhundert vor Christus. Der Volksmund hat es da einfacher: »Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt« oder »Auch die schwärzeste Stunde hat nur sechzig Minuten« sollen ermutigen, dass man den Anfang wagen kann, wagen soll, auch wenn er gefährlich scheint. Dass Veränderungen wichtig sind, dass man alte Gewohnheiten loslassen muss, um neue Ziele zu erreichen.
»Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben«, verspricht Hermann Hesse in seinem Gedicht Stufen. Man kann den Zauber des Anfangs gar nicht oft genug genießen.
Abstieg in die Vergangenheit
Sommer 2009: Es ist fast fünfundzwanzig Jahre her, dass sich diese Tür das letzte Mal vor meinen Augen öffnete. Ich wage einen Schritt nach vorn in die Vergangenheit.
Vor einem Vierteljahrhundert bin ich das letzte Mal in diesem Haus gewesen; dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich wohnte schon damals nicht mehr dort, aber als meine Eltern 1984 in eine andere Wohnung zogen, hatte ich mit ein paar Freunden den Umzug organisiert. Und auch alles, was sich hinter dieser Tür befand, vor der ich jetzt stehe, in Kisten, Säcken und Tüten in die neue Wohnung oder auf den Müll gebracht. Ein Stuhl war dabei, irreparabel. Aber ich sah mich noch als Steppke auf ihm am Esstisch sitzen. Ein schlichtes Holzgestell mit einem Sitz aus Korbgeflecht. Er ging damals wie so Vieles den Weg allen Fleisches bzw. Holzes; einer meiner Freunde warf ihn mit Begeisterung in die Sperrgutschere der städtischen Müllverbrennungsanlage und konnte sich gar nicht mehr beruhigen, wie das stählerne Ungetüm das Möbelstück zermalmte, als sei es aus Zahnstochern gefertigt. Warum denke ich gerade an diese Szene, als ich vor dieser Tür stehe? Wahrscheinlich, weil die Sperrgutschere das kräftigste Bild der Erinnerung ist und sich die leuchtenden Augen des Freundes in die interne Festplatte namens Gedächtnis eingebrannt haben.
»Wollen wir?«, höre ich eine Stimme.
Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch und schüttele mich ein wenig, als wolle ich den Staub der Erinnerungen loswerden.
»Klar!«
Mit einem Quietschen öffnet sich die Tür. Neonlicht flammt auf. Verglichen mit der Ausbeute zweier unscheinbarer Glühlampen zu meiner Jugendzeit erscheint es wie Flutlicht. Eine Stimme mahnt zur Vorsicht, dann steigen wir langsam die aus Stein gehauenen Stufen in den Keller hinab. Ja – in einen richtigen Keller, in ein richtiges Gewölbe, immer noch feucht, kühl und modrig riechend. Und mittlerweile über einhundertsechzig Jahre alt. Auf der vierten Stufe ziehe ich – selbst nach fünfundzwanzig Jahren immer noch wie gewohnt – den Kopf ein. Es gibt eben Dinge, die man nicht vergisst.
Regale stehen an den gemauerten Wänden, dort, wo zu meiner Zeit die ausgemusterte Esszimmeranrichte ihr Gnadenbrot bekommen hatte. Statt des Familiensilbers und des Sonntagsgeschirrs musste sie nun Schrauben, Dübel, Werkzeuge und allerlei Krimskrams beherbergend ihr freudloses Dasein fristen. Für Dinge, für die es in der Wohnung keinen Platz mehr gab, die aber zu schade zum Wegwerfen waren – wobei sich die Halbwertszeit der meisten dort aufbewahrten Gegenstände dem Gesetz der steten Feuchtigkeit zu unterwerfen hatte. Daneben stand ein alter Schrank, der, seiner Tür beraubt und mit wachstuchbelegten Regalbrettern ausgestattet, Heimat des Nahrungsmittelvorrats war. Fein säuberlich geordnet standen gekaufte und selbst eingekochte Konserven neben Flaschen von Essig, Öl und Tomatenketchup. Rechts daneben ein halbhohes Regal, ebenfalls mit kellertauglichen Lebensmitteln gefüllt. Gegenüber die riesige Kiste, in der mindestens ein Zentner Kartoffeln eingelagert werden konnte. Und daneben der Durchgang zu einem kleinen Raum, der ganz früher noch mit dem in der Etage darüber stehenden Kohleofen verbunden war; hier wurden wohl, wenn ich mich recht an alte Erzählungen erinnere, die Aschereste des fossilen Heizmaterials aufgefangen. Seit dem Einbau einer Gasheizung aber barg er die Schätze des sich selbst als vinophil bezeichnenden Vaters. Weißweine aus Rheinhessen, Rotweine aus der Pfalz, jeweils temperaturident zum Verzehr freigegeben.
Weißwein kühlen – warum?
Rotwein atmen lassen? Keine Zeit!
Flaschen von den damals weithin bekannten Versand-Weingütern Ferdinand Pieroth oder Jakob Gerhardt, jenen Fließbandproduzenten vergorenen Traubensaftes nicht immer zweifelsfreier Qualität, die der Massenhaltung hilf- und rechtloser Weinreben geschuldet war. Dazwischen immer wieder mal die crème de la crème damaligen Genussverständnisses: hier eine Beerenauslese, dort ein Eiswein … und an anderer Stelle wiederum eine Spätlese, deren Süße mancher Colasorte zur Ehre gereicht hätte: »Alzeyer Galgenberg«, welch programmatischer Name. Und doch geht er zu weit: Trinkt man Weißwein statt gut gekühlt bei Zimmertemperatur, steigt er zwar erfahrungsgemäß deutlich schneller zu Kopf, aber er führt im Gegensatz zur Verheißung des Lagennamens nicht zum vorfristigen Lebensende. Über den Umfang des Hauptes am nächsten Morgen wäre allerdings an anderer Stelle zu diskutieren.
Anlässlich meiner Konfirmation 1974 überraschte mich mein Vater mit einer Flasche »Alzeyer Galgenberg«