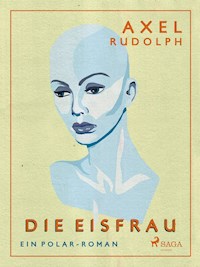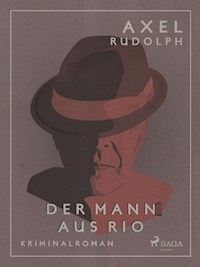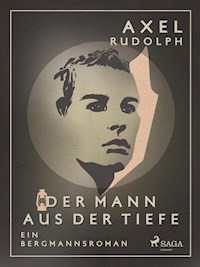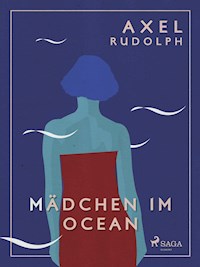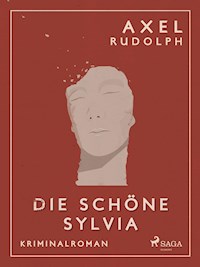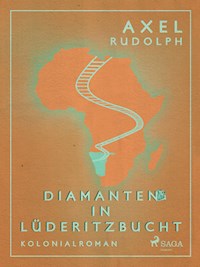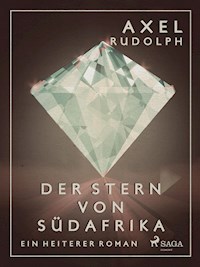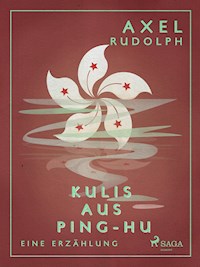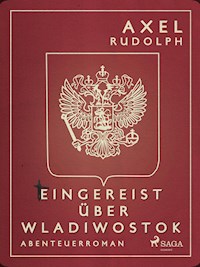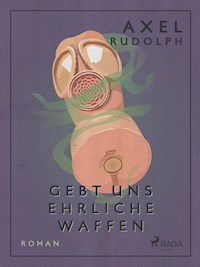Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um einer schönen Tänzerin willen arbeitet sich der deutsche Kapitän Hermann Horn aus dem Nichts zum vermögenden Mann empor. Fünf Jahre lang kennt er nur einen Wunsch: Gelt, viel Geld zu verdienen, um der Tänzerin Juanita Cintederas zu imponieren. Und als er das Ziel erreicht hat - lehnt Juanita seine Werbung ab. Die unverhoffte Niederlage erweckt in Hermann Horn einen knabenhaften Trotz. mutwillig stürzt er sich in abenteuerliche Unternehmungen. Nicht mehr als fünf Groschen gilt ihm sein Leben, wagehalsig setzt er es bei jeder Gelegenheit aufs Spiel. So lange bis er ein liebes Mädel kennenlernt, das Hermann Horn und seine Verbissenheit mit einer Handbewegung zähmt. Und jetzt erst fühlt under Freund, dass er stets einem Phantom nachgejagt ist. Nie härter es für ihn ein Glück bedeuten können, Juanita zu besitzen, denn das Schicksal hat ihn der stillen, tapferen Karin bestimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Rudolph
Fünf Groschen für mein Leben
Abenteuerroman
Saga
Ebook-Kolophon
Axel Rudolph: Fünf Groschen für mein Leben. © Axel Rudolph. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2016 All rights reserved.
ISBN: 9788711445358
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Mit dumpfem Knall fiel die Haustür der Villa hinter Hermann Horn ins Schloß. Er schob seinen Toquilla-Strohhut in den Nacken, drehte sich um und blickte einen Augenblick wütend die Tür an, als sei das glatte, feste Holz daran schuld, daß er da oben bei der schönen Juanita Cintadera abgeblitzt war. Dann reckte er sich, schob die Hände tief in die Jackettaschen und ging. Die kleine, mit vergoldeten Spitzen versehene Eisentür im Gitter des Vorgartens ließ er genau so lärmend hinter sich zufallen wie vorhin die Haustür. Es war dumm und kindisch. Aber der Lärm entsprach seinem Gemütszustand, dessen unerträgliche Spannung sich gefährlich dem Explosionsmoment näherte. Diese Frauen! Sie sind an allem Unglück schuld! Warum hat sie der Herrgott so schön gemacht!
Weiß und glatt dehnte sich die breite, moderne Autostraße, an der sich zu beiden Seiten aus tropischen Gärten die weißen Villen derjenigen hoben, die es sich leisten konnten, hier zu wohnen. Hermann Horn kam an eine Straßenkreuzung, in deren Mitte statt eines Verkehrspolizisten ein Rondell von Büschen mit einer ragenden Palme stand. Ein kleines Auto hielt hier dicht am Straßenrand. Die Lenkerin, eine junge Dame, war abgestiegen und suchte anscheinend ergebnislos nach einem Wegweiser oder Straßenschild. Ein Reisehandbuch hielt sie offen in der Hand.
„Verzeihen Sie“, hörte Horn dicht neben sich eine schüchterne Stimme sagen. „Wo geht’s denn nun hier nach der Stadt?“
„Sehen Sie doch in Ihrem Reiseführer nach!“ schnob sie Hermann Horn unhöflich an, ließ sich aber dann doch herbei, mit einer Kopfbewegung nach der linksabführenden Straße zu deuten. Im Weitergehen hatte er den schwachen Eindruck von einem blonden Haarwuschel und ein paar erschrockenen, blauen Mädchenaugen. Aber seine Stimmung war nicht danach, sich Vorwürfe über seine Grobheit zu machen. Der Teufel hole das ganze Weiberpack!
Mit einem scharfen Ruck bog er in die Straße zur Rechten ein und beschleunigte trotz der Mittagsglut seine Schritte. Er hatte keine Ahnung, wohin diese Straße ging, wußte nur, daß sie aus der Stadt herausführte. Das war ihm recht. Er konnte jetzt unmöglich in die Stadt und ins Hotel zurückkehren. Hermann Horn war sich klar darüber, daß er die erste Flasche Guarapo dem bedienenden Kellner ins Gesicht werfen oder mit dem Erstbesten, der sich erdreistete, ihn anzureden, Händel anfangen würde. Auslaufen mußte man sich einmal! Den Schmerz unterkriegen, ach was, Schmerz, die Wut! Den Kopf mußte er erst wieder klar bekommen.
Der Tag war schön; die Gegend entzückend reizvoll. In üppigen, saftigen Gärten leuchteten die weißen Landhäuser im spanischen Hacienda-Stil, durch dunkelgrüne Balatas und Taguena-Nußbäume schimmerte das klare Wasser eines tiefblauen Binnensees, und hoch über allem wölbte sich der Himmel so heiter und wolkenlos, als könne von diesem Erdenfleck aus der Blick hinaufdringen in ungeahnte Sphären.
Hermann Horn sah nichts von dieser Schönheit. Je schneller seine Schritte wurden, desto mehr beruhigten sich seine Gedanken. Aber erfreulich waren sie nicht. Aus war sein Traum! Er war abgewiesen worden! Verlacht! Bis auf die Knochen blamiert, zur Tür hinausklomplimentiert worden!
Erst vor zwei Stunden, als er sich in seinem Hotelzimmer mit besonderer Sorgfalt für den entscheidenden Besuch ankleidete, hatte er keine Sekunde daran gezweifelt, daß er das Haus Juanita Cintaderas als Sieger verlassen würde.
In einem zweitrangigen Kabarett einer südamerikanischen Hafenstadt hatte er sie zum ersten Male erblickt. Er war damals als zweiter Steuermann auf dem holländischen Tanker „Volendam“ gelandet und hatte durchaus nicht die Absicht gehabt, an Land zu bleiben. Da hatte er sie gesehen, die unbekannte und von den anderen kaum beachtete Tänzerin, und — war geblieben.
Hermann Horn hatte sich nie viele Gedanken über die Liebe gemacht. Für ihn waren Mädchen und Frauen nur immer Zwischenstationen gewesen, eine Zerstreuung in den Hafenstädten, die man schnell wieder vergaß. Sentimentale oder romantische Gedanken hatten ihn nie belastet. So hatte er auch nicht geseufzt und über die Veränderung philosophiert, die plötzlich sein ganzes Wesen befallen hatte wie eine heimtückische Krankheit. Er wußte ganz einfach nur, daß er diese Frau erringen mußte und erst heimfahren würde, wenn Juanita Cintadera ihm als seine Frau folgte. Diese Erkenntnis, so plötzlich sie ihm auch gekommen war, erschien ihm sofort wie eine unabänderliche Tatsache, nach der er sein Leben ganz nüchtern einzurichten hatte. Er verdrehte nicht sehnsuchtsvoll die Augen, er schwatzte nicht von der Allmacht der Liebe oder von dem Blitzstrahl, der ihn getroffen, oder von dem Finger des Schicksals, der ihm Juanita gezeigt habe als das Mädchen, das gerade ihm von Ewigkeit her bestimmt sei. Er redete überhaupt nicht, machte sich nicht viel Gedanken und handelte. Zunächst heuerte er ab, um die Tänzerin nicht wieder aus den Augen zu verlieren. So war aus dem Steuermann Hermann Horn eine Landratte ohne Stellung und Vermögen geworden. Aber das kümmerte ihn wenig. Er war doch ein ansehnlicher Mann, vierunddreißig Jahre alt, einen Meter einundachtzig hoch, gut gebaut und strotzend von Lebenslust und Muskelkraft. Und Juanita Cintadera war doch nichts weiter als eine unbekannte kleine Tänzerin, die ihr Brot in Singspielhallen und kleinen Kabaretts verdiente. Natürlich war sie abends oft genug von Kavalieren umgeben, Herren mit dicken, unechten Brillantknöpfen in der Hemdbrust, Grandseigneurmanieren und recht bescheidenen Brieftaschen. Aber Juanita Cintaderas Augen waren nicht nur die schönsten, sondern auch die klügsten. Sie durchschauten sicher die Talmi-Eleganz und -Liebe um sie herum und würden bestimmt einen ehrlichen Seemann, der ihr Heirat und Heim bot, diesen Auch-Kavalieren vorziehen.
Leider hatte er nie Gelegenheit gehabt, Juanita persönlich kennenzulernen und mit ihr über seine Pläne zu sprechen. Er war gerade zu ihrer Abschiedsvorstellung gekommen. Am nächsten Tage war Juanita Cintadera nach einer weit im Innern des Landes gelegenen Stadt gereist, um dort ein neues Monatsengagement anzutreten, ohne von der Existenz eines Hermann Horn und seinen Heiratsabsichten etwas zu ahnen. Und Hermann Horn konnte ihr nicht folgen. Er hatte kein Geld, sondern nur Schulden bei dem Gastwirt in der Hafenkneipe.
Eine Heuer hätte er damals leicht bekommen können, sogar eine gute Heuer auf einem deutschen Dampfer. Aber er schlug das vorteilhafte Angebot aus trotz der tückischen Augen seines Gastwirts und Gläubigers. Aber der ließ nicht locker. Er wollte zu seinem Gelde kommen. Er vermittelte ihm eine Stellung als Lagerist und Aufseher bei der Firma Gonzales, die zur Elliot-Alves-Gruppe gehörte und natürlich mit Rohöl handelte.
Sonderlich hohe Gehälter zahlte die Firma Gonzales ihren Angestellten nicht. Trotzdem hatte Hermann Horn nach einigen Monaten doch so viel zurückgelegt, daß er Juanita nachreisen konnte. Da sah er sie wieder! Allerdings nur ihr Bild in den Zeitungen. Die Blätter brachten sogar eine ganze Menge Bilder von ihr, der schönsten Frau der Staaten, dem aufgehenden Stern am Himmel Terpsichores!
Hermann Horn las bedächtig, was die Zeitungen zu berichten wußten. Juanita Cintadera hatte in einem Schönheitswettbewerb den ersten Preis erhalten. Auch ihre Tanzkunst wurde auf einmal in das hellste Licht gerückt. Man sprach schon von einer zweiten Argentina, die im Fluge den halben Erdball erobern würde. Das Ganze sah ein bißchen nach bestellter Arbeit aus. Das wichtigste aber war: Juanita Cintadera hatte einen weiteren, größeren Sprung nach vorwärts getan; sie hatte ein Engagement an das Staatstheater in der Hauptstadt erhalten.
Für eine Reise dorthin und einen Aufenthalt in der Hauptstadt reichten seine kleinen Ersparnisse nicht. Hermann Horn beschloß, noch einen Monat bei der Firma zu bleiben. Er schuftete doppelt, wies ein paar böse Unterschlagungen nach, die der vorherige Lagerist begangen hatte, und drückte damit bei seiner Firma eine kleine Gehaltserhöhung durch. In seinen wenigen Freistunden studierte er eifrig die Zeitungen.
Sie brachten immer häufiger den Namen Juanita Cintadera, der tatsächlich über Nacht zu Ansehen gelangt sein mußte.
Diese letzte Nachricht glaubte Hermann Horn nicht, und sie änderte nichts an seinem Entschluß, Juanita Cintadera für sich zu erringen. Die Sache war nur — das gestand er sich offen zu — erheblich schwieriger geworden. Juanita war keine kleine Tänzerin mehr, sie war sogar auf dem besten Wege, eine große gefeierte Dame zu werden. Sie war Mitglied des Staatstheaters und verkehrte in einem Kreise von Kavalieren, die nicht nur echte Brillanten im Frackhemd trugen, sondern auch die dazugehörigen dicken Brieftaschen besaßen. In einem solchen Kreise aulzutauchen und mit Erfolg als Bewerber aufzutreten, war für einen ehemaligen Seemann und jetzigen Lageristen aussichtslos. Das war klar. Ebenso klar war aber auch, daß man nun mehr verdienen mußte. Wer Juanita erringen wollte, mußte etwas aufzuweisen haben. Hermann Horn hatte das nur als gerecht empfunden. Und da ihn Schwierigkeiten nie ängstigten, im Gegenteil sogar seinen Willen härter machten, hatte er sich sogar innerlich darüber gefreut.
Es kamen die harten Jahre, erfüllt von einem zähen, verbissenen Ringen. Hermann Horn hatte jedes Ding angepackt, das ihm aussichtsvoll erschien. Er war Schlächtergehilfe in den Schlachthäusern von Palma Sole geworden, Viehtreiber in den Llanos, Bohrmann auf den Oelfeldern, Arbeiterwerber für die Dutch Shell Co., Grundstücksmakler, Agent, Kommissionär. Er war dem Erfolg durch alle Staaten Südamerikas nachgejagt. Er hatte gegeizt, gehandelt, gerauft und gerungen, mit beiden Ellbogen rücksichtslos um sich gestoßen und zäh und unerbittlich immer nur an das eine gedacht: Vorwärtskommen! Geld verdienen! Juanita erringen!
Nach fünf Jahren kannte Hermann Horn die mittel- und südamerikanischen Küsten wie seine Tasche. Nach fünf Jahren war er so weit, daß er haltmachen durfte. Natürlich war er noch kein Krösus geworden, aber immerhin besaß er schon bare 20 000 amerikanische Dollar, ein Kapital, mit dem sich in Südamerika schon etwas anfangen ließ.
Das Ziel hatte in all diesen Jahren unverrückbar fest vor ihm gestanden: Juanita Citadera! Er hatte sie nicht wiedergesehen. Aber in den Zeitungen hatte er aufmerksam ihren Weg verfolgt. Die hervorragende Bühnenlaufbahn, die man ihr prophezeit hatte, hatte sich nicht verwirklicht; trotzdem war der Abstand zwischen ihr und ihm nicht kleiner geworden. Vor einem Jahr hatte sie sich ganz vom Theater zurückgezogen, spielte aber bei allen gesellschaftlichen Angelegenheiten eine um so größere Rolle. Juanita Cintadera war eine große Dame geworden. Sie wohnte jetzt in einer Villa der teuersten Wohngegend jenes Städtchens, das wegen seiner herrlichen landschaftlichen und verkehrspolitisch glücklichen Lage die Sommerresidenz der Regierung geworden war.
Hermann Horn war stolz darauf, daß er als erster den Wert Juanitas erkannt hatte. Ihre Erfolge bestärkten nur sein Zusammengehörigkeitsgefühl mit ihr. Er war ja auch nicht mehr der kleine, heuerlose Seemann von einst. Seine Anzüge waren jetzt auch von den ersten Schneidern der Hauptstädte nach Maß angefertigt; er trug seidene Wäsche, und in seiner Brieftasche steckten 20 000 Dollar. Und Juanita Cintadera war noch unverheiratet!
Einen Augenblick lang hatte er daran gedacht, ihr zunächst einen langen Brief zu schreiben und ihr seine fünf Jahre alte Liebe zu gestehen. Aber diesen Gedanken hatte er sofort wieder verworfen. Wozu schreiben, wenn man sprechen konnte? In diesen fünf Jahren hatte sich die Gewißheit, daß er siegen würde, derart in ihn eingefressen, daß er sich gar keine andere Möglichkeit mehr vorzustellen vermochte. Was für einen Sinn hätten denn sonst sein ganzes zähes Kämpfen, seine Erfolge gehabt?
Und nun war alles aus!
Juanita Citadera hatte den fremden Herrn, der sich bei ihr anmelden ließ, höflich empfangen und mit wachsendem Erstaunen seine Erzählung angehört. Mit aufmerksamer Verwunderung hatte sie dem Bericht Hermann Horns gelauscht, der ihr in klarer, schmuckloser Weise schilderte, wie er für sie gearbeitet und gekämpft hätte, fünf Jahre lang, ohne nach rechts oder links zu schauen, immer nur mit dem einen Ziel, sich den Weg zu ihr zu bahnen.
Die schöne Juanita Cintadera war in der peinlichsten Verlegenheit, als ihr Hermann Horn endlich die Frage, die schon wie eine Inbesitznahme klang, stellte, ob sie die Seine werden wolle. Sie hegte große Hochachtung vor dem Mann, der sich so sieghaft mit dem Leben herumgeschlagen hatte, und fühlte sich zugleich von seiner Siegessicherheit abgestoßen. Sie war verletzt, daß er sie so selbstverständlich als sein Eigentum betrachtet hatte, und war voll Mitleid, weil er sich ganz umsonst so viel Mühsal aufgeladen hatte. Sie wußte, daß dieser Mann nicht zum sorglosen Genießen geboren sei, daß ihm das Leben immer ein ununterbrochener Kampf bedeuten würde. Sie liebte aber nicht die Aufregungen des Kampfes, sie lebte nur für die Sicherheit und den Genuß des Erfolges. Ein Leben an der Seite dieses Mannes war ihr zu gefährlich. Aber sie hätte gern seine Freundschaft erworben, um seine Feindschaft zu vermeiden. So lehnte sie den Antrag Hermann Horns in der liebenswürdigsten, schonendsten Form, aber doch in ganz unmißverständlicher Weise ab.
Hermann Horn konnte, wollte sie nicht verstehen. Vielleicht hatte er sich nur falsch ausgedrückt. Vielleicht hielt ihn Juanita noch für den armen, stellungslosen Seemann. Er wurde heftiger. Er wies mit renommierendem Stolz auf seine Erfolge, seine Ersparnisse hin. Er riß sein Banknotenbündel aus der Brusttasche: „20 000 Dollar bar! Damit läßt sich hier schon etwas Ordentliches anfangen!“ Juanita hatte ihn einfach stehenlassen. Schweigend hatte sie sich erhoben, sich mit einer kühlen Kopfneigung verabschiedet und war in ein Nebenzimmer gegangen.
Horn lachte grimmig auf, während er die sonnige Straße entlangschritt, ohne auf seinen Weg zu achten. Das war also das hohe, leuchtende Ziel, dem er fünf Jahre lang entgegengestürmt war! Sie wollte ihn gar nicht, die schöne Juanita! Sie dachte gar nicht daran, seine Liebe zu erwidern! Vielleicht hätte sie ihn auch abgewiesen, wenn er zweihunderttausend oder zwei Millionen Dollar gehabt hätte!
Die Wut in seinem Innern wandelte sich langsam in Traurigkeit. War er bisher blindlings vorwärts gestürmt, so begann er nun zum erstenmal über sich und sein Handeln nachzudenken. Die erste, zornige Enttäuschung wich. Er fühlte keinen Groll mehr gegen Juanita Cintadera. Aber die Traurigkeit in ihm wurde immer stärker. Als ob etwas in ihm in Stücke geborsten sei, ein Etwas, ein Idol, für das Juanita nur den Namen gegeben hätte, irgend etwas Unfaßbares, jetzt auch namenlos und damit unaussprechbar Gewordenes, das ihm Kraft und Zähigkeit, Lebensmut und Siegeszuversicht gegeben hatte.
Er hatte sich niemals eine bestimmte Vorstellung davon gemacht, wie seine entscheidende Begegnung mit Juanita ausfallen würde. Er hatte natürlich nicht erwartet, daß sie ihm, dem Fremden, gleich um den Hals fallen würde. Aber er hatte erwartet, daß sie ihm Hoffnungen machen, ihm Gelegenheit geben würde, sich vor ihren Augen auszuzeichnen. An einen Sieg hatte er geglaubt, weil ihm dieser Sieg der logische Abschluß dieser fünf Jahre zu sein schien. Erst dadurch hätte das Tolle, Sinnlose seinen Sinn bekommen. Und nun? Fünf Jahre waren vertan! Umsonst waren also alle zähen Kämpfe gewesen, umsonst Arbeit und Mühen, Haß und Dreck, Geiz und Selbstsucht!
Trotzig reckte sich Hermann Horn gegen sich selbst auf. Nun nur nicht sentimental werden! Er hatte geirrt. Das war schon manchem besseren Mann vor ihm so gegangen. Da mußte man eben zusehen, daß man den Weg zurückfand! Freilich, ein fünf Jahre langer Irrweg war schon ein gewaltiges Stück Weg, und es wird schwer fallen, ihn zurückzufinden. Die erste Voraussetzung dazu ist, sein Gepäck zu revidieren, alles, was überflüssig ist, über Bord zu werfen, sich zu entlasten, vor allem sein Gewissen zu entlasten. Man muß also zuerst streng mit sich selbst ins Gericht gehen, eine ehrliche Bilanz vor sich selbst ziehen.
Also: Du bist ein Esel gewesen, mein lieber Horn! Du hast geglaubt, ein Allerweltskerl zu sein, und warst dabei nur ein blöder Träumer! Du hast geschuftet und geschuftet und hast doch nicht erreicht, was du wolltest. Gewiß, zwanzigtausend Dollar hast du dir erspart. Aber was sind dir diese zwanzigtausend Dollar jetzt? Mühsam erworbenes Geld, an dem mehr als genug Schmutz und Haß kleben; Geld, mit dem du dich vor dir selbst verächtlich gemacht hast und für das du jetzt keine Verwendung weißt! Nirgendwo in der Welt wartet auf dich ein Mensch, dem du eine Freude bereiten könntest. Nicht einmal für deine Heimreise brauchst du Geld. Du könntest dir einfach wieder eine Heuer suchen. Aber kannst und willst du denn wieder zurück, solange du nicht wieder ehrlich vor dir selbst geworden bist? Also ein Gewinnposten sind diese zwanzigtausend Dollar nicht. Auf der anderen Seite aber steht der Verlustposten riesengroß da. Fünf Lebensjahre vertan in einem Lande, in dem du nichts zu suchen hast, unter Menschen, die dich nicht interessieren; dazu die Heimat verloren, bis man durch ehrliche Arbeit vor sich selbst wieder bewiesen hat, daß man ihrer würdig ist; und endlich den höheren Zweck des Daseins verloren! Oder sollte das ein Aktivposten sein? Ist vielleicht der einzige Gewinn dieser fünf Jahre die Erkenntnis: es ist alles sinnlos auf dieser Welt? Horn stöhnt vor Ratlosigkeit. Diese verdammten Weiber! flucht er und schwört bei sich selbst, sich niemals wieder von einer Evatochter von seinem Weg abbringen zu lassen. Da stolpert sein Fuß über einen hartgebackenen Lehmklumpen. Hermann Horn wäre beinahe gestürzt und beginnt nun wieder, auf seine Umwelt zu achten. Er war von der asphaltierten Straße abgekommen und auf einen holprigen Landweg geraten, der sich in weiten Windungen zwischen immer höher aufstrebenden Berghängen dahinwand. Seitwärts weidete zwischen Kakteen und dürftigem Gras eine kleine Ziegenherde. Von der Stadt und ihren Villenvororten war nichts mehr zu sehen.
Hermann Horn ahnte nicht, daß er vor einer neuen Schicksalswende stand, als er die Höhe hinaufschlenderte. Sie zu erklimmen, war unter dem Druck der sengenden Sonnenstrahlen schwieriger, als er gedacht hatte. Als er es endlich geschafft hatte und nach einem schattigen Ruheplatz Ausschau hielt, fiel sein Blick zufällig in ein stilles Seitental, durch das sich eine Abzweigung des Weges schlängelte. Er stutzte. Was war denn das für ein Wagen, der da mitten auf dem Wege stand? Er war ein gut Stück entfernt, wohl an dreihundert Meter, aber der sonderbare grellrote Anstrich des großen, schwerbereiften, fest geschlossenen Lastkraftwagens leuchtete wie eine lodernde Fackel zu ihm herauf.
Hermann Horn wußte sofort Bescheid. Er hatte sich ja lange genug im Lande des Petroleums herumgetrieben. Er hatte solche Autos oft gesehen, als er noch in den Pozos als Arbeiter an den Bohrtürmen beschäftigt gewesen war. Ein „Suppenwagen“ war das, einer der Lastwagen, die das Nitroglyzerin zu den Oelfeldern brachten, einer der Wagen, die am meisten gehaßt und gefürchtet werden.
Das Nitroglyzerin ist das gefährlichste aller Explosivmittel. Es wird zum Auflockern ölhaltiger Sandschichten und zum Ausblasen brennender Sonden auf den Oelfeldern benutzt. Die Wagen, die es in eigens dazu konstruierten Kannen befördern, sind zur unübersehbaren Warnung für alle, die in seine Nähe kommen, grellrot gestrichen. Sie dürfen nur bei Nacht fahren, nur außerhalb geschlossener Siedlungen halten und müssen Städte mit mehr als zehntausend Einwohnern in weitem Bogen umfahren. Trotz aller nur erdenkbaren Sicherheitsmaßnahmen, trotz Gummikannen und bester Federung, fliegt jeder fünfte dieser Suppenwagen in die Luft; denn das Nitroglyzerin explodiert bei der geringsten Spannungsverlagerung. Eine etwas zu schnelle Temperatursteigerung, ein kleiner Stoß oder Schlag, ein Stein im Weg oder auch nur ein allzu scharfes Anlassen des Motors kann genügen, um den roten Dreitonner, in tausend Splitter zerfetzt, in die Luft fliegen zu lassen. Ein tiefer Sprengtrichter in der Straße zeigt dann an, wo die Katastrophe eingetreten ist.
Horn bog in den Seitenweg ein und näherte sich dem Auto. „Tatsächlich ’ne Suppenkutsche“, murmelte er. „Der Fahrer scheint sich verdrückt zu haben.“
Das war nichts Sonderbares. Horn kannte die Verhältnisse im Reiche des Erdöls. Die „Suppenkutscher“ mußten bei jeder Radumdrehung mit einer „Himmelfahrt“ rechnen. Sie verdienen einen Dollar pro Meile, und manche bringen es auf fünfzig bis sechzig den Tag. Aber die grauenhafte Angst vor dem lauernden Tod, die ständig wachsende Möglichkeit, in Stücke gerissen, zerstäubt zu werden, frißt an ihren Nerven. Oft genug kommt es vor, daß einen solchen Wagenlenker mitten auf dem Weg derart das Grauen packt, daß er sein Auto einfach stehen läßt und wie ein von Dämonen Gehetzter davonrennt. Wahrscheinlich stand auch der rote Kasten hier bereits seit der Nacht herrenlos auf diesem abseitigen Wege. Von dem Fahrer war jedenfalls keine Spur mehr zu entdecken.
Hermann Horn ging vorsichtig um den roten Wagen herum und besah ihn sich von allen Seiten. Dann öffnete er die Haube des Motors. Es schien alles in Ordnung zu sein. Auch der Benzintank war gefüllt. Und sonst ...? — Der Wagen hatte volle Ladung. Natürlich, er war zweifellos aus dem in der Nähe liegenden staatlichen Sprengstoff-Depot gekommen und hatte seine „Suppe“ an Bord.
Horn grübelte. Wollte ihn die Vorsehung auf die Probe stellen? Sollte er hier die entsühnende schwere Arbeit finden, die er sich selbst als Vorbedingung seiner Heimkehr gestellt hatte? „Sehen wir mal nach, wo sein Bestimmungsort ist“, brummte er und nestelte die große Ledertasche an der Innenseite des Wagenschlags auf. „Da sind ja die Papiere, der Führerschein! So, Charles Turner heißt der Brave. Nordamerikaner wahrscheinlich. Und hier die Marschroute. Bestimmungsort: Pozo Tortilla. Hm. Diesen ‚Pfannkuchen‘ kenn’ ich noch nicht. Jedenfalls ein geschmackvoller Ort, den man sich mal ansehen sollte.“
Er suchte noch einmal die Umgegend sorgfältig ab, ob der Wagenlenker irgendwo zu finden sei. Dann schwang er sich kurz entschlossen auf den Lenksitz und probierte vorsichtig den Motor und Steuer. Alles war in Ordnung. Es war schon so, wie er sich gedacht hatte: Der brave Charles Turner hatte es mit der Angst bekommen und war vor seinem Höllenauto geflüchtet.
Horn bot ein merkwürdiges Bild, wie er dasaß auf dem Lenksitz des Suppenwagens, in seinem tadellosen, hellgrauen Straßenanzug, mit seinen feinen, gelben Halbschuhen und der zart getönten Seidenwäsche. Er kam sich selbst reichlich stilwidrig vor und begann in dem kleinen Verschlag zu kramen. Richtig, da hatte der Fahrer in seiner kopflosen Flucht seinen zusammengeknüllten, ölfleckigen Staubmantel zurückgelassen. Während Hermann Horn ihn überstreifte, dachte er noch eine Minute an sein Gepäck in dem vornehmen Hotelzimmer unten in der feudalen Residenzstadt. Nun, er würde es sich irgendwohin nachschicken lassen und die Rechnung von irgendwoher begleichen. Und sonst hatte er von niemandem und nichts Abschied zu nehmen. Er begann ohne jeden Ballast sein neues Leben als Hermann Horn, der Suppenfahrer.
„Fünf Groschen für mein Leben!“ brummte er und brannte sich auf dem Lenksitz des gefährlichen Wagens gleichmütig eine Zigarette an.
Dann gab er Gas und fuhr vorsichtig an.
Ein brüchiger, altersschwacher Kleinwagen stuckerte asthmatisch durch die trostlose Gegend. Ingenieur Benzon döste in dem offenen Wagen vor sich hin. Nur wenn die Räder gar zu hart über einen Stein holperten und ihm einen kräftigen Stoß versetzten, brüllte er dem Mulatten, der am Lenkrad saß, ein paar Scheltworte zu. Sand, Lehm, vereinzelte Kakteen und die stumpfen Pyramiden der Bohrtürme, die allenthalben steif in die Luft stachen, das war das ermüdende, trostlos eintönige Bild, das er tagtäglich sah; denn täglich mußte er in diesem alten Rumpelkasten seine sechzig Kilometer Inspektion fahren.
Endlich hielt der Wagen mit einem Ruck mitten in einer seichten Pfütze schwarzer, öliger Flüssigkeit. Das Kreischen des Bohrmeisels von Sonde 123 erfüllte die Luft, ein Laut, der Benzons Ohr schon so vertraut war, daß er ihn kaum mehr wahrnahm.
Vom Bohrgestänge her stapfte ein Mann durch den klebrigen Dreck auf den Wagen zu und winkte lässig mit der Hand: „Hallo, Benzon!“
„Hallo, Carstensen!“ Der Ingenieur und der Bohrmeister von Sonde 123, die einzigen Skandinavier im Pozo, mußten schreien, um sich durch den Lärm des Meisels verständlich zu machen.
„Habt ihr den Meisel drüben in Sonde 120 gefunden?“
„Ja, endlich hat der Fänger ihn erwischt. Genau zehn Tage hat das Suchen gedauert. Schweinerei verfluchte!“
„Sei froh, daß ihr ihn habt.“
„Ja, nun kann’s drüben wieder weitergehen. Wie weit seid ihr hier?“
„Auf 720 Meter. Eben angeschlagen.“
„Also noch zwei Wochen Arbeit?“
„Vielleicht.“ Der Bohrmeister Carstensen wischte sich mit der ölbeschmutzten Hand über die Stirn, was sein ohnehin wie unter einer schwarzen Maske steckendes Gesicht nicht schöner werden ließ. „Neunhundert sollen wir ja bohren. Aber ich glaube, es gibt bald ein bißchen Abwechslung bei uns. Die Enrobage fängt an, dünn zu werden wie ’ne Eierschale,“
„Und?“ Ingenieur Benzons müde Gleichgültigkeit verflog mit einem Schlage. „Salzwasser!?“
„Nee, bis jetzt keine Anzeichen. Ich sehe schwarz.“
„Gott sei dank!“ Benzon atmete auf. In der Sprache der Oelleute bedeutete die Redewendung „Ich sehe schwarz“ genau das Gegenteil des sonst Ueblichen. Wenn Carstensen also schwarz sah, hieß das Hoffnung auf eine ergiebige Quelle. Und Carstensen war ein alter Pozo-Mann, der wußte, was er sagte!
„Alles Gute, Carstensen! Wird auch Zeit, daß wir wieder mal was Vernünftiges erbohren. Die Sonden 112 und 115 verlohnen ja kaum noch die Betriebskosten. Von den Toten gar nicht zu reden.“
„Das kann man wohl flüstern, Benzon Uebrigens du hast Besuch bekommen. Deine Schwester ist da.“
„Und das sagst du mir jetzt erst!?“ Ingenieur Benzon sprang mit einem Satz aus dem Wagen, mitten in die stinkende, schwarze Pfütze. „Wieso denn? Wie kommt Karen denn hierher?“
„Weiß ich nicht. Jedenfalls fragte vorhin ’ne junge Dame nach dir und sagte, sie sei deine Schwester.“
„Da soll doch ...! Wo ist sie denn?“
„Drüben natürlich. In deiner Bude.“
Ingenieur Benzon lief so schnell durch den Dreck auf das „Verwaltungsgebäude“ zu, daß selbst die stumpfen, gleichgültigen Pozoleute verwundert den Kopf hoben und ihm nachsahen.
Das sogenannte Verwaltungsgebäude war ein schmuckloses Holzhaus, etwas größer und höher als die umliegenden niedrigen Wellblechbaracken. Es enthielt drei mittelgroße Räume: das „Büro“ und zwei Wohnräume, von denen Benzon jedoch nur den einen benutzte, während in dem anderen allerlei Gerümpel, Proviantkisten und Werkzeuge aufbewahrt wurden. Er riß die Tür zum Büro auf und sah sich um. Wahrhaftig, da lag Karens Staubmantel aus gestreifter Seide! Und da ihre Kappe! Ihre Handschuhe! „Karen! Karen!“
Die Tür zum „Wohnraum“ öffnete sich. Ein junges Mädchen trat heraus, eine Schürze umgebunden, ein altes Tuch um das Haar geknotet, das Gesicht hochrot und die Hände naß vom Waschwasser. Eine Sekunde stand sie da, dann flog Karen Benzon über Eimer und Schrubber hinweg mit einem Freudenschrei in die Arme ihres Bruders.
„Karen! Mädel! Verrücktes Mädel, du! Wie kommst du hierher? Nu sag mal, Kind! Ich denke, du sitzt wohlversorgt in Tschatta-Hill?“
„Nicht böse sein, Kai“, lachte das Mädchen in seinen Armen. „Ich hielt’s nicht mehr aus und da bin ich eben ... Aber laß mich erst mal die Arbeitskluft abbinden. Sie sagten, du kämst erst heute abend zurück. Da hab’ ich mir gleich mal deine Bude vorgenommen. Das sieht ja gräßlich aus bei dir!“
„Ach, laß das! Erzähl mir lieber, weshalb du hierher kommst! Hast du das Geld nicht bekommen, das ich dir schickte?“
Angekommen ist’s schon, Kai, aber gesehen hab ich keinen Cent davon. Mr. Wymmers behauptete, noch eine ganze Reihe Forderungen an dich zu haben, die er erst einmal von dem Geld abdecken müsse.“
„Den Deubel hat er, der alte Gauner! Hat er dich etwa vor die Tür gesetzt, armes Kind?“
„Bewahre! Mrs. Wymmers erzählte mir jeden Tag, wie dankbar ich dem lieben Gott sein müsse, daß ich den Zufluchtsort bei ihnen hätte. Ach, Kai, seitdem wir unsere Plantage an die Wymmers verkaufen mußten, seitdem du weg bist ... du weißt ja gar nicht, wie böse ich auf dich war, weil du mit Wymmers ausgemacht hattest, daß ich bei ihnen wohnen bleiben sollte. Das kaltschnäuzige, geldgierige Gesicht Mr. Wymmers, die bigotte, heuchlerische Frömmigkeit seiner Frau ... Ich hielt das nicht mehr aus. Da habe ich heimlich meinen letzten Schmuck verkauft und bin auf einem Frachtdampfer losgefahren. Scheußliche Reise, aber vor fünf Tagen bin ich glücklich gelandet. Freust du dich gar nicht ein bißchen?“
„Doch, doch ... natürlich ...“ stotterte Benzon verwirrt. „Aber wie bist du denn hier nach Tortilla gekommen? Die Eisenbahn geht doch nur bis ...“
„Das hat mir der Käppen auf dem Frachtdampfer schon auseinandergesetzt. Ein netter Kerl. Er half mir auch, im Hafen für billiges Geld ein altes Auto zu erstehen. Achtzehn Pannen habe ich mit dem Scherbenquetscher gehabt, aber geschafft hat er es schließlich doch, obwohl er von Rechts wegen längst ausrangiert werden müßte!“
„Tolles Mädel! Aber ... ja, hat dich denn niemand angehalten? Um das Oelgebiet zu besuchen, muß man doch von der Behörde einen Erlaubnisschein haben.“
„Ist vorhanden“, lachte Karen vergnügt. „Auch darüber hatte mich der nette Kapitän informiert. Ich bin erst mal in die Hauptstadt gefahren und habe mir von der Regierung so einen Schein ausstellen lassen. Zum Glück konnte ich ja nachweisen, daß mein Bruder Ingenieur in Tortilla ist. Du, die Leute waren höflich und entgegenkommend.“
„Wie konntest du nur allein losreisen, Kind! Mir brummt der Schädel! Und nun bist du also ... nun willst du bei mir bleiben ...? Hier, in dem Dreck?“
„Fortschicken kannst du mich nicht, Kai“, schmeichelte Karen, sich an den Bruder hängend. „Natürlich bleibe ich hier bei dir.“
Ingenieur Benzon tat einen tiefen Atemzug. „Kind, Kind, wie du dir das vorstellst. Hier im Camp willst du leben? Das ist doch unmöglich! Herrgott nochmal, da denkt man, die Schwester sitzt gut und warm drüben auf der lieben, alten Plantage, man meint, sie ist bewahrt vor den bösen Folgen des Zusammenbruchs, während man selber hier unten in Dreck und Speck ... Mädel, du hast ja keine Ahnung, was das heißt, hier im Pozo zu leben! Sonnenglut, entnervende Einförmigkeit, Gestank, Schmutz ...!“
„Ja, reichlich schmutzig ist’s schon hier, Kai. Schämst du dich gar nicht? Wie dein Zimmer aussieht! Ich habe gleich angefangen, mit Besen und Schrubber ordentlich sauber zu machen.“
Kai Benzon warf einen Blick durch die Tür des Nebenzimmers und stöhnte. „Gleich eimerweise hast du das Wasser verspritzt! Mädel, was wirst du noch lernen müssen! Unsere Wasserration beträgt pro Kopf und Tag genau fünf Liter! Wer zusätzlich Wasser haben will, muß dem Halsabschneider im Store ein Schweinegeld dafür bezahlen.“
„Es wird schon irgendwie gehen, Kai. In solchem Schweinestall darfst du nicht länger hausen. Und das Zimmer daneben? Ich hab vorerst mal das ganze Gerümpel in den Schuppen hinübergetragen.“
„Was? Die Kammer hast du auch schon ausgeräumt?“
„Ja, natürlich! Wo soll ich denn schlafen? Aber nun laß mich schnell den Aufwasch beenden! Dann koch ich einen anständigen Nachmittagskaffee, ja?“
Benzon ließ resignierend die Schultern hängen. „Du willst also wirklich hierbleiben, Karen?“
„Puh, wie das hier aussieht!“ Karen schob die wirren, von Oelfingern befleckten Papiere auf dem Schreibtisch beiseite, und setzte sich mit einem Schwung auf die Tischplatte. „Ich bleibe bei dir, Kai, das steht fest. Du hättest mich gleich mitnehmen sollen, statt ... Genug davon! Für mich gibt es kein Zurück! Selbst wenn du mir das Reisegeld gäbest, ich ginge nicht!“
„Also dann ... ich kenn dich, Trotzkopf. Aber wie das werden soll, weiß ich nicht ... das weiß ich wirklich nicht.“
Die hellen Augen Karens liefen verwundert über das bekümmerte, bedrückte Gesicht des Bruders. „Warum bist du so niedergeschlagen, Kai? Und wie schlecht siehst du aus! Und ich war so stolz auf dich, als du von deiner Stellung hier schriebst. Ich dachte mir, hier im Oelgebiet, im Kampf um das schwarze Gold, da gäbe es nur Männer, verstehst du, starke, entschlossene Männer, Führernaturen, die lachend den Kampf aufnehmen mit Natur und Menschen.“
Benzon ließ sich auf einen wackligen Stuhl nieder und seufzte ironisch. „Romantisches Seelchen. Ich weiß noch, wie du, als wir nach Virginia kamen, geschwärmt hast für die ‚markigen Gestalten‘, die einstmals mit ihren Ochsengespannen durch Prärie und Savannen zogen. Westward ho! Wurde nachher eine böse Enttäuschung für dich, als du dann drüben in God’s own country die Brüder kennenlerntest.“
„Ach, in Dollarika! Aber hier?“
Es zuckte nervös um den Mund des Ingenieurs. „Hier ist es hundertfach schlimmer, Karen. Stumpfsinn! Zermürbende Eintönigkeit. Tag für Tag das gleiche! Gestank und Schmutz, Hitze und Langeweile, ununterbrochene, gleichförmige Arbeit! Hier in den Pozos findest du keine Helden. Nur stumpfsinnige Peonen und vom Leben zermürbte Männer mit zerrissenen Nerven.“
„Aber ich habe meinen Bruder gefunden.“ Karen glitt von ihrem Sitz herab und strich zärtlich tröstend über sein beschmutztes, müdes Gesicht. „So, und nun laß mich an meine Arbeit gehen, Kai. Sonst kriegen wir keinen Kaffee.“