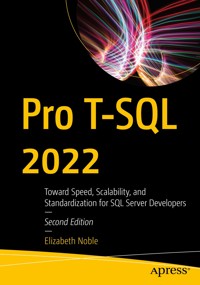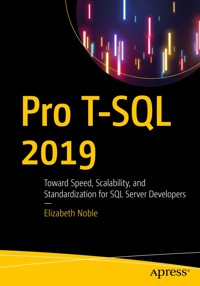4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf jeder Seite ein Funken Hoffnung: Der berührende Schicksalsroman »Für immer bei dir« von Elizabeth Noble jetzt als eBook bei dotbooks. Ihr ganzes Leben waren Barbaras Töchter so unterschiedlich wie Tag und Nacht – doch jetzt müssen sie sich einer gemeinsamen Herausforderung stellen: Als ihre geliebte Mutter stirbt sind die vier am Boden zerstört – doch dann finden sie die Briefe, die Barbara für sie alle geschrieben hat und für jede von ihnen beginnt eine letzte Reise an ihrer Seite: für Jennifer, deren Ehe in einer tiefen Krise steckt, während Lisa, die sich von einer Beziehung in die nächste flüchtet. Amanda dagegen reist seit Jahren rastlos um die Welt umherreist und die junge Hannah muss erst einmal lernen, auf ihren eigenen vier Beinen zu stehen. Mit der Hilfe von Barbaras letzten Ratschlägen stellen sich die vier Schwestern nicht nur ihrer Trauer, sondern auch den Herausforderungen des Lebens – und erkennen schließlich, dass das Band, dass sie alle verbindet, stärker ist, als sie es jemals für möglich gehalten haben … »Meisterhaft geschrieben, ergreifend und zum Nachdenken anregend – mit Tränengarantie!« The Sun Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Liebesroman »Für immer bei dir« von Elizabeth Noble wird alle Fans von Cecilia Ahern und Kristin Hannah begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ihr ganzes Leben waren Barbaras Töchter so unterschiedlich wie Tag und Nacht – doch jetzt müssen sie sich einer gemeinsamen Herausforderung stellen: Als ihre geliebte Mutter stirbt sind die vier am Boden zerstört – doch dann finden sie die Briefe, die Barbara für sie alle geschrieben hat und für jede von ihnen beginnt eine letzte Reise an ihrer Seite: für Jennifer, deren Ehe in einer tiefen Krise steckt, während Lisa, die sich von einer Beziehung in die nächste flüchtet. Amanda dagegen reist seit Jahren rastlos um die Welt umherreist und die junge Hannah muss erst einmal lernen, auf ihren eigenen vier Beinen zu stehen. Mit der Hilfe von Barbaras letzten Ratschlägen stellen sich die vier Schwestern nicht nur ihrer Trauer, sondern auch den Herausforderungen des Lebens – und erkennen schließlich, dass das Band, dass sie alle verbindet, stärker ist, als sie es jemals für möglich gehalten haben …
Über die Autorin:
Elizabeth Noble wurde 1968 in England geboren und studierte englische Literatur in Oxford. Danach arbeitete sie einige Jahre im Verlagswesen, bis sie die Liebe zum Schreiben schließlich dazu brachte, ihre eigenen Romane zu veröffentlichen, von denen viele zu internationalen Bestsellern wurden.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre Romane:
»Die Farbe des Flieders«
»All die Sommer zwischen uns«
»Für immer bei dir«
»So wie es einmal war«
»Das leise Versprechen des Glücks«
»Wo die Liebe zu Hause ist«
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2008 unter dem Originaltitel »Things I Want My Daughters To Know« bei Michael Joseph, published by the Penguin Group London.
Copyright © der englische Originalausgabe 2008 by Elizabeth Noble
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, Münchnen, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung eines Motives von Jung Suk hyun / stock.adobe.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-816-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Für immer bei dir« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Noble
Für immer bei dir
Roman
Aus dem Englischen von Gabriela Schönberger
dotbooks.
Für meine beiden Töchter, Tallulah Ellen Young und Ottilie Florence Young.
In Liebe.
12. Juni
Meine Lieben,
obwohl ich es gewohnt bin, die Dinge immer selbst in die Hand zu nehmen, werde ich mich aus meiner eigenen Beisetzung ausnahmsweise weitestgehend heraushalten. Bringt die Sache einfach sobald wie möglich hinter euch. Das ist für alle Beteiligten das Beste. Lisa weiß Bescheid wegen der Musik, das heißt, falls ihr euch das anhören mögt, was ich mir ausgesucht habe. Den generellen Ablauf der Beisetzung haben wir besprochen – ihr wisst ja, dass ich nur euch dabeihaben will, und welchen Sarg und welch verruchtes Leichenhemd ich ausgewählt habe, wisst ihr auch. Im Übrigen wünsche ich mir das folgende Gedicht, das ich wahrhaftig liebe. Ich danke Gott für meine Schlaflosigkeit und das Internet, sonst hätte ich es wohl nie gefunden, und ihr hättet euch irgendwelche schwülstigen Sprüche aus den Fingern saugen müssen. Das Gedicht soll jemand vorlesen, der glaubt, es vortragen zu können, ohne dabei loszuheulen – denn das ist meine einzige und wichtigste Regel. Bitte keine Tränen, das heißt, falls ihr das schafft. Ach ja, und kein Schwarz. Zieht eure bunteste Kleidung an, die ihr im Schrank findet. Ich weiß, das ist auch wieder nur ein Klischee, aber lieber die heitere als die düstere Variante. Und sorgt bitte dafür, dass die Sonne scheint (obwohl mir natürlich durchaus klar ist, dass ihr darauf nur geringen Einfluss habt). Ansonsten verzichte ich in diesem Brief auf alles allzu Persönliche – hier geht es ums Geschäftliche –, aber ich kann euch versprechen, dass weitere Briefe folgen werden. Ich habe euch nämlich noch ein paar andere Dinge zu sagen, das heißt, falls ich lange genug durchhalte, sie zu Papier zu bringen ... (schon witzig, dieser gallige Humor Todgeweihter, nicht wahr?).
Tut mir leid, dass ich euch das alles zumute. Ehrlich.
Also, in Liebe, auf immer und ewig ...
Mum
Steht nicht an meinem Grab und weint,
Ich bin nicht hier, ich schlafe nicht.
Ich bin die tausend Winde,
Das diamantne Glitzern auf dem Schnee,
Ich bin der Sonnenschein auf reifem Korn,
Ich bin der Regen, zärtlich sanft im Herbst.
Wenn ihr erwacht in morgendlicher Stille,
Bin ich der schnelle Flügelschlag
Stiller Vögel in kreisendem Flug.
Ich bin das sanfte Licht der Sterne in der Nacht.
Steht nicht an meinem Grab und weint,
Ich bin nicht hier, ich sterbe nicht.
(Ist das nicht ein perfektes Gedicht für eine Trauerfeier auf der grünen Wiese?!)
August
Kapitel 1: LISA
Lisa ließ sich vorsichtig in das heiße, mit aromatischem Öl angereicherte Schaumbad zurücksinken und betrachtete die Fotografie, die sie vom Klavier genommen und mit nach oben gebracht hatte. Sie hatte das Bild hinter die Armaturen geklemmt, sodass sie es vom Kopfende der dampfenden Badewanne aus sehen konnte, und bemühte sich, es nicht nass zu spritzen. Es war ein Schwarzweißfoto ihrer Mutter Barbara, aufgenommen am Hochzeitstag ihrer Schwester Jennifer vor acht Jahren. Mum sah atemberaubend schön aus in ihrem raffiniert schlichten Outfit und mit der neuen Frisur. Für eine Frau wie sie kam kein pfirsichfarbenes Brautmutterkostüm infrage. Lisa sah ihren Hut wieder vor sich – ein kaffeebrauner Strohhut mit weicher Krempe, groß wie ein Wagenrad, der jedem in den vier Bankreihen hinter ihr die Sicht auf die Zeremonie versperrte. Warum sie lachte, war nicht ersichtlich, und Lisa erinnerte sich auch nicht mehr an den Grund – aber ihre Mutter hatte den Kopf in den Nacken gelegt und stieß ihr lautes, herzhaftes Lachen aus. Den hinderlichen Hut hatte sie schon längst abgenommen, und die sommerliche Brise wehte ihr die rötlich braunen Locken ins Gesicht. Ihr großer, ausdrucksvoller Mund stand weit offen, sodass man eine Füllung in der oberen Zahnreihe sehen konnte, und um ihre haselnussbraunen Augen bildeten sich feine Lachfältchen. Dieses Foto war eine besonders gelungene Aufnahme ihrer Mutter, obwohl Barbara stets sehr fotogen gewesen war. Lisa glaubte fast, ihr tiefes, kehliges und unbändig lebendiges Lachen zu hören. Es war Mums heiseres Lachen, das ihr am meisten fehlen würde – das und der Duft von Fracas.
Unwillkürlich musste Lisa an das letzte Mal denken, als sie und ihre Mutter herzhaft zusammen gelacht hatten. Es war an dem Tag gewesen, an dem sie ihrer Mutter geholfen hatte, ihre eigene Trauerfeier zu planen. Mit Mark ginge das nicht, das könne sie nicht ertragen, hatte Barbara zu ihr gesagt. Er würde nur ständig in Tränen ausbrechen, und sie wolle doch auf keinen Fall weinen. Gegen Ende war sie fast besessen gewesen von dem Wunsch, nur ja nicht zu weinen. Hannah war offensichtlich zu jung dafür, und Amanda, die irgendwo in der Weltgeschichte herumschwirrte, war nicht greifbar. Und Jennifer ... tja, Jenny war nicht unbedingt der Mensch, der einem spontan in diesem Zusammenhang einfiele, meinte ihre Mutter, wobei sie das Gesicht verzog und mit den Augen rollte. Nein, dafür kam sie wirklich nicht infrage. Das sah Lisa, die einerseits starr vor Angst und Panik war, sich andererseits aber natürlich geschmeichelt fühlte, ebenso.
Lisa hatte jedoch nicht erwartet, dass der Nachmittag mit ihrer Mutter so rasend komisch werden würde, aber als sie jetzt darüber nachdachte, wusste sie keinen Grund dafür zu nennen, warum es nicht so hätte sein sollen. Ihr ganzes Leben lang hatten die beiden Frauen viel zusammen gelacht. Mum war es in dieser Woche recht gut gegangen. Sie war zwar dünn und hatte eine merkwürdige fahle, fast bläuliche Gesichtsfarbe, aber sie war noch immer mobil und energiegeladen. Auf dem Esszimmertisch hatte sie jede Menge Broschüren und Computerausdrucke vor sich ausgebreitet gehabt. Alles über Särge, Leichenwagen, Kränze ... Das Leben sei eine einzige Schnäppchenjagd, pflegte ihre Mutter immer zu sagen, aber der Tod anscheinend auch, wie es nun schien. Die letzte große Party, die man nicht versäumen durfte, wenn man es richtig anstellte. Die ersten zwanzig Minuten waren Lisa noch makaber und bizarr erschienen, doch irgendwann alberten die beiden Frauen nur noch herum, denn das erleichterte die Sache ungemein. Mum hatte sich sogar erkundigt, was ein von Pferden gezogener Leichenwagen kostete, aber sie beide kamen zu dem Schluss, dass die Leute wahrscheinlich kein Verständnis hätten für eine große, geschmacklose Verabschiedung, mit allem Pomp und lila Samtrüschen. Doch die Entscheidung für ihr Leichenhemd war bereits gefallen. Barbara wollte unbedingt das Kleid tragen, das sie auf der Millenniumsparty an Silvester anhatte, auch wenn es ihr inzwischen um einiges zu weit war. Eigentlich ein Grund zum Feiern und fast eine Rechtfertigung für eine Aufbahrung im offenen Sarg. Eine Woche lang hatte Barbara nur Kohlsuppe gegessen und Lymphdrainagen über sich ergehen lassen, damit ihr das Kleid am 31. Dezember 1999 passte. Es hatte auch wie angegossen gesessen, und zwar bis zum 1. Januar 2000, als die Wirkung der Massagen nachließ und die Zellulitis zurückkehrte. Lisa erinnerte sich genau an das smaragdgrüne Kleid aus fließender Seide, in dem ihre Mutter so gut ausgesehen hatte – so gut, dass sogar erwachsene Töchter neidisch werden konnten. Es hatte sich die Frage gestellt, was ihre Mutter darunter tragen sollte, und Lisa hatte sie zum ersten und letzten Stringtanga ihres Lebens überredet. Unter einem Kleid wie diesem sei dies die einzige tragbare Variante. Am Neujahrstag hatte Mum sie angerufen. Der Slip hatte so stark gekniffen, dass sie ihn nach ungefähr einer Stunde ausgezogen und ohne Unterhose in das neue Jahr hinübergefeiert hatte. Und das, man stelle sich nur vor, mit einem Friedensrichter, einem Magistrat und einem Schuldirektor am Tisch. Noch mehr Gelächter.
»Ist das nicht eine Verschwendung für ein Kleid von Ben de Lisi? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich es einmal erben werde«, hatte Lisa gefrotzelt. Jennifer wäre entrüstet gewesen. Woraufhin ihre Mutter augenzwinkernd erwiderte: »Tja, ist schade. Aber du erbst dafür ein bisschen Geld. Kauf dir davon ein eigenes Kleid.«
Was wirklich an die Nieren ging, war die Auswahl der Musik. Das übliche Trauergedudel könne sie nicht ertragen, meinte ihre Mutter – kein So nimm denn meine Hände (»kein Mensch schafft die hohen Stellen – da hört man immer die Tränen durch«); kein Näher mein Gott zu dir (»zu viel Titanic«). Lord of the Dance kam ebenso wenig infrage, denn dabei müsse sie unweigerlich an Michael Flatley denken. Und wer wollte sich schon dessen eitles Gehopse vorstellen, wenn man sich gerade seiner sterblichen Hülle entledigte? Und He’s Got the Whole World klang zu sehr nach Heilsarmee. Jerusalem war schon eher nach Mutters Geschmack. Das passte zwar mehr zu einer Hochzeit als zu einer Trauerfeier, aber wen kümmerte das? Und ganz besonders mochte sie Be Thou My Vision, vor allem in der Version von Van Morrison auf der Querflöte, obwohl sich das in der hohen Kirche sicher etwas dünn anhörte.
Auf der Suche nach einer Website mit nicht religiösen Musiktipps für diesen Anlass hatte Barbara auch das Internet durchforstet, und diese Liste hatte den beiden Frauen schließlich den Rest gegeben. Sie hatten Tränen gelacht. Frank Sinatras My Way: »Als ob ich es mir ausgesucht hätte, mit sechzig zu sterben!« Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye: »Na ja, wahrscheinlich immer noch passender als I Will Survive, aber wer, zum Teufel, sind alle diese Leute, die sich so etwas aussuchen, und warum war ich noch nie zu einer ihrer Beerdigungen eingeladen?«, hatte Barbara prustend gefragt. Bei der Vorstellung, dass der Sarg zu den süßlichen Klängen von Doris Days Que Sera Sera aus der Kirche getragen werden würde, verkrampfte sich schmerzhaft ihr Zwerchfell, und der Gedanke, sich ergriffen Vera Lynns We’ll Meet Again anzuhören, ließ Mutter und Tochter sich ausschütten vor Lachen. Nachdem die beiden wieder Luft geholt und ihre tränennassen Gesichter getrocknet hatten, hatten sie sich schließlich auf Wonderful World von Louis Armstrong geeinigt. Doch in dem Moment, als ihre Mutter entschlossen nickte und mit ihrer runden, mädchenhaften Handschrift den Titel auf ihren DIN-A4-Block schrieb, ertönte die Melodie in Lisas Kopf, und sie musste sich abwenden, damit ihre Mutter nicht die erneuten Tränen sah, die wahrzunehmen sie sich weigerte.
Und nun war der Tag gekommen, der Tag, den sie so penibel vorbereitet hatten, und auf den sie dennoch so wenig vorbereitet waren. Van Morrison und Louis Armstrong warteten in dem tragbaren CD-Player, und der Organist hatte seine Notenblätter bei Jerusalem aufgeschlagen. Nur dass das alles jetzt gar nicht mehr lustig war. Lisa ließ sich in das heiße Schaumbad gleiten, bis ihr das Wasser über dem Gesicht zusammenschlug und sie die Augen zusammenkneifen musste. Wäre Andy doch nur da gewesen.
Kapitel 2: JENNIFER
Stephen wollte nur rasch einen Platz für das Auto suchen, hatte er gesagt, aber das war nun schon eine ganze Weile her. Die Auffahrt war belegt von Marks Wagen und Mums Polo, auch Lisas VW Käfer stand da. Sie wollte über Nacht bleiben, hatte sie gemeint, als sie am gestrigen Vormittag darüber gesprochen hatten. Also war Stephen ein paar Meter weiter die Straßen hinuntergefahren und hatte dort geschickt eingeparkt. Jennifer konnte ihn schließlich sehen. Er hatte den Motor abgestellt und das Fenster ein Stück heruntergelassen. Jetzt griff er nach seinem BlackBerry und starrte darauf. Der heutige Tag kam ihm schrecklich ungelegen. So viel hatte Jennifer begriffen. Er hatte diese Kunden am Hals, die auf der Durchreise von irgendwoher in London waren. Sie hätten sich nur heute mit ihm treffen können; sie waren wichtig. Stephen hatte es ihr deutlich unter die Nase gerieben. Offenbar waren sie aber nicht wichtiger als sie, denn er war hier und nicht dort, doch er hätte ebenso gut dort sein können. Sehr feinfühlig hatte er sich trotzdem nicht verhalten. Er hätte ihr überhaupt nichts zu erzählen brauchen über irgendwelche Kunden, Meetings oder Geschäftsessen. Immerhin trug sie heute ihre Mutter zu Grabe. Dieses Thema hätte überhaupt keine Rolle spielen dürfen. Er war ihr Ehemann. Auf dem Weg hierher war Stephen absolut unleidlich gewesen. Der Empfang im Radio war unscharf – wütend hatte er abgeschaltet. Die Schlange für den Kaffee im Bistro an der Tankstelle war zu lang – dramatisch seufzend hatte er sich eine Cola gekauft. Und jetzt war es ihm offenbar zu heiß. Er hatte die Jacke seines schwarzen Anzugs an den Haken über der hinteren Autotür gehängt, hatte den obersten Kragenknopf geöffnet und die schwarze Strickkrawatte gelockert. Jennifer verharrte ein paar Minuten am Ende der Auffahrt, bis ihr klar wurde, dass sie sich schämte, ohne ihn ins Haus zu gehen. Sie sollten zusammen sein. Es sollte eine Selbstverständlichkeit für ihn sein, bei ihr sein zu wollen, vor allem heute.
Stephen hasste Begräbnisse. Särge jagten ihm Angst ein, hatte er Jennifer vor langer Zeit einmal gestanden. Er musste dabei die ganze Zeit an den toten Körper darin denken und fragte sich, wie dieser wohl aussah, wie er roch, wie er sich anfühlte. Bei der Bestattung seines Großvaters – er war ungefähr acht Jahre alt gewesen – war er vollkommen ausgerastet. Er hatte so laut geschrien, dass man ihn aus dem Krematorium zerren musste.
Wenigstens mit dem Wetter hatte er Recht gehabt. Es war für den Anlass viel zu sonnig. Genau das hätte ihre Mutter sich zwar gewünscht, aber Jennifer kam das nicht richtig vor. Es war wie an dem Tag, an dem diese beiden Flugzeuge in das World Trade Center flogen. Während sie ihren endgültigen Abstieg in die Hölle antraten, war der Himmel hinter ihnen von einem irrealen, fast zu perfekten Blau. Das Bühnenbild passte nicht zum Stück. Jennifer wünschte sich einen schiefergrau verhangenen Himmel und Nieselregen; sie wollte zittern vor Kälte. Sie wollte keinen schönen Tag erleben, nicht heute.
Die Tür ging auf, und Mark erschien auf der Schwelle. »Jen?« Jennifer trat von einem Fuß auf den anderen, als hätte man sie bei etwas ertappt. Sie winkte und deutete in Richtung von Stephen. »Wir sind in einer Minute da. Stephen ist nur ...» Doch da kam Mark bereits auf sie zu. Er war noch nicht umgezogen für die Beisetzung und trug eine kurze Leinenhose, ein vergammeltes, pinkfarbenes T-Shirt und war barfuß. Er sagte kein Wort, als er bei ihr war, sondern breitete nur die Arme aus und drückte sie fest an sich. Jennifer spürte, wie sie sich augenblicklich verkrampfte, aber dann entspannte sie sich und lehnte sich an den Mann, der die vergangenen sechzehn Jahres ihres Lebens ihr Stiefvater gewesen war. Sie hatte es weiß Gott nötig, in den Arm genommen zu werden.
Als Mark sich von ihr löste, nahm er ihr Gesicht in beide Hände und betrachtete sie aufmerksam. Er roch nach Seife und Kaffee. »Wie geht es dir?«
»So weit ganz gut. Und dir?«
»Es fällt mir schwer.« Er zuckte mit den Schultern. »Sie hat das Wetter bekommen, das sie bestellt hat, wie?« Jennifer nickte und lächelte matt.
Mark warf einen Blick an ihr vorbei zu Stephen hinüber. »Kommt er rein?«
»Er muss nur noch was nachschauen ... Es hat eine Menge am Hals, in der Arbeit, weißt du, und ...»
Mark ergriff ihre Hand und drückte sie. Du musst nichts erklären oder ihn verteidigen, sagte sein Händedruck. Laut sagte er nur: »Mach dir keine Gedanken, wir haben keine Eile. Amanda ist noch gar nicht da. Die Show geht erst in ein paar Stunden los. Komm doch schon mal rein – ich habe gerade einen Kaffee aufgesetzt, und ich habe Muffins und Croissants ...» Jennifer warf einen letzten vorwurfsvollen Blick auf Stephens Hinterkopf, ehe sie mit Mark ins Haus ging.
Kapitel 3: HANNAH
Hannah starrte auf ihr Gesicht im Spiegel und fragte sich, ob es in Ordnung war, wenn sie sich die Wimpern tuschte. In der Schule durfte sie sich nicht schminken, aber am Wochenende und in den Ferien. Und in der Kirche? Sie konnte sich nicht an irgendwelche Verbote erinnern. Vielleicht würde sie mit getuschten Wimpern nicht weinen, weil sie dann verschmierte Augen bekäme. Vielleicht würde ihr das helfen, nicht zu weinen.
»Keiner war bei ihr, als sie starb.« Das war ein Zitat aus Wilbur und Charlotte, eines ihrer Lieblingsbücher, als sie noch jünger gewesen war. Und es war mit einer der schönsten Stellen, wenn die Spinne Charlotte ihr Netz zu Ende gesponnen und ihre Eier abgelegt hatte und sanft in das Vergessen hinüberglitt. »Keiner war bei ihr, als sie starb.« Es war so herrlich traurig. Man konnte sich diesem kleinen trockenen Schmerz in der Kehle und dem leichten Ziehen in der Herzgegend so wunderbar hingeben. Hannah liebte es, traurig zu sein, als sie noch jünger war, aber nur, solange die Trauer »künstlich« war. So nannte sie das, wenn der Auslöser der Trauer nicht real war. Wenn Leonardo di Caprio am Ende von Titanic in den eisigen Wellen versinkt, während Kate Winslet heiser flüsternd ihr Versprechen abgibt, ihn niemals zu vergessen. Oder wenn Charlotte im Buch stirbt. Nun, das hier war etwas anderes. Diese Trauer war echt, und der Schmerz war kein Genuss. Es kostete Hannah große Mühe, nicht zu weinen. Den ganzen Tag über strengte sie sich an, bis sie abends ins Bett gehen konnte und sich nicht mehr zusammenreißen musste. Vor allem heute. Sie alle hatten versprochen, sich zusammenzureißen. Sie hatten es Mum versprochen, auch wenn Hannah es nicht fair von ihr fand, sie darum zu bitten. Aber was war schon fair? Sie versuchte, nicht mehr an Charlotte zu denken. Nutzlose, dumme Spinne! Als Mum starb, waren jede Menge Leute bei ihr gewesen. Sie war inmitten vieler Menschen gestorben. Alle waren da gewesen und hatten sich um dieses schrecklich hohe Krankenhausbett versammelt, das man in das hübsche Zimmer geschoben und das dort so fehl am Platz gewirkt hatte. Ihre Schwestern Jen und Lisa ... Dad. Und der Pfarrer und der Arzt – beide mehr aus Zufall als geplant, überlegte Hannah. Dabei fiel ihr ein Gedicht von Philip Larkin ein, das sie in der Schule gelernt hatte – etwas über einen Priester und einen Arzt, die in ihren langen Mänteln querfeldein laufen und versuchen, Antworten auf die ewigen Fragen zu finden. Der Arzt kam jeden zweiten Tag, um nach Mum zu sehen, der Pfarrer, weil ihre Mutter nach ihm verlangt hatte. Was Hannah seltsam vorkam, da sie ihn ihrer Erinnerung nach in früheren Zeiten nur alle dreihundertfünfundsechzig Tage zu Gesicht bekommen hatte, und zwar am Weihnachtsmorgen, wenn er mit leuchtend roter, schnupfentriefender Nase O Little Town of Bethlehem schmetterte. Zu ihrem Vater sagte sie, dass ihre Mutter sich wohl nach allen Seiten absichere. Aber selbstverständlich nicht in Gegenwart des Pfarrers. Und im Erdgeschoß waren noch mehr Menschen anzutreffen, Freunde von Mum, die im regelmäßigen Turnus kamen und gingen, Tee kochten, den niemand trinken wollte, Sandwiches machten, die niemand essen wollte, und Anrufe entgegennahmen, die sonst keinen interessierten.
Hannah entschied sich gegen die Wimperntusche und griff nach der Bürste, mit der sie durch ihr langes, kastanienbraunes Haar fuhr. Mums Haar. Dads Haare waren an den Schläfen silbrig grau und oben am Kopf noch erstaunlich dunkel. Das wäre auch in Ordnung gewesen – die dunkle Farbe, nicht das Graue. Aber sie hatte nun mal Mums Haare geerbt. Als sie mit dem Bürsten fertig war, setzte Hannah sich an das Ende ihres Betts, faltete die Hände auf dem Schoß, presste sie zusammen und wartete.
Jennifer wollte keinen Kaffee, aber sie nahm den Becher trotzdem, damit ihre Hände etwas zu tun hatten, und wanderte damit durch das große Wohnzimmer. Das Haus war tadellos aufgeräumt. Im Sommer war es ein wunderbarer Ort. Mark hatte das Haus gebaut. Nicht mit eigenen Händen, doch er war Architekt und hatte es für sich und Mum in dem Jahr ihrer Hochzeit entworfen, kurz bevor Hannah zur Welt kam. Auf einem wunderschön gelegenen, drei Morgen großen Grundstück hatten die beiden einen grässlichen Bungalow, von dem bereits die senfgelbe Farbe abblätterte, erworben und umgehend vor den Augen der staunenden Nachbarn abgerissen, die sich kopfschüttelnd zuraunten, welche Mühe sich das ältere Paar, das ihn verkauft hatte, noch damit gemacht habe, jeden Nagel zu entfernen und jeden Riss in der Wand zu verputzen. Ein halbes Jahr hatte es gedauert, das neue Haus zu bauen, und diesen ganzen Sommer über hatten Mark und Barbara in einem Wohnwagen auf dem Bauplatz gewohnt. Jennifer sah ihre Mutter wieder vor sich, wie sie, schwanger mit Hannah, auf den Stufen des Wohnwagens stand und allen Tee anbot, den sie auf dem Campingkocher zubereitet hatte. Sie erinnerte sich bestens daran, wie schamlos ihr das damals erschienen war. Jennifer war zweiundzwanzig Jahre alt gewesen. Sie hatte seit ihrem achtzehnten Lebensjahr nicht mehr zuhause gewohnt und kannte Mark kaum. Irgendwie gehörte sich das nicht: Ihre Mutter, fünfundvierzig Jahre alt, die mit ihrem dicken, nicht zu übersehenden Babybauch mit einem zehn Jahre jüngeren Mann übergangsweise in diesem Chaos hauste. Jennifer hatte sich geschämt für sie. Oder für sich selbst?
Als sie jetzt dastand und in den Garten hinaussah durch die hohen Glastüren, die über die gesamte Rückseite des Erdgeschosses verliefen, fragte sie sich, ob sie nicht einfach nur eifersüchtig gewesen war. Sie hatte nie in diesem Haus hier gewohnt; sie war nie wirklich Teil des glücklichen, von Lachen erfüllten Familienlebens gewesen, das hier stattgefunden hatte, bevor ihre Mutter erkrankt war. Jede Ecke barg eine andere Erinnerung: Hannah als Baby auf einer karierten Decke unter diesem Apfelbaum, wie sie zufrieden mit ihren glatten, runden Ärmchen und Beinchen fuchtelte und strampelte. Ihre Mutter, die in ihrem geliebten Kräutergarten kniete und an den aromatischen Pflanzen zupfte. Mark, der die Hamburger auf dem Grill wendete; Mum, strahlend vor Glück und Zufriedenheit. Sie war stets nur eine Besucherin gewesen.
Stephen liebte das Haus. Als er das erste Mal hier gewesen war, war er stundenlang mit Mark herumgewandert und hatte Details bewundert, die Jennifer zuvor nie aufgefallen waren. Seine Fragen hatten jedoch nicht darauf abgezielt, dem Hausherrn zu schmeicheln, auch wenn Mark stets gern jede Gelegenheit nützte, mit dem Haus anzugeben. Jennifer wusste, dass Stephen sich eines Tages selbst so ein Haus wünschte. Natürlich konnten sie es sich noch nicht leisten. Doch ihre jetzige Wohnung – richtiges Viertel, hohe, sonnendurchflutete Räume – war immerhin ein guter Anfang. Sie war modern und schick eingerichtet, mit viel dunklem Wenge-Holz und Edelstahl. Mit dem Haus war sie jedoch nicht zu vergleichen, und das hatte nichts mit Geld zu tun. Es fehlte einfach die Atmosphäre.
Mark stellte sich neben sie und schaute ebenfalls in den Garten hinaus. »Müsste dringend mal gegossen werden. Alles stirbt.« Er schien nicht zu bemerken, was er gesagt hatte.
Sie lächelte ihn an. »Du hattest genug zu tun. Gönn dir eine kleine Verschnaufpause.«
»Sie wäre sauer.«
»Nein, bestimmt nicht.«
Mark schenkte ihr ein verhaltenes Lächeln, und Jennifer schmunzelte.
»Okay, vielleicht ein bisschen.«
»Wo ist Hannah?«
»Oben. Lisa hat gebadet – ich glaube, Hannah ist in ihrem Zimmer.«
»Kein Andy?«
»Nein. Ich habe sie nicht danach gefragt. Sie ist gestern Abend gekommen. Wir haben zusammen ein Curry gegessen und zu viel Rotwein getrunken. Aber sie hat ihn nicht erwähnt.«
Jennifer nickte. Sie überlegte, ob sie anbieten sollte, nach oben zu gehen und nach Hannah zu schauen. Aber eigentlich wollte sie nicht. »Wie geht es Hannah?«
»Sie ist sehr still. Seit Tagen schon. Kein Musikgedudel aus ihrem Zimmer. Sie hat auch kaum mit ihren Freundinnen telefoniert, und Besuch hatte sie auch nicht. Ich vermute mal, dass sie gern gekommen wären, wenigstens ein paar von ihnen, aber ich glaube nicht, dass sie mit jemandem gesprochen hat. Ich bin nicht einmal sicher, ob sie es ihnen überhaupt erzählt hat, obwohl sie es mittlerweile eigentlich wissen müssten. Nicht einmal Coronation Street hat sie sich angeschaut, und das macht mir wirklich Sorgen.« Er versuchte, unbekümmert zu klingen, aber das misslang ihm gründlich.
»Es ist noch so frisch, Mark. Sie hat ihre Mum verloren. Und sie ist erst fünfzehn.«
»Ich weiß. Es ... es ist hart. Ich bemühe mich ja, doch ich habe nicht mehr viele Reserven. Ich weiß, dass sie mich braucht. Aber ich ... ich brauche Barbara. Ich brauche sie, damit sie mir hilft. Aber sie ist nicht da.«
Oben klopfte jemand leise an Hannahs Tür.
»Herein.«
Es war Lisa, in ein Badetuch gehüllt, noch feucht von ihrem Schaumbad.
»Hast du was zum Schminken, Hannah? Ich habe alles vergessen. Ist das zu glauben? Darf ich reinkommen?«
Hannah nickte und deutete auf ihren Frisiertisch. »Aber nicht viel, nur ein bisschen – Wimperntusche, Lipgloss und so was. Nimm dir, was du willst.«
»Wunderbar.« Lisa schloss die Tür hinter sich und ließ das Handtuch zu Boden fallen. Darunter trug sie einen trägerlosen BH und einen Stringtanga, beides aus beigefarbener Spitze, die sehr teuer und hübsch aussah. Hannah reagierte verlegen, und Lisa sah, wie sie den Blick abwandte.
»Entschuldige meinen schamlosen Aufzug, aber mir ist so warm. Das Badewasser war viel zu heiß, und draußen hat es bestimmt schon fast dreißig Grad. Ich hätte lieber kalt duschen sollen.« Sie war ziemlich rot im Gesicht, und ihre Beine waren fleckig. »Ich habe ganz vergessen, dass du nicht an Schwestern gewöhnt bist, die nackt durch die Gegend laufen. Jen und ich haben das immer gemacht, als wir noch jünger waren.«
Das klang aber gar nicht nach Jennifer. »Ist schon in Ordnung.«
Lisa bemerkte den Blick ihrer Schwester. »Okay ... nicht Jennifer. Nur ich. Ich bin ständig nackt herumgelaufen, als wir noch jünger waren. Jen hat es über sich ergehen lassen.«
Lisa setzte sich an den Frisiertisch und fing an, sich zu schminken. Hannah fand nicht, dass sie es nötig hatte. Ihre Schwester war außergewöhnlich hübsch. Lisas Haare waren viel heller als ihre eigenen – rotblond mit hellblonden Strähnen. Und sie hatte winzige Sommersprossen auf Nase und Wangen. Doch ihre Wimpern und Augenbrauen waren überraschend dunkel (vielleicht färbte sie sie?), und die Farbe ihrer mandelförmigen Augen wechselte von Grün zu Haselnussbraun, je nach Tageszeit. Lisa hatte als Teenager bestimmt keine Pickel gehabt, dachte Hannah, und wenn, dann hatte Mum alle fotografischen Beweise weggeworfen. Lisa war schlank und groß, sie hatte eine tolle Haut und Haare, die immer gut aussahen, ohne dass man lange Zeit darauf hätte verwenden müssen. An ihr sah sogar ein schlichter Pferdeschwanz nicht so aus, als hätte sie keine Zeit mehr zum Waschen gehabt; an ihr wirkte er hübsch und natürlich. Hannah verspürte einen Anflug von Neid und Elend. Sie hatte zwar keine Pickel, und sie war auch nicht fett oder hässlich. So viel immerhin wusste sie. Sie fühlte sich nur einfach nicht wohl in ihrer Haut, so wie Lisa das zu tun schien. Und sie war nicht so locker wie ihre Schwester. Sie wäre lieber gestorben, als sich in BH und Höschen sehen zu lassen.
»Was ziehst du denn an?«, fragte sie Lisa.
»Tja ... Mum hat mich wirklich in die Bredouille gebracht mit ihren ›bunten, fröhlichen‹ Klamotten. Ich bin eher der Typ für Beige und Schwarz; ich mag lieber neutrale Farben. Aber im Sommerschlussverkauf habe ich noch was gefunden. Findest du es nicht auch schrecklich, dass sie schon im Juli damit anfangen – als ob der Sommer bereits vorbei sei, bevor er überhaupt angefangen hat. Es ist ein Kleid und leuchtend gelb, ein bisschen à la Jackie Kennedy, ein Strandkleid. Ich werde bestimmt wie eine riesige Banane darin aussehen. Aber es ist das, was sie wollte. Und du?«
»Ich habe dieses pinkfarbene Kleid vom letzten Sommer. Das habe ich zu einer Hochzeit getragen – die Schwester von meiner Freundin Amy hat geheiratet, und sie durfte eine Freundin einladen, und das war ich. Mum hat es mir gekauft, also hat es ihr auch gefallen. Der Stoff glänzt ein bisschen, und ...» Hannas Stimme verlor sich.
Lisa betrachtete sie mit zusammengekniffenen Augen im Spiegel. »Dann wird es ihr umso mehr gefallen«, sagte sie so sanft wie möglich und drehte sich auf dem Hocker um.
»Hannah?«
Hannah stand auf. »Sei nicht so nett zu mir, Lisa. Sonst fange ich noch zu weinen an. Bitte nicht, okay? Bringen wir es einfach hinter uns. Ich will einfach, dass es vorbei ist. Ist doch völlig egal, was wir dabei anhaben, oder? Das ist eine ganz blöde Regel.«
Lisa nickte und bemühte sich um einen betont munteren Tonfall, als sie weiterredete. »Na, was das betrifft, seid ihr beide euch ja einig, Jennifer und du. Sie hat mich gestern Abend am Telefon deswegen genervt. Sie hat gesagt, Stephen würde sich weigern, etwas anderes als Schwarz zu tragen. Sie hat gemeint, sie würde sich das auch überlegen. Ich habe ihr einen Kompromiss vorgeschlagen – schwarzes Kleid und rote Schuhe. Bin ja gespannt, was sie anhat, wenn sie kommt.«
»Was ist mit Amanda?«
»Gott weiß, ob sie überhaupt auftaucht ...»
Aufmunternd lächelte sie einander zu. So war Amanda nun mal – im Fall einer Krise konnte man nicht unbedingt mit ihr rechnen. Trotzdem bezweifelte keine von ihnen ernsthaft, dass sie heute nicht hier sein würde.
»Begleitet dich jemand?«
»Nein.« Lisa sah sie fragend an. Hannah zuckte mit den Schultern.
»Ich habe niemanden darum gebeten. Ich will eigentlich auch gar nicht, dass jemand mitkommt. Was ist mit dir? Kommt Andy nicht?«
»Nein, er kommt nicht.«
»Wieso das denn?«
Das war eine gute Frage ...
Das Geräusch eines Wagens, der vor dem Haus hielt, rettete Lisa davor, eine Antwort geben zu müssen. Der Motor stotterte im Leerlauf, Türen wurden geöffnet und wieder geschlossen. Hannah rannte ans Fenster.
»Es ist Amanda.« Bevor sie diese Worte gehört und die Erleichterung gespürt hatte, war Lisa nicht bewusst gewesen, wie sehr sie auf die Rückkehr ihrer Schwester gewartet hatte.
Kapitel 4: AMANDA
Amanda bezahlte den Taxifahrer und bedankte sich bei ihm, während er den schweren Rucksack für sie aus dem Kofferraum hob.
»Mann, Mädchen, wollen Sie mir erzählen, dass Sie dieses Monstrum um die halbe Welt geschleppt haben?«
»Irgendeiner muss ihn ja tragen!«
»Was haben Sie denn da drin? Ziegelsteine?«
»Keine Ziegelsteine, nein, aber mein ganzes Leben.«
»Das erklärt natürlich alles!« Er zog eine imaginäre Mütze wie Dick van Dyke in Mary Poppins und öffnete die Fahrertür. »Na, dann viel Glück, Mädchen. Und willkommen zuhause.«
»Danke.«
Zuhause.
Sie war acht Jahre alt gewesen, als sie hierhergezogen war, in dieses Haus, das Mark gebaut hatte. Sie hatte elf Jahre hier gewohnt. Und dann war sie fortgegangen. Nicht für immer natürlich. Sie war wieder zurückgekommen. Manchmal für mehrere Monate am Stück, manchmal nur für eine Nacht. Es hatte noch andere Orte gegeben, an denen sie gelebt hatte. Wohngemeinschaften, Mietwohnungen, möblierte Zimmer, Studentenwohnheime ... Doch dies war der Ort, den sie als ihr Zuhause bezeichnete, die Adresse, die sie nach wie vor beim Ausfüllen von Formularen angab.
Dieses Mal war sie seit fast drei Monaten nicht mehr hier gewesen. Sie hatte Mum nicht gesehen, als es richtig schlimm war, und sie war nicht dabei gewesen, als sie starb. Mit Absicht, und zu der Zeit glaubte sie, oder redete es sich zumindest ein, dass ihre Mutter sie verstehen würde und dass es in Ordnung sei. Doch jetzt wusste Amanda nicht, ob sie froh darüber war, alles verpasst zu haben oder nicht. Sie warf dem Taxi einen Blick nach und verspürte den vertrauten Fluchtimpuls, ehe sie sich zum Haus umdrehte. Mit Mühe hievte sie sich den Rucksack auf eine Schulter und stapfte die Auffahrt hinauf. Mark sah sie und kam an die Haustür. Hinter ihm konnte sie ihre drei Schwestern erkennen. Als sie ihren Stiefvater erreicht hatte, stellte Amanda den Rucksack neben ihm auf den Boden und fiel ihm in die Arme. Wortlos verharrten die beiden eine lange Zeit so und hielten einander fest. Nach einer Weile zwängte Hannah sich an Jennifer und Lisa vorbei über die Türschwelle und schlang ihre Arme um ihren Vater und die Schwester. »Du bist wieder da!«
Stephen, der die dringende Angelegenheit im Wagen – was immer es auch gewesen war – offenbar erledigt hatte, kam den Gartenweg herauf und rückte im Gehen die Krawatte zurecht. Er machte einen weiten Bogen um das Dreiergrüppchen und ging direkt in die willkommene Kühle des Vorraums weiter. »Wie ich sehe, ist die verlorene Tochter heimgekehrt«, bemerkte er ironisch, als er an seiner Frau vorbeikam. Jennifer warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
Hinter ihm trafen inzwischen noch mehr Trauergäste ein. Marks Bruder Vince und seine Frau Sofie parkten hinter Stephens Wagen, und weitere Autos füllten rasch die Lücken. Das waren die besten Parkplätze – von hier aus konnte man zu Fuß zur Kirche gehen. Mark erinnerte sich an einen Spaziergang im Mai, als er, flankiert von Freunden und Familienangehörigen, nach Hannahs Taufe mit dem schlafenden Kind auf dem Arm diesen Weg zurückgegangen war. Einige von damals würden auch heute wieder dabei sein. Bei ihrem Anblick stöhnte Mark leise. »Mist, ich hätte mich früher umziehen sollen!« Er ließ Amanda los und ging in den Vorgarten, um Hallo zu sagen, sich umarmen zu lassen und sich dümmliche Fragen zum Thema Parken anzuhören.
Hannah und Lisa hoben den Rucksack hoch und schleppten ihn zusammen bis zum Treppenabsatz.
»Das grausame Ende hast du dir erspart, wie?« Jennifer hatte nicht die Absicht, so hart zu klingen.
»Geh doch nicht schon wieder auf sie los«, schalt Lisa sie. »Nicht jetzt.«
»Tut mir leid.«
»Nein, mir tut es leid. Ich wollte euch keine Sorgen machen.«
»Das willst du nie«, sagte Jennifer leise und kaum hörbar. Lisa war die Einzige, die sie verstand.
»Sei so gut und mach ihr eine Tasse Tee oder Kaffee, ja?« Dabei musterte sie Amanda von Kopf bis Fuß und fragte: »Ich vermute, dass du direkt von irgendwoher angereist kommst?«
»Von Stansted. Ja, bitte. Ich bin vollkommen ausgedörrt.«
Jennifer blähte die Nasenflügel und ging in die Küche.
»Komm mit nach oben. Wir müssen uns endlich umziehen. Wieso kommen diese Leute nur alle so früh? Es ist ja nicht so, als bräuchte man unbedingt einen guten Platz – es sieht sie doch keiner in dieser verdammten Kiste! Willst du das hier vielleicht anbehalten? Bitte, sag nein. Hannah, schaffst du das mit dem Rucksack ...?«
»Wo, zum Teufel, bist du gewesen?«
Sie waren in Hannahs Zimmer gegangen und hatten die Tür hinter sich zugemacht. Lisa zwängte sich in ihr auffallendes gelbes Kleid, ohne Amanda eines Blickes zu würdigen.
»Du hörst dich ja schon an wie Jennifer. Und ich habe gedacht, du hättest mich vor ihrem Zorn da unten gerettet.«
»Das habe ich auch, aber nur, um dir hier oben die Leviten zu lesen. Ich bin vielleicht nicht so oft wütend auf dich, aber mein Zorn ist nicht weniger vernichtend. Wo, zum Teufel, hast du gesteckt, Mand? Mark muss vor Kummer fast verrückt geworden sein.«
»Und? Ist Mark verrückt geworden, Hannah?«
Hilfe suchend sah Amanda ihre kleine Schwester an.
Hannah zuckte mit den Schultern. »Er hat nur gesagt, wenn du könntest, wärst du hier.«
Amanda warf Lisa, die verzweifelt die Hände hob, einen viel sagenden Blick zu.
»Darum geht es nicht, Mand. Ich bin verrückt geworden, okay. Ich war am Durchdrehen.«
»Ich habe doch in meiner E-Mail geschrieben, dass ich komme.«
»Das ist fast eine Woche her.«
»Und jetzt bin ich da.«
»Auf den letzten Drücker.«
»Aber ich bin da.«
Lisa drehte sich verzweifelt zum Spiegel um, wo ihr Blick auf ihr breites, gelbes Konterfei fiel. Sie schnaubte.
Amanda kramte indes in ihrem Rucksack. Natürlich hatte sie das angezogen, was sie für die Kirche als geeignet erachtete. Sie wollte es nur nicht zugeben.
»Was Helles, ja?«, fragte sie nun Hannah.
»Hell und bunt, ja.« Hannah nickte. »Das hat Mum sich gewünscht.«
»Okay ... hell.« Amanda klappte eine weitere Seitentasche auf und fing an, zerknitterte Kleidungsstücke aus den Tiefen des Rucksacks ans Licht zu befördern. »Sie kann von Glück reden, wenn ich noch was Sauberes finde, ganz zu schweigen, von was Hellem. Sogar meine buntesten Sachen sind inzwischen schmutzig grau ...« Ihre Stimme brach ab. Lisas Zorn verpuffte augenblicklich, und sie legte Amanda, die sich über den Stapel am Boden beugte, eine Hand auf den Rücken.
»Alles okay mit dir?«
Amandas Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. »Mir geht es gut.«
Ihr ging es nicht gut. Natürlich nicht. War es eine Woche her? Es hätte auch ein Monat sein können, oder nur zwei Minuten. Die Zeit hatte stillgestanden dort in diesem Internetcafé. Die Welt war aus den Fugen geraten. Zehn Minuten lang hatte Amanda dagesessen und auf den Bildschirm gestarrt. Marks Adresse ... das rote Ausrufezeichen signalisierte ihr die Dringlichkeit. Die E-Mail trug das Datum vom Vortag; kein Betreff – das war nicht nötig. Sie wusste es auch so, bevor sie den Text geöffnet hatte und es Wirklichkeit geworden war: Mutter war tot.
Sie war nicht weit weg gewesen dieses Mal. In Spanien hatte sie in einer Strandbar an der Costa Calida in der Nähe von Murcia gearbeitet. Sie hatte bei Freunden von Freunden gewohnt, deren Eltern dort unten in der Nähe des Meers eine kleine Villa besaßen. Normalerweise wäre sie an einem Ort wie diesem nicht lange geblieben. Aber sie hatte nicht weiter wegfahren wollen. Sie hatte gewartet, hatte auf diese E-Mail gewartet.
Als sie schließlich eintraf, schickte Amanda eine einzige Zeile als Antwort zurück und schrieb, dass sie nach Hause kommen würde. Und jetzt war sie da. In den fünf Tagen dazwischen hatte sie zu viel Tequila getrunken, lange Spaziergänge am Strand gemacht und dem Drang widerstanden, ihre Tickets nach Hause umzutauschen, um woanders hinzufliegen, irgendwohin.
Doch nicht wegen des Ärgers, den ihr unweigerlich von ihren Schwestern drohte. Viel mehr schreckte sie der Gedanke an den Kummer anderer; die Trauer anderer war viel schwerer zu ertragen als die eigene. Amanda war nach Hause gekommen, um sich kopfüber in ihre Trauer zu stürzen, und sie hatte Angst, darin zu ertrinken. Bestimmt würde es nicht so sein wie in manchen Filmen – wie in Magnolien aus Stahl oder Zeit der Zärtlichkeit, wo eine Beisetzung das Ende einer wirklich schlimmen Zeit und den Anfang von allem Guten für die Beteiligten markierte. So würde es ganz und gar nicht werden: Es war lediglich der Anfang.
Hannah ergriff ihre Hand. »Ich bin froh, dass du jetzt da bist. Und es ist mir völlig egal, wo du warst.«
»Danke, Hannah.« Amanda ließ es zu, dass man sie berührte. Das passierte nicht oft. Mum hatte sich immer darüber beklagt, was für ein zappeliges Kind sie gewesen war – nie hatte sie stillsitzen oder sich umarmen lassen wollen. Einmal gestand ihre Mutter sogar, dass sie es fast genossen habe, als Amanda als Kleinkind erkrankt war, denn das sei der einzige Zeitpunkt gewesen, zu dem sie es gestattet habe, in den Arm genommen und übers Haar gestreichelt zu werden.
Ohne anzuklopfen kam Jennifer ins Zimmer. Amanda wappnete sich gegen die zweite Runde.
»Hör mal, Jen. Ich weiß, dass du sauer bist auf mich, und wahrscheinlich hast du jedes Recht dazu. Es tut mir leid, dass ich mich einfach verpisst und euch das alles überlassen habe. Ich weiß, das war egoistisch und feige von mir. Und es tut mir leid, wenn du gedacht hast, ich wäre eher zurück. Ich habe einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht, um überhaupt zu kapieren, was passiert ist, mehr nicht. Ich weiß – war auch wieder egoistisch von mir. Aber so bin ich nun mal, hey? Doch es tut mir wirklich sehr leid. Und jetzt bin ich ja da. Können wir also ausnahmsweise auf die Geißelung verzichten, nur heute. Ja?«
»Was ist eine Geißelung?«, fragte Hannah.
»Eine Tracht Prügel, wenn man etwas falsch gemacht hat.«
»Kein Mensch macht dir Vorwürfe, Amanda.« Jennifer versuchte, sich nicht schulmeisterlich anzuhören. »Ich habe mir lediglich gewünscht, dass wir das hier zusammen durchstehen. Und zwar alles.«
Amanda verkniff sich eine Antwort. Sie hatte Recht. Ihre Schwester war sauer. Es war auch nicht fair von ihr gewesen – sie hatte gekniffen und alles den anderen überlassen. Und jetzt fing sie auch noch zu weinen an, was sie eigentlich hatte vermeiden wollen.
Hannah trat zwischen die beiden. »Bitte, Jennifer«, sagte sie und blickte ihrer älteren Schwester fest in die Augen, »sei nicht sauer auf Amanda, nicht heute.« Wie so oft in den letzten paar Monaten, stellte Jennifer verwundert fest, wie erwachsen Hannah aussah und wirkte. »Heute geht es um Mum, um unsere Mum.« Sie hatte ja Recht.
Zögernd fassten Amanda und Jennifer sich an den Händen, nahmen Hannah in die Mitte und umarmten sie. Auch Lisa trat zu ihnen, legte beide Arme um die Schwestern und drückte sie fest.
Wie für alle Schwestern zu allen Zeiten galt letztlich auch für sie: Sie gegen den Rest der Welt, ganz gleich, welche Schlachten auch zwischen ihnen toben mochten. Ein paar Minuten später verließen sie, sich an den Händen haltend, Hannahs Zimmer. Amanda trug ein Kleid, das Hannah in ihrem Schrank gefunden hatte. Ihre Tränen waren getrocknet, das Haar aus dem Gesicht gekämmt.
In der Kirche konnten sie sich anfangs noch zusammenreißen. Amanda meinte, in ihren Knallfarben würden sie aussehen wie ein paar Komparsen in einem kitschigen Musical oder wie eine von diesen Girliebands, die null Punkte beim Eurovision Song Contest einheimste: Lisa in Gelb, Hannah in Pink, Amanda von Kopf bis Fuß in Orange und Rot; sogar Jennifer trug ein himmelblaues Shiftkleid. Kerzengerade, als hätten sie einen Stock verschluckt, standen sie in der ersten Reihe, flankiert von Mark, der inzwischen ein lila Leinenhemd trug, und Stephen, der stur und ostentativ bei seinem Schwarz geblieben war, aber wenigstens seinen BlackBerry im Auto gelassen hatte. Sie trafen als Erste in der Kirche ein, sodass ihnen der Anblick der anderen Trauergäste zunächst erspart blieb, und sie drehten sich auch nicht um. Sie wussten, dass sich das Kirchenschiff füllen würde. Ihre Mutter hatte viele Freunde. Danach beim Leichenschmaus müssten sie mit allen reden. Aber nicht jetzt.
Erst bei der eigentlichen Beerdigung brachen alle Dämme, und sie verstießen gegen »Regel Nummer eins«. Barbara hatte sich für eine alternative Begräbnisstätte entschieden, ungefähr drei Meilen entfernt von der Kirche, in der der Gottesdienst gehalten wurde. Wenn sie sich vorstelle, wie sie auf einer Art Supermarktfließband hinter einem Vorhang verschwand, der sich auf unfreiwillig komische Weise öffnete und wieder schloss, könne sie es nicht ertragen, verbrannt zu werden, sagte sie, und auf einem Kirchhof verscharrt werden wolle sie auch nicht. Deshalb wolle sie lieber langsam und sanft in einem biologisch abbaubaren Sarg zerfallen und so der Erde wieder zurückgegeben werden. Und irgendwann würde ein Baum auf ihr wachsen, zu dem ihre Lieben kommen konnten, wann immer sie wollten, und sie besuchen. Es sei ihr lieber, auf einer Wiese mit Schmetterlingen zu liegen, meinte sie, als inmitten eines deprimierenden steinernen Meeres aus Marmor und Granit. Außerdem würde ihnen das enorme Summen für den Blumenschmuck sparen. Jennifer erinnerte sich gut an den Abend, an dem Barbara ihnen ihren Entschluss eröffnet hatte; sie spürte noch immer die nagende Eifersucht, dass ihre Mutter das alles mit Lisa besprochen hatte. Wieso nicht mit ihr? Mark hatte mit unbewegter Miene Barbaras Hand gedrückt und ein ernstes Gesicht gemacht. Dann hatte er ihr zugeflüstert: »Was, Blumen willst du auch noch! Ist denn nie ein Ende mit deinen Wünschen?«
Und so kam es, dass sich an einem heißen Augustnachmittag in der flirrenden Hitzewelle die vier Schwestern samt Mark und Stephen auf dieser grünen Wiese einfanden. Nur der Hausmeister der Anlage stand neben ihnen vor einem kunstvoll geflochtenen, aber befremdlich wirkenden Weidensarg. Angeblich sollte in ihm in voller Schönheit ihre Mutter in dem smaragdgrünen Kleid von Ben de Lisi liegen, während sie den Klängen von Van Morrisons In the Garden lauschten, das blechern aus einem Kassettenrecorder ertönte. Und keiner konnte die Tränen zurückhalten, und jeder weinte so lange und ausgiebig, wie sein trauerndes Herz es ihm befahl.
»Gott, Mark, du wirst den Rest des Monats nur noch Hühnersalat zu essen bekommen!« Eine Gruppe von Barbaras Freunden aus dem Ort hatte die Speisen und Getränke für den Leichenschmaus organisiert, danach abgewaschen und die Essensreste in saubere Tupperwarebehälter gefüllt. Sie hatten gute Arbeit geleistet. Auf Außenstehende musste es wie eine Party gewirkt haben – eine Hochzeit vielleicht oder ein Familientreffen. Auf dem Rasen standen mit gelbem Krepppapier umwickelte Tapetentische, darauf große Schüsseln voller Reis- und Kartoffelsalat, Baguette und Tomaten. Dazwischen hatte man Vasen und Krüge mit Rosen aus dem Garten arrangiert. Dazu gab es Bleche voller Hafermehlkekse, kleine Schüsseln mit Erdbeeren und Schalen mit Schlagrahm, der in der Hitze zerfloss. Die Leute hatten Pimms und selbst gemachte Limonade getrunken. Es war alles sehr stimmungsvoll gewesen. Statt des leisen, respektvollen Gemurmels, das man sonst bei Trauerfeiern zu hören bekam, wurde viel gelacht, Geschichten wurden erzählt, und aus dem Haus drang die Musik von Simon and Garfunkel und The Mamas and the Papas. Die Männer traten nicht verlegen, die Hände in den Taschen, von einem Bein auf das andere, die Frauen hatten keine rot geränderten Augen. Barbara hätte sich gefreut. Es war genau so, wie sie es sich gewünscht hätte – gute Freunde, gutes Essen, gutes Wetter. Nur der Anlass war weniger erfreulich.
Barbaras Freunde hatten auch aufgeräumt, etwas munterer und fröhlicher, als sie sich wahrscheinlich fühlten, und jetzt waren sie fort. Die Familie saß allein im Wohnzimmer und starrte auf die reichliche Auswahl an Tupperwarebehältern auf der Küchentheke.
»Sieht ganz so aus.«
Mittlerweile lief die Musik nicht mehr. Lisa hatte ihre Schuhe abgestreift und saß mit angewinkelten Beinen in einer Ecke des Sofas. Hannah hatte den Kopf auf dem Schoß ihrer Schwester liegen und war fast eingeschlafen. Amanda hockte im Schneidersitz auf dem Fußboden, mit dem Rücken an einen Hocker gelehnt.
An der Eingangstür stand Stephen und verabschiedete sich von Jennifer. Seine Lippen fühlten sich trocken an auf ihrer Wange, als er sie flüchtig in den Arm nahm. Auf dem Rückweg von der Beerdigung zu ihrem Wagen hatte er ihre Hand gehalten, und sie hatte es eine oder zwei Minuten geschehen lassen. Aus irgendeinem Grund verübelte sie ihm den schwarzen Anzug, die schwarze Krawatte und den BlackBerry. Und selbstverständlich auch das Eine, worauf er absolut keinen Einfluss hatte. Sie wusste genau, dass es im Moment viel für ihn zu tun gab. Und sie wusste auch, dass er aus den Wochen vor Barbaras Tod viel nachzuholen hatte. Trotzdem war sie noch immer wütend auf ihn. Als er sie in den Arm nahm, versteifte sie sich und erlaubte sich keine Entspannung in seiner Umarmung.
»Bist du sicher, dass du hierbleiben willst?«
»Ja. Schließlich habe ich Amanda lange nicht mehr gesehen, und Hannah ist in einem fürchterlichen Zustand, und ich will Mark nicht allein lassen ...»
»Aber können sich nicht Amanda, Hannah und Lisa um ihn kümmern?« Seine Frage klang fast sarkastisch und irgendwie belustigt. »Außerdem siehst du erschöpft aus.«
»Ich habe gerade meine Mutter beerdigt, Stephen ... Wie soll ich denn deiner Meinung nach aussehen?« Sie wollte nicht mit ihm nach Hause fahren, sondern hierbleiben; das war die Wahrheit.
»So habe ich das nicht gemeint.« Er wusste, dass sie heute Abend lieber mit den anderen zusammen war. Sie musste es ihm nicht extra sagen. Stephen versuchte es nicht persönlich zu nehmen.
»Ich weiß. Entschuldige.«
»Ich muss mich entschuldigen.« Gott, diese Höflichkeit.
»Ich bin ja wieder zuhause, bis du morgen aus dem Büro kommst. Lisa fährt mich sicher heim. Oder vielleicht nehme ich auch den Zug ...»
Stephen hob die Hände in einer Geste unnötiger Ergebenheit. »Schon gut, schon gut ... Um ehrlich zu sein, hatte ich schon den ganzen Tag über den Eindruck, dass du mich eigentlich nicht brauchst.«
»Ist es dieses Gefühl, das dir fehlt – dass ich dich brauche?«
Ungeduldig strich er sich mit einer Hand über die Augen. »Weißt du was, Jen? Es ist gut, dass du hierbleibst. Es ist gut.« Wieder küsste er sie, und seine trockenen Lippen streiften ihre Wangen. »Wir sehen uns morgen.«
Jennifer lehnte sich an die Tür und sah ihm nach, wie er zum Wagen ging, einstieg und davonfuhr. Er drehte sich noch einmal zu ihr um und rief ihr zu, dass er sie liebe, ohne eine Antwort abzuwarten. Wieder war es so, als befänden sie sich auf verschiedenen Seiten eines tiefen Grabens, eine Kluft, die sie zwar beide zu überwinden versuchten, doch nie zur selben Zeit.
Als sie zu den anderen zurückkehrte, kochte Mark gerade Tee: das englische Nationalgetränk für alle Lebenslagen. Jennifer holte Milch aus dem Kühlschrank und verteilte sie in den Bechern, die Mark auf das Tablett stellte und zurück zum Sofa trug.
»Wie geschlaucht seid ihr?«
Lisa lachte schwach. »Auf einer Skala von eins bis zehn? Eine gute Neun, würde ich sagen.«
Hannah hob im Liegen matt die Hand. »Elf, hier drüben.«
»Wieso?«, fragte Jennifer.
»Weil ich noch etwas für euch habe«, erwiderte Mark. »Nichts Offizielles – das regeln wir bei den Anwälten. Ihr kennt doch eure Mum. Sie hat es tatsächlich noch geschafft, die Briefe zu schreiben, die sie angekündigt hat. Ich habe sie hier. Ich soll sie euch geben, wenn alles vorbei ist. Ich hätte ja bis morgen gewartet, aber dann ist Jen nicht mehr hier ...»
»Doch, ich bleibe hier. Stephen ist gerade gefahren ...»
Lisa sah ihre Schwester mit fragend gerunzelter Stirn an.
»Er muss morgen früh raus. Ich dachte mir ...»
Mark legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Ich bin froh, dass du bleibst. Deine Mum hätte sich sehr darüber gefreut, dass ihre Mädchen alle zusammen sind.«
Sie öffneten die Briefe nicht sofort. Es war schließlich nicht Weihnachten. Jede ließ ihren Brief zunächst auf dem Schoß liegen. Amanda versuchte sich daran zu erinnern, wie die Hände ihrer Mutter ausgesehen hatten; sie versuchte sich vorzustellen, wie sie den Umschlag hielt. Die Schwestern unterhielten sich, bis sie zu müde dafür waren. Irgendwann schlief Hannah ein und musste sanft geweckt werden. Eine nach der anderen brach schließlich auf, verabschiedete sich mit einem gedämpften Gute-Nacht-Dialog wie in der Waltons-Familie am Fuß der Treppe und ging ins Bett, froh, wenigstens diesen Tag hinter sich gebracht zu haben.
Kapitel 5: LISA
Der Brief war mit einem breiten, grünen Band an einer rechteckigen Schachtel befestigt, die ungefähr dreißig Zentimeter hoch und lang war. Bereits das Äußere rief Erinnerungen wach – Barbara hatte ihre Geschenke immer sehr originell verpackt. Mit einer Schleife aus Organza, einem Wachssiegel oder schlichtem braunem Packpapier und einer Paketschnur, in die Lavendelzweige gesteckt waren. Das war ihre Spezialität. Lisa legte das Päckchen beiseite, während sie sich auszog und nackt unter die Bettdecke schlüpfte. Einen Moment betrachtete sie die Schachtel, fast ängstlich, ehe sie den Brief aus dem Umschlag nahm. Sie stockte kurz, als sie ihn auseinanderfaltete: Mums Handschrift mit den ordentlichen, runden Buchstaben, die ihr so vertraut war wie ihre eigene.
Meine liebste Lisa,
du und ich, wir beide stehen uns in vielerlei Hinsicht am nächsten. Ich finde, dass wir vieles gemeinsam haben. Du bist mein erstgeborenes Kind und der erste Mensch, der mir das Wunder dieser besonderen Liebe, die eine Mutter für ihr Kind empfindet, gezeigt hat. Du hast jeden Morgen zu einem Weihnachtsmorgen für mich gemacht. Dafür danke ich dir. Ich denke, viele andere Dinge muss ich dir nicht extra sagen, da ich glaube, dass du sie bereits weißt. Ich liebe dich. Unendlich. Du bist die Stärkste von allen, denke ich. Vielleicht stärker, als es dir guttut. Frag Andy bei Gelegenheit. Ich mag ihn übrigens sehr – habe ich dir das eigentlich je gesagt? Ich hätte eine große Bitte an dich, mein liebes Mädchen. Pass an meiner Stelle auf deine Schwestern auf und auch auf Mark. Und lass es zu, dass sich jemand um dich kümmert.
Mum
PS: Was den Inhalt der Schachtel betrifft, da hattest du Recht – es wäre eine Verschwendung gewesen. Trag es, wenn du Lust verspürst, selbstvergessen zu tanzen, als würde niemand dir dabei zusehen.
In der Schachtel lag, fein säuberlich zusammengelegt und in weißes Seidenpapier eingeschlagen, das smaragdgrüne Kleid von Ben de Lisi.
Andy meldete sich beim zweiten Klingeln. Lisas Stimme klang heiser und gedämpft.
»Das ging aber schnell«, sagte sie.
»Ich dachte mir schon, dass du es bist.«
»Ich bin es.«
»Hallo, du.«
»Was machst du gerade?«
»Ich schaue Fußball. Und du?«
»Ich rufe dich an.«
»Wie war’s?«
»Es tut mir leid, dass ich dich gebeten habe, nicht mitzukommen.«
»Ist schon in Ordnung.«
»Nein, ist es nicht, Andy. Es war dumm von mir. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe.«
»Ich glaube nicht, dass du in dem Moment überhaupt was gedacht hast. Das soll nicht unfreundlich klingen – ich will damit nur sagen, dass dabei weniger die Vernunft als deine Gefühle ausschlaggebend waren. Du wolltest es eben allein, ohne mich, hinter dich bringen.«
»Rede nicht so verdammt vernünftig mit mir!«
»Entschuldige.«
»Und entschuldige dich nicht dauernd!«
Schweigen.
»Ich sollte mich bei dir entschuldigen.« Lisa machte eine Pause. »Ich wünschte, du wärst hier gewesen.«
»Ich auch.«
Einen Moment lang saß Lisa mit dem Telefon in der Hand da und lauschte Andys Atem, was fast ebenso tröstlich war wie eine Umarmung. Dann seufzte sie.
»Dann sehe ich dich morgen.«
»Ich werde hier sein.« Er ging so vorsichtig mit ihr um.
»Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Lisa.«
Ihm war das kurze Stocken in ihrer Stimme nicht entgangen, als sie das letzte Wort gesagt hatte, und mehr brauchte er nicht zu wissen. Er hatte nicht Fußball geschaut. Er hatte zwar vor dem Fernsehapparat gesessen, aber das war nicht dasselbe. Andy stand auf, nahm die Autoschlüssel von der Ablage neben der Eingangstür und fuhr dorthin, wo seine Gedanken und sein Herz den ganzen Tag über bereits gewesen waren.
Während er in Richtung der M25 fuhr, ein wenig zu schnell, hörte er Radio, ein wenig zu laut, und fragte sich, nicht zum ersten Mal in den vergangenen zwei Jahren, was in Lisas Kopf vor sich ging. Sie war wie keine andere Frau, die er jemals gekannt hatte. Sie verlor sich stärker in den Höhen und Tiefen des Lebens als andere. Sie waren zuerst nur Freunde gewesen, bevor sie ein Liebespaar wurden. Sie hatten sich an ihrem Arbeitsplatz kennen gelernt. Bis dahin waren sie mit anderen Partnern zusammen gewesen, zwar nichts Ernstes für beide, aber es bedeutete, dass eine Romanze zunächst nicht infrage kam. So lernten sie einander ziemlich gut kennen, bevor es zwischen ihnen funkte. Andy wusste, dass Lisa klug und temperamentvoll war, auch, dass sie stur sein konnte, eine spitze Zunge hatte, dumme Menschen nicht ertrug und drei Stück Zucker in ihren Kaffee tat, wenn sie einen Kater hatte – was aber nicht allzu häufig vorkam. Sie war witzig und sarkastisch, aber niemals gefühllos. In ihrer Gesellschaft fühlte er sich rundum wohl.
Eines Tages wurde ein gemeinsamer Freund aus heiterem Himmel entlassen. Einige Kollegen aus ihrer Abteilung gingen in die Weinbar um die Ecke, um dort ihre kollektiven Sorgen zu ertränken und über die Geschäftsleitung zu lästern. Nach und nach waren die anderen gegangen, vielmehr hinausgetorkelt, bis Lisa und Andy übrig geblieben waren und sich zusammen auf den Weg gemacht hatten, um den Nachtbus zu erwischen. Betrunken war Lisa ein anderer Mensch. Im Büro wahrte sie stets Abstand, war perfekt zurechtgemacht und wirkte fast unnahbar. In jener Nacht sah sie zehn Jahre jünger aus, und alle Schranken schienen gefallen zu sein. Lisa hatte ihre Schuhe mit den Schwindel erregend hohen Absätzen ausgezogen und war in einen Brunnen geklettert. Dabei war sie ausgerutscht, und sie hatte sich ins Wasser gesetzt, hatte gelacht, geschrien und gekreischt wie ein kleines Kind. Er war ihr nachgeklettert, um sie herauszuholen, und sie hatte ihn gepackt und neben sich ins Wasser gezogen. Und dann waren sie beide zu nass und zu aufgedreht für den Nachtbus gewesen, waren zum Geldautomaten gegangen und hatten sich ein Taxi nach Hause geleistet. Lisa hatte dem Fahrer nur ihre Adresse genannt.
In ihrer Wohnung zog sie ihn mit derselben Geste, mit der sie in dem kalten Brunnen nach seiner Hand gegriffen hatte, unter die warme Dusche, und sie hatten einander ausgezogen und sich in trunkener Unbekümmertheit geküsst, bis das erotische Knistern überhandnahm ...
Andy hätte es dabei belassen. Er wusste, dass Lisa vollkommen betrunken war; er hatte andere kurze, peinliche Begegnungen mit Frauen hinter sich und war entschlossen, diese Erfahrung nicht noch einmal zu machen. Doch Lisa sah ihn aus halb geschlossenen Augen an und flüsterte ihm ins Ohr, was sie mit ihm machen wollte. Und dann zeigte sie es ihm, stieß ihn auf das weiche, ungemachte Bett und setzte sich rittlings auf ihn, sanft, aber entschlossen. Als er tief in ihr war, überwältigt von ihrem heißen, sich fantastisch anfühlenden Körper und ihrer Feuchtigkeit, beugte Lisa sich vor und flüsterte ein einziges Mal seinen Namen in seinen offenen Mund, bevor sie sich wieder aufrichtete. Ihre weichen, runden Brüste zeigten keck nach oben, und sie gab sich einem schnellen, heftigen Orgasmus hin. Andy konnte sein Glück nicht fassen.
Auch am nächsten Tag konnte er es nicht fassen, als Lisa ihm den Kaffee ans Bett brachte. Den ihren natürlich mit drei Stück Würfelzucker.
»Wieso bist du schon so munter?«, fragte er sie stöhnend und rappelte sich hoch. Mit Freuden hätte er den ganzen Tag in seinem Traumland verbracht.
»Guter Sex macht mich immer munter.«
»War es gut für dich?«
Sie versetzte ihm einen spielerischen Klaps auf den Oberschenkel.
»Das hast du nicht nötig, bitte! Es war gut, zumindest für mich. Ich glaube aber, dass du ein bisschen zu kurz gekommen bist.«
Er zuckte verlegen die Schultern. Wenn er ehrlich war, musste er gestehen, dass seine Erinnerung an die vergangene Nacht nicht sehr detailliert war.
»Aber wenn du willst, werde ich das wiedergutmachen. Heute Abend?« Sie warf einen Blick auf ihre Uhr. »Jetzt ist die Zeit ein wenig zu knapp. Ich glaube nicht ...»
Andy stellte seinen Becher auf dem Nachttisch ab und nahm Lisa den ihren aus der Hand. Dann zog er sie neben sich und streifte ihr den Morgenmantel über die Schultern.
»Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns einfach die Zeit ...»
An dem Morgen waren sie beide mit reichlicher Verspätung zu der Verkaufsbesprechung gekommen.