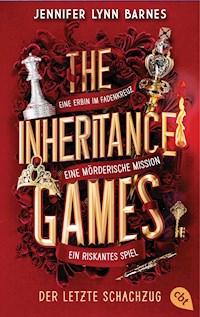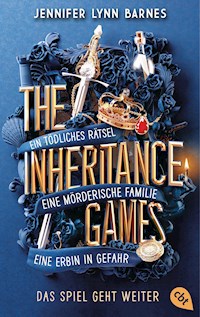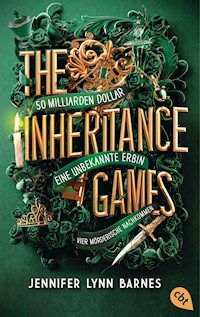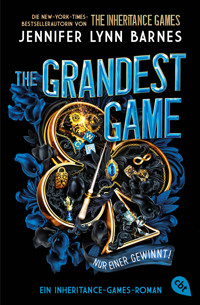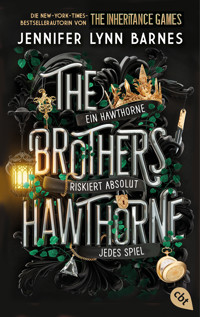12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die THE-INHERITANCE-GAMES-Reihe
- Sprache: Deutsch
Prickelnde Romantik, dekadenter Luxus und dunkle Geheimnisse satt – die exklusiven Storys lassen alle Fans erneut eintauchen in die Welt aller The-Inheritance-Games-Bände!
Vier Brüder, durch ein unzertrennbares Band miteinander verbunden, aufgewachsen in einem Haus voller Rätsel und Geheimnisse, umgeben von Freundschaft und Verrat, Liebe und Rache, Macht und unermesslichem Reichtum.
Brandneue Geschichten aus der schillernden Welt der Familie Hawthorne enthüllen bislang unbekannte Details und Hintergründe aus dem Leben der vier Hawthorne Brüder und der Erbin ihres Vermögens, Avery Grambs.
Der heiß ersehnte fünfte Band der weltweiten Bestseller-Serie »The Inheritance Games«!
Die Sammlung beinhaltet:
· Von vorne wie von hinten gleich
· Der Cowboy und das Gothmädchen
· Die fünf Male, als Xander jemanden angegriffen hat (und das eine Mal, als er es nicht tat)
· That Night in Prague
· Pain at the Right Gun
· Was im Baumhaus geschieht
· VV!CHT3LN
· Eine Hawthorn’sche Nacht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jennifer Lynn Barnes
Games Untold
Aus dem Amerikanischen von Ivana Marinović und Katja Hildebrandt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Erstmals als cbt Taschenbuch November 2024
© 2024 Jennifer Lynn Barnes
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel
»Games Untold« bei Little, Brown and Company, einem Verlag
der Verlagsgruppe Hachette, New York
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ivana Marinović, Katja Hildebrandt
Lektorat: Katja Hildebrandt
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München
unter Verwendung des Originalumschlags: © 2024 Hachette Book Group, Inc.,
Illustration © Katt Phatt, Gestaltung: © Karina Granda
Innengestaltung unter Verwendung der Bilder von: © Adobe Stock (This is Art; orbcat; Smix Ryo; anomalicreatype; natrot; Tartila; KEN111)
MP · Herstellung: DiMo
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-32614-2V001
www.cbj-verlag.de
FÜR RACHEL
INHALT
That Night in Prague
Von hinten wie von vorne gleich
Der Cowboy und das Gothmädchen
Die fünf Male, als Xander jemanden angegriffen hat (und das eine Mal, als er es nicht tat)
Eine Hawthorn’sche Nacht
VV!CHT3LN
Was im Baumhaus geschieht
Pain at the Right Gun
Danksagung
That Night in Prague
Nichts an diesem Ort war unendlich, außer Jameson und mir.
Der Morgen danach
Ich machte mir keine Sorgen um ihn. Sich um Jameson Winchester Hawthorne zu sorgen, war ungefähr so nützlich, wie sich mit dem Wind zu streiten. Ich war schlau genug, um zu wissen, dass es sinnlos war, gegen Hurrikans anzubrüllen oder sich den Kopf um einen Hawthorne mit einer Leidenschaft für Himmelfahrtskommandos, halb kalkulierte Risiken und Balance-Akte an schwindelerregenden Abgründen zu zerbrechen.
Jameson hatte die Angewohnheit, auf den Füßen zu landen.
»Avery?«, machte Oren seine Anwesenheit bemerkbar – was reine Höflichkeit war, da mein Security-Chef sich nie weit von mir entfernte. »Es dämmert bald. Ich kann mein Team noch einmal losschicken und …«
»Nein«, unterbrach ich ruhig. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass Jameson nicht wollen würde, dass ich nach ihm suchen ließ. Das hier war kein Versteckspiel. Das hier war kein Fang-mich-wenn-du-kannst.
All meine Instinkte sagten mir, dass das hier … etwas war.
»Es sind jetzt vierzehn Stunden.« Orens Stimme war die militärische Variante von ruhig: knapp, sachlich, stets auf das Schlimmste vorbereitet. »Er ist ohne Ankündigung verschwunden. Er hat keine Spuren hinterlassen. Das Ganze geschah innerhalb von Sekunden. Wir müssen Fremdeinwirkung in Betracht ziehen.«
Üble Szenarien in Betracht zu ziehen, war Orens Job. Ich war die Hawthorne-Erbin. Jameson war ein Hawthorne. Wir zogen Aufmerksamkeit auf uns … und zuweilen Drohungen. Doch tief in meinem Inneren sagte mir mein Bauchgefühl noch dasselbe, was es seit Jamesons Verschwinden schon die ganze Zeit sagte: Ich hätte das hier kommen sehen müssen.
Seit Tagen hatte sich eine elektrisierende Unruhe in Jameson aufgestaut – eine unheilvolle Energie, ein mächtiger Trieb. Ein Geheimnis. Blitzartig feuerten Erinnerungsfetzen durch meinen Kopf: eine Momentaufnahme nach der anderen, seit ich einen Fuß in Prag gesetzt hatte.
Die Turmspitze.
Das Messer.
Die Uhr.
Der Schlüssel.
Was führst du im Schilde, Hawthorne? Du hast ein Geheimnis. Welches?
»Noch eine Stunde«, sagte ich zu Oren. »Wenn Jameson dann nicht zurück ist, kannst du ein Team aussenden.«
Als klar war, dass mein Leibwächter – und manchmal auch meine Vaterfigur – nicht weiter mit mir diskutieren würde, ging ich in den Eingangsbereich unserer luxuriösen Suite. Der Königssuite. Ich ließ mich in einem mit rot-schwarzem Knautschsamt bezogenen Sessel nieder und betrachtete die Wand vor mir – die nicht bloß eine Wand war –, während ich innerlich zum hundertsten Mal dieses Rätsel durchging.
Vor mir prangte ein dekadentes goldenes Wandgemälde.
Wo bist du, Jameson? Was entgeht mir hier?
Meine Augen fanden die gut kaschierte Nahtstelle in der Wand. Eine Geheimtür. Ihre Existenz war eine Erinnerung daran, dass dieses Hotel einst Jamesons verstorbenem Großvater gehört hatte und dass die Königssuite ganz nach den minutiösen Vorgaben des detail- und rätselversessenen Milliardärs gebaut worden war.
Falltür um Falltür, dachte ich. Und Rätsel um Rätsel. Dieser Spruch gehörte zu den ersten Worten, die Jameson je zu mir gesagt hatte. Damals, als er noch mit seiner Trauer gekämpft hatte und immerzu dem nächsten Rätsel, dem nächsten Kick hinterhergejagt war – fest entschlossen, sich um nichts und niemanden zu scheren.
Damals, als er Risiken zum Teil auch eingegangen war, weil er Schmerz spüren wollte.
Während ich die Wand und die verborgene Tür betrachtete, sagte ich mir, dass der Jameson aus jenen frühen Tagen nicht derselbe Jameson war, der mir gestern noch das Haar aus dem Gesicht gestrichen und es wie einen Heiligenschein auf der Matratze ausgebreitet hatte.
Mein Jameson ging zwar immer noch Risiken ein – aber er kam auch immer zurück.
Ich bin klug genug, mir keine Sorgen um Jameson Hawthorne zu machen. Und doch …
Innerlich beschwor ich die Tür, sich zu öffnen. Beschwor sie, dass Jameson hinter ihr stand.
Und schließlich – endlich –, kurz bevor meine Stunde rum war, tat die Tür genau das, und da stand er. Jameson Winchester Hawthorne.
Das Erste, was ich sah, als er in den Lichtschein trat, war das Blut.
Kapitel 1
Drei Tage zuvor …
Die Postkarte in meiner Hand gab den Blick aus dem Flugzeugfenster wieder. Prag in der Morgendämmerung. Jahrhunderte der Geschichte zeichneten sich vor einem dunstig-goldenen Himmel ab, an dem wirbelnde Wolken in violett getöntem Grau dunkel über die Stadt zogen.
Jameson hatte mir die Postkarte geschickt – eine Anspielung auf die Postkarten, die sein Onkel einst meiner Mutter geschrieben hatte. Diese Parallele brachte mich auf den Gedanken, was Mom wohl sagen würde, könnte sie mich heute sehen – was sie sagen würde zu dem Privatjet, dem dicken Stapel Papierkram, den ich auf dem Flug hierher durchgegangen war, der Tatsache, dass mir immer noch jedes Mal der Atem stockte, wenn mich die Realität von Augenblicken wie diesem mit der Wucht einer Flutwelle überrollte.
Prag in der Morgendämmerung. Mom und ich hatten immer davon gesprochen, eines Tages die Welt bereisen zu wollen. Es war der eine, der einzige Traum, an dem ich nach ihrem Tod noch festgehalten hatte; doch mit fünfzehn, sechzehn und auch noch mit siebzehn hatte ich mir nie gestattet, mich länger als ein paar Minuten am Stück diesen Tagträumen hinzugeben. Ich hatte mir nie gestattet, das hier – oder überhaupt irgendwas – allzu sehr zu wollen.
Aber heute? Ich fuhr mit der Daumenkuppe den Rand der Postkarte entlang. Heute wollte ich die Welt. Ich wollte alles. Und es gab nichts, was mir im Weg stand.
»Eines schönen Tages wirst du dich daran gewöhnen«, sagte die Frau, die mir in meinem Privatjet gegenübersaß, und legte dann drei Zeitschriften auf dem Tisch zwischen uns ab. Mein Gesicht prangte auf allen drei Titelseiten.
»Nein«, berichtigte ich Alisa schlicht. »Werde ich nicht.« Ich konnte kein Wort von den Schlagzeilen entziffern. Bei zwei der drei Sprachen, in denen sie verfasst waren, war ich mir nicht mal sicher, um welche es sich handelte.
»Sie nennen dich Saint Avery.« Alisa zog eine vielsagende Augenbraue hoch. »Irgendeine Ahnung, was Jamesons Spitzname sein könnte?«
Alisa Ortega war meine Anwältin, doch ihre Expertise reichte weit über juristische Beratung für mich – und die Stiftung, die ich gegründet hatte – hinaus. Musste etwas in Ordnung gebracht werden, brachte sie es in Ordnung. Mittlerweile waren unsere Rollen klar definiert: Ich war die Teenie-Milliardärin, die Erbin und Philanthropin. Sie löschte die Brände.
Und Jameson Hawthorne loderte.
»Rate«, forderte Alisa mich nun auf, als der Jet aufsetzte, »wie sie ihn nennen.«
Ich wusste ganz genau, worauf das hier hinauslief, aber ich war keine Heilige, und Jameson war keine Gefährdung. Wir waren zwei Seiten ein- und derselben Medaille.
»Nennen sie ihn vielleicht Hör-bitte-nicht-auf?«, fragte ich Alisa ernst.
Ihre perfekt geformten Augenbrauen zogen sich zusammen.
»’tschuldigung«, sagte ich staubtrocken. »Ganz vergessen. So nenne ich ihn ja.«
Alisa schnaubte. »Tust du nicht.«
Ein geradezu Hawthorn’sches Grinsen zupfte an meinen Mundwinkeln und mein Blick ging wieder zum Fenster raus. In der Ferne konnte ich immer noch die Kirchtürme ausmachen, die im gold-violett-grauen Himmel verschwanden.
Alisa irrte sich. Niemals würde ich mich hieran gewöhnen. Das hier war alles – genauso wie Jameson Hawthorne.
»Ich bin nicht Saint Avery«, sagte ich zu Alisa. »Das weißt du.«
Ich hatte genug von meinem Erbe behalten, um buchstäblich niemals auch nur einen nennenswerten Bruchteil davon ausgeben zu können; aber alles, was die meisten Menschen sahen, war die Summe, die ich verschenkt hatte. Der landläufigen Meinung zufolge war ich entweder der Inbegriff von Tugend oder aber ungefähr so intelligent wie ein Brot.
»Du magst vielleicht keine Heilige sein«, entgegnete Alisa, »aber du bist diskret.«
»Und Jameson … nicht.« Falls Alisa merkte, wie meine Lippen sich nach oben bogen, nur weil ich seinen Namen sagte, beschloss sie, es zu ignorieren.
»Er ist ein Hawthorne. Diskret gehört nicht zum Wortschatz dieser Familie.« Alisa hatte ihre eigene Vergangenheit mit den Hawthornes. »Die Stiftungsarbeit nimmt gerade erst Fahrt auf. Wir können im Moment keinen Skandal gebrauchen. Wenn du also Jameson siehst, dann sag ihm: keine Welpen diesmal. Keine Einbrüche. Keine Dächer. Keine Mutproben. Lass ihn nichts trinken, was im Dunkeln leuchtet. Ruf mich an, wenn er Lederhosen auch nur erwähnt. Und denk dran …«
»Ich bin keine Cinderella mehr«, beendete ich für sie. »Ich schreibe jetzt meine eigene Geschichte.«
Mit siebzehn, als mein Leben sich für immer verändert hatte, war ich noch der Glückspilz aus der Gosse gewesen – ein armes Mädchen, das aus dem Sumpf der Bedeutungslosigkeit gezogen worden war und aufgrund der Laune eines exzentrischen Milliardärs die Welt zu Füßen gelegt bekommen hatte. Aber heute? Heute war ich die exzentrische Milliardärin.
Ich hatte mein Vermächtnis angetreten. Und die Welt schaute zu.
Saint Avery. Bei der Vorstellung schüttelte ich den Kopf. Wer auch immer sich den Spitznamen ausgedacht hatte, kapierte offenbar nicht, dass es nur einen einzigen Unterschied zwischen Jameson und mir gab: Sobald es an Mutproben, Spiele und brenzlige Momente ging, war ich schlicht besser darin, mich nicht erwischen zu lassen.
Innerhalb weniger Minuten war alles zum Ausstieg bereitet – erst die Security, dann Alisa, dann ich. Kaum dass ich festen Boden unter den Füßen hatte, erhielt ich eine Nachricht von Jameson. Ich bezweifelte, dass das Timing Zufall war.
Bei Jameson waren das gemeinhin nur sehr wenige Dinge.
Ich las die Nachricht, und eine Woge von Energie – ähnlich der, die mich überkam, als ich gerade eben durchs Fenster auf die uralte Stadt unter mir geblickt hatte – erfasste mich. Ein langsames Lächeln breitete sich über mein Gesicht.
Zwei Sätze. Mehr brauchte Jameson nicht, um mein Herz dazu zu bringen, ein wenig stärker, ein wenig schneller zu schlagen.
Willkommen in der Stadt der hundert Kirchtürme. Lust auf eine Runde Verstecken?
Kapitel 2
Unsere Version von Verstecken hatte genau drei Regeln:
Derjenige, der sich versteckte, musste sein Handy bei sich behalten.
Die GPS-Überwachung musste aktiviert sein.
Zum Suchen hatte man eine Stunde Zeit.
In den vergangenen sechs Monaten hatten Jameson und ich auf Bali, in Kyoto und in Marseille gespielt, an der Amalfiküste und in den labyrinthartigen Märkten Marokkos. Den GPS-Koordinaten zu folgen, war dabei nie der schwierige Teil gewesen, und das galt auch heute. Ganz gleich, wie oft ich Jamesons Standort checkte, die blinkende blaue Markierung blieb in einem Radius, der etwa einen halben Häuserblock unterhalb der Prager Burg umfasste. Und das war die Herausforderung.
Mein Schwachpunkt beim Versteckspielen war immer der, dass es mir schwerfiel, mich nicht in meiner Umgebung zu verlieren, im Moment … oder in diesem Fall dem Ausblick. Der Burg. Schon bevor ich nach Prag gekommen war, hatte ich gewusst, dass die Burganlage zu den größten der Welt gehörte, aber zu wissen, war etwas anderes, als zu sehen, war etwas anderes, als zu spüren.
Es lag ein gewisser Zauber darin, im Schatten eines uralten, massiven Etwas zu stehen, das einen sich unwillkürlich klein fühlen ließ, das einem vermittelte, wie gewaltig die Erde mit all ihren Möglichkeiten war. Ich nahm mir eine ganze Minute, um alles in mich aufzusaugen – nicht nur den Anblick, sondern auch die Brise der frischen Morgenluft auf meiner Haut und das Treiben der Menschen um mich herum, die bereits in den Straßen unterwegs waren.
Dann machte ich mich an die Arbeit.
Laut GPS hatte Jamesons Standort sich zwischen mehreren Positionen bewegt, die sich allesamt innerhalb vom Palastgarten oder manchmal auch knapp außerhalb seiner Mauern zu befinden schienen. Auf der Suche nach einem Eingang ging ich besagte Mauern ab und brauchte nicht lang, um zu begreifen, dass es sich bei dem Garten tatsächlich um mehrere untereinander verbundene Gärten handelte, die allesamt geschlossen waren – zumindest für die Öffentlichkeit.
Als ich mich schließlich dem Eingang näherte, schwang das eiserne Tor für mich auf.
Wie von Zauberhand. Das, was ich vorhin im Flugzeug zu Alisa gesagt hatte, hatte ich auch so gemeint. Niemals würde ich mich an das hier gewöhnen. Ich schritt durch das Tor und Oren folgte in gemessenem Abstand. Sobald wir beide drinnen waren, schwang das Tor hinter uns zu.
Ich begegnete dem Blick des Aufsehers, der es geschlossen hatte. Er schmunzelte.
Ich hatte keine Ahnung, wie Jameson das hier eingefädelt hatte. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich es wissen wollte. Mein gesamter Körper sirrte vor Aufregung über das Spiel. Ich ging weiter, bis ich eine Reihe schmaler, steiler Treppen erreichte – die Art Treppen, die einem das Gefühl vermittelten, als könnten die Stufen einen in die Vergangenheit zurückbefördern.
Als ich die erste erklommen hatte, schaute ich kurz auf mein Handy runter und hob den Blick dann wieder zu der mich umgebenden Gartenterrasse. Dann weiter hoch und noch höher. Mein Gehirn überschlug automatisch die Anzahl von Treppen, die Anzahl von Terrassen.
Wieder schaute ich auf mein Handy und bog kurzerhand vom vorgegebenen Pfad ab; ich lief weiter und bog dann wieder ab. In der Sekunde, in der mein GPS-Standort Jamesons streifte, verschwand sein blinkender Cursor von der Karte.
Genau genommen waren es damit vier Regeln für unsere Version von Verstecken.
Die Jagd hatte begonnen.
»Hab dich!« Einst war ich eine bescheidenere Siegerin gewesen, doch heute kostete ich jeden Triumph genauso aus wie ein Hawthorne.
»Sind wir etwas knapp dran, Erbin?«, meldete sich Jamesons Stimme von hinter dem Baum zwischen uns. Zwar konnte ich keinen Teil seines Körpers sehen, aber ich konnte seine Präsenz spüren, die Umrisse seiner hohen, schlanken Gestalt. »Achtundfünfzig Minuten, neunzehn Sekunden«, berichtete er.
»Eine Minute einundvierzig vor der Zeit«, gab ich zurück, ging um den Baum herum und blieb unmittelbar vor ihm stehen. »Wie hast du sie dazu gebracht, früher zu öffnen?«
Jamesons Lippen verzogen sich nach oben. Er drehte sich um neunzig Grad und machte drei Schritte in Richtung des Gartenpfads. »Wie hätte ich sie nicht dazu bringen können, früher zu öffnen?«
Noch drei Schritte und er befand sich auf dem Pfad. Er ging in die Hocke und hob etwas von einem Stein auf. Noch bevor er sich wieder aufrichtete, wusste ich, dass es sich bei seinem Fund um eine Münze handelte.
Jameson ließ sie über seinen Handrücken wandern, von einem Finger zum nächsten. »Kopf oder Zahl, Erbin?«
Meine Augen kniffen sich ganz leicht zusammen, doch ich vermutete stark, dass meine Pupillen sich weiteten, während sie all das in sich aufsogen. Das hier, das waren wir. Jameson. Ich. Unsere Sprache. Unser Spiel.
Kopf oder Zahl?
»Die hast du da deponiert«, bemerkte ich mit einem Nicken zur Münze. Ich hatte eine ganze Sammlung davon, immer mindestens eine von jedem Ort, den wir besucht hatten. Und an jeder dieser Münzen hing eine Erinnerung.
»Nun«, murmelte Jameson, »wieso sollte ich so etwas tun?«
Kopf? – Ich küsse dich, hatte er mir mal gesagt. Zahl? – Du küsst mich. So oder so hat es etwas zu bedeuten.
Ich streckte die Hand aus, um ihm die Münze abzunehmen, und er ließ es zu – nicht, dass ich nicht auch so gesiegt hätte. Ich blickte auf die Münze hinab. Der äußere Ring war aus Bronze, der Kreis innen, der das Bild einer Burg trug, aus Gold. Auf der Rückseite prangte eine goldene löwenartige Kreatur.
Ich ließ die Münze über meinen Handrücken wandern, so wie Jameson es getan hatte – ein Fingerspalt nach dem anderen. Zuletzt klemmte ich sie zwischen die Seiten von Daumen und Zeigefinger und warf sie hoch.
Ich fing sie in meiner hohlen Hand auf. Gemächlich streckte ich die Finger aus und sah von der Münze zu ihm. »Kopf.«
Kapitel 3
Vierzig Minuten später befanden wir uns auf einem Dach. Sorry, Alisa. Die Münze hatte ich mitgenommen.
»Du könntest dir was wünschen«, schlug ich Jameson vor, wobei ich erneut die Münze zwischen den Fingern drehte. Meine Lippen waren geschwollen und schmerzten auf die einzig richtige Art. Ich warf einen Blick über die Schulter zu den Gärten. »An Brunnen mangelt es da unten nicht.«
Jameson drehte sich nicht zu den Brunnen um. Er lehnte sich an mich, beide in perfekter Balance – sowohl auf dem Dach als auch miteinander. »Welchen Spaß bringt Wünschen schon?«, entgegnete Jameson. »Kein Spiel, das es zu spielen, keine Herausforderung, die es zu gewinnen gilt – einfach nur … paff, hier ist er, dein Herzenswunsch.«
Das war eine sehr Hawthorn’sche Sicht aufs Wünschen, aufs Leben. Jameson war in einer glitzernden elitären Welt aufgewachsen, wo nichts je unerreichbar gewesen war. Er hatte seine Kindergeburtstage nicht damit verbracht, Kerzen auszupusten. Jedes Jahr hatte er mehrere Tausend Dollar bekommen, um sie nach Belieben zu investieren, dazu eine Herausforderung, um sie zu erfüllen, sowie die Chance, sich jedes Talent, jede Fähigkeit dieser Welt auszusuchen, um diese zu kultivieren. Keine Kosten und Mühen wurden gescheut – und keine Ausflüchte oder Entschuldigungen akzeptiert.
Ich erwog, das Thema fallen zu lassen, entschied aber letztlich, ein bisschen dagegenzuhalten. Meiner Erfahrung nach mochte Jameson es, auf Widerstand zu stoßen.
»Du weißt nicht, was du dir wünschen würdest.« Mein Tonfall machte deutlich, dass die Worte als Herausforderung gedacht waren, nicht als Frage.
»Mag sein.« Jameson warf mir einen verschmitzten Blick zu, der nichts als Ärger verhieß. »Dafür fallen mir ganz sicher einige faszinierende Spiele ein, die ich gern für mich entscheiden würde.«
Diese Äußerung war genauso eine Einladung wie sein Kopf oder Zahl davor. Ich hielt mich zurück – nur noch ein bisschen, nur noch einen Moment – und zog die Postkarte, die er mir geschickt hatte, aus der Hosentasche. Sie sah schon etwas geknickt, etwas abgewetzt aus.
Echt – auf eine Art, wie es die Träume der meisten Menschen nie waren.
»Ich habe deine Postkarte bekommen«, sagte ich. »Keine Nachricht auf der Rückseite.«
»Wie lange hast du versucht, herauszufinden, ob ich was mit unsichtbarer Tinte draufgeschrieben habe?«, wollte Jameson wissen. Nichts als Ärger.
Ich konterte mit einer Gegenfrage. »Was für eine unsichtbare Tinte hast du benutzt?«
Nur weil ich es nicht geschafft hatte, sie sichtbar zu machen, hieß das nicht, dass da keine war.
Jameson lehnte sich auf seinen Ellbogen zurück und blickte erneut zur Prager Burg empor. »Womöglich habe ich ja nur überlegt, etwas zu schreiben, und dann beschlossen, es nicht zu tun.« Er ließ ein kleines, lässiges Schulterzucken sehen – ein sehr Jameson-Hawthorn’sches Schulterzucken. »Immerhin wurde das schon mal getan.«
Über Jahrzehnte hinweg hatte ein anderer Hawthorne Postkarten wie diese an meine Mutter geschickt. Ihre Liebe hatte unter einem schlechten Stern gestanden – aber sie war echt gewesen.
Wie die Knicke in meiner Postkarte.
Wie Jameson und ich.
»Alles wurde schon einmal von irgendwem getan«, merkte ich ruhig an.
Jamesons freies Jahr, das er sich nach dem Schulabschluss eingeräumt hatte, war zu drei Vierteln um. Tag um Tag konnte ich spüren, wie er innerlich immer rastloser wurde. Ich hatte nun lange genug mit Hawthornes verbracht, um zu wissen, dass das wahre Vermächtnis des Milliardärs Tobias Hawthorne nicht das Vermögen war, das er mir vermacht hatte. Es waren die Spuren, die er bei jedem seiner Enkelsöhne hinterlassen hatte. Unsichtbar. Bleibend.
Und diese Spur hier war Jamesons: Jameson Winchester Hawthorne war hungrig. Er wollte alles und brauchte etwas, und weil er ein Hawthorne war, durfte dieses flüchtige Etwas niemals gewöhnlich sein.
Er durfte nicht gewöhnlich sein.
»Du solltest mittlerweile wissen, Erbin, dass die Worte Alles wurde schon einmal von irgendwem getan für mich sehr nach Herausforderung klingen.« Er zeigte sein schiefes, verschmitztes Jameson-Hawthorne-Lächeln. »Oder nach Mutprobe.«
»Keine Mutproben«, erwiderte ich ebenso grinsend.
»Du hast mit Alisa gesprochen«, sagte er und wackelte mit einer Augenbraue. »Saint Avery.«
Soweit mir bekannt war, beherrschte Jameson neun Sprachen fließend. Er wusste mit ziemlicher Sicherheit ganz genau, was die Welt über ihn zu sagen hatte.
»Nenn mich nicht so«, befahl ich. »Ich bin keine Heilige.«
Jameson richtete sich auf und strich mir die Haare aus dem Gesicht, wobei seine Fingerspitzen jegliche Anspannung in jedem Muskel verscheuchten, den sie streiften. In meiner Schläfe. Meiner Kopfhaut.
»Du tust so, als wäre das, was du mit deinem Erbe getan hast, nichts«, sagte er. »So als hätte das jeder getan. Aber ich hätte es nicht getan. Grayson hätte es nicht getan. Keiner von uns. Du tust so, als wäre das, was du mit deiner Stiftung leistest, nichts Außergewöhnliches … oder, wenn doch, dann, weil diese Arbeit so viel größer ist als du selbst. Aber weißt du was, Avery? Was du da tust … das ist etwas.«
Die Hawthorn’sche Art von etwas. Alles.
»Das bin doch nicht nur ich«, erwiderte ich heftig. »Das sind wir alle.« Er und seine Brüder arbeiteten mit mir zusammen an der Stiftung. Es gab Dinge, für die er sich starkgemacht hatte, Menschen, die er für den Vorstand gewonnen hatte.
»Und doch …« Jameson zog die Worte in die Länge. »… bist du heute diejenige mit den Meetings.«
Milliarden zu verschenken – auf strategische, gerechte Weise, mit Blick auf die Ergebnisse –, war viel Arbeit. Ich war nicht so naiv, alles selbst machen zu wollen, aber ich hatte auch nicht vor, mich auf Blut, Schweiß und Tränen anderer auszuruhen.
Das war meine Geschichte. Ich war dabei, sie zu schreiben. Das war meine Chance, die Welt zu verändern.
Aber die nächsten paar Minuten … Ich legte meine Hand an Jamesons Wange … sind da nur du und ich. Auf diesem Dach hier, hoch oben über der Welt, zu den Füßen einer Burg, schien es, als wären wir die beiden einzigen Menschen im Universum.
So als stünde Oren nicht unten Wache. So als würde Alisa nicht draußen vor dem Tor warten. So als wäre ich einfach nur Avery und er nur Jameson, und das wäre genug.
»Mein Meeting ist erst in einer Stunde«, merkte ich an.
Jamesons adrenalingeküsstes Lächeln war, mit einem Wort, gefährlich. »In diesem Fall«, raunte er, »dürfte ich dich wohl für ein paar formschöne Hecken, eine Herkulesstatue und einen weißen Pfau begeistern?«
Ich musste nicht zu den Palastgärten unter uns schauen, um zu wissen, dass sie immer noch geschlossen waren. Jameson und ich hatten diesen magischen, der Vergangenheit entnommenen Ort immer noch für uns allein.
Ich zeigte meinerseits ein adrenalingeküsstes Lächeln. »Alisa sagte, keine Welpen.«
»Ein Pfau ist doch kein Welpe«, erwiderte Jameson unschuldig. Dann brachte er seine Lippen ganz nah an meine, streifte sie gerade so – einer Einladung gleich, einer Herausforderung, einer Frage.
Ja. Bei Jameson lautete meine Antwort beinahe immer Ja.
Ihn zu küssen, setzte meinen gesamten Körper in Brand. Während ich mich in den Flammen verlor, in ihm, hatte ich das Gefühl, am Fuße von etwas zu stehen, das so viel monumentaler war als eine Burg.
Die Welt war groß, und wir waren klein, und das hier war alles.
»Ach, Erbin?« Jamesons Lippen wanderten zu meinem Kiefer, dann zu meinem Hals. »Nur fürs Protokoll …«
Ich spürte ihn überall. Meine Fingernägel gruben sich sanft in die Haut an seinem Hals.
»Ich würde dich nie mit einer Heiligen verwechseln«, wisperte er heiser.
Der Morgen danach
Da war Blut an Jamesons Hals, auf seiner Brust. Ich brauchte einen Moment, um festzustellen, dass der Großteil getrocknet war, und dann verging noch eine kleine Ewigkeit, in der die Zeit stillzustehen schien, bis ich die Quelle ausgemacht hatte: ein tiefer Schnitt an der Stelle, wo die Spitze seines Schlüsselbeins in die Mulde an seinem Halsansatz überging.
Ich stürzte vorwärts. Als meine Hände sich seitlich an Jamesons Hals hoben, registrierte ich, dass, obgleich der tiefste Teil des Schnitts kurz war, sich lange rote Linien zu beiden Seiten seines Schlüsselbeines entlangzogen – flachere Schnitte, die seiner Wunde beinahe die Form eines Dreiecks verliehen.
Jemand hat dir das angetan. Ich brachte kein Wort heraus. Das Einzige, was eine solche Verletzung verursachen konnte, war eine Klinge, geführt von jemandem, der ganz genau wusste, was er tat.
Ein Messer? Bei der Vorstellung, wie jemand Jameson ein Messer an den Hals hielt – so nah an seinen Schlagadern –, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Immer noch bekam ich kein Wort raus, während ich mit den Fingern behutsam bis knapp über die Wunde hinabstrich. Ich starrte das zarte Rinnsal getrockneten Blutes auf seiner Brust an, dann erst fiel mir sein Hemd auf.
Als Jameson verschwunden war, hatte er eben dieses Hemd getragen, doch jetzt waren die obersten vier Knöpfe fort – abgeschnitten? –, sodass die Haut darunter zu sehen war.
»Jameson.« Noch nie in meinem Leben hatte ich ein Wort mit einer solchen Dringlichkeit ausgesprochen.
»Ich weiß, Erbin.« Seine Stimme war heiser und tief, trotzdem brachte er ein verwegenes Grinsen zustande. »Blut steht mir echt gut.«
Jameson blieb Jameson, und zwar immer.
Das Rasen meines Herzschlags ließ langsam nach. Ich öffnete den Mund, um zu fragen, wo zum Henker er gesteckt hatte und was zur Hölle ihm widerfahren war, doch bevor ich auch nur eine Silbe rausbekam, registrierte ich …
Er roch nach Rauch. Nach Feuer. Und sein Hemd war von Asche verdreckt.
Kapitel 4
Drei Tage zuvor …
Nachdem ich den ganzen Tag nonstop gearbeitet hatte, hatte ich nur noch eins im Sinn. Nur einen Menschen. Kaum dass ich unser von jahrhundertealten Gebäuden umgebenes Hotel erblickte, stieg die Vorfreude in mir mit jedem Schritt an.
Ich eilte in die Lobby.
In den Aufzug.
Und wieder raus.
Die Königssuite belegte eine eigene Etage. Ich registrierte zwei von Orens Männern, die im Flur Stellung bezogen hatten. In der Lobby unten hatte ein dritter gestanden. Soweit ich wusste, war dies das gesamte Team, das er nach Prag mitgenommen hatte.
Die Drohungen gegen meine Person bewegten sich auf einem Rekordtief.
Das hielt Oren nicht davon ab, sich unmittelbar vor mir aufzubauen, während wir den Flur entlanggingen. Er öffnete die Tür zur Suite und checkte den Eingangsbereich sowie die angrenzenden Zimmer, bevor ich eintreten durfte. Sobald ich das tat, fiel mir etwas auf: Vom Flur aus hatte die Tür, durch die ich gerade getreten war, einfach nur wie eine Tür ausgesehen; doch als sie sich auf dieser Seite schloss, verschwand sie nahtlos in einem opulenten goldenen Wandgemälde und erzeugte so den Eindruck, dass der Eingangsbereich weder über Ein- noch Ausgang verfügte – dass die Königssuite eine Welt für sich war.
Der Boden bestand aus weißem Marmor, doch nur wenige Schritte vor mir lag ein dunkelroter Teppich, der so weich und flauschig aussah, dass ich dem Drang nachgab, die Schuhe von mir zu kicken und barfuß draufzutreten. Auf dem Teppich standen zwei Sessel, die zum Wandgemälde hin ausgerichtet waren. Das marmorne Tischchen zwischen ihnen war buchstäblich ein Kunstwerk. In die Vorderseite des Marmorsockels war eine Skulptur gemeißelt. Ich brauchte einen Moment, bis ich die Kreatur von der Münze darin wiedererkannte. Der Löwe. Ein Wappen.
»Alles sauber«, erklärte Oren – mit anderen Worten: Er hatte den Rest der Suite überprüft, womit sich eine Frage stellte …
»Wo ist Jameson?«
»Diese Frage könnte ich zwar beantworten«, erwiderte Owen, »aber irgendwas sagt mir, dir wäre es lieber, wenn ich es nicht tue.« Er hob eine Hand ans Ohr – ein Signal, dass er eine Botschaft über sein Headset reinbekam. »Alisa ist auf dem Weg nach oben«, berichtete er.
Alisa würde sicher eine kurze Nachbesprechung meines letzten Meetings wollen, an dem sie nicht hatte teilnehmen können. Genauso wie Grayson – Jamesons Bruder – einen Bericht über sämtliche heutigen Meetings erwartete, doch ich unterdrückte den Impuls, mein Handy hervorzuziehen.
Diese Frage könnte ich beantworten, hatte Oren gesagt. Aber irgendwas sagt mir, dir wäre es lieber, wenn ich es nicht tue. Das hätte ganz schön ominös klingen können. Aber ich wusste, wie Oren aussah, wenn er ganz vage mit dem Gedanken spielte, beinahe zu lächeln.
Und so ging ich vom Eingangsbereich in den nächsten Raum: ein Esszimmer mit kristallenem Kronleuchter an der Decke und goldgerändertem Porzellan auf dem Tisch. Neben jedem der zwölf Gedecke stand eine Champagnerflöte. In den Champagnerflöten befanden sich Kristalle.
Tausende von Kristallen, diamantartig und winzig. Ich ging um den Tisch herum und blieb stehen, als ich einen Farbsprengsel in einem der eleganten Gläser erblickte – grün, wie Jamesons Augen.
Vorsichtig, wenn auch flink kippte ich die Kristalle auf den Tisch. Unter ihnen fand ich einen größeren Edelstein. Ein Smaragd? Er war so breit wie mein Daumennagel, und als ich ihn hochhob und im Licht hin und her drehte, bemerkte ich, dass da etwas auf seiner Oberfläche war.
Ein Pfeil.
Ich drehte den Klunker und der Pfeil bewegte sich ebenfalls. Kein Juwel, wurde mir klar. Ich hielt einen kleinen, äußerst zerbrechlichen Kompass in der Hand.
Ich brauchte keine drei Sekunden, um zu kapieren, dass der »Kompass« nicht nach Norden zeigte.
Jameson. Ich spürte, wie sich meine Mundwinkel nach oben bogen. Bevor ich ihn kennengelernt hatte, hatte ich nie so gelächelt – ein Lächeln, das sich über mein gesamtes Gesicht breitete und einen kribbelnden Schwall von Energie durch meinen ganzen Körper sandte.
Ich folgte dem Pfeil.
Als ich ein Wohnzimmer betrat – ausstaffiert mit einem weiteren Kronleuchter, einem weiteren dicken roten Teppich sowie großzügigen Fenstern, die einen atemberaubenden Blick auf den Fluss boten –, suchte ich den Raum ab und entdeckte ein weiteres kunstvoll gefertigtes Marmortischchen.
Auf dem Tischchen stand eine Vase.
Mein Blick verweilte auf den Blumen. Rosen. Fünf schwarze. Sieben rote. Erneut wandte ich mich dem Raum zu, um nach dieser Farbkombination Ausschau zu halten, nach irgendwas, das sich zählen ließe, als mir klar wurde, dass ich dabei war, in eine Hawthorne-Falle zu tappen.
Ich verkomplizierte die Dinge.
Ich beugte mich vor und griff in den Strauß. Sieg. Meine Finger schlossen sich um einen zylindrischen Metallgegenstand.
»Möchte ich es wissen?«, hörte ich hinter mir Alisa Oren fragen.
»Musst du denn fragen?«, gab der zurück.
Eine Taschenlampe. Ich betrachtete den Gegenstand in meiner Hand und drehte ihn, um mich sogleich laut zu korrigieren. »Ein Schwarzlicht.«
Jameson machte mir das hier nicht sonderlich schwer, was mich auf den Gedanken brachte, dass es hier nicht um die Aufgabe an sich ging. Sondern um die Spannung.
»Kann einer von euch das Licht ausmachen?«, rief ich nach hinten zu Oren und Alisa. Ich wandte mich nicht um, um zu sehen, wer meiner Bitte nachkam.
Ich war zu beschäftigt mit der Schwarzlichtlampe.
Mehrere Pfeile erschienen auf dem Boden. Das sah Jameson ähnlich: nicht mal mit der Wimper zu zucken bei der Vorstellung, die allerschönste Hotelsuite, die ich je gesehen hatte, zu beschmieren – wenn auch unsichtbar.
»Stichwort unsichtbar«, murmelte ich bei mir, während ich den Pfeilen aus dem Wohnzimmer in den nächsten und übernächsten Raum und dann auf einen Balkon hinaus folgte. Die Pfeile führten mich an die Brüstung – mit dieser unglaublichen Aussicht auf den Fluss –, bevor sie sich wieder Richtung Gebäude drehten … und die Mauer hochwanderten.
Die Hotelfassade war aus massivem Stein erbaut, nicht aus Ziegeln, was bedeutete, dass es Griffe für die Hände gab. Mauerspalten für die Füße. Möglichkeiten.
Barfuß begann ich zu klettern.
»Ich meine mich zu erinnern, keine Dächer gesagt zu haben!«, rief Alisa mir hinterher.
Ich war zu beschäftigt mit Klettern, um zu antworten, doch Oren sprang ein. »Gefährdungslevel niedrig.« Ich verkniff mir ein Grinsen, was sich als vergebliches Unterfangen erwies, als mein Security-Chef fortfuhr: »Ach ja, ich meine in der Küche eine Champagnerflasche mit deinem Namen drauf gesehen zu haben – ungelogen.«
Jamesons Werk, dachte ich. Er hatte die Fertigkeit, Alisa abzulenken, zu einer Kunstform perfektioniert.
Das Letzte, was ich hörte, als ich meine Hand um die Dachtraufe schloss, war Alisas Antwort auf Orens nur spärlich verborgene Belustigung. »Verräter.«
Ich hätte ja gelacht, wäre das nicht der Moment gewesen, in dem ich meine Kletterpartie beendete und das Dach in mein Blickfeld kam. Die Ziegel leuchteten orangerot – der exakte Farbton der untergehenden Sonne. Ganz oben in der Mitte befand sich eine Metallkuppel, die in eine Turmspitze überging.
Auf der Kuppel, eine Hand an die Turmspitze gelehnt, stand Jameson Winchester Hawthorne.
Lediglich die sanfte Neigung der Dachschrägen sowie die Tatsache, dass sich eine kleine steinerne Terrasse am Fuß der Kuppel befand, konnte auch nur annähernd Orens Einschätzung rechtfertigen, dass hier keine Gefahr bestand. Aber vielleicht wusste er auch einfach, dass Jameson und ich die Angewohnheit hatten, mit den Füßen auf dem Boden zu landen.
Vorsichtig überquerte ich die Ziegel und erreichte den steinernen Vorsprung. Die Brüstung erinnerte an ein Gemäuer, durch das einst Bogenschützen ihre Pfeile abgeschossen haben könnten. Nachdem ich die Terrasse betreten hatte, vollführte ich eine Drehung um dreihundertsechzig Grad, um alles in mich aufzunehmen.
Jameson blieb noch einen Moment auf der Kuppel stehen, dann schwang er sich zu mir hinab.
»Hab dich gefunden«, murmelte ich. »Zweimal an einem Tag.«
Die Art, wie Jamesons Lippen sich langsam nach oben verzogen, hatte etwas leicht Träges und absolut Schelmisches an sich. »Ich muss zugeben«, erwiderte er, »ich fange an, Prag zu mögen. Sehr.«
Während ich ihn in allen Einzelheiten musterte, registrierte ich eine Spannung in seinen Muskeln; er stand da, als wäre er gerüstet und für alles bereit. So als würde er immer noch oben auf der Kuppel stehen.
»Will ich wissen, wie du deinen Tag zugebracht hast?«, fragte ich.
Einer Sache war ich mir sicher: Jameson hatte ihn nicht hier im Hotel verbracht. Ich bezweifelte, dass er länger als eine halbe Stunde gebraucht hatte, um das Ganze hier zu arrangieren. Mein Bauchgefühl sagte mir außerdem, dass irgendwas ihn dazu getrieben hatte. Etwas hatte ihn in Spiellaune versetzt.
Ich konnte diese gewisse Energie spüren, die direkt unter seiner Haut sirrte.
»Klar willst du das.« Jameson schmunzelte. Ich konnte hören, was er wirklich sagte: Ihm war klar, dass ich wissen wollte, wie er seinen Tag verbracht hatte, aber genauso klar war …
»Du wirst es mir nicht verraten.«
Jameson blickte auf die Moldau unter uns hinab, bevor er sich um die eigene Achse drehte so wie ich gerade eben, um auch den Rest der Aussicht in sich aufzunehmen. Diese Stadt. »Ich habe ein Geheimnis, Erbin.«
Ich habe ein Geheimnis war eines der Lieblingsspiele meiner Mutter gewesen, eines der am längsten anhaltenden Spiele, die wir zusammen gespielt hatten. Die eine von uns verkündete, dass sie ein Geheimnis habe, und die andere musste raten. Die größten Geheimnisse meiner Mutter hatte ich nie erraten, hatte sie erst aufgedeckt, als Mom schon lange tot und ich in die Welt der Hawthornes hineingezogen worden war; aber sie hatte immer ein Händchen dafür gehabt, meine zu erraten.
Ich richtete die ganze Kraft meines Blicks auf Jamesons leuchtend grüne Augen. »Du hast etwas gefunden«, riet ich. »Du hast etwas getan, was du nicht hättest tun sollen. Du hast jemanden getroffen.«
Jameson entblößte seine Zähne zu einem kurzen Lächeln. »Ja.«
»Ja zu was davon?«, wollte ich wissen.
Jameson setzte eine Unschuldsmiene auf – viel zu unschuldig. »Wie waren deine Meetings?«
Ich konnte das Rauschen von Adrenalin in seinen Adern förmlich hören. Er war so lebendig – hier oben, in diesem Augenblick, genau jetzt –, dass eine leise summende Intensität in Wellen von ihm abstrahlte.
Jameson hatte definitiv ein Geheimnis.
»Produktiv«, beantwortete ich seine Frage und machte einen Schritt auf ihn zu. »Morgen habe ich überhaupt keine Meetings.«
»Und auch übermorgen nicht. Und überübermorgen.« Jamesons Stimme nahm eine etwas tiefere, etwas heisere Färbung an. »Lust auf ein Spiel?«
Sofort musste ich grinsen, aber ich war klug genug – und hatte genug Erfahrung mit Hawthornes –, um diesen Vorschlag mit einem Mindestmaß an Vorsicht anzugehen. »Was für eine Art Spiel?«
»Unsere Art«, erwiderte Jameson. »Ein Hawthorne-Spiel. Ein Samstagmorgenspiel – Hinweis um Hinweis.«
Jameson richtete den Blick auf die steinerne Brüstung hinter mir. Ich drehte mich um und erblickte obenauf zwei Gegenstände: einen, den ich sofort wiedererkannte, und einen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte.
Ein Messer. Ein Schlüssel.
Das Messer gehörte Jameson – erbeutet in einem eben jener lang vergangenen Samstagmorgenspiele mit seinem Milliardärsgroßvater. Der Schlüssel war alt und aus Eisen geschmiedet.
»Nur zwei Gegenstände?« Ich zog eine Augenbraue hoch. Normalerweise gab es bei dieser Sorte Spiel mehr Hilfsmittel. Einen Angelhaken. Ein Preisschild. Eine gläserne Ballerina. Ein Messer.
»Das habe ich nie behauptet.« Jameson ahmte meine Miene nach, indem er ebenfalls eine Augenbraue hochzog.
Einst hatte er mich lediglich als eine der vielen Figuren in einem der vertrackten Spiele seines Großvaters betrachtet. Heute wäre ihm im Traum nicht eingefallen, mich als etwas anderes als Spielerin zu betrachten.
»Ein Spiel.« Ich beäugte das Messer und den Schlüssel.
»Eigentlich habe ich mir gedacht, wir könnten zwei spielen: eins nach meiner Idee, eins nach deiner.«
Zwei Spiele. Von unserer Art von Spielen.
»Wir haben noch drei ganze Tage in Prag«, merkte ich an.
»In der Tat, Erbin, die haben wir.« Er hatte ein gutes Pokerface, aber nicht annähernd gut genug.
»Du hast dir dein Spiel bereits ausgedacht, stimmt’s?«, wollte ich wissen.
»Dieser Ort, diese Stadt … im Grunde hat sie es für mich ausgedacht.« Da war es wieder, dieses Sirren von Energie in Jamesons Stimme, das mir verriet, dass er gerade nicht nur spielte. Dass etwas vorgefallen war.
Ich habe ein Geheimnis …
»Ein Tag für mein Spiel«, bot mir der magnetische, adrenalintrunkene, wunderschöne, elektrisierende Junge vor mir an. »Ein Tag für deines. Das Spiel darf nicht mehr als fünf Schritte haben. Der Schnellere gewinnt und darf die Freizeitgestaltung für unseren letzten Tag in Prag bestimmen.«
Jamesons Tonfall machte sehr deutlich, was seine Freizeitgestaltung beinhalten würde. Ich hatte zwar keine Ahnung, was er in den letzten Stunden erlebt hatte, aber was auch immer es war, ich konnte den Nachhall davon beinahe auf meiner Zungenspitze schmecken – einen zarten, lockenden Kitzel. Ich konnte Jamesons Energie durch meine eigenen Adern pulsieren spüren.
Du hast ein Geheimnis, dachte ich.
»In Ordnung, Hawthorne«, erwiderte ich. »Wir spielen.«
Der Morgen danach
Ich konnte meine Finger gerade noch davon abhalten, die Asche auf Jamesons weißem Hemd zu berühren. »Du riechst nach Rauch«, bemerkte ich.
»Ich rauche nicht, Erbin.«
Jameson Hawthorne, Meister der Ablenkung. »Das ist nicht die Art von Rauch, die ich meine«, erwiderte ich, doch anhand des Ausdrucks auf seinem Gesicht wusste ich genauso gut wie er selbst, dass er kein Wort über Feuer, Flammen oder darüber, wie knapp er einer Verbrennung entgangen war, verlieren würde.
Was ist passiert? Stumm suchte ich in seinen Augen nach einer Antwort, bevor mein Blick wieder zu dem Schnitt an seinem Halsansatz wanderte – am unteren Ende tief, nach oben hin flach auslaufend. Wer hat dir das angetan?
Statt die Frage auszusprechen, fuhr ich mit den Fingerspitzen das getrocknete Blut auf seiner Brust entlang – dunkle Schlieren, als wären die Blutstropfen wie schwere, dicke Tränen an seiner Brust hinabgeronnen. Mir entgingen die Schweißperlen nicht, die jetzt noch auf seiner Haut prangten. Und als ich den Blick wieder zu seinem Gesicht hob, schien er auf der Hut zu sein, als müssten seine Züge etwas verbergen.
Jameson lächelte zwar immer noch, doch meine Instinkte sagten mir, dass dieses Lächeln eine Lüge war.
Blut steht mir echt gut, hatte er gewitzelt.
»Ich bin nicht fertig mit Fragenstellen«, warnte ich ihn.
Jameson hob die Hand und berührte mich mit einem leichten Streifen meiner Wange, so als wäre ich hier die Zerbrechliche. »Das dachte ich auch nicht, Erbin.«
Entschlossene Schritte kündigten Oren an. Mein Security-Chef kam ums Eck und sondierte die Lage in einem Sekundenbruchteil: Jameson, ich, das Blut.
Oren verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich habe ebenfalls Fragen.«
Kapitel 5
Zwei Tage zuvor …
An meinem zweiten Tag in Prag erwachte ich mit der Morgendämmerung. Jameson neben mir schlief noch. Ein Tag für mein Spiel, hatte er am Vorabend bestimmt. Ein Tag für deines.
Den Regeln zufolge, auf die wir uns geeinigt hatten – nach langwierigen und nicht ganz jugendfreien »Verhandlungen« –, hatte ich bis Mitternacht Zeit, um es bis zum Ende seines Spiels zu schaffen. So verlockend es auch war, im Bett liegen zu bleiben, war ich nicht so naiv, zu denken, dass Jameson es mir leicht gemacht hatte.
Sein Spiel würde eine Herausforderung werden und ich würde jede mir zur Verfügung stehende Minute brauchen.
Ich rollte mich herum, stützte mich auf und griff über Jameson hinweg nach den Gegenständen auf dem Nachttisch. Dem Messer. Dem Schlüssel. Als ich Letzteren zu Ersterem rüberschob und meine Finger um beide schloss, rührte Jameson sich unter mir. Einen Moment lang blickte ich zu der gezackten Narbe, die sich der Länge nach über seinen Oberkörper zog. Ich kannte jeden Zentimeter dieser Narbe.
Genauso wie ich Jameson Winchester Hawthorne kannte und wusste, dass er spielte, um zu gewinnen.
»Guten Morgen, Erbin.« Jameson hatte die Augen immer noch geschlossen, aber ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
Mir blieb nur ein Wimpernschlag, um meine Wahl zu treffen: Sollte ich aufgestützt neben ihm im Bett liegen bleiben oder mich in eine Position begeben, die mir etwas mehr Kontrolle bot?
Ich entschied mich für Letzteres. Als Jameson die Augen öffnete, saß ich bereits rittlings auf ihm, eine Hand auf seiner Brust, mit der anderen fest die beiden Gegenstände gepackt, die das Spiel lostreten würden.
Es hatte Vorteile, seinen Gegner unter sich festzunageln.
Jameson machte nicht einmal den Versuch, sich auf seine Ellbogen aufzustützen. Er sah bloß mit diesem ganz gewissen Zug um die Lippen zu mir hoch.
»Du wirst mich nicht ablenken, Hawthorne.«
»Würde mir im Traum nicht einfallen.« Jameson feixte. »Ich habe Skrupel, weißt du.«
»Ich weiß das«, erwiderte ich. »Du nicht.«
Jameson hegte die tief sitzende Überzeugung, dass er kein guter Kerl war – so einer, der die richtigen Entscheidungen traf –, geschweige denn ein Held. An seinen schlimmsten Tagen sah er mich an und dachte, dass ich etwas Besseres verdiente als ihn.
Heute würde nicht einer dieser Tage werden.
Auf ihm sitzend verlagerte ich mein Gewicht. Nachdem ich den Schlüssel auf seinem brettharten Bauch abgelegt hatte, wandte ich meine Aufmerksamkeit dem Messer zu. Es war nicht das erste Mal, dass ich diese Klinge betrachtete oder sie in Händen hielt, daher wusste ich genau, dass sich im Griff ein Geheimfach verbarg.
Ich brauchte nicht lang, um den Riegel dafür ausfindig zu machen.
Sobald das Fach aufschnappte, kippte ich das Messer, woraufhin ein kleiner Zettel herausfiel wie ein Spruch aus einem Glückskeks. Beinahe wollte ich mich schon von Jameson runterschwingen, um ihn zu lesen, entschied mich dann aber dagegen. Die untere Hälfte seines Körpers weiterhin durch mein Gewicht fixiert, beugte ich mich vor und rollte den schmalen Papierstreifen neben dem Schlüssel auf seinem Bauch aus.
Auf dem Papier starrte mir Jamesons krakelige Handschrift entgegen. Ein Gedicht. Ein Hinweis.
»Zählt dieser Fund als Schritt eins?«, wollte ich von Jameson wissen. Am Vorabend hatte er bestimmt, dass unsere Spiele sich auf fünf Schritte begrenzen müssten.
Jameson verschränkte die Hände unter seinem Hinterkopf und lächelte, als kümmerte ihn nichts auf der ganzen Welt. So als würde sein Körper unter mir sich nicht auf die bestmögliche Art und Weise anspannen. »Was glaubst du denn?«, entgegnete er.
Ich glaube, dass, wenn ich jetzt nicht von dir runtergehe, ich es niemals aus diesem Zimmer schaffe.
Ich rollte mich zur Seite, dann vom Bett und kam auf einem weiteren fluffigen roten Teppich zum Stehen. »Ich glaube«, erwiderte ich, »dass das hier Schritt eins ist.«
Ich überflog die Worte meines ersten Hinweises:
Borrow or rob?
Don’t nod.
Now, sir, a war is won.
Nine minutes ’til seven
On the second of January, 1561.
Als ich am Ende angelangt war, ging ich das Gedicht noch einmal durch, langsam, Zeile um Zeile.
Dann spazierte ich zum Fenster hinüber und zog die schweren Vorhänge zurück. Ich blickte auf die Moldau und die Stadt jenseits ihres Ufers hinaus und sann über den Inhalt nach: Borgen oder rauben? … Nicke nicht … Nun, Sir, ein Krieg ist gewonnen … Neun Minuten vor sieben, am zweiten Januar 1561.
Ich hörte, wie Jameson aus dem Bett stieg und über den Teppich auf mich zugetapst kam. »Was suchst du?« Damit fragte Jameson nicht, was ich mir draußen anschaute. Er wollte wissen, was für einen Reim ich mir auf diesen Hinweis – seinen Hinweis – machte. Er testete mich.
Erneut senkte ich den Blick auf die Worte.
Eines davon sprang mir vom Papier förmlich entgegen und die Rädchen in meinem Kopf setzten sich in Bewegung. Womöglich war ich geradewegs dabei, mich kopfüber auf die falsche Fährte zu stürzen, aber in einem Hawthorn’schen Spiel musste man zuweilen seinem Bauchgefühl folgen.
Ich blickte noch einen Moment auf die Moldau hinab, während mein Entschluss Gestalt annahm; dann erst wandte ich mich Jameson und seiner Frage zu. Was suchte ich? Auf welchen Teil des Rätsels wollte ich mich als Erstes konzentrieren?
Ich begegnete seinem Blick, bereit, die Herausforderung anzunehmen. »Krieg.«
Kapitel 6
Eine Internetrecherche mit den Schlagworten Prag und Krieg ergab, dass die meisten Suchergebnisse sich auf einen bestimmten Krieg konzentrierten – den Zweiten Weltkrieg. Der Prager Aufstand. Die Befreiung von Prag.
Immer wieder tauchten verschiedene Versionen ein- und desselben historischen Berichts auf. Die Datumsangaben passten nicht zu denen in meinem Hinweis – weder der Monat noch der Tag noch das Jahr –, doch ich hatte genug Hawthorne-Spiele gespielt, um zu wissen, dass es sich bei dem Datum in meinem Rätsel womöglich gar nicht um ein Datum handelte. Genauso gut könnte es ein Zahlencode sein. Und obwohl der Prager Aufstand nicht im Jahr 1561 stattgefunden hatte, fiel er doch mit dem Ende eines Krieges zusammen. Erneut warf ich einen Blick auf den Zettel.
Now, sir, a war is won.
Falls meine ursprünglichen Instinkte sich als richtig erwiesen – falls ich mich hiermit auf den Teil des Hinweises verlegt hatte, der mir den Startschuss geben sollte –, dann würde sich die Bedeutung der anderen Zeilen womöglich erst später klären, wenn ich der Antwort näher wäre.
Physisch näher.
Jameson hatte gesagt, dass die Stadt ihm das Spiel förmlich vorgegeben hatte. Ich sollte also nicht den ganzen Tag in diesem Hotelzimmer verbringen. Wonach ich suchte, befand sich da draußen.
Die Stadt der hundert Kirchtürme. Die Goldene Stadt. Prag. Meine Gedanken überschlugen sich, während ich die Suche auf meinem Handy verfeinerte, indem ich sie speziell auf den Zweiten Weltkrieg bezog und dann zwei weitere Begriffe hinzufügte: Denkmal und Mahnmal.
Ich brauchte nicht lang, um genau das zu finden, worauf ich aus war: sechs Markierungen auf dem Stadtplan.
»Und schon«, murmelte Jameson mit hörbarer Befriedigung in der Stimme, »ist sie auf und davon.«
An den ersten drei Orten fand ich nichts, doch am vierten sprach mich eine ältere Frau mit ziegelrotem Kopftuch an. Ich erzählte ihr, dass ich mir die Denkmale zum Zweiten Weltkrieg ansah und auf der Suche nach einem bestimmten war – ich sei mir nur nicht sicher, nach welchem.
Die alte Frau taxierte mich eingehend, wobei sie sich nicht mal die Mühe machte, es zu verbergen. Nach einer ganzen Weile zeigte sie beinahe so was wie ein Lächeln, bevor sie sich mit einer einzigen Information verabschiedete. »Vielleicht suchst du nach den Tafeln.«
»Den Tafeln?«, hakte ich rasch nach.
»Zum Gedenken an die gefallenen Helden.« Die Frau richtete ihren Blick auf den Horizont. »Einige von ihnen bekannt. Die anderen unbekannt. Die Tafeln sind überall in der Stadt, man muss nur zu suchen wissen.«
Überall? Ich suchte bereits seit zwei Stunden, und obwohl ich mich in Prag verliebte, Straßenzug um Straßenzug, Kilometer um Kilometer, war ich keinen Schritt weitergekommen.
»Wie viele Tafeln gibt es denn?«, wollte ich wissen.
Die alte Frau wandte den Blick wieder zu mir. »Tausend«, erwiderte sie. »Oder auch mehr.«
Die alte Frau hatte recht gehabt: Sobald ich nach den Gedenktafeln zu suchen wusste, waren sie wirklich überall. Die meisten waren recht klein und aus Bronze oder Stein gefertigt. Manche trugen konkrete Namen. Manche waren unbekannten Kämpfern gewidmet. Eine Sache war glasklar: Solange ich sie nicht irgendwie eingrenzen konnte, würde ich nicht weiterkommen.
Und so wandte ich mich erneut dem exakten Wortlaut meines Rätsels zu:
Borrow or rob?
Don’t nod.
Now, sir, a war is won.
Nine minutes ’til seven
On the second of January, 1561.
Dieses Mal fokussierte ich mich auf die Zahl, die einzige, die in Ziffern geschrieben war. Falls 1561 kein Jahr war, dann vielleicht Teil einer Adresse. Aber war das nicht zu offensichtlich?
Ich kehrte zum Anfang des Gedichtes zurück.
Borrow or rob?
Ich blickte von dem Zettel auf. Die Straßen waren mittlerweile voll, es herrschte reges Treiben. Ich beschloss, mein Glück erneut bei einem Einheimischen zu versuchen, ging zu einem Straßenverkäufer rüber, der Süßgebäck anbot, und suchte mir ein Teilchen aus.
»Gibt es hier zufällig eine Straße, deren Name auf Tschechisch etwas mit Räubern zu tun hat?«, fragte ich ihn. »Ich versuche gerade, ein Rätsel zu lösen.«
Borgen oder rauben? Einen Versuch war es wert.
»Räuber?« Zu meinem Glück sprach der Verkäufer Englisch. »Räuber so wie Dieb?« Der Mann reichte mir mein Gebäckstück.
»Ja«, sagte ich. »Genau.«
Er fragte nicht, was für ein Rätsel ich lösen wollte. Stattdessen wandte er sich dem nächsten Kunden zu.
Gerade als ich schon aufgeben und weitergehen wollte, drehte der Verkäufer sich wieder zu mir um.
»Wenn es in deinem Rätsel um Diebe geht, dann suchst du keine Straße«, erklärte er knapp und nickte dann zu einem Kirchturm in der Nähe. »Du suchst nach dem Arm.«
Kapitel 7
Die Basilika St. Jakob war ein wunderschönes, massives barockes Juwel, das einem den Atem verschlug. Sobald ich über die Schwelle trat, hatte ich das Gefühl, mich in einer anderen Welt zu befinden. Und dann blickte ich auf … zu dem Arm.
Der Arm des Diebes. Ich starrte ihn länger an, als mir selbst lieb war … Es handelte sich um einen echten mumifizierten Arm, der unterhalb der Decke von einer Stange baumelte. Schließlich riss ich den Blick davon los, unterdrückte ein Schaudern und wandte meine Aufmerksamkeit der Kirche um mich herum zu.
Borrow or rob?
Don’t nod.
Nicke nicht. Hieß das, ich sollte mein Kinn heben? Und nach irgendeinem Verweis auf einen Krieg suchen?
»Ich dachte mir schon, dass du womöglich hier landest.«
Jameson. Ich drehte mich zu ihm um. Seine grünen Augen richteten sich auf meine wie Leuchtfeuer, so als wären sie dafür gemacht, mich anzusehen. »Rate noch mal, Erbin.«
Diese Aussage aus seinem Mund kam einem Hinweis gleich: Offenbar hatte ich irgendwo einen Fehltritt begangen und befand mich nun auf dem Holzweg. Während er grinste.
»Du traust dich was, Hawthorne«, sagte ich.
Jameson machte einen kleinen Schritt zurück. »Fang mich, wenn du kannst, Erbin.« Schon wetzte er los und war durch die Tür, bevor ich überhaupt blinzeln konnte.
Ich setzte ihm nach – raus aus der Kirche, eine überfüllte Straße entlang, um die Ecke, in …
Nichts.
Hier war nichts. Keine Tafeln. Keine Adressen mit der Zahl 1561. Und kein Jameson.
Als wäre er vom Erdboden verschluckt worden.
Ich blieb stehen. Wohin bist du verschwunden, Hawthorne? Ich wirbelte herum und blickte auf, in der Erwartung, ihn an einem der Häuser hochklettern zu sehen, die die Gasse säumten, aber da war er auch nicht.
An den Fassaden gab es nichts, woran er sich hätte hochhangeln können. Ich blickte die Gasse entlang. Keine Versteckmöglichkeit weit und breit.
Wo bist du? Ich kehrte um die Ecke zurück, da ich mich fragte, ob meine Sinne mir einen Streich gespielt hatten, ob ich mir nur eingebildet hatte, dass er hier abgebogen war.
Auch da nichts. Von Jameson keine Spur.
Fang mich, wenn du kannst, hatte er gesagt. Ich hätte wetten können, er wusste, dass ich es nicht schaffen würde. Jameson hatte einen Plan gehabt; doch mir blieb keine Zeit, mich in Grübeleien darüber zu verstricken.
Dieses Mysterium konnte warten.
Stattdessen konzentrierte ich mich wieder auf die vor mir liegende Aufgabe und das, was Jameson in der Basilika zu mir gesagt hatte. Rate noch mal.
Das war seine Art, mir zu stecken, dass ich mich auf der falschen Fährte befand. Mit den Tafeln, dem mumifizierten Arm, dem Zweiten Weltkrieg oder mit allem?, fragte ich mich. Oder nur mit einem Teil davon?
So stand ich gedankenverloren eine ganze Weile da. Oren, der am Eingang der Gasse Position bezogen hatte, sagte kein Wort. Mein Security-Chef war klug genug, mich in meinen Überlegungen nicht zu unterbrechen.
Aus vorangegangenen Erfahrungen wusste ich, was am meisten half, wenn man bei Rätseln wie diesem in einer Sackgasse steckte – ob nun metaphorisch oder buchstäblich: zum Anfang zurückzukehren und sämtliche Annahmen und Entscheidungen noch mal infrage zu stellen.
Und so kehrte ich zur Basilika zurück, ging aber nicht hinein. Mit geschlossenen Augen rief ich mir meine erste Internetsuche im Hotelzimmer in Erinnerung: die nach Prag und Krieg.
Die meisten Ergebnisse bezogen sich auf den Zweiten Weltkrieg. Die meisten – aber nicht alle.
Es gab zwei große kriegerische Auseinandersetzungen, die beide als Schlacht bei Prag bezeichnet wurden – eine, die 1648 stattfand, und eine weitere im Jahr 1757. Als ich nach Denkmälern zu diesen beiden historischen Ereignissen suchte, stieß ich gleich auf drei.
Das dritte Denkmal erreichte ich gegen Mittag. Die Karlsbrücke. Sie war einer der markantesten und symbolträchtigsten Orte Prags. Und quoll über von Touristen. Zu beiden Enden der uralten steinernen Brücke befanden sich Türme. An einem davon war eine Tafel zum Gedenken an die Schlacht bei Prag angebracht. Mit einer steinernen Inschrift.
Ich stieß in eben dem Moment darauf, als Jameson zu mir stieß.
Ich fragte mich, wie lang er mich schon beobachtet hatte – und dann fragte ich mich, wie es ihm vorhin gelungen war, mich abzuhängen.
Fang mich, wenn du kannst, Erbin. Entschieden schob ich der Erinnerung einen Riegel vor und wappnete mich für sein nächstes Ablenkungsmanöver.
Jameson trat an meine Seite, wobei sein Körper den meinen streifte, und nickte dann zu den auf dem Turm verewigten Worten hoch. Er übersetzte laut: »Raste hier, Wanderer, und freue dich: Du kannst hier halten aus freiem Willen, aber …«
Mit einem Schmunzeln verstummte Jameson an der Stelle und sein Blick schweifte von der Inschrift zu mir.
»Den Rest kannst du dir denken«, sagte er viel zu eingenommen von sich selbst – und von seinem Spiel. »Im Kern geht es darum, dass die bösen Buben hier gegen ihren Willen aufgehalten wurden. Sieg! Hurra!«
Ich kniff die Augen zusammen. »Hurra?«
Jameson lehnte sich gegen die Steinmauer. »Nur zu deiner Information, Erbin: Es wird wärmer.«
Ich traute seinem Tonfall kein bisschen. »Nur zu deiner Information«, erwiderte ich, »den Blick kenne ich.«
Es war ein Blick, der sagte: Ich werde gewinnen. Er sagte: Du siehst nicht, was direkt vor deiner Nase ist. Er sagte: Bin ich nicht clever?
Und ja, das war er.
Aber das war ich auch. »Der Teil mit dem Krieg«, sagte ich, sein Gesicht musternd, um ihn zu lesen, wie nur ich es konnte, »ist bloß eine Irreführung.«
Eine äußerst Hawthorn’sche Irreführung in einer Stadt mit tausend Tafeln. Als ich dieses Mal mein Handy zückte, versuchte ich es mit anderen Suchbegriffen – lediglich dem Datum.
2. Januar 1561.
Ein Ergebnis tauchte immer wieder auf, ein Name: Francis Bacon. Zwar nicht unter dem exakt gleichen Datum, aber angeblich wurde der sogenannte Vater des Empirismus am 22. Januar 1561 geboren. Auch hierbei – die zweite 2 unter den Tisch fallen zu lassen – könnte es sich um eine äußerst Hawthorne’sche Irreführung handeln.
Ich blickte zu Jameson auf, der mich mit gespannter Erwartung beobachtete.
Ich verengte meine Augen zu Schlitzen und wandte mich erneut meinem Handy zu, um nach Francis Bacon und Prag zu suchen. In weniger als einer Minute hatte ich herausgefunden, dass es einen irischen Künstler mit demselben Namen gab. Hatte Jameson deswegen das Datum vom 22. zum 2. geändert – weil es um den zweiten Francis Bacon ging?
Außerdem hatte eine Galerie in Prag eine beträchtliche Sammlung von Kunstwerken eben dieses Francis Bacon versteigert.
Der Weg zur Galerie führte mich über den Altstädter Ring, den ältesten Platz von Prag, zurück. Nachdem ich einer Reihe von Seitensträßchen gefolgt war, erreichte ich die Galerie ohne allzu viele falsche Abzweigungen.
Ich war kaum eingetreten, als ein Angestellter in superteurem Anzug mich mit bohrendem Blick fixierte. Es war einer dieser Blicke, der ganz klar sagte, dass eine Teenagerin in Jeans und abgewetztem T-Shirt nichts an einer Örtlichkeit wie dieser verloren hatte – ein Blick, der verpuffte, sobald Oren hinter mir eintrat.
Es ging doch nichts über einen militärisch ausgebildeten Bodyguard, um die Leute dazu zu bringen, ihren ersten Eindruck noch mal zu überdenken.
Während ich durch die Galerie spazierte und nach etwas Ausschau hielt, versuchte der hochnäsige Typ zu kaschieren, wie er mich anstarrte, doch schließlich riss er die Augen auf. Dieser Blick war mir inzwischen vertraut – man hatte mich erkannt. Doch soweit ich das sehen konnte, gab es hier nichts für mich zu holen.
Noch eine falsche Fährte. Bevor der Angestellte damit loslegen konnte, den sprichwörtlichen roten Teppich für die Hawthorne-Erbin auszurollen, schlüpfte ich schon wieder aus dem Geschäft. Draußen meinte ich Jameson zu sehen … in der Menge, davoneilend. Ich beschleunigte meine Schritte und setzte ihm nach, wobei ich immer wieder Grüppchen von Passanten ausweichen musste. Doch kaum dass ich den Altstädter Ring erreichte, verlor ich ihn aus den Augen.
Während ich das Gedränge von Menschen absuchte, fiel mir auf, dass die allermeisten Leute um mich herum sich in eine Richtung orientierten.
In Richtung der Rathausuhr. Sie war gewaltig, alt, ein Kunstwerk – ein kreisrundes Zifferblatt über dem anderen, in Türkis, Orange und Gold.
»In nur wenigen Augenblicken«, meldete sich ein Touristenführer irgendwo hinter mir, »werden Sie ganz oben auf der Uhr die Prozession der zwölf Apostel beobachten können. Und dort, auf der rechten Seite … dieses Skelett stellt den Tod dar. Bei den anderen Figuren, die Sie um die Uhr herum sehen können, handelt es sich um verschiedene katholische Heilige. Die Astronomische Uhr zeigt nicht nur die Zeit an, sondern wird durchaus ihrem Namen gerecht. Auf dem kleineren Ring sind Tierkreiszeichen abgebildet, die der Uhr ermöglichen, sowohl die Stellung des Mondes als auch der Sonne anzuzeigen, während die …«
Die Rathausuhr schlug eins.
Wie auch der Rest der Menge blickte ich auf, als die »Prozession« begann. Die Apostelstatuen tauchten eine nach der anderen hinter zwei Fenstern in der Uhr auf. Überall um mich herum wurden Kameras gezückt, um den Moment festzuhalten.
Alles, woran ich plötzlich denken konnte, war: nine minutes ’til seven. Ich hatte eine Uhrzeit bekommen, und hier war eine Uhr – eine offenbar sehr berühmte Uhr.
Ich zwang mich innezuhalten. Ich konnte mir nicht leisten, noch einmal den falschen Weg einzuschlagen. Ich hatte bereits genug Zeit verschwendet. Mir blieben nur elf Stunden und ich befand mich immer noch beim ersten Hinweis. Ich musste mich konzentrieren. Ich musste hinsehen.
Denn irgendwas entging mir hier.
Tobias Hawthornes Rätsel hatten stets eine klare Antwort gehabt. Und Jamesons Rätsel würde ebenfalls eine haben. Das wusste ich. Ich wusste es, und doch hatte ich den gesamten Vormittag nach den sprichwörtlichen Strohhalmen gegriffen.