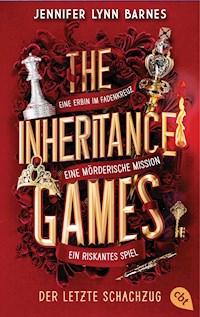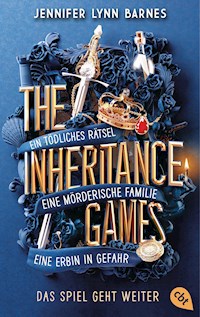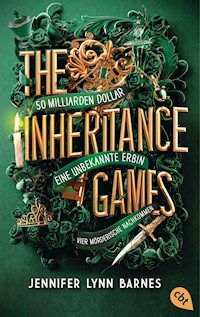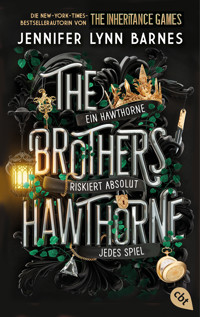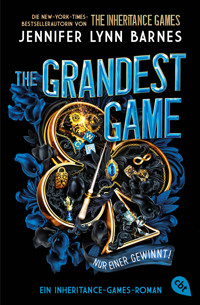
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die The-Grandest-Game-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Familie – Unzählige Geheimnisse – Ein Spiel um Millionen
Nachdem Avery Grambs das milliardenschwere Erbe der Familie Hawthorne angetreten hat, ruft sie einen jährlichen Wettbewerb der besonderen Art auf. Jeder der geladenen sieben Teilnehmer soll die Chance bekommen, Millionen zu gewinnen. Abgeschieden auf einer Privatinsel der Hawthornes stellen sie sich dem exklusiven Wettbewerb. Doch die Geheimnisse, die dabei ans Licht kommen, erschüttern nicht nur das Leben der Mitspieler, sondern auch das der Hawthorne-Brüder und Averys ...
Von Millionen Fans weltweit atemlos erwartet: Die Fortsetzung zur Thriller-Bestsellersensation »The Inheritance Games« und eine Begegnung mit den Lieblingscharakteren
Die »The Inheritance Games«-Reihe:
The Inheritance Games (Band 1)
The Inheritance Games – Das Spiel geht weiter (Band 2)
The Inheritance Games – Der letzte Schachzug (Band 3)
The Brothers Hawthorne (Band 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jennifer Lynn Barnes
TheGrandest Game
Aus dem Amerikanischen von Ivana Marinović
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Für Rose
Erstmals als cbt Taschenbuch August 2024
© 2024 Jennifer Lynn Barnes
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Grandest Game« bei Little, Brown and Company, einem Verlag der Verlagsgruppe Hachette, New York
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ivana Marinović
Lektorat: Katja Hildebrandt
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München
unter Verwendung des Originalumschlags: © 2024 Hachette Book Group, Inc.,
Illustration © Katt Phatt, Gestaltung: © Karina Granda
MP · Herstellung: AW
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30964-0V002
www.cbj-verlag.de
Prolog
Ein Jahr zuvor
Für Macht galt es einen Preis zu zahlen, immer. Die einzige Frage war, wie stolz dieser Preis war – und wer ihn bezahlen würde. Rohan wusste das besser als irgendwer sonst. Er war zudem klug genug, sich deswegen nicht ins Hemd zu machen. Was waren schon etwas Blutverlust und das gelegentlich gebrochene Herz oder Fingergelenk unter Freunden?
Nicht dass Rohan tatsächlich Freunde hatte.
»Frag mich, warum du hier bist.« Der ruhige Befehl des Eigners schnitt durch die Luft wie ein Schwert.
Der Eigner des Devil’s Mercy war Macht, und er hatte Rohan großgezogen wie einen Sohn – einen machiavellistischen, amoralischen, nützlichen Sohn. Schon als Kind hatte Rohan begriffen, dass an diesem verborgenen unterirdischen Ort Wissen die Währung war und Unwissen Schwäche bedeutete.
Er war klug genug, keine verdammte Frage zu stellen.
Stattdessen zeigte er ein Lächeln – das schelmische Lächeln eines Gauners, das in seinem Arsenal genauso sehr eine Waffe war wie jede Klinge, jedes Geheimnis, das er gesammelt hatte. »Fragen sind für jene, die über keine anderen Wege verfügen, an Antworten zu kommen.«
»Und du bist ein Meister dieser anderen Wege«, räumte der Eigner freimütig ein. »Beobachten und Manipulieren, die Fähigkeit, dich unsichtbar zu machen und einen Raum deinem Befehl und Willen zu unterstellen.«
»Ich biete zudem einen recht angenehmen Anblick.« Rohan trieb da gerade ein gefährliches Spiel, aber dies war die einzige Art von Spiel, die er je verfolgt hatte.
»Wenn du nicht fragen willst …« Die Hand des Eigners schloss sich um den Knauf seines kunstvoll verzierten silbernen Gehstocks. »Dann sage mir, Rohan: Warum habe ich dich hergerufen?«
Das hier war es. Gewissheit pulsierte durch Rohans Adern, als er antwortete: »Die Nachfolge.«
Das Devil’s Mercy war, zumindest an seiner Oberfläche, eine luxuriöse Spielhölle, gut versteckt und lediglich seinen Mitgliedern bekannt: den Ultrawohlhabenden, den Aristokraten, den Einflussreichen. Doch in Wahrheit war das Mercy ungleich mehr. Ein historisches Vermächtnis. Eine Kraft, die in den Schatten wirkte. Ein Ort, an dem Geschäfte gemacht und Vermögen gesetzt wurden.
»Die Nachfolge«, bestätigte der Eigner. »Ich benötige einen Erben. Man hat mir zwei Jahre zu leben gegeben … wenn es hochkommt, drei. Zum einunddreißigsten Dezember nächsten Jahres gebe ich die Krone ab.«
Jemand anders hätte sich auf die Aussicht des nahenden Todes fokussiert, aber nicht Rohan. In zweihundert Jahren war die Leitung des Mercy bisher nur vier Mal weitergegeben worden. Der Erbe war stets jung gewesen, eine Berufung fürs Leben.
Das hier war Rohans Endspiel, war es schon immer gewesen. »Ich bin nicht dein einziger Anwärter aufs Erbe.«
»Warum solltest du das auch sein?« Das war keine rhetorische Frage.
Plädiere für deine Sache, Junge.
Ich kenne jeden Zentimeter des Mercy, dachte Rohan. Jeden Winkel, jeden Trick. Den Mitgliedern bin ich bestens bekannt. Sie wissen, mit mir ist nicht zu spaßen. Von meinen Fähigkeiten – den akzeptableren zumindest – hast du gerade erst gesprochen.
Laut verlegte sich Rohan auf eine andere Taktik. »Wir wissen beide, dass ich ein ausgezeichneter Bastard bin.«
»Du bist all das, wozu ich dich gemacht habe. Doch manche Dinge gilt es zu gewinnen.«
»Ich bin bereit.« Rohan fühlte sich so wie jedes Mal, wenn er zum Kampf in den Ring stieg, wohl wissend, dass Schmerz unvermeidbar war – und unerheblich.
»Es gibt eine Gebühr«, kam der Eigner direkt zur Sache. »Um die Leitung des Mercy zu übernehmen, musst du erst deinen Einsatz aufbringen. Zehn Millionen Pfund sollten genügen.«
Ganz automatisch begann Rohan damit, im Geiste die Wege zur Krone zu zeichnen. Die Tatsache, dass er Optionen sah, setzte seinen sechsten Sinn in Gang. »Wo ist der Haken?«
»Der Haken, mein Junge, ist immer derselbe – für mich, für alle, die vor uns kamen, zurückreichend bis zum Erben des ersten Eigners. Weder darfst du dein Vermögen innerhalb der Mauern des Mercy machen noch ein Druckmittel einsetzen, das du während deiner Anstellung hier erworben hast. Zudem ist es dir nicht erlaubt, diese Hallen zu betreten, den Namen des Mercy zu verwenden oder eine Gefälligkeit von irgendeinem Mitglied einzufordern oder anzunehmen.«
Außerhalb des Mercy hatte Rohan nichts – nicht einmal einen Nachnamen.
»Du wirst London innerhalb von vierundzwanzig Stunden verlassen, und du kehrst nicht zurück, außer beziehungsweise bis du die Gebühr hast.«
Zehn Millionen Pfund. Das hier war nicht bloß eine Herausforderung. Das hier war das Exil.
»In deiner Abwesenheit«, fuhr der Eigner fort, »wird die Herzogin an deiner statt als Handlanger fungieren. Falls du dabei versagst, die Gebühr aufzubringen, wird sie mein Erbe.«
Da war es: das Spiel, der Einsatz, die Drohung.
»Geh«, sagte der Eigner und versperrte ihm den Weg zu seinen Zimmern. »Jetzt.«
Rohan kannte London. Einem Phantom gleich konnte er sich in jedem Teil der Stadt bewegen, sei es in den höheren oder den niederen Gesellschaftsschichten. Aber zum ersten Mal seit seinem fünften Lebensjahr hatte er nicht mehr das Mercy, um dorthin zurückzukehren.
Halt Ausschau nach einer Lücke. Einem Schlupfloch. Einer Schwachstelle. Da sein Hirn am Rotieren war, hielt Rohan Ausschau nach einem Bier.
Vor dem Pub seiner Wahl kämpften zwei Hunde miteinander. Der kleinere von beiden – eine Hündin, wie er erkannte – hatte etwas Wölfisches an sich. Sie war dabei, den Kampf zu verlieren. Dazwischenzugehen war wahrscheinlich nicht die klügste Handlungsoption, aber Rohan bewegte sich im Augenblick etwas jenseits von Klugheit.
Als der größere Hund sich verzogen hatte, wischte Rohan das Blut vom Unterarm und kniete sich vor der kleinen Hündin auf den Boden. Sie knurrte. Er lächelte.
Die Tür zum Pub ging auf. Im Inneren plärrte ein Fernseher – die Stimme eines Moderators. »Uns erreichen gerade Berichte, dass die erste Ausgabe des alljährlichen Grandest Game – des von der Hawthorne-Erbin Avery Grambs entworfenen und finanzierten Spiels in Form eines groß angelegten kniffligen Wettstreits – zu seinem Ende gekommen ist. Der Gewinner des Siebzehn-Millionen-Dollar-Preisgelds wird jeden Moment via Livestream bekannt gegeben …«
Die Tür fiel zu.
Rohan begegnete dem wölfischen Blick der Hündin. »Alljährlich«, murmelte er. Was bedeutete, dass in knapp zwölf Monaten das nächste Spiel anstand. Er hätte ein Jahr für die Vorbereitungen. Ein Jahr, um alles in die Wege zu leiten. Und wie das Glück es wollte, war Avery Grambs nie Mitglied des Devil’s Mercy gewesen.
Hallo, Schlupfloch. Rohan erhob sich. Er schob die Tür auf und sah nach unten. »Kommst du?«, fragte er die Hündin.
Im Inneren erkannte der Besitzer des Pubs ihn sofort. »Was darf es sein?«
Selbst ohne das Mercy im Rücken hatte ein Mann mit Rohans Fähigkeiten und Ruf immer noch ein, zwei Asse im Ärmel. »Ein Bier für mich«, sagte er. »Und ein Steak für die Dame.« Rohans Mundwinkel verzogen sich nach oben, auf der einen Seite eine Spur mehr als auf der anderen. »Und ein Transportmittel aus London raus. Heute Nacht.«
Kapitel 1
Lyra
Der Traum begann, wie er es immer tat. Mit der Blume. Der Anblick der weißen Calla-Lilie in ihrer Hand erfüllte Lyra mit einem Gefühl bittersüßen Grauens. Sie blickte auf ihre andere Hand … und die traurigen Überreste einer Zuckerperlenkette. Nur noch drei Zuckerperlen hingen dran.
Nein.
Unterbewusst war Lyra klar, dass sie neunzehn war, aber im Traum, da waren ihre Hände klein … die Hände eines Kindes. Der Schatten, der über ihr emporragte, war riesig.
Dann kam das Flüstern. »Ein Hawthorne hat das hier getan.«
Der Schatten – ihr leiblicher Vater – drehte sich um und ging davon. Lyra konnte sein Gesicht nicht sehen. Sie hörte nur die Schritte, die die Treppenstufen emporstiegen.
Er hat eine Pistole. Mit einem erstickten Atemzug in ihrer Brust schreckte Lyra aus dem Schlaf, ihr Körper starr, ihr Kopf … auf einem Schreibpult. In den Sekunden, die es brauchte, bis ihre Sicht sich klärte und die Welt vor ihr wieder fest in ihre Angeln glitt, fiel Lyra ein, dass sie in einer Vorlesung saß.
Nur dass der Hörsaal praktisch leer war.
»Sie haben noch zehn Minuten für den Test.« Der einzige andere Mensch im Raum war ein fünfzigjähriger Mann in einem Sakko.
Test? Lyras Blick zuckte zu der Wanduhr. Als die Uhrzeit zu ihr durchdrang, flaute ihre Panik ab.
»Sie können sich das Durchgefallen genauso gut gleich abholen.« Der Professor sah sie finster an. »Der Rest des Kurses ist schon fertig. Ich nehme an, Ihre Kommilitonen haben die letzte Nacht nicht durchgefeiert.«
Ja, weil der einzige Grund, warum ein Mädchen wie ich derart müde sein könnte, um im Unterricht einzuschlafen, der ist, dass sie feiern war. Ärger flackerte in ihrem Inneren auf und vertrieb auch die letzten Überreste des Grauens, das der Traum in ihr ausgelöst hatte. Sie blickte auf das Blatt vor sich runter. Ein Multiple-Choice-Test.
»Ich schau mal, was ich in den zehn Minuten noch schaffe.« Lyra angelte einen Kuli aus ihrem Rucksack und begann zu lesen.
Die meisten Menschen konnten in ihrem Kopf Bilder sehen. Für Lyra waren da nur Worte, Begriffe, Gefühle. Nur wenn sie träumte, sah sie etwas vor ihrem inneren Auge. Die Tatsache, dass Lyra sich nicht in mentalen Bildern verstrickte, machte sie glücklicherweise zu einer sehr schnellen Leserin. Und ebenso erfreulich war, dass dieser Test nach einem vorhersehbaren, einem wohlbekannten Muster erstellt worden war.
Um die richtigen Antworten zu finden, musste man lediglich die Beziehung zwischen den angebotenen Optionen aufdecken. Handelte es sich bei zweien davon um Gegensätze? Wich einer dieser Gegensätze nur graduell von den verbliebenen Wahlmöglichkeiten ab? Oder gab es da zwei Antworten, die gleich klangen? Oder eine, vielleicht auch mehrere Antworten, die zwar wahr erschienen, es wahrscheinlich aber nicht waren?
Das war die Sache mit Multiple-Choice-Tests. Wenn man den Code knackte, musste man nichts über den Stoff an sich wissen.
In der ersten Minute beantwortete Lyra fünf Fragen. Vier in der nächsten. Je mehr Fragekästchen sie ankreuzte, desto spürbarer wuchs der Ärger des Professors auf sie.
»Sie verschwenden meine Zeit«, sagte er. »Und Ihre.«
Die alte Lyra hätte sich einen Tonfall wie diesen zu Herzen genommen. Stattdessen las sie nur noch schneller. Finde das Muster, finde die Antwort. Eine Minute vor Ablauf der Zeit kam sie zum Ende und gab den Test ab, wobei sie ganz genau wusste, was der Professor sah, als er sie anblickte: ein Mädchen mit einem Körper, der für einige Leute mehr Party schrie, als er je Tänzerin geflüstert hatte.
Nicht dass sie noch Tänzerin gewesen wäre.
Lyra schnappte sich ihren Rucksack und wandte sich zum Gehen, doch der Professor hielt sie auf. »Warten Sie«, befahl er angespannt. »Ich werde Ihnen den Test gleich benoten.« Dir eine Lektion erteilen war, was er eigentlich meinte.
Lyra drehte sich langsam um, was ihr genug Zeit gab, eine neutrale Miene aufzusetzen.
Nachdem er die ersten zehn Fragen durchgegangen war, hatte der Professor nur eine ihrer Antworten als falsch markiert. Seine Augenbrauen zogen sich enger zusammen, während er mit der Auswertung fortfuhr. Der Anteil korrekter Antworten blieb stabil … bis er weiter stieg.
»Vierundneunzig Prozent.« Er blickte vom Test auf. »Nicht übel.«
Wart’s nur ab, dachte Lyra.
»Stellen Sie sich bloß vor, was Sie schaffen könnten, wenn Sie etwas mehr Mühe investieren würden.«
»Woher wollen Sie wissen, wie viel Mühe ich investiere?«, gab Lyra zurück. Ihre Stimme war ruhig, doch sie blickte ihm unverwandt in die Augen.
»Sie tragen einen Pyjama, Ihr Haar ist ungekämmt, und Sie haben den Großteil des Tests verschlafen.« Er hatte ihr offenbar eine neue Rolle verpasst – vom Partymädchen zum Faultier. »Ich habe Sie noch nie in meiner Vorlesung gesehen«, fuhr der Professor streng fort.
Lyra zuckte die Schultern. »Das liegt daran, dass ich nicht in diesem Kurs bin.«
»Sie …« Er stockte. Glotzte sie an. »Sie sind …«
»Ich bin nicht in diesem Kurs«, wiederholte Lyra. »Ich bin in der Vorlesung davor eingenickt.« Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte sie sich ab und stieg die flachen Stufen zum Ausgang hoch. Ihre Schritte waren lang. Vielleicht waren sie würdevoll. Vielleicht war auch sie es immer noch.
Der Professor rief ihr hinterher: »Wie haben Sie vierundneunzig Prozent bei einem Test für einen Kurs geschafft, den Sie nicht mal belegen?«
Mit dem Rücken zu dem Mann schritt Lyra unbeirrt weiter. »Trickreiche Tests entwerfen geht nach hinten los, wenn der Prüfling weiß, nach welchen Tricks er Ausschau halten muss.«
Kapitel 2
Lyra
Am Nachmittag kam eine E-Mail vom Studierendensekretariat, mit der Zahlstelle im Cc und der Betreffzeile: Immatrikulationssperre. Sie dreimal zu lesen, änderte nichts am Inhalt.
Lyras Handy klingelte beim vierten Lesen. Dir geht’s gut, ermahnte sie sich, wenn auch nur aus bloßer Gewohnheit. Alles ist gut.
Sich innerlich wappnend, ging sie ran. »Hi, Mom.«
»Du erinnerst dich also an mich! Und dein Handy funktioniert! Und du wurdest nicht von einem mathematisch veranlagten Serienkiller gekidnappt, der von der Idee besessen ist, dich zu seiner unfassbar bösartigen Gleichung hinzuzufügen.«
»Neues Buch?«, tippte Lyra. Ihre Mutter war Schriftstellerin.
»Neues Buch! Sie mag Zahlen mehr als Menschen. Er ist ein Cop, der lieber seinen Instinkten vertraut als ihren Berechnungen. Sie hassen einander.«
»Auf die gute Art?«
»Auf die sehr gute Art. Und wo wir schon bei überwältigender Chemie und knisternder romantischer Spannung sind … Wie läuft es bei dir?«
Lyra verzog das Gesicht. »Ganz schlechte Überleitung, Mom.«
»Beantworte die Frage, du Ausweichlerin! Ich bin auf Tochter-Entzug. Dein Dad findet, November sei zu früh für Weihnachtsdeko, dein vierjähriger Bruder zeigt keinerlei Wertschätzung für dunkle Schokolade, und falls ich mal doch mit jemandem romantische Komödien gucken will, werde ich Kabelbinder benötigen.«
Die letzten drei Jahre hatte Lyra alles Menschenmögliche getan, um normal zu erscheinen, um normal zu sein – ebenjene Lyra, die Weihnachten, Schokolade und romantische Komödien liebte. Und jeden Tag hatte das So-tun-als-ob sie ein Stückchen mehr umgebracht.
So war sie an einem College tausend Meilen von zu Hause entfernt gelandet.
»Also? Wie läuft es bei dir?« Ihre Mom würde einfach nie Ruhe geben.
Lyra hatte als Antwort drei Worte zu bieten: »Single. Mürrisch. Bewaffnet.«
Ihre Mutter lachte. »Bist du nicht.«
»Nicht mürrisch oder nicht bewaffnet?«, fragte Lyra. Das Thema Single wollte sie nicht mal streifen.
»Mürrisch«, erwiderte ihre Mom. »Du bist eine liebe, großmütige Seele, Lyra Catalina Kane. Und wie wir beide wissen, kann alles eine Waffe sein, solange du mit ganzem Herzen daran glaubst, dass du jemanden damit verstümmeln oder töten kannst.«
Das Gespräch fühlte sich so normal an, so nach ihnen, dass Lyra es kaum ertrug. »Mom? Ich hab gerade eine Mail vom Studierendensekretariat bekommen.«
Ein lastendes Schweigen legte sich über sie.
»Es ist gut möglich, dass mein letzter Scheck vom Verlag zu spät kam«, sagte ihre Mom schließlich. »Und niedriger ausfiel als erwartet. Aber ich kümmere mich darum, Kleines. Alles wird gut.«
Alles ist gut. Das war seit drei Jahren Lyras Spruch – seit der Name Hawthorne angefangen hatte, durch sämtliche Nachrichten zu geistern, und seit Erinnerungen, die sie aus gutem Grund verdrängt hatte, sie gnadenlos eingeholt hatten. Eine Erinnerung im Besonderen.
»Vergiss die Studiengebühr, Mom.« Lyra musste dringend auflegen. Es war zwar einfacher, aus der Ferne auf normal zu machen, aber es kostete sie immer noch einiges. »Ich kann nächstes Semester aussetzen, mir einen Job suchen und mich im Herbst für einen Studienkredit bewerben.«
»Auf gar keinen Fall.« Die Stimme, die diese Worte äußerte, war nicht die ihrer Mutter.
»Hi, Dad.«
Keith Kane hatte ihre Mutter geheiratet, als Lyra drei gewesen war, und sie mit fünf adoptiert. Er war der einzige Dad, den sie je gekannt hatte. Bis das mit den Träumen anfing, hatte sie keinerlei Erinnerung an ihren leiblichen Vater gehabt.
»Deine Mom und ich werden das klären, Lyra.« Der Tonfall ihres Vaters duldete keinen Widerspruch.
Die alte Lyra hätte es nicht mal versucht. »Klären? Wie denn?«
»Wir haben Optionen.«
Lyra wusste allein an der Art, wie er das Wort Optionen sagte, an was er dachte. »Mile’s End«, stieß sie aus.
Das konnte er nicht ernst meinen. Mile’s End war mehr als nur ein Haus. Es waren die spitzen Giebeldächer und die Verandaschaukel, der Wald und der Bach und Generationen von Kanes, die ihren Namen in denselben Baumstamm geritzt hatten.
Lyra selbst war auf Mile’s End aufgewachsen. Sie hatte ihren Namen, als sie neun war, in ebenjenen Baum geritzt. Und ihr kleiner Bruder verdiente es, dasselbe zu tun. Ich darf nicht der Grund dafür sein, dass sie es verkaufen.
»Wir haben schon eine Weile darüber geredet, uns zu verkleinern.« Ihr Dad sprach ruhig, nüchtern. »Die Instandhaltung dieser alten Hütte bringt uns noch um. Wenn ich Mile’s End loslasse, könnten wir uns ein kleines Haus in der Stadt suchen und einen Studienfonds für deinen Bruder einrichten. Es gibt da einen Bauunternehmer –«
»Es gibt immer einen Bauunternehmer.« Lyra ließ ihn nicht zu Ende sprechen. »Und du jagst ihn immer zum Teufel.«
Dieses Mal sprach das Schweigen am anderen Ende der Leitung Bände.
Kapitel 3
Lyra
Laufen schmerzte. Vielleicht war das der Grund, warum sie es mochte. Die alte Lyra hatte Laufen gehasst. Heute konnte sie endlose Strecken zurücklegen. Das Problem war, dass es mit der Zeit immer etwas weniger schmerzte. Und so trieb sie sich jeden Tag weiter an.
Und weiter.
Und weiter.
Ihre Eltern und Freunde waren fassungslos gewesen, als sie das Tanzen hierfür aufgegeben hatte. Lyra hatte durchgehalten bis zum November ihres letzten Schuljahres an der Highschool, fast auf den Tag genau vor einem Jahr. Solange es ihr möglich gewesen war, hatte sie alle getäuscht. Aber selbst sie war nicht Schauspielerin genug, um die Tänzerin zu mimen, die sie mal gewesen war. Davor.
Dabei schien es nicht richtig, dass ihr gesamtes Leben durch nur einen Traum aus der Bahn gebracht werden konnte. Durch eine einzige Erinnerung. Lyra hatte gewusst, dass ihr leiblicher Vater tot war – aber nicht, dass er Selbstmord begangen hatte, nicht, dass sie dabei gewesen war. Sie hatte dieses Trauma so dermaßen gründlich verdrängt, dass es für sie nicht mal existiert hatte. An dem einen Tag war sie noch eine ganz normale, glückliche Teenagerin gewesen und am nächsten – buchstäblich über Nacht – nicht mehr.
Nicht mehr normal, nicht mehr okay, geschweige denn glücklich.
Ihre Eltern wussten es – nicht, was sich geändert hatte, aber dass sich etwas geändert hatte. Lyra hatte sich auf ein weit entferntes College geflüchtet, aber wohin hatte sie das gebracht? Stipendien deckten eben nur einen Teil der Kosten. Ihre Eltern hatten versichert, dass der Rest der Studiengebühren kein Problem wäre, aber sie hatten offenbar gelogen, was wohl nur eins bedeutete: dass Lyra es nicht mal annähernd so gut hinbekommen hatte, einen auf normal zu machen, wie gedacht.
Während sie so lief – ganz gleich, wie weit sie lief –, kamen Lyras Gedanken immer wieder zu demselben Schluss: Ich muss das Studium auf Eis legen. Das würde ihr zumindest etwas Zeit verschaffen und ihre Eltern um einen Rechnungsposten erleichtern. Die Aussicht, das College zu verlassen, hätte nicht schmerzen dürfen. Es war nicht so, als hätte Lyra das Semester über Freunde gefunden oder es auch nur versucht. Sie hatte sich vielmehr durch den Fluss von Lehrveranstaltungen treiben lassen wie ein akademisch veranlagter Zombie. So trat sie zwar auf der Stelle, doch das war allemal besser, als unterzugehen.
Lyra biss die Zähne zusammen und beschleunigte ihr Tempo. Nach einer so weiten Strecke hätte das nicht möglich sein dürfen. Aber manchmal konnte man nur weiterpushen.
Als sie schließlich stehen blieb, bekam sie kaum noch Luft. Die Bahn verschwamm vor ihren Augen, und Lyra beugte sich vor, die Hände auf die Knie gestützt, um Sauerstoff in ihre Lunge zu saugen. Und irgendein Arschloch wählte genau diesen Moment, um ihr hinterherzupfeifen. Als hätte sie sich bloß für ihn gebückt.
Eine Sekunde später rollte ein Fußball auf sie zu und blieb neben ihr liegen.
Lyra sah auf und erblickte eine Gruppe Typen, die darauf warteten, wie sie reagieren würde; kurz überlegte sie, was wohl der Sammelbegriff für Arschloch war.
Eine Schar?
Ein Haufen?
Nein, dachte sie und hob den Ball auf. Eine Meute. Die Meute Arschlöcher vor ihr erwartete wahrscheinlich nicht, dass sie den Ball über ihre Köpfe hinweg im Tor versenkte, doch ihr Dad war Fußballtrainer an der Highschool, und sobald Lyras Körper einmal wusste, wie er etwas zu tun hatte, vergaß er es nicht mehr.
»Daneben!«, brüllte einer der Typen spottend.
Der Ball traf die Torlatte, prallte ab und knallte dem Penner, der gepfiffen hatte, gegen den Hinterkopf.
»Nein«, rief Lyra rüber. »Volltreffer!«
Das Studium schmeißen war die richtige Entscheidung. Die einzig mögliche. Aber als Lyra die Stufen zum Studierendensekretariat ansteuern wollte, landete sie stattdessen ein Gebäude weiter bei der Poststelle des Campus.
Ich werde es schon noch tun. Ich brauche nur eine Minute. Mechanisch ging Lyra zu ihrem Postfach rüber. Sie erwartete keine Post. Das hier war Prokrastination pur, aber das hielt sie nicht davon ab, den Schlüssel umzudrehen und das Fach zu öffnen.
Im Inneren lag ein Umschlag aus dickem Leinenpapier. Kein Absender. Sie zog ihn hervor. Der Brief war schwerer, als er aussah. Keine Frankierung. Lyra erstarrte. Dieser Umschlag – was auch immer er enthielt – war nicht per Post geschickt worden.
Mit dem plötzlichen Gefühl, beobachtet zu werden, warf sie einen Blick über die Schulter, bevor sie das Kuvert aufriss. Im Inneren befanden sich zwei Dinge.
Das erste war ein hauchdünnes Blatt Papier mit einer handgeschriebenen Nachricht in dunkelblauer Tinte: DU VERDIENST DAS HIER. Noch als sie die Worte las, kräuselte sich das Papier in ihren Händen. Sekunden darauf war da nur noch Staub.
In dem akuten Bewusstsein, wie heftig ihr das Herz in der Brust schlug – mit brutaler, wiederholter Wucht gegen ihren Rippenkäfig hämmernd –, griff Lyra nach dem zweiten Inhalt. Er hatte die Größe eines zusammengefalteten Briefes, doch kaum, dass ihre Finger die goldene Kante streiften, wurde ihr klar, dass das Ding aus Metall war – wenn auch aus sehr dünnem Metall.
Als sie es aus dem Kuvert zog, sah Lyra, dass die Metallplatte eine Gravur enthielt: drei Worte plus ein Symbol. Nein, kein Symbol, wurde ihr klar. Ein QR-Code. So einer, den man scannen konnte. Die Worte wiederum verrieten Lyra unmissverständlich, was sie da in der Hand hielt.
Das hier war ein Ticket, eine Einladung, ein Aufruf. Die Worte, die über dem Code eingraviert waren, waren ihr bestens bekannt – ihr und jedem auf diesem Planeten, der Zugang zu Medien irgendeiner Art hatte.
The Grandest Game.
Kapitel 4
Gigi
Gigi Grayson war nicht besessen! Sie hatte auch nicht zu viel Koffein im Blut! Und sie stand ganz sicher nicht kurz davor, vom Dach zu fallen! Aber versuch das mal, einem Hawthorne zu verklickern.
Eine Hand packte ihren Ellbogen. Ein in einen Anzug gehüllter Arm schlang sich um ihre Taille.
Bevor Gigi sichs versah, befand sie sich sicher verwahrt auf ihrem Zimmer. So lief die Sache nun mal mit ihrem Hawthorne-Halbbruder: Er erledigte die Dinge umgehend. Grayson Hawthorne verströmte Macht. Er gewann Streitigkeiten mit der bloßen Wölbung einer seiner scharfwinkligen blonden Augenbrauen!
Und ja, okay, da bestand die klitzekleine Möglichkeit, dass Gigi kurz davor gewesen war, vom Dach zu fallen.
»Grayson! Dein Gesicht hat mir gefehlt! Hier, nimm dir ’ne Katze!« Schwungvoll hob Gigi ihre riesige Bengalkatze Katara hoch, die eigentlich mehr schon ein Leopard war, und ließ sie Grayson in die Arme plumpsen.
Katzen waren ganz hervorragende Mittel, um Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Grayson jedoch ließ sich unmöglich überrumpeln. Unbeirrt strich er über Kataras Köpfchen. »Erkläre.«
Als zweitältester der vier Enkelsöhne des verstorbenen Milliardärs Tobias Hawthorne hatte Grayson den Hang, im Befehlston zu kommunizieren. Er hatte außerdem die schlechte Angewohnheit, zu vergessen, dass er nur dreieinhalb Jahre älter war als Gigi – nicht dreißig.
»Warum ich auf dem Dach war, warum ich dich nicht zurückgerufen habe oder warum ich dir gerade eine Katze überreicht habe?«, fragte Gigi fröhlich.
Graysons hellgraue Augen schweiften durch ihr Zimmer und über die Hunderte von Schmierzetteln, die sämtliche Flächen zumüllten: ihre Matratze, den Boden, selbst die Wände. Dann kehrte sein Blick zu Gigi zurück. Wortlos schob Grayson sanft ihren linken Ärmel hoch. Diverse Notizen, frisch mit Kuli hingekritzelt, zogen sich in Gigis chaotisch-verschlungener Schrift über ihre Haut.
»Mir ist das Papier ausgegangen. Aber ich glaub, ich bin ganz nah dran!« Gigi grinste. »Ich brauchte nur einen kleinen Perspektivwechsel.«
Grayson bedachte sie mit einem wissenden Blick. »Deswegen das Dach.«
»Deswegen das Dach.«
Grayson setzte Katara behutsam ab. »Ich dachte, du wolltest dein freies Jahr nach der Schule für Reisen nutzen.«
Und das war der Grund, warum sie seine Anrufe ignoriert hatte. »Ich hab später noch genug Zeit, einen auf Gigi-ohne-Grenzen zu machen«, versicherte sie.
»Nach dem Grandest Game.« Das war keine Frage.
Gigi wies es nicht von sich. Welchen Sinn hätte es auch gehabt? »Sieben Spieler«, sagte sie stattdessen mit funkelnden Augen. »Sieben goldene Tickets – drei für Spieler nach Averys Wahl und vier Wildcards.«
Diese vier Wildcard-Tickets waren an geheimen Orten quer in den USA versteckt worden. Ein einziger Hinweis war vor nicht einmal vierundzwanzig Stunden an die Öffentlichkeit rausgegangen. Und Gigi Grayson, die Rätsel-Knackerin, hatte sich sofort dahintergeklemmt!
»Gigi«, begann Grayson ruhig.
»Sag nichts!«, platzte Gigi heraus. »Es wird so schon komisch ausschauen, weil ich doch deine Schwester bin und alle wissen, dass das Grandest Game ein Gruppenprojekt ist.«
Ein Gruppenprojekt der Hawthorne-Brüder und der Hawthorne-Erbin, eine Zusammenarbeit zwischen Tobias Hawthornes vier Enkelsöhnen und einer scheinbar wahllosen Teenagerin, die das gesamte Vermögen des exzentrischen Milliardärs vererbt bekommen hatte.
»Wie der Zufall es will«, sagte Grayson, »hatte ich bei der Gestaltung des diesjährigen Spiels keinerlei Anteil. Avery und Jamie haben mich vielmehr gebeten, den Job vor Ort zu übernehmen. Ich werde die ganze Sache beaufsichtigen – und um die Integrität der Rätsel zu gewährleisten, begebe ich mich daher ohne jegliches Vorwissen hinein.«
Wenn du die Karten nicht kennst, kannst du dich auch nicht verraten, dachte Gigi. »Dafür liebe ich dich«, sagte sie zu Grayson. »Aber trotzdem: Psst!« Sie bedachte ihn mit ihrem strengsten Blick. »Ich muss das hier alleine durchziehen.«
Grayson reagierte auf Gigis Versuch, Strenge zu zeigen, mit exakt zwei Sekunden Schweigen, gefolgt von einer schlichten Frage: »Wo ist dein Bett?«
Mit diesem Themenwechsel hatte Gigi nun nicht gerechnet. Sehr gewieft, Grayson. Mit ihrem sonnigsten Grinsen deutete Gigi schwungvoll zu der Matratze auf dem Boden. »Voilà!«
»Das«, klärte Grayson sie auf, »ist eine Matratze. Wo ist dein Bett?«
Besagtes Bett war aus Mahagoni gewesen, eine echte Antiquität. Bevor Gigi sich eine angemessen wirre Ausrede überlegen konnte, um die Antwort auf die Frage zu umschiffen, marschierte Grayson auf ihren Kleiderschrank zu und öffnete ihn.
»Wahrscheinlich wunderst du dich gerade, wo meine ganzen Klamotten hin sind«, sagte Gigi heiter. »Und das werde ich dir liebend gerne verraten – nach dem Spiel.«
»In maximal fünf Worten, Juliet.«
Die Verwendung ihres vollen Vornamens war ein Zeichen dafür, dass er die Sache nicht auf sich beruhen lassen würde. In den anderthalb Jahren, die sie ihren Bruder nun kannte, hatte Gigi begriffen – durch ihr Talent, Schlüsse zu ziehen, plus eine Portion Herumschnüffeln –, dass Grayson derjenige Enkelsohn war, den Tobias Hawthorne von Kindesbeinen an zum perfekten Erben geformt hatte: Respekt einflößend, gebieterisch und stets beherrscht.
Mit einem Augenrollen gab Gigi seiner Forderung nach, wobei sie die Worte an ihren Fingern abzählte: »Rückwärts-Raub.« Sie grinste. »Hab’s mit zwei geschafft!«
Grayson antwortete darauf mit einer weiteren gefürchteten Wölbung seiner Augenbraue.
»Rückwärts-Raub heißt«, klärte Gigi ihn bereitwillig auf, »mit Einbruch und allem Drum und Dran – aber statt was zu klauen, lässt man was zurück.«
»Soll ich dir jetzt glauben, dass dein Mahagonibettgestell im Haus von jemand anderem herumsteht?«
»Sei nicht albern!«, erwiderte Gigi. »Ich hab’s verscherbelt und die Kohle rückwärts-geraubt.« Entschieden ging Gigi in die Hocke und lockte Katara zu sich.
In der – korrekten – Annahme, dass jemand gleich eine riesige Katze auf seinem Kopf platzieren wollte, kniete Grayson sich hin und legte leicht eine Hand auf Gigis Schulter. »Geht es hierbei um unseren Vater?«
Sie atmete eifrig weiter. Sie lächelte eifrig weiter. Sie hatte einen ganz einfachen Trick entwickelt, um so zu tun, als ob DAS GEHEIMNIS bloß ein Geheimnis und Gigi ganz hervorragend darin wäre, es für sich zu behalten – und zwar den, niemals auch nur an Sheffield Grayson zu denken.
Außerdem machte Lächeln einen glücklicher. Das war bloße Wissenschaft.
»Hier geht es um mich«, sagte Gigi. Sie kraulte Katara im Nacken und hob eine ihrer Pfoten, um damit zur Tür zu deuten. »Ab mit dir!«
Grayson dachte gar nicht daran. »Ich hab hier was für dich.« Er griff in die Innentasche seines Armani-Anzugs und zog eine Geschenkschatulle hervor: zweieinhalb Zentimeter hoch und vielleicht zwei Butterkekse lang. »Von Avery.«
Gigi starrte die Schatulle an. Als Grayson den Deckel entfernte, konnte sie über das lärmende Wummern ihres eigenen Herzens nur eins denken: Sieben goldene Tickets – drei an Spieler nach Averys Wahl.
»Es gehört dir, wenn du es willst.« Graysons Stimme war nun sanfter. Er war keine sanfte Person, und so wusste Gigi, dass dieses Geschenk nicht bloß ein netter Spaß war. Das hier war Averys Versuch einer Wiedergutmachung für …
Denk nicht dran. Einfach weiterlächeln.
»Ich werde es niemandem erzählen«, sagte Gigi, während ein verräterischer Kloß in ihre Kehle wanderte. »Avery weiß das doch, oder?«
Grayson richtete den Blick auf ihre Augen. »Ja, das weiß sie.«
Gigi nahm einen tiefen Atemzug, stand auf und trat einen Schritt zurück. »Richte Avery aus, danke … aber nein.« Gigi wollte niemandes Schuldgefühle. Sie wollte niemandes Mitleid. Sie wollte nicht, dass Grayson auch nur eine Sekunde dachte, dass sie nicht stark genug wäre. Dass sie Mitleid verdient hätte.
»Wenn du es nicht nimmst«, sagte Grayson, »habe ich die Anweisung, das Ticket Savannah zu geben.«
»Savannah ist beschäftigt«, erwiderte Gigi wie aus der Pistole geschossen. »Mit College. Und Basketball. Und Weltherrschaft.« Gigis Zwillingsschwester kannte DAS GEHEIMNIS nicht. Savannah war die Kluge von ihnen beiden, die Hübsche, die Starke. Sie war fokussiert, entschlossen und erfolgreich im Studium.
Und Gigi war … hier.
Sie blickte auf die Notizen auf ihrem Arm, wobei sie Graysons Gegenwart aus ihrem Kopf verbannte. Sie konnte das hier schaffen – und zwar alles.
DAS GEHEIMNIS bewahren.
Savannah beschützen.
Und einmal in ihrem Leben beweisen, dass sie hatte, was es zum Gewinnen brauchte.
Kapitel 5
Rohan
Bekäme ich einen Zehner, für jedes Mal, wenn jemand mir eine Knarre an den Hinterkopf hält …
»Rück es raus.« Der Narr mit der Waffe hatte ja keine Ahnung, wie sehr ihn seine Stimme verriet.
»Was rausrücken?« Rohan drehte sich um und zeigte seine leeren Hände. Zugegeben, noch vor einer Sekunde waren sie nicht leer gewesen.
»Das Ticket.« Der Mann wedelte mit dem Lauf vor Rohans Nase. »Gib es mir! Es sind nur noch zwei Wildcards im Spiel.«
»Tatsächlich«, erwiderte Rohan gedehnt, »sind keine mehr übrig.«
»Das kannst du nicht wissen.«
Rohan lächelte. »Mein Fehler.« Er erkannte den exakten Moment, in dem sein Widersacher begriff: Rohan machte keine Fehler. Er hatte sein erstes Wildcard-Ticket in Las Vegas gefunden und ein zweites hier in Atlanta, womit er zur nächsten Phase seines Plans übergegangen war.
Diese Dachterrasse bot einen hervorragenden Aussichtspunkt, um den Hof darunter im Blick zu behalten.
»Du hast die letzten zwei Tickets? Beide?« Der Mann senkte seine Pistole und machte einen Schritt auf ihn zu – das waren gleich zwei Fehler. »Gib mir eins. Bitte.«
»Es freut mich, zu sehen, dass deine Manieren sich bessern, aber tatsächlich ziehe ich es vor, meine Konkurrenz selbst zu wählen.« Rohan wandte dem Mann – und der Waffe – den Rücken zu und sah zum Hof runter. »Sie soll es sein.«
Vier Stockwerke tiefer war eine junge Frau mit schokoladenbraunem Haar und einem der Schwerkraft trotzenden Schwung in ihren Schritten gerade dabei, eine Statue zu inspizieren.
»Gut möglich«, verkündete Rohan mit einem zufriedenen Brummen, »dass das Ticket, das ich hier oben gefunden habe, nun da unten weilt.«
Ein Wimpernschlag, und schon stürmte der Mann mit der Knarre auf die Treppe zu … runter zum Hof. Zum Mädchen.
»Krümm ihr ein Haar, und du wirst es bereuen.« Rohan legte keinerlei Nachdruck in diese Worte. Das musste er nicht.
Die meisten Leute waren schlau genug, um den Moment zu erkennen, ab dem mit ihm nicht mehr zu spaßen war.
»Das war’s, Leute! Eine Pressemitteilung der Hawthorne-Erbin Avery Grambs hat soeben bestätigt, dass – keine achtundvierzig Stunden nach dem Startschuss – alle sieben Plätze im diesjährigen Grandest Game belegt wurden.«
Rohan saß auf der Kante eines Bettes, war lediglich in einen opulenten türkischen Baumwollbademantel gehüllt und drehte langsam ein Messer zwischen seinen Fingern. Es hatte seine Vorteile, ein Phantom zu sein. Im vergangenen Jahr hatte er so immer wieder mühelos in Luxushotels wie diesem rein- und wieder rausschlüpfen können. Er hatte diese Monate damit zugebracht, finanzielle Mittel zu besorgen, Kontakte, Geheiminformationen – an und für sich zwar nicht genug, um ihm das Mercy zu sichern, aber doch genug, damit er bei seinem gegenwärtigen Plan nichts dem Zufall überlassen musste.
»Das letztjährige Spiel stand allen offen«, fuhr der Reporter auf dem Bildschirm fort. »Menschen aus allen Ecken der Welt jagten einer Reihe ausgeklügelter Spuren und Hinweise hinterher, die sie von Mosambik über Alaska bis nach Dubai führten. Der diesjährige Wettstreit scheint eine privatere Angelegenheit, denn die Identität der sieben glücklichen Teilnehmer bleibt momentan noch ein gut gehütetes Geheimnis.«
Gut gehütet? Nicht für jemanden mit Rohans Fähigkeiten.
»Auch der Austragungsort des Spiels wird streng unter Verschluss gehalten.«
»Je nachdem, wie streng man es mit dem Wort streng hält«, scherzte Rohan.
Er schaltete den Fernseher aus. Nachdem er sein Ticket eingereicht hatte, hatte man ihm einen Ort sowie eine Uhrzeit genannt. Da diese näher rückte, schlenderte er zu der riesigen Dusche der Luxussuite hinüber.
Auf dem Weg verlor er den Bademantel, nicht jedoch das Messer.
Während die gläsernen Wände der Dusche um ihn herum beschlugen, führte Rohan die Spitze der Klinge an die Scheibe. Er hatte schon immer ein geschicktes Händchen gehabt, hatte immer ganz genau gewusst, wie fest – oder sanft – er drücken musste. Flink fuhr er mit dem Messer durch den Dampf und zeichnete sechs Schach-Symbole in die Feuchtigkeit auf der Glasoberfläche.
Einen Läufer, einen Turm, einen Springer, zwei Bauern und eine Dame.
Rohan hatte bereits damit begonnen, seine Konkurrenz zu sichten: Odette Morales. Brady Daniels. Knox Landry. Er zog die Messerspitze quer durch den Läufer, den Turm und den Springer. Damit blieben nur drei Spieler im Alter von Rohan übrig, allesamt nicht ganz zwanzig: Gigi Grayson, die er von der Dachterrasse aus beobachtet hatte; die anderen beiden kannte er nur vom Namen her.
Ein Spiel wie dieses erforderte die Pflege gewisser äußerer Vorzüge. Denn diese drei Figuren waren … Möglichkeiten.
Gigi Grayson. Savannah Grayson. Lyra Kane. Die Zeit allein würde zeigen, welche der drei sich für Rohan am nützlichsten erweisen würde – und ob eine von ihnen über die Vielseitigkeit der Dame verfügte.
Kapitel 6
Lyra
Ein Wagen mit Chauffeur holte Lyra am festgelegten Treffpunkt ab. Ein Privatjet flog sie von einem gesicherten Flugplatz zum nächsten. Dort fand sie einen Helikopter vor.
»Willkommen an Bord«, meldete sich eine Stimme von der anderen Seite des Flugzeugs, und einen Moment darauf kam eine hochgewachsene, schlanke Gestalt zu ihr hinübergeschlendert.
Lyra erkannte ihn sofort. Natürlich tat sie das. Jameson Hawthorne verfügte über Wiedererkennungswert. »Theoretisch befinde ich mich noch nicht an Bord«, erwiderte sie.
War das kleinlich? Vielleicht. Aber er war ein Hawthorne, und allein sein Anblick brachte den Traum zurück – samt der einzigen drei Dinge, die ihr toter Vater ihrer Erinnerung nach je zu ihr gesagt hatte.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Lyra.
Ein Hawthorne hat das hier getan.
Und dann, ein Rätsel: Eine Wette beginnt womit? Nicht damit.
»Als ich an Bord sagte, sprach ich nicht vom Hubschrauber.« Jameson Hawthorne war anscheinend einer dieser Menschen, der ein Feixen mit einem Wimpernschlag in ein Lächeln verwandeln konnte. »Willkommen beim Grandest Game, Lyra Catalina Kane.«
Da war etwas in der Art, wie er diese Worte sagte … eine unheilvolle Energie, eine Einladung.
»Du bist Jameson Hawthorne.« Lyra erlaubte sich keine Spur von Scheu in ihrem Tonfall. Sie wollte nicht, dass er glaubte, seine Anwesenheit, sein Aussehen, die Art, wie er lässig am Helikopter lehnte wie an einer Mauer, würde sie in irgendeiner Weise beeindrucken.
»Schuldig«, erwiderte Jameson. »Eigentlich in fast allen Punkten.« Dann blickte er über ihre Schulter. »Du bist spät dran!«, rief er.
»Mit spät meinst du wohl früh.«
Lyra erstarrte. Sie kannte diese Stimme, kannte sie, so wie ihr Körper eine Choreografie kannte, die sie tausendmal geübt hatte; so wie die Erinnerung daran noch in Jahrzehnten schmerzen würde, kaum dass sie die Musik hörte. Ja, sie kannte diese Stimme.
Grayson Hawthorne.
»Definitiv spät«, rief Jameson.
»Ich bin nie spät.«
»Klingt beinahe so«, gab Jameson betont unschuldig zurück, »als hätte dir jemand die falsche Uhrzeit gesagt.«
Lyra hörte Jameson kaum, denn das einzige Geräusch, das ihr Hirn verarbeiten konnte, waren die Schritte auf dem Asphalt hinter ihr. Sie ermahnte sich, dass es albern war. Sie konnte Grayson Hawthornes Näherkommen nicht spüren.
Er bedeutete ihr rein gar nichts.
Ein Hawthorne hat das hier getan. Diese Erinnerung wich einer anderen, die Stimme ihres Vaters wurde durch Graysons ersetzt: Hör auf anzurufen. So lautete der gebieterische, abschätzige Befehl, den er beim dritten und letzten Mal geäußert hatte, als sie, auf der Suche nach Antworten, nach irgendwas, seine Nummer gewählt hatte.
Bis zum heutigen Tag war Grayson Hawthorne der einzige Mensch, dem sie je von der Erinnerung erzählt hatte, von den Träumen, vom Selbstmord ihres Vaters, von der Tatsache, dass sie dabei gewesen war.
Und Grayson Hawthorne hatte es nicht gekümmert.
Natürlich nicht. Sie war eine Fremde für ihn, ein Niemand. Und er war ein Hawthorne. Ein arrogantes, unterkühltes, überhebliches Hawthorne-Arschloch, das es nicht juckte, wie viele – oder wessen – Leben sein Milliardärsgroßvater ruiniert hatte.
Grayson blieb ein paar Schritte von Lyra entfernt stehen. »Jamie, ich nehme an, dir ist bewusst, dass du beobachtet wirst.«
»Oh, ich versichere dir, das ist ihm absolut bewusst.« Diese Antwort war nicht von Jameson gekommen.
Endlich schaffte Lyra es, sich umzudrehen. Hinter Grayson – den sie bewusst nicht anschaute – sah sie einen anderen Typen gemächlich auf sie zuschlendern; er war so weit entfernt, dass er das Gespräch eigentlich nicht hätte hören dürfen.
Und doch … Lyra musterte den Neuankömmling. Er war groß, um die Schultern herum kräftig, doch ansonsten schlank; und er bewegte sich mit einer Anmut, die sie von sich selbst kannte. Sein Akzent war britisch, seine Haut hellbraun, seine Wangenknochen markant.
Und sein Lächeln alles andere als ungefährlich.
Das schwarze, dichte Haar war an den Spitzen etwas gewellt, doch es hatte nichts Unordentliches an sich. Genauso wenig wie seine gesamte Erscheinung.
»Aber nur um eins klarzustellen«, sagte der Neuankömmling, wobei seine Augen die von Lyra fixierten, »Jameson war es nicht, den ich beobachtet habe.«
Mich, dachte Lyra. Mich hat er beobachtet. Die Konkurrenz sondiert.
»Rohan«, grüßte Jameson, sein Tonfall halb vorwurfsvoll, halb amüsiert.
»Freut mich auch, dich zu sehen, Hawthorne.« Der Akzent des Typen klang weniger aristokratisch als noch einen Moment zuvor, und Lyra überkam das plötzliche Gefühl, dass dieser Rohan sein konnte, wer immer er sein wollte.
Wenn es doch nur für sie auch so einfach wäre.
»Schalt mal einen Gang runter«, befahl Grayson. Lyra war nicht sicher, ob er Jameson oder Rohan meinte. Nur eins war klar: Ihre Anwesenheit wurde nicht mal registriert.
»Mein verklemmter und etwas weniger charismatischer Bruder hier wird sicherstellen, dass dieses Jahr alle nach den Regeln spielen«, warnte Jameson scherzhaft, an Rohan gewandt. »Deine Wenigkeit eingeschlossen.«
»Ich persönlich«, erwiderte Rohan, wobei seine Augen wieder zu Lyras schweiften und seine Lippen sich erneut zu diesem Lächeln verzogen, »finde ja, nach den Regeln zu spielen, macht exakt nur halb so viel Spaß.«
Kapitel 7
Lyra
Jameson flog den Helikopter, was Lyra weniger überraschte als die Tatsache, dass Grayson sich dazu herabließ, hinten bei den Spielern zu sitzen – vier insgesamt. Die Vorstellungsrunde hatten sie schon hinter sich gebracht.
Konzentriere dich auf die Konkurrenz, ermahnte sich Lyra. Nicht auf Grayson Hawthorne.
Rohan saß zu ihrer Rechten, wobei er praktischerweise den Blick auf Grayson fast komplett versperrte. Der britische Konkurrent hatte die langen Beine etwas von sich gestreckt, seine Haltung war locker. Gegenüber von Rohan saß ein Typ Mitte zwanzig, den Jameson als Knox Landry vorgestellt hatte. Lyra richtete ihre Aufmerksamkeit auf ihn.
Knox hatte eine spießige Burschenschaftlerfrisur, das brünette Haar gegelt und nach hinten gekämmt, außer an der Stelle, wo es ihm kunstvoll in die Stirn fiel. Er war leicht gebräunt, hatte einen gerissenen Ausdruck in den Augen, dunkle Brauen und ein scharfkantiges Kinn; über einem Hemd trug er eine teure Fleece-Sportweste. Die Kombi aus Outfit und Frisur hätte von der Wirkung her Country Club oder Finanzmakler schreien müssen, doch die einmal zu oft gebrochene Nase flüsterte stattdessen Kneipenschlägerei.
Während Lyra ihn taxierte, tat Knox es ihr unverhohlen gleich. Was auch immer er in ihr sah, der Typ schien definitiv nicht beeindruckt.
Ja, bitte. Unterschätze mich. Lyra war das gewohnt. Aber es gab Schlimmeres auf dieser Welt, als auf Anhieb einen strategischen Vorteil an die Hand zu bekommen.
Ihr Temperament voll unter Kontrolle, wandte Lyra ihre Aufmerksamkeit nun der alten Frau zu, die neben Knox Platz genommen hatte. Odette Morales hatte dickes silbergraues Haar, das sie lang und offen trug. Die Spitzen – und nur die Spitzen – waren pechschwarz gefärbt. Lyra fragte sich, wie alt sie wohl war.
»Einundachtzig, Darling.« Odette las Lyra wie ein offenes Buch. Dann lächelte sie. »Ich denke ja gerne von mir, dass ich mit dem Alter milder geworden bin.«
Nein, milde bestimmt nicht, dämmerte es Lyra. Irgendwas an Odette – ihre alternde Schönheit, ihr Lächeln – erinnerte sie vielmehr an einen Adler auf der Jagd.
Der Helikopter vollführte eine plötzliche, scharfe Wendung, und Lyra stockte kurz der Atem, als die Aussicht aus dem Fenster sämtliche anderen Gedanken aus ihrem Kopf verbannte. Der Pazifische Ozean unter ihr war gewaltig, sein sattes dunkles Blau durchzogen von nicht minder tiefen grünen Schattierungen. Entlang der Küste ragten riesige Steinformationen über dem Wasser auf wie Monumente aus einer anderen Zeit, einer uralten Erde. Es hatte etwas Magisches, wie die gewaltigen Wogen sich an den Felsen brachen.
Als der Helikopter sich allmählich von der Küste löste und über dem offenen Meer in die Höhe schwang, fragte Lyra sich, wie lange sie wohl unterwegs wären. Was für eine Reichweite hatte so ein Helikopter? Hundert Meilen? Fünfhundert Meilen?
Nimm alles in dich auf. Atme. Einen Moment lang konnte Lyra, während der Hubschrauber seiner Bahn folgte, nur noch den Ozean sehen – unergründlich und grenzenlos.
Und dann … sah sie die Insel.
Sie war nicht sonderlich groß, doch als der Helikopter sich näherte, wurde Lyra klar, dass der Flecken Land auch nicht so klein war, wie es zuerst den Anschein gemacht hatte. Der Anblick von oben zeigte hauptsächlich einen Wechsel aus Beige und Grün – bis auf die Stellen, wo das Land schwarz war.
Und da begriff Lyra: wo sie waren, wohin sie flogen. Hawthorne Island.
Der Helikopter neigte sich abrupt vor, tauchte ab und richtete sich gerade rechtzeitig wieder aus, um knapp über den Baumwipfeln hinwegzufegen. Im Nu war er quer über den gesunden Wald zu den verkohlten Überresten lang abgestorbener Bäume geflogen – eine krasse Erinnerung daran, dass es sich bei der Insel nicht bloß um eine der vielen luxuriösen Schwächen eines verstorbenen Milliardärs mit Vorliebe für entlegene Ferienrückzugsorte handelte.
Dieser Ort war verflucht.
Lyra wusste das besser als die meisten Menschen. Eine Tragödie ließ sich nicht so einfach fortwischen. Verluste hinterließen Narben. Je tiefer sie reichten, desto länger waren sie zu spüren. Hier gab es vor Jahrzehnten einen Brand. Sie versuchte, sich alles in Erinnerung zu rufen, was sie über das Feuer auf Hawthorne Island gelesen hatte. Menschen kamen ums Leben. Die Schuld fiel auf ein Mädchen aus der Gegend, nicht auf die Hawthornes.
Wie praktisch.
Lyra lehnte sich nach vorn, wobei ihr Blick versehentlich auf Grayson fiel. Er hatte diese Art von Gesicht, das aussah, als wäre es aus Eis oder Stein geschnitzt worden: geschliffene Züge, harter Kiefer, Lippen, die so voll waren, dass sie dem Gesicht etwas Weiches hätten verleihen sollen, es aber nicht taten. Sein Haar war blond, seine Augen von einem stechenden silbrigen Grau. Grayson Hawthorne sah genauso aus, wie er klang: wie zur Waffe geschmiedete Perfektion – unmenschlich, beherrscht, gnadenlos.
Mit wem spreche ich?, sagte seine Stimme in ihrer Erinnerung. Oder ziehst du es vor, dass ich die Frage anders formuliere: Mit wem spreche ich gleich nicht mehr, wenn ich auflege?
Abrupt lehnte Lyra sich wieder zurück. Glücklicherweise fiel es niemandem auf.
Sie befanden sich im Sinkflug.
Ein großer Kreis markierte den Hubschrauberlandeplatz, und dank Jameson Hawthorne trafen sie diesen genau in der Mitte, sodass Lyra die Landung kaum spürte.
Nicht mal eine Minute später öffneten sich die Hubschraubertüren, doch selbst das schien zu lang. Lyra konnte den geschlossenen Raum nicht schnell genug verlassen.
»In gewissem Sinne«, verkündete Jameson, sobald alle Spieler ausgestiegen waren, »beginnt das Spiel heute Abend. Aber in einem anderen, sehr realen Sinne … beginnt es genau jetzt.«
Genau jetzt. Ihr Herzschlag beschleunigte. Vergiss Grayson. Vergiss die Hawthornes. Sie waren Kinder gewesen, als Lyras Vater, den sie kein bisschen gekannt hatte, mit dem Namen Hawthorne auf den Lippen gestorben war. Vielleicht hätten sie etwas über die Wahrheit herausfinden können, wenn ihnen etwas daran gelegen wäre – wenn ihm etwas daran gelegen wäre –, aber deswegen war sie nicht hier. Lyra war für ihre Familie hergekommen. Für Mile’s End.
»Ihr habt bis Sonnenuntergang, um die Insel zu erkunden«, erklärte Jameson den Spielern, wobei er sich erneut lässig gegen den Helikopter lehnte. »Durchaus möglich, dass wir da draußen ein paar Dinge versteckt haben. Hinweise darauf, was ihr beim diesjährigen Spiel erwarten dürft. Gegenstände, die sich im weiteren Verlauf als nützlich erweisen werden.« Jameson stieß sich vom Helikopter ab und streifte um sie herum, während er fortfuhr: »An der Nordspitze befindet sich ein neu errichtetes Haus. Zwischen jetzt und der Dämmerung könnt ihr tun, was euch beliebt, doch wer es nicht ins Haus schafft, bevor die Sonne untergegangen ist, ist raus aus dem Spiel.«
Erkundet die Insel. Schafft es vor Einbruch der Dunkelheit ins Haus. Lyras Körper war bereit, die Muskeln gespannt, ihre Sinne geschärft. Sie schritt direkt an Grayson Hawthorne vorbei zum Rand des Landeplatzes.
»Pass auf, wo du hintrittst«, befahl seine knappe, souveräne Stimme hinter ihr. »Es geht tief runter.«
»Ich falle nie«, erwiderte Lyra tonlos. »Guter Gleichgewichtssinn.« Es kam keine Antwort und unwillkürlich sah sie über die Schulter nach hinten. Ihr Blick landete erst auf Jameson, der Grayson mit einem ganz merkwürdigen Ausdruck betrachtete. Während Grayson …
Grayson betrachtet sie. Er starrte Lyra förmlich an – nicht bloß so, als würde er sie zum ersten Mal bemerken, sondern so, als hätte ihre schiere Existenz ihn wie ein Schlag ins Gesicht erwischt.
War es wirklich so ungewohnt für ihn, Widerspruch zu erhalten?
Auf so was konnte Lyra gerade verzichten. Sie musste los. Knox und Rohan waren bereits fort. Odette stand dem Meer zugewandt da, wobei der Wind ihr langes, mit schwarzen Spitzen versehenes Haar wie eine Flagge hinter ihr wehen ließ.
Jameson schaute von Grayson zu Lyra und zeigte ein Lächeln, das nur als verschmitzt beschrieben werden konnte. »Das wird ein Spaß.«
Kapitel 8
Lyra
Auf direktem Weg steuerte sie die verbrannte Seite der Insel an – und damit die Ruine jenes Hauses, wo das Feuer vor all den Jahren gewütet hatte. Während ihr Blick auf dem verharrte, was von dem Gebäude noch übrig war, bemächtigte sich ein unheimliches Gefühl ihres Körpers. Es gab Teile der alten Villa, die bis auf die Grundfesten abgebrannt waren, und Teile, wo ihr ramponiertes Gerüst noch stand, wenn auch bis auf die Knochen entblößt. Die Böden waren rußgeschwärzt, die Decken nicht existent. Ein gemauerter Kamin stand noch, sein steinerner Sockel war von Pflanzen überwuchert.
Laub raschelte unter Lyras Sohlen, als sie die Schwelle zur alten Ruine überschritt. Überall um sie herum waren durch die Risse im Fundament grüne Ranken geschossen, die sich wie Peitschen um herumliegende Betonklumpen krallten. Der Boden war uneben. Es gab keinerlei Überreste von Möbeln oder anderen Habseligkeiten – nur die Blätter, von denen sich in einem ungewöhnlich warmen Herbst die ersten schon bunt gefärbt hatten und herabgefallen waren.
Eine ganze Minute lang ließ Lyra den Anblick auf sich wirken, hielt Ausschau nach irgendwas, das als Hinweis oder Gegenstand im Spiel durchgehen könnte. Als sie nichts sah, begann sie damit, den Rand der Ruine abzulaufen, um sich deren Ausmaße körperlich zu verinnerlichen. Später würde sie zwar nicht in der Lage sein, sich auch nur ein einziges Bild ins Gedächtnis zu rufen, doch ihr Körper würde sich an die sanfte, vom Meer kommende Brise erinnern, an die Risse im Boden, die exakte Anzahl von Schritten, die sie in jede Richtung gemacht hatte.
Nachdem sie ihre Runde beendet hatte, ging Lyra denselben Weg ein zweites Mal, die Augen geschlossen, um ihren Körper dazu zu bringen, die Welt um sie herum zu erspüren. Sie machte einen kompletten Rundgang, bevor sie sich in den Wind drehte, zur einstigen Rückseite des Hauses.
Zum Meer.
Die Lider immer noch geschlossen, schritt Lyra vorwärts, wobei sie die Hand hob, als sie am steinernen Kamin vorbeikam. Ihre Finger strichen über die Oberfläche … und da spürte sie etwas im Stein. Eine Inschrift.
Lyra öffnete die Augen. Die Buchstaben waren so klein, die eingeritzten Linien ganz flach. Es wäre ein Leichtes gewesen, sie zu übersehen. Lyra grub die Fingerspitzen in die Rillen und las, indem sie die Buchstaben ertastete.
Man kann der Realität von morgen nicht entFLIEHEN, indem man sich ihr heute entzieht. – Abraham Lincoln.
Das musste, allein wegen der seltsamen Großschreibung mitten im Satz, eine Art Hinweis sein, aber die Worte klangen eher wie eine Warnung: Eine Flucht war unmöglich.
Die nächsten zehn Minuten strich Lyra mit den Fingern über den restlichen Kamin, auf der Suche nach mehr, aber da war nichts. Und so schloss sie erneut die Augen und nahm ihren Gang wieder auf. Als sie wie ein Geist durch das hindurchschritt, was einst eine Außenmauer gewesen sein musste, hob sie das Kinn. Ohne das wenige schützende Gerippe des Hauses war der Wind hier nur noch stärker.
Erneut ging sie voran … als eine Hand sich um ihren Arm schloss.
Lyra riss die Augen auf. Grayson Hawthorne blickte sie an. Wo war er hergekommen? Die Art, wie er ihren Arm festhielt, war nicht schmerzhaft, aber sein Griff hatte auch nichts sonderlich Sanftes an sich.
Sie standen viel zu nah beieinander.
»Dir ist bewusst, dass hier eine Klippe kommt?« Grayson ließ ihren Arm nicht los; sein Tonfall machte überdeutlich, dass er glaubte, ihr wäre irgendwie entgangen, wie nah sie sich am Rand dessen befand, was einst eine weitläufige Terrasse mit spektakulärem Meerblick gewesen sein musste.
»Äußerst bewusst sogar.« Lyra sah auf seine Hand auf ihrem Arm hinunter, und er ließ sie so abrupt fallen, als hätte ihre Haut ihn durch das Shirt hindurch versengt. »Von nun an«, sagte Lyra lapidar, »darfst du wohl einfach davon ausgehen, dass ich weiß, was ich tue. Und wo du schon dabei bist, darfst du auch deine Hände bei dir behalten.«
»Ich bitte um Verzeihung.« Grayson Hawthorne klang nicht bedauernd. »Du hattest die Augen geschlossen.«
»War mir gar nicht aufgefallen«, sagte Lyra mit beißender Trockenheit.
Grayson bedachte sie mit einem ebenso trockenen Blick. »Von nun an«, wandte er ihre eigenen Worte gegen sie, »darfst du, falls du vorhast, deinen Leichtsinn zu meinem Problem zu machen, erwarten, dass dieses Problem gelöst wird.«
Er sprach wie jemand, der es gewohnt war, die Regeln aufzustellen – für sich und für alle anderen.
»Ich kann auf mich aufpassen.« Lyra schritt an ihm vorbei, zurück in die Ruine, weg von der Klippe.
Gerade als sie dachte, dass er sie ziehen lassen würde, sprach Grayson wieder. »Ich kenne dich.«
Lyra blieb stehen. Etwas an der Art, wie er kenne sagte, ging ihr durch und durch. »Ja, Klugscheißer. Wir sind uns begegnet. Hubschrauber? Vor nicht mal einer Stunde?«
»Nein.« Grayson Hawthorne sagte das Nein als Fakt, als spielte es keine Rolle, ob er gerade einen Befehl erteilte oder bloß klarstellte, dass man sich irrte – alles, was man verstehen musste, war: Nein.
»Doch.« Lyra hatte nicht vorgehabt, sich zu ihm umzudrehen, hatte nicht die Absicht gehabt, ihm in die Augen zu schauen, doch sobald sie sich mit ihm im Blickduell befand, weigerte sie sich, als Erste wegzusehen.
Graysons silbergrauer Blick geriet nicht ins Wanken. »Ich kenne dich. Deine Stimme.« Das Wort blieb ihm im Hals stecken. »Ich erkenne deine Stimme.«
Lyra hatte nicht mal über die Möglichkeit nachgedacht, dass er irgend