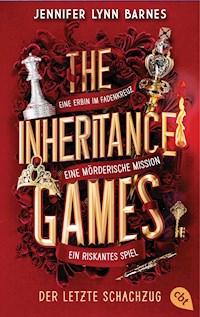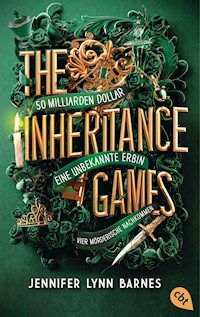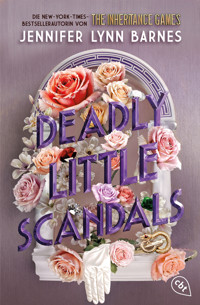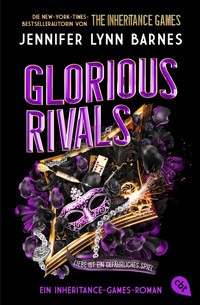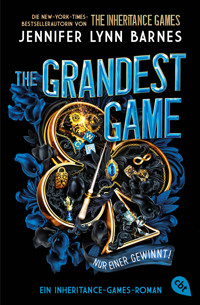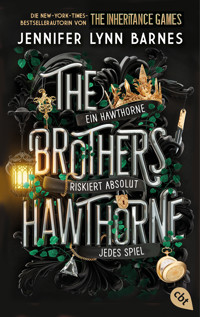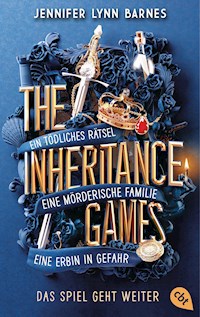
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die THE-INHERITANCE-GAMES-Reihe
- Sprache: Deutsch
Intrigen, Reichtümer und Romantik – die Fortsetzung des New-York-Times-Bestsellers!
Avery steht weiterhin vor einem Rätsel: Warum nur hat der milliardenschwere Tobias Hawthorne ausgerechnet ihr sein gesamtes Vermögen vermacht? Ihr, einer völlig Unbekannten anstatt seinen Töchtern oder seinen vier Enkelsöhnen.
Eine Blutsverwandte ist sie jedenfalls nicht, so viel hat die junge Erbin inzwischen herausgefunden. Aber auf ihrer Spurensuche mehren sich die Hinweise, dass sie eine weit tiefere Verbindung zu dieser außergewöhnlichen Familie hat, als sie je ahnte. Die schillernden und charmanten Enkelsöhne des Patriarchen spielen derweil hinter den Kulissen ihr ganz eigenes Spiel. Und damit nicht genug, treten weitere Gegenspieler auf den Plan, die Avery loswerden wollen – um jeden Preis …
Ein atemberaubender Thriller mit jeder Menge Action, Glamour und vier atemberaubenden Intriganten
Die Inheritance-Reihe:
The Inheritance Games (Band 1)
The Inheritance Games - Das Spiel geht weiter (Band 2)
The Inheritance Games - Der letzte Schachzug (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jennifer Lynn Barnes
THE
INHERITANCE
GAMES
DAS SPIEL GEHT WEITER
Aus dem Amerikanischen
von Ivana Marinović
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Juli 2022
© 2021 Jennifer Lynn Barnes
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Hawthorne Legacy« bei Little, Brown and Company, einem Verlag der Verlagsgruppe Hachette, New York
© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ivana Marinović
Lektorat: Katja Hildebrandt
Zitat frei nach: »A Poison Tree« von William Blake, veröffentlicht in »Songs of Experience« 1794
Covergestaltung: Carolin Liepins, München
unter Verwendung des Originalumschlags: © 2021 Hachette Book Group, Inc.,
Illustration © Katt Phatt, Gestaltung: © Karina Granda
MP · Herstellung: AW
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-27183-1V003
www.cbj-verlag.de
KAPITEL 1
Erzähl mir doch noch einmal vom ersten Mal, als ihr beide im Park Schach gespielt habt.« Jamesons Gesicht wurde nur vom Kerzenschein erhellt, aber selbst in dem spärlichen Licht konnte ich das Funkeln in seinen dunkelgrünen Augen sehen.
Es gab nichts – und niemanden –, was Jameson Hawthornes Blut so sehr in Wallung brachte wie ein Rätsel.
»Das war kurz nach der Beerdigung meiner Mutter«, erwiderte ich. »Ein paar Tage danach, eine Woche höchstens.«
Wir befanden uns in dem Tunnelsystem unter Hawthorne House, allein, da wo niemand sonst uns hören konnte. Es war keinen Monat her, dass ich meinen Fuß zum ersten Mal in dieses palastartige texanische Herrenhaus gesetzt hatte, und nur eine Woche, seit wir das Rätsel gelöst hatten, warum ich überhaupt hergebracht worden war.
Falls wir das Rätsel wirklich gelöst hatten.
»Meine Mom und ich gingen früher immer im Park spazieren.« Ich schloss die Augen, sodass ich mich auf die Fakten konzentrieren konnte, nicht auf die Intensität, mit der Jameson sich an jedem meiner Worte festsaugte. »Sie nannte es das Ziellos-Herumwandern-Spiel.« Ich sperrte mich gegen die Erinnerung, indem ich meine Augenlider wieder aufklappte. »Ein paar Tage nach ihrer Beerdigung ging ich das erste Mal ohne sie in den Park. Als ich mich dem Teich näherte, erblickte ich eine Menschenmenge, die sich dort versammelt hatte. Ein Mann lag mit geschlossenen Augen unter einem Haufen lumpiger Decken auf dem Gehweg.«
»Obdachlos.« Jameson hatte die ganze Geschichte schon mal gehört, doch sein Blick mit dem berüchtigten Laserfokus geriet kein bisschen ins Wanken.
»Die Leute dachten, er wäre tot – oder sturzbetrunken. Doch da setzte er sich auf. Ich sah, wie ein Polizist sich den Weg durch die Menge bahnte.«
»Aber du kamst ihm zuvor«, beendete Jameson meine Schilderung, seine Augen fest auf meine gerichtet, seine Mundwinkel nach oben verziehend. »Und hast den Mann gefragt, ob er mit dir eine Runde Schach spielt.«
Ich hatte nicht erwartet, dass Harry auf mein Angebot einsteigen würde – geschweige denn gewinnen.
»Danach haben wir jede Woche mindestens einmal gespielt«, fuhr ich fort. »Manchmal zwei-, dreimal. Er hat mir nie mehr verraten als seinen Vornamen.«
Sein Name war aber gar nicht Harry. Er hat gelogen. Und genau deswegen befand ich mich gerade mit Jameson Hawthorne in diesem Tunnel. Das war auch der Grund, warum er wieder dazu übergegangen war, mich anzuschauen, als wäre ich ein Mysterium, ein Rätsel, das er – und nur er – lösen könnte.
Es konnte schlicht kein Zufall sein, dass der Milliardär Tobias Hawthorne sein gesamtes Vermögen einer Fremden vermacht hatte, die seinen »verstorbenen« Sohn kannte.
»Bist du dir sicher, dass es Toby war?«, fragte Jameson, wobei die Luft zwischen uns vor Spannung knisterte.
Seit Neuestem war ich mir praktisch keiner anderen Sache mehr so sicher. Vor drei Wochen noch war ich ein normales Mädchen gewesen, das gerade so über die Runden kam und verzweifelt versuchte, die Highschool zu überleben, ein Uni-Stipendium zu ergattern und aus New Castle, einem Kaff in Connecticut, rauszukommen. Dann, aus dem Blauen heraus, hatte ich eine Nachricht erhalten, dass einer der reichsten Männer des Landes gestorben war und mich in seinem Testament bedacht hatte. Tobias Hawthorne hatte mir Milliarden hinterlassen, im Grunde sein gesamtes Vermögen – und ich hatte keine Ahnung gehabt, warum. Jameson und ich hatten zwei Wochen damit zugebracht, die Rätsel und Hinweise zu entwirren, die der alte Mann hinterlassen hatte. Warum ich? Wegen meines Namens. Wegen des Datums, an dem ich zur Welt kam. Weil Tobias Hawthorne alles auf die eine unwahrscheinliche Karte gesetzt hatte, dass ich irgendwie seine zerrüttete Familie wieder zusammenbringen könnte.
Oder zumindest war dies die Schlussfolgerung, zu der uns das letzte Rätselspiel des alten Herrn verleitet hatte.
»Ich bin mir sicher«, erwiderte ich mit Nachdruck. »Toby lebt. Und falls dein Großvater das wusste – was mit einem großen Fragezeichen versehen ist, ich weiß –, aber falls er es wusste, dann müssen wir davon ausgehen, dass er mich ausgewählt hat, weil ich Toby kannte, oder weil er es überhaupt erst eingefädelt hat, dass wir uns begegnen.«
Wenn ich eine Sache über den verstorbenen Milliardär Tobias Hawthorne gelernt hatte, dann, dass er dazu in der Lage war, so gut wie alles einzufädeln, so gut wie jeden zu manipulieren. Er hatte eine Leidenschaft für Geheimnisse, Rätsel und Spiele gehabt.
Genauso wie Jameson.
»Was, wenn jener Tag im Park gar nicht das erste Mal war, dass du meinem Onkel begegnet bist?« Jameson trat einen Schritt auf mich zu, wobei eine unheimliche Energie von ihm ausging. »Denk doch mal nach, Erbin. Du sagtest, das einzige Mal, dass du meinen Großvater getroffen hast, war, als du sechs Jahre alt warst. Er sah dich in dem Diner, in dem deine Mutter damals kellnerte, und er hörte deinen vollen Namen.«
Mein Name, Avery Kylie Grambs, wurde, anders angeordnet, zu A very risky gamble – Ein sehr riskantes Spiel. Ein Name, der sich einem Mann wie Tobias Hawthorne ins Gedächtnis brannte.
»Das stimmt«, sagte ich. Jameson war mir nun ganz nahe. Zu nahe. Alle vier Hawthorne-Brüder verfügten über ein magnetisches Charisma, das nicht ohne Wirkung auf die Menschen um sie herum blieb – und Jameson war sehr gut darin, genau diese Kraft einzusetzen, um zu bekommen, was er wollte. Und jetzt will er etwas von mir.
»Warum war mein Großvater, ein texanischer Milliardär, der eine ganze Riege von Meisterköchen auf Abruf bereitstehen hatte, in einem schäbigen Diner essen, und das in einer Kleinstadt in Connecticut, von der keiner je was gehört hat?«
Meine Gedanken überschlugen sich. »Du glaubst, er hat nach etwas gesucht?«
Jameson grinste verschmitzt. »Oder nach jemandem. Was, wenn der alte Herr nach New Castle gefahren ist, um Toby zu suchen, und dann dich gefunden hat?«
Da war etwas in der Art, wie er das Wort dich sagte. So als wäre ich jemand. Als wäre ich besonders. Doch an diesem Punkt waren Jameson und ich schon mal gewesen. »Und du meinst, alles andere war bloß Ablenkung?«, fragte ich, wobei ich den Blick von ihm abwandte. »Mein Name. Die Tatsache, dass Emily an meinem Geburtstag gestorben ist. Das Rätsel, das dein Großvater uns hinterlassen hat – das war alles bloß eine Lüge?«
Jameson zeigte keinerlei Reaktion auf Emilys Namen. Im Rätselfieber konnte ihn nichts von seiner Fährte abbringen – nicht einmal sie. »Eine Lüge«, wiederholte Jameson. »Oder ein Verwirrspiel.«
Er hob eine Hand, um mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht zu streichen, und sämtliche Nervenenden in meinem Körper richteten sich auf.
Ich wich zurück. »Hör auf, mich so anzuschauen«, sagte ich ernst.
»Wie denn?«, gab er zurück.
Ich verschränkte die Arme und bedachte ihn mit einem ungerührten Blick. »Du knipst deinen Charme immer dann an, wenn du etwas willst.«
»Erbin, du kränkst mich.« Jameson sah mit diesem unverschämten Schmunzeln besser aus, als das irgendeinem Jungen erlaubt sein sollte. »Ich will bloß, dass du ein bisschen in deiner kostbaren Erinnerung kramst. Mein Großvater war ein Mensch, der gerne vierdimensional dachte. Womöglich hatte er mehr als nur einen Grund, warum er dich gewählt hat. Warum zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sagte er immer, wenn man auch ein Dutzend erwischen kann?«
Da war etwas in seiner Stimme, in seinem Blick, das es nur zu einfach gemacht hätte, sich in dem hier zu verlieren. In all den Möglichkeiten. Den Geheimnissen. Ihm.
Aber ich war kein Mädchen, das einen Fehler zweimal machte. »Vielleicht irrst du dich aber auch.« Ich wandte mich von ihm ab. »Was, wenn dein Großvater gar nicht wusste, dass Toby am Leben ist? Was, wenn es Toby war, der gemerkt hat, dass der alte Herr mich beobachten lässt? Dass er mit dem Gedanken spielt, mir sein gesamtes Vermögen zu vermachen?«
Harry, so wie ich ihn gekannt hatte, war ein höllisch guter Schachspieler gewesen. Vielleicht war jener Tag im Park gar kein Zufall gewesen. Vielleicht hatte er mich bewusst aufgespürt.
»Irgendwas entgeht uns hier«, sagte Jameson, der direkt hinter mich trat. »Oder«, murmelte er an meinen Hinterkopf gerichtet, »du hältst etwas zurück.«
Da lag er nicht ganz falsch. Ich dachte nämlich nicht im Traum daran, meine Karten komplett auf den Tisch zu legen – und Jameson Winchester Hawthorne wiederum erweckte gar nicht erst den Anschein, vertrauenswürdig zu sein.
»Ich sehe schon, Erbin.« Ich konnte das verschmitzte Schmunzeln förmlich hören. »Wenn du die Sache hier auf diese Art spielen willst, warum machen wir es dann nicht richtig interessant?«
Ich drehte mich wieder zu ihm um. So Auge in Auge war es schwer, nicht daran zu denken, dass, wenn Jameson ein Mädchen küsste, darin nichts Zögerliches lag. Es war weder sanft noch behutsam. Es war nicht echt, rief ich mir in Erinnerung. Ich war für ihn bloß ein Teil des Rätsels gewesen, ein Werkzeug, das man benutzt. Und heute war ich immer noch Teil des Rätsels.
»Nicht alles ist ein Spiel«, sagte ich.
»Und vielleicht«, erwiderte Jameson mit glitzernden Augen, »ist genau das das Problem. Vielleicht ist das der Grund, warum wir hier Tag für Tag vergeblich durch diese Gänge kreisen, diese Geschichte wiederkäuen und keinen Schritt weiterkommen: weil das hier kein Spiel ist. Noch nicht. Ein Spiel hat Regeln. Ein Spiel hat einen Sieger. Vielleicht, Erbin, brauchen du und ich, um das Geheimnis um Toby Hawthorne zu lüften, nur etwas mehr Motivation.«
»Was für eine Motivation?« Ich kniff die Augen zusammen.
»Wie wäre es mit einer Wette?« Jameson hob eine Augenbraue. »Wenn ich die Sache als Erster aufdecke, musst du mir meinen kleinen Fehltritt nach unserem Ausflug in den Black Wood vergeben und vergessen.«
Im Black Wood, dem Wald auf dem Hawthorne-Anwesen, hatten wir herausgefunden, dass seine tote Ex-Freundin an meinem Geburtstag verunglückt war. Das war auch der Moment, in dem erstmals klar wurde, dass Tobias Hawthorne mich nicht ausgewählt hatte, weil ich irgendwie besonders gewesen wäre. Er hatte mich ausgesucht wegen der Wirkung, die diese Enthüllung auf seine Enkel hätte.
Unmittelbar danach hatte Jameson mich eiskalt abserviert.
»Und wenn ich gewinne«, gab ich zurück, wobei ich unverwandt in seine grünen Augen blickte, »dann wirst du vergessen müssen, dass wir uns je geküsst haben – und nie wieder versuchen, mich mit deinem Charme einzulullen, um mich noch mal zu küssen.«
Ich traute ihm nicht – aber genauso wenig traute ich mir selbst in seiner Gegenwart.
»Also gut, Erbin.« Jameson trat noch einen Schritt vor. Dann senkte er seine Lippen an mein Ohr und flüsterte: »Die Wette gilt.«
KAPITEL 2
Unsere Wette war damit besiegelt. Jameson schlug eine Richtung in den unterirdischen Gängen ein, ich nahm eine andere. Hawthorne House war gewaltig, weitläufig, so groß, dass ich selbst nach drei Wochen, die ich nun schon hier wohnte, nicht alles davon gesehen hatte. Man könnte problemlos Jahre mit dem Erforschen dieses Ortes verbringen und würde immer noch nicht alle Besonderheiten kennen, all die Geheimgänge und verborgenen Kammern – und das, ohne das Tunnelsystem unter dem Anwesen mitzuzählen.
Glücklicherweise lernte ich schnell. Ich nahm eine Abkürzung unter dem Fitnessraum zu einem Gang, der unterhalb des Musikzimmers verlief. Ich kam an der Orangerie vorbei und kletterte dann eine verborgene Treppe zum Großen Salon empor, wo ich auf Nash Hawthorne traf, der lässig neben dem gemauerten Kamin lehnte. Und wartete.
»Hey, Kleines.« Nash zuckte nicht mal mit der Wimper, als ich scheinbar aus dem Nichts auftauchte. Tatsächlich vermittelte der älteste der Hawthorne-Brüder den Eindruck, als könnte das gesamte Herrenhaus um ihn herum zusammenbrechen und er würde einfach weiter da am Kamin lehnen. Nash Hawthorne würde wohl noch den Tod persönlich mit einem Tippen an seinen Cowboyhut begrüßen.
»Hey«, erwiderte ich.
»Ich nehme mal an, du hast nicht zufällig Grayson gesehen?«, fragte Nash. Sein gedehnter texanischer Akzent verlieh der Frage etwas beinahe Träges.
Trotzdem milderte das nicht die Wirkung seiner Worte. »Nein.« Ich hielt meine Antwort knapp, meine Miene reglos. Grayson Hawthorne und ich waren auf Abstand gegangen.
»Und ich nehme auch an, dass du nichts über eine kleine Unterredung zwischen Gray und unserer Mutter weißt, bevor sie die Koffer gepackt hat?«
Skye Hawthorne, Tobias Hawthornes jüngere Tochter und Mutter seiner vier Enkelsöhne, hatte versucht, mich umbringen zu lassen. Der Typ, der den Abzug betätigt hatte, saß nun in einer Gefängniszelle, während Skye gezwungen worden war, Hawthorne House zu verlassen – von ihrem Sohn Grayson. Ich werde dich immer beschützen, hatte er mir gesagt. Aber das hier … wir … Es kann nie sein, Avery.
»Nein«, wiederholte ich ungerührt.
»Dachte ich mir schon.« Nash zwinkerte mir zu. »Deine Schwester und deine Anwältin suchen dich. Im Ostflügel.« Wenn ich je eine schwergewichtige Aussage gehört hatte, dann diese. Immerhin war meine Anwältin seine ehemalige Verlobte und meine Schwester war …
Keine Ahnung, was Libby und Nash Hawthorne waren.
»Danke«, sagte ich, doch als ich die geschwungene Treppe zum Ostflügel von Hawthorne House hochstieg, begab ich mich nicht auf die Suche nach Libby. Oder Alisa. Ich hatte eine Wette mit Jameson laufen und ich hatte die Absicht, zu gewinnen. Erster Zwischenstopp: Tobias Hawthornes Büro.
In dem Arbeitszimmer befand sich ein Mahagonischreibtisch und dahinter eine ganze Wand mit Auszeichnungen, Patenten und Büchern, die allesamt den Namen Hawthorne auf dem Rücken trugen – eine atemberaubende visuelle Erinnerung daran, dass rein gar nichts an den vier Hawthorne-Brüdern gewöhnlich war. Sie hatten bereits in jungen Jahren alle erdenklichen Chancen geboten bekommen, und der alte Herr hatte von ihnen nicht weniger erwartet, als herausragend zu sein. Aber ich war nicht hergekommen, um die Trophäen der Jungs anzuglotzen.
Stattdessen nahm ich hinter dem massiven Schreibtisch Platz und öffnete das Geheimfach, das ich vor Kurzem entdeckt hatte. Es enthielt eine Mappe, in der sich Fotos von mir befanden, zahllose Aufnahmen, die Jahre zurückreichten. Nach jener schicksalhaften Begegnung im Diner hatte Tobias Hawthorne mich ständig im Auge behalten. Alles nur wegen meines Namens? Oder hatte er andere Beweggründe?
Ich ging die Bilder durch und zog zwei heraus. Jameson hatte unten im Tunnel recht gehabt. Ich hielt etwas vor ihm zurück: Ich war zweimal mit Toby fotografiert worden und beide Male hatte der Fotograf lediglich den Hinterkopf des Mannes neben mir eingefangen.
Hatte Tobias Hawthorne seinen Sohn Toby von hinten erkannt? Hatte »Harry« gemerkt, dass man uns fotografierte, und den Kopf bewusst von der Kamera weggedreht?
Was sachdienliche Hinweise anging, gab das nicht viel her. Alles, was die Fotos bewiesen, war, dass Tobias Hawthorne mich schon Jahre vor »Harrys« Auftauchen im Blick gehabt hatte. Ich blätterte weiter durch die Mappe bis zu einer Kopie meiner Geburtsurkunde. Die Unterschrift meiner Mutter war ordentlich, die meines Vaters eine schräge Mischung aus Schreibschrift und Druckbuchstaben. Tobias Hawthorne hatte sowohl die Unterschrift meines Vaters als auch mein Geburtsdatum farblich markiert.
18.10. Die Bedeutung war mir bewusst. Sowohl Grayson als auch Jameson hatten ein Mädchen namens Emily Laughlin geliebt. Ihr Tod – am 18. Oktober – hatte einen Keil zwischen sie getrieben. Irgendwie hatte der alte Herr den Plan gehabt, dass ich sie wieder zusammenbringe. Aber warum sollte Tobias Hawthorne die Unterschrift meines Vaters markiert haben? Ricky Grambs war ein Loser, der sich mein ganzes Leben um die Unterhaltszahlungen gedrückt hatte. Er hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, ans Telefon zu gehen, als meine Mutter gestorben war. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre ich wohl in einem Heim gelandet. Ich starrte eindringlich Rickys Unterschrift an, so als könnte mir dadurch der Grund für Tobias Hawthornes Markierung klar werden.
Nichts.
Ganz hinten in meinem Kopf hörte ich die Stimme meiner Mutter. Ich habe ein Geheimnis, hatte sie mir gesagt, lange bevor Tobias Hawthorne mich in sein Testament aufgenommen hatte, über den Tag, an dem du zur Welt kamst.
Was auch immer sie damit gemeint hatte, nun da sie tot war, würde ich es wohl niemals erfahren. Das Einzige, was ich ganz sicher wusste, war, dass ich keine Hawthorne war. Wenn schon die Unterschrift meines Vaters auf meiner Geburtsurkunde nicht Beweis genug war, so hatte ein DNA-Test bereits bestätigt, dass ich kein Hawthorne-Blut in mir hatte.
Warum hat Toby mich aufgespürt? Hat er mich überhaupt aufgespürt? Ich dachte daran, was Jameson vorhin über seinen Großvater gesagt hatte – darüber, zwölf Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Während ich erneut die Mappe durchging, versuchte ich, ein Fitzelchen Sinn oder Bedeutung darin zu finden. Was entging mir hier? Es musste doch etwas …
Ein Klopfen an der Tür war die einzige Warnung, die ich bekam, bevor der Türknauf sich drehte. Blitzschnell schob ich die Fotos zusammen und ließ die Mappe in das Geheimfach gleiten.
»Da bist du ja.« Alisa Ortega, meine Rechtsanwältin, war ein Muster an Professionalität. Sie wölbte ihre dunklen Brauen zu einem Ausdruck, den ich insgeheim den Alisa-Blick getauft hatte. »Gehe ich recht in der Annahme, dass du das Spiel vergessen hast?«
»Das Spiel«, wiederholte ich, etwas unschlüssig, welches Spiel sie wohl meinte. Ich hatte das Gefühl, zu spielen, seit ich zum ersten Mal über die Schwelle von Hawthorne House getreten war.
»Das Football-Spiel«, stellte Alisa mit einem weiteren Alisa-Blick klar. »Teil zwei deiner Einführung in die High Society von Texas. Nun, da Skye das Anwesen verlassen hat, ist es wichtiger denn je, den Anschein zu wahren. Wir müssen das Narrativ kontrollieren. Das hier ist eine Cinderella-Story, kein Skandal, und das bedeutet, du musst die Cinderella spielen. In der Öffentlichkeit. So oft und so überzeugend wie möglich – angefangen damit, dass du heute Abend die Besitzerloge beziehst.«
Die Besitzerloge. Da machte es Klick. »Das Spiel«, wiederholte ich, als es mir dämmerte. »Von der National Football League. Weil ich eine Football-Mannschaft besitze.«
Der Gedanke war immer noch so irre, dass er mich beinahe von dem anderen Teil ablenkte, den Alisa erwähnt hatte – die Sache mit Skye. Nach der Abmachung, die ich mit Grayson getroffen hatte, durfte ich niemandem von der Rolle seiner Mutter an dem Attentat auf mich erzählen. Im Austausch dafür hatte er sich der Sache angenommen.
So wie er es versprochen hatte.
»Die Besitzerloge verfügt über achtundvierzig Plätze«, erklärte Alisa, die in den Belehrungsmodus gewechselt hatte. »Der Sitzplan wird Monate im Voraus aufgestellt. Ausschließlich VIPs. Dabei geht es nicht nur um Football – es ist zudem eine Gelegenheit, sich den Platz an einem Dutzend verschiedener Tische zu erkaufen. Die Einladungen sind heiß begehrt, egal ob Politiker, Promis, Firmenchefs. Ich habe Oren bereits sämtliche Gäste für heute Abend durchleuchten lassen, außerdem werden wir einen Fotografen dahaben, um ein paar strategisch gute Aufnahmen zu machen. Landon hat eine Pressemitteilung erstellt, die eine Stunde vor dem Spiel rausgehen wird. Alles, worum wir uns jetzt noch kümmern müssen …« Alisa verstummte taktvoll.
Ich schnaubte. »Bin ich?«
»Das ist eine Cinderella-Story«, rief mir Alisa in Erinnerung. »Was, glaubst du, würde Cinderella zu ihrem ersten NFL-Spiel tragen?«
Das konnte nur eine Fangfrage sein.
»So was in der Art?« Libby tauchte in der Tür auf. Sie trug einen Lone-Stars-Pulli mit passendem Schal, passenden Handschuhen und passenden Cowboystiefeln. Ihr blaues Haar war zu zwei Zöpfen geflochten und mit einem Bündel blauer und goldener Bänder verziert.
Alisa zwang sich zu einem Lächeln. »Ja«, sagte sie an mich gewandt. »So was in der Art … Minus dem schwarzen Lippenstift, dem schwarzen Nagellack und dem schwarzen Samthalsband.« Libby war womöglich der fröhlichste Goth der Welt, aber Alisa war kein Fan vom Modegeschmack meiner Schwester. »Wie ich gerade sagte«, fuhr Alisa nachdrücklich fort, »ist der heutige Abend sehr wichtig. Während du für die Kameras das Aschenputtel spielst, werde ich eine Runde zwischen unseren Gästen drehen, um ein besseres Gespür dafür zu bekommen, wo sie stehen.«
»Wo sie bei was stehen?«, fragte ich. Man hatte mir zigmal versichert, dass Tobias Hawthornes Testament bombenfest war. Soweit ich wusste, hatte die Familie Hawthorne aufgegeben, es anzufechten.
»Es schadet nie, ein paar zusätzliche mächtige Player auf seiner Seite zu haben«, sagte Alisa. »Und wir wollen doch, dass unsere Verbündeten aufatmen können.«
»Hoffe, ich störe nicht.« Nash tat so, als wäre er uns dreien zufällig über den Weg gelaufen – so als hätte er mich nicht selbst vorgewarnt, dass Alisa und Libby nach mir suchten. »Mach ruhig weiter, Lee-Lee«, sagte er an meine Anwältin gewandt. »Du sagtest gerade irgendwas von Aufatmen?«
»Die Leute müssen wissen, dass Avery nicht hier ist, um alles durcheinanderzubringen.« Alisa vermied es, Nash direkt anzusehen, so wie jemand, der es vermeidet, in die Sonne zu schauen. »Dein Großvater hatte Investitionen am Laufen, Geschäftspartner, politische Bündnisse – diese Dinge erfordern einen sorgsamen, bedächtigen Umgang.«
»Was sie damit meint«, sagte Nash an mich gewandt, »ist, dass sie den Leuten verklickern muss, dass McNamara, Ortega & Jones die Situation völlig unter Kontrolle haben.«
Die Situation?, dachte ich. Oder mich? Mir gefiel die Vorstellung nicht, irgendjemandes Marionette zu sein. Zumindest in der Theorie sollte die Anwaltskanzlei eigentlich für mich arbeiten.
Da fiel mir etwas ein. »Alisa? Erinnerst du dich noch, als ich dich bat, einem Freund von mir Geld zukommen zu lassen?«
»Harry, nicht wahr?«, erwiderte Alisa, aber mich beschlich das Gefühl, dass ihre Aufmerksamkeit momentan in dreierlei Weise geteilt war: zwischen meiner Frage, ihren großen Plänen für heute Abend und dem Lächeln, das an Nashs Mundwinkeln zuckte, als er Libbys Outfit musterte.
Das Letzte, was ich im Moment brauchte, war, dass meine Anwältin sich zu sehr darauf fixierte, wie ihr Ex meine Schwester anglotzte. »Ja. Konntest du ihm das Geld übermitteln?«, fragte ich. Der einfachste Weg, Antworten zu bekommen, wäre, Toby aufzuspüren – bevor Jameson es tat.
Alisa riss den Blick von Libby und Nash los. »Unglücklicherweise«, sagte sie rasch, »konnten meine Leute keine Spur von deinem Harry ausfindig machen.«
Ich überschlug in meinem Kopf, was das wohl zu bedeuten hatte. Toby Hawthorne war nur wenige Tage nach dem Tod meiner Mutter im Park aufgetaucht, und keinen Monat, nachdem ich fortgegangen war, war er verschwunden.
»Nun«, sagte Alisa und klatschte energisch in die Hände, »was dein Outfit betrifft …«
KAPITEL 3
Ich hatte noch nie ein Football-Spiel gesehen, aber als neue Besitzerin der Texas Lone Stars konnte ich das natürlich nicht den Reportern sagen, die den SUV belagerten, kaum dass wir vor dem Stadion hielten. Genauso wenig, wie ich zugeben konnte, dass mein schulterfreier Pulli und die metallicblauen Cowboystiefel an meinen Füßen sich ungefähr so authentisch anfühlten wie ein Halloweenkostüm.
»Lass das Fenster runter«, wies Alisa mich an, »lächle und schrei: Go, Lone Stars!«
Ich wollte das Fenster nicht runterlassen. Ich wollte nicht lächeln. Und ich wollte auch nichts schreien – aber ich tat es. Weil das hier eine Cinderella-Story war und ich der Star der Geschichte.
»Avery!«
»Avery, schau hierher!«
»Wie fühlst du dich bei deinem ersten Spiel als Besitzerin?«
»Hast du was zu sagen zu den Berichten, dass du Skye Hawthorne tätlich angegriffen hast?«
Ich war in Sachen Presse noch nicht sehr geschult, aber doch genug, um die goldene Regel zu befolgen, wenn eine Horde Reporter Fragen auf einen abfeuerte: Nicht antworten. Das praktisch Einzige, was ich sagen durfte, war, dass ich aufgeregt, dankbar, tief beeindruckt und unfassbar überwältigt war.
Also tat ich mein Bestes, Aufregung, Dankbarkeit und Ehrfurcht zu vermitteln. Fast hunderttausend Menschen würden dem Spiel heute Abend beiwohnen. Millionen rund um die Welt würden zusehen und das Team anfeuern. Mein Team.
»Go, Lone Stars!«, brüllte ich. Ich wollte gerade das Fenster wieder hochlassen, doch als mein Finger den Knopf berührte, löste sich eine Gestalt aus der Menge. Kein Reporter.
Mein Vater.
Ricky Grambs hatte mein gesamtes Leben damit verbracht, mich wie eine lästige Erinnerung zu behandeln – wenn überhaupt. Ich hatte ihn seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Aber nun, da ich Milliarden geerbt hatte?
Schon war er da.
Mich von ihm – und den Paparazzi – abwendend, ließ ich das Fenster hoch.
»Ave?« Libbys Stimme klang zögerlich, als unser kugelsicherer SUV in einer privaten Garage unterhalb des Stadions verschwand. Meine Schwester war eine hoffnungslose Optimistin. Sie ging bei allen Menschen immer vom Besten aus, und das schloss auch einen Mann ein, der nie auch nur einen verdammten Finger für uns krumm gemacht hatte.
»Wusstest du, dass er hier sein würde?«, fragte ich gedämpft.
»Nein!«, erwiderte Libby. »Ich schwöre!« Sie nagte an ihrer Unterlippe, wobei sie ihren schwarzen Lippenstift verschmierte. »Aber er will nur reden.«
Ja, ich wette, das will er.
Vor mir auf dem Fahrersitz saß Oren, der Chef meines Security-Teams. Er parkte den SUV, während er ruhig in sein Headset sprach. »Wir haben da ein kleines Problem am Nordeingang. Streng privat, ich möchte einen vollständigen Bericht.«
Das Schöne daran, Milliardärin mit einer Leibgarde voller ehemaliger Spezialeinsatzkräfte zu sein, war, dass die Wahrscheinlichkeit, noch mal in einen Hinterhalt zu geraten, gegen null ging. Ich rang die Gefühle nieder, die der Anblick von Ricky in mir aufgewühlt hatte, und trat aus dem Wagen in die Untiefen des größten Stadions der Welt. »Lasst uns das durchziehen«, sagte ich entschieden.
»Nur für’s Protokoll«, wandte Alisa sich an mich, als sie ebenfalls aus dem Wagen gestiegen war, »die Kanzlei ist durchaus in der Lage, sich um deinen Vater zu kümmern.«
Und das wiederum war das Schöne daran, die exklusive Klientin einer milliardenschweren Anwaltskanzlei zu sein.
»Alles okay bei dir?«, hakte Alisa nach. Sie war nicht unbedingt der einfühlsame Typ. Viel wahrscheinlicher war, dass sie abzuschätzen versuchte, ob heute Abend Verlass auf mich wäre.
»Mir geht’s gut«, erwiderte ich.
»Warum sollte es ihr nicht gut gehen?«
Diese Stimme – leise und glatt – kam von einem Aufzug hinter mir. Ich drehte mich um und stand zum ersten Mal seit sieben Tagen Grayson Hawthorne gegenüber. Er hatte hellblondes Haar, eisgraue Augen und so scharfe Wangenknochen, dass sie als Waffen durchgehen könnten. Vor zwei Wochen noch hätte ich gesagt, dass er der selbstsicherste, selbstgerechteste, arroganteste Arsch war, den ich je getroffen hatte.
Ich war mir nicht sicher, was ich heute über Grayson Hawthorne sagen sollte.
»Warum«, wiederholte er knapp und trat aus dem Aufzug, »sollte es Avery anders als gut gehen?«
»Mein Versager von Vater hat sich draußen blicken lassen«, murmelte ich. »Ist schon okay.«
Grayson sah mich eindringlich an, wobei seine Augen sich in meine bohrten, dann wandte er sich an Oren. »Stellt er eine Bedrohung dar?«
Ich werde dich immer beschützen, hatte er geschworen. Aber das hier … wir … Es kann nie sein, Avery.
»Du musst mich nicht beschützen«, erwiderte ich scharf. »Was Ricky Grambs betrifft, bin ich Expertin im Selbstschutz.« Ich schritt an Grayson vorbei und betrat den Lift, aus dem er gerade gekommen war.
Der Trick beim Verlassenwerden bestand nämlich darin, sich nie nach jemandem zu sehnen, der fortgegangen ist.
Eine Minute später, als sich die Aufzugtüren zur Besitzerloge öffneten, trat ich hinaus – Alisa neben mir auf der einen Seite, Oren auf der anderen –, ohne mich noch mal nach Grayson umzudrehen. Da er den Aufzug nach unten genommen hatte, um mich in Empfang zu nehmen, war er offenbar bereits hier oben gewesen. Wahrscheinlich wollte er in Ruhe mit ein paar Leuten plaudern. Ohne mich.
»Avery. Du hast es geschafft.« Zara Hawthorne-Calligaris trug eine elegante Perlenkette um den Hals. Etwas in ihrem messerscharfen Lächeln verleitete mich zu dem Gedanken, dass sie mit dieser Perlenkette einen Mann erdrosseln könnte, falls ihr danach wäre. »Ich war mir ja nicht sicher, ob du dich heute Abend blicken lassen würdest.«
Und du warst bereit, in meiner Abwesenheit Hof zu halten, schloss ich stumm. Ich dachte daran, was Alisa vorhin gesagt hatte – über Verbündete, mächtige Player und den Einfluss, der sich mit einer Eintrittskarte in diese Loge erkaufen ließ. Wir würden ja sehen.
Oder wie Jameson sagen würde: Die Wette gilt.
KAPITEL 4
Die Besitzerloge bot einen perfekten Blick auf die 50-Yard-Linie in der Mitte, doch eine Stunde vor dem Anpfiff schaute keiner der Anwesenden aufs Spielfeld. Die Loge erstreckte sich weit nach hinten und wurde dabei breiter, und je weiter man sich von den Sitzplätzen entfernte, desto mehr sah es aus wie eine schnieke Bar oder ein Klubhaus. Heute Abend war ich die Hauptattraktion – eine exotische Spezies, eine Kuriosität, eine Anziehpuppe aus Papier, die man hergerichtet hatte. Eine gefühlte Ewigkeit schüttelte ich Hände, posierte für Fotografen und tat so, als würde ich Footballwitze kapieren. Ich schaffte es sogar, nicht mit offenem Mund zu gaffen, als man mir einen Popstar, einen ehemaligen Vizepräsidenten und einen IT-Giganten vorstellte, der wahrscheinlich während einer Pinkelpause so viel Geld verdiente wie andere Menschen in ihrem ganzen Leben.
Mein Hirn setzte fast komplett aus, als ich die Anrede »Ihre Hoheit« hörte und mir klar wurde, dass tatsächlich königlicher Adel zugegen war.
Alisa spürte offenbar, dass ich an meine Grenze kam. »Es ist gleich Zeit für den Anpfiff.« Sie legte sanft eine Hand auf meine Schulter – wahrscheinlich, um mich davon abzuhalten zu flüchten. »Ich bringe dich zu deinem Platz.«
Ich hielt bis zur Halbzeit durch, bevor ich mich schließlich doch verdrückte. Grayson fing mich ab. Wortlos neigte er den Kopf zur Seite und ging dann los, überzeugt, dass ich folgen würde.
Etwas widerstrebend tat ich genau das und fand mich vor einem zweiten Aufzug wieder.
»Der hier geht nach oben«, erklärte er mir. Mit Grayson überhaupt irgendwohin zu gehen, war wahrscheinlich ein Fehler, aber da die Alternative darin bestand, weiter mit irgendwelchen Promis Small Talk zu halten, beschloss ich, es darauf ankommen zu lassen.
Schweigend fuhren wir mit dem Lift aufwärts. Die Türen öffneten sich zu einem kleinen Raum mit fünf Sitzplätzen, allesamt leer. Der Blick auf das Spielfeld war noch besser als unten.
»Mein Großvater hielt es nur begrenzt aus, sich unter die Leute zu mischen, bevor er die Schnauze voll hatte und hier hochkam«, erklärte Grayson mir. »Meine Brüder und ich waren die Einzigen, die zu ihm durften.«
Ich setzte mich und ließ den Blick über das Stadion schweifen. Da waren so unglaublich viele Menschen in der Menge. Die Energie, das Gewimmel, die schieren Ausmaße waren überwältigend. Nur hier drin war es ruhig.
»Ich dachte, Jameson würde dich vielleicht zum Spiel begleiten.« Grayson machte keine Anstalten, sich zu setzen, so als würde er sich selbst nicht trauen, wenn er mir zu nahe käme. »Ihr beide verbringt seit Neuestem viel Zeit miteinander.«
Das ärgerte mich nun doch – aus Gründen, die ich selbst nicht benennen konnte. »Dein Bruder und ich haben eine Wette laufen.«
»Was für eine Wette?«
Ich hatte nicht die Absicht, zu antworten, aber als ich meinen Blick zu ihm wandern ließ, konnte ich nicht widerstehen, die eine Sache zu sagen, die ihm in jedem Fall eine Reaktion entlocken würde: »Toby lebt.«
Jemand anderem wäre Graysons Reaktion womöglich entgangen, aber ich sah das Zucken, das durch ihn hindurchging. Seine grauen Augen klebten nun förmlich an mir. »Verzeihung, wie bitte?«
»Dein Onkel ist am Leben und macht sich einen Spaß daraus, sich in New Castle, Connecticut als Obdachloser auszugeben.« Wahrscheinlich hätte ich etwas sensibler vorgehen können.
Grayson kam näher und bequemte sich nun doch auf den Platz neben mir. Seine Anspannung war deutlich sichtbar in seinen Armen, als er die Hände betont ruhig zwischen seinen Knien verschränkte. »Was bitte redest du da, Avery?«
Ich war es nicht gewohnt, dass er mich mit meinem Vornamen ansprach. Und es war zu spät zurückzunehmen, was ich gesagt hatte. »Ich habe ein Foto von Toby im Medaillon deiner Großmutter gesehen«, erklärte ich deshalb und schloss die Augen, als ich an den Moment zurückdachte. »Ich habe ihn darauf erkannt. Er hat mir gesagt, er würde Harry heißen. Wir haben über ein Jahr zusammen im Park Schach gespielt.« Ich öffnete meine Augen wieder. »Jameson und ich sind uns nicht sicher, was die Geschichte zu bedeuten hat … noch nicht. Wir haben eine Wette laufen, wer es als Erster herausfindet.«
»Wem hast du es erzählt?« Graysons Stimme war todernst.
»Das mit der Wette?«
»Das mit Toby.«
»Na ja, Nan war natürlich dabei, als ich das Foto gesehen habe. Ich wollte es Alisa erzählen, aber …«
»Tu’s nicht«, schnitt Grayson mir das Wort ab. »Kein Sterbenswörtchen zu niemandem. Verstehst du?«
»Langsam glaube ich, nein.« Ich sah ihn fragend an.
»Meine Mutter hat bisher keinerlei Grundlage, auf der sie das Testament anfechten könnte. Meine Tante ebenfalls nicht. Aber Toby?« Grayson war in der Überzeugung aufgewachsen, dass er das Vermächtnis seines Großvaters antreten würde. Von allen Brüdern hatte es ihn am meisten getroffen, enterbt worden zu sein. »Falls mein Onkel am Leben ist, ist er der einzige Mensch auf diesem Planeten, der das Testament des alten Herren für nichtig erklären lassen könnte.«
»Du sagst das, als wäre es was Schlimmes«, erwiderte ich. »Aus meiner Sicht, ja, klar. Aber aus deiner …«
»Meine Mutter darf es nicht herausfinden. Zara darf es nicht herausfinden.« Graysons Blick war eindringlich und vollständig auf mich gerichtet. »McNamara, Ortega & Jones dürfen es nicht herausfinden.«
In der Woche, die Jameson und ich diese Wendung der Geschichte diskutiert hatten, waren wir voll und ganz auf das Geheimnis dahinter fokussiert gewesen – jedoch nicht auf das, was passieren könnte, falls Tobias Hawthornes verlorener Stammhalter plötzlich lebend auftauchte.
»Bist du denn kein bisschen neugierig?«, wollte ich von Grayson wissen. »Was das zu bedeuten hat?«
»Ich weiß, was das zu bedeuten hat«, erwiderte Grayson knapp. »Ich erkläre dir gerade, was das zu bedeuten hat, Avery.«
»Wenn dein Onkel Interesse daran hätte, zu erben, meinst du nicht, er hätte sich inzwischen gemeldet?«, gab ich zu bedenken. »Außer es gibt einen Grund dafür, dass er sich versteckt hält.«
»Lass ihn sich doch verstecken. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie riskant …?« Grayson kam nicht dazu, seine Frage zu beenden.
»Was wäre das Leben ohne ein bisschen Risiko, Bruder?«
Ich drehte mich zum Aufzug um. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass er nach unten gefahren, geschweige denn wieder hochgekommen war, aber nun stand da Jameson. Er schlenderte an Grayson vorbei und ließ sich auf dem Platz zu meiner anderen Seite nieder. »Irgendwelche Fortschritte bei unserer Wette, Erbin?«
Ich schnaubte. »Das wüsstest du wohl gerne.«
Jameson grinste verschmitzt, dann öffnete er den Mund, um etwas anderes zu sagen, doch seine Worte gingen in einer Explosion unter. Mehr als einer. Gewehrschüsse. Blanke Panik schoss durch meine Adern, und schon lag ich auf dem Boden. Wo ist der Schütze? Das hier war wie im Black Wood. Genauso wie damals im Wald.
»Erbin.«
Ich konnte mich nicht rühren. Konnte nicht atmen. Und dann gesellte sich Jameson neben mich auf den Boden. Er brachte sein Gesicht auf die Höhe von meinem und umfasste meinen Kopf mit seinen Händen. »Ein Feuerwerk«, erklärte er mir. »Es ist nur ein Feuerwerk, Erbin. Zur Halbzeit.«
Mein Gehirn registrierte seine Worte, doch mein Körper hing immer noch in der Erinnerung fest. Jameson war dort im Black Wood bei mir gewesen. Er hatte seine Körper über meinen geworfen.
»Alles ist gut, Avery.« Grayson kniete sich neben Jameson hin, neben mich. »Wir werden nicht zulassen, dass dir etwas zustößt.« Für einen endlosen Moment war kein Geräusch im Raum zu hören bis auf unseren Atem. Graysons. Jamesons. Und meinen.
»Nur ein Feuerwerk«, erwiderte ich an Jameson gerichtet. Meine Brust war wie zugeschnürt.
Grayson erhob sich, doch Jameson blieb, wo er war. Er schaute mich an, sein Körper an meinem. Da war etwas beinahe Zärtliches in seinem Ausdruck. Ich schluckte – und da verzogen sich seine Lippen zu einem verschlagenen Grinsen.
»Nur für’s Protokoll, Erbin, ich habe herausragende Fortschritte bei unserer Wette gemacht.« Er ließ seinen Daumen an meinem Kiefer entlangstreifen.
Ich erschauderte, dann funkelte ich ihn wütend an und rappelte mich auf. Allein meiner geistigen Gesundheit wegen musste ich diese Wette gewinnen. Und zwar schnell.
KAPITEL 5
Montag hieß Schule. Privatschule, wohlgemerkt. Eine Privatschule mit scheinbar unerschöpflichen Ressourcen und »modularen Stundenplänen«, weswegen ich über den ganzen Tag verteilt Freistunden hatte. Ich nutzte die Zeit, um so viel über Tobias Hawthorne herauszufinden wie möglich.
Das Wesentlichste wusste ich bereits: Er war das jüngste von Tobias Hawthornes drei Kindern und, den meisten Aussagen zufolge, auch sein liebstes. Im Alter von neunzehn Jahren unternahmen Toby und ein paar Freunde einen Ausflug zu einer Privatinsel der Familie vor der Küste Oregons. Es kam zu einem tödlichen Brand samt einem verheerenden Sturm, und sein Leichnam wurde nie gefunden.
Die Tragödie war durch sämtliche Medien gegangen, und als ich die Artikel durchlas, erfuhr ich ein paar mehr Details darüber, was passiert war. Vier Personen waren auf die Hawthorne-Insel hinausgefahren. Keine hatte es lebend zurückgeschafft. Drei Leichen wurden geborgen. Toby ging mutmaßlich im Sturm verloren.
Über die anderen Opfer fand ich so viel heraus, wie möglich war. Zwei von ihnen waren mehr oder weniger Klone von Toby: Privatschulknaben, reiche Erben. Das dritte war ein Mädchen, Kaylie Rooney. Soweit ich das richtig verstand, stammte sie aus der Gegend, eine problembelastete Teenagerin aus einem kleinen Fischerort auf dem Festland. Mehrere Artikel erwähnten, dass sie vorbestraft war, doch da es sich um eine Minderjährige handelte, blieb die Akte unter Verschluss. Ich brauchte schon länger, um eine Quelle zu finden – wenn auch nicht unbedingt eine seriöse –, die behauptete, dass Kaylie Rooneys Vorstrafenregister Drogendelikte, Körperverletzung und Brandstiftung beinhaltete.
Sie hat das Feuer gelegt. Das war die Story, die in den Artikeln durchklang, ohne jedoch direkt mit der Sprache rauszurücken. Drei vielversprechende junge Männer, eine junge Frau aus schwierigen Verhältnissen. Eine Party, die außer Kontrolle gerät. Alles von den Flammen verschlungen. Kaylie war es, der die Presse die Schuld gab – manchmal zwischen den Zeilen, manchmal explizit. Die Jungs wurden über alle Maßen gelobt, gepriesen und als leuchtende Vorbilder ihrer Gemeinden hochgehalten. Colin Anders Wright. David Golding. Tobias Hawthorne II. So viel Brillanz, so viel Potenzial, viel zu früh von uns gegangen.
Aber Kaylie Rooney? Nichts als Ärger.
Mein Handy vibrierte und ich warf einen Blick aufs Display. Eine Nachricht von Jameson: Ich habe einen Hinweis.
Jameson war in der Abschlussklasse der Heights Country Day. Er befand sich irgendwo auf diesem prachtvollen Campus. Was für einen Hinweis?, dachte ich, wollte ihm aber nicht die Genugtuung einer Antwort geben. Schließlich zeigte mir mein Handy an, dass er gerade tippte.
Sag mir, was du weißt, dachte ich.
Dann kam die Nachricht endlich durch. Lust, den Einsatz zu erhöhen?
Der Speisesaal der Heights Country Day sah nicht aus wie eine gewöhnliche Schulcafeteria. Lange hölzerne Tische reihten sich über die gesamte Länge des Raums, altehrwürdige Porträts hingen an den Wänden. Die hohen Decken waren gewölbt und die Fenster bestanden aus Buntglasscheiben. Als ich mir mein Essen nahm, suchte ich reflexartig den Raum nach Jameson ab – und fand stattdessen einen anderen Hawthorne-Bruder.
Xander Hawthorne saß an einem der Esstische und betrachtete eingehend eine Apparatur, die er vor sich abgestellt hatte. Das Ding sah ein bisschen aus wie ein Zauberwürfel, nur länglicher und mit Kacheln, die sich in sämtliche Richtungen drehen und aufklappen ließen. Ich nahm an, dass es sich um eine von Xanders Originalanfertigungen handelte. Er hatte mir einmal gestanden, dass er derjenige von den vier Brüdern war, der sich am ehesten von komplexen Apparaturen – und leckeren Scones – ablenken ließ.
Wie ich ihn so an drei Kacheln gleichzeitig herumfummeln sah, kam mir ein Gedanke. Während seine Brüder früher ständig unterwegs gewesen waren, um eines der Rätselspiele seines Großvaters zu lösen, war Xander oft bei dem alten Herrn geblieben, um seine Scones mit ihm zu teilen. Haben sie sich dabei je über Toby unterhalten? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Ich durchquerte den Raum, um mich neben Xander zu setzen, doch er war so in seine Überlegungen versunken, dass er mich nicht mal bemerkte. Hin und her, vor und zurück drehte er die Kacheln.
»Xander?«
Blinzelnd sah er mich an. »Avery! Was für eine erfreuliche und im Grunde nicht ganz unerwartete Überraschung!« Seine Hand stahl sich auf die andere Seite der Apparatur, wo ein Notizbuch lag. Er klappte es zu.
Das bedeutete wohl, dass Xander Hawthorne etwas im Schilde führte. Andrerseits … ich auch. »Kann ich dich was fragen?«
»Kommt drauf an«, erwiderte Xander. »Hast du vor, diese Köstlichkeiten zu teilen?«
Ich sah auf das Croissant und den Cookie auf meinem Tablett und schob Letzteren in seine Richtung. »Was weißt du über deinen Onkel Toby?«
»Warum willst du das wissen?« Xander biss vom Cookie ab und runzelte die Stirn. »Sind da etwa getrocknete Cranberrys drin? Was für ein Monster mischt bitte Buttertoffee mit Cranberrys?«
»Ich bin nur neugierig«, erwiderte ich.
»Du weißt doch, was man über Neugierde sagt«, warnte Xander gut gelaunt und nahm einen weiteren Riesenhappen von dem Keks. »Neugierige Katzen verbrennen sich die … Bex!« Xander schluckte schnell seinen Bissen runter, wobei sein Gesicht erstrahlte.
Ich folgte seinem Blick zu Rebecca Laughlin, die mit einem Tablett in den Händen hinter mir stand und aussah wie immer: prinzessinnengleich, als wäre sie direkt aus einem Märchenbuch entwendet worden. Das Haar rubinrot. Die Augen unfassbar groß und strahlend.
Und alles andere als unschuldig.
Als könnte sie meine Gedanken lesen, wandte Rebecca rasch ihre Augen ab. Ich spürte förmlich, wie sie sich Mühe gab, nicht zu mir zu sehen. »Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen«, sagte sie zögernd an Xander gewandt, »mit der …«
»Der Sache!«, fiel Xander ihr ins Wort und beugte sich vor.
Ich kniff die Augen zusammen und drehte den Kopf wieder zu dem jüngsten Hawthorne – und dem Notizbuch, das er zusammengeklappt hatte, kaum dass er mich sah. »Was für eine Sache?«, fragte ich argwöhnisch.
»Ich sollte gehen«, murmelte Rebecca hinter mir.
»Du solltest dich hinsetzen und zuhören, wie ich mich über getrocknete Cranberrys beschwere«, berichtigte Xander sie.
Nach einem langen Moment setzte sich Rebecca, wobei sie einen Stuhl zwischen uns freiließ. Ihre klaren, grünen Augen schweiften zu mir. »Avery.« Sie senkte den Blick wieder. »Ich schulde dir eine Entschuldigung.«
Als Rebecca und ich uns das letzte Mal unterhalten hatten, hatte sie mir gebeichtet, Skye Hawthornes Beteiligung an dem Mordkomplott gegen mich verschwiegen zu haben.
»Ich bin nicht sicher, ob ich eine will«, sagte ich etwas schnippisch. Auf reiner Vernunftebene verstand ich durchaus, dass Rebecca ihr ganzes Leben im Schatten ihrer Schwester verbracht hatte, dass Emilys Tod sie kaputtgemacht hatte, dass sie, ihrer toten Schwester gegenüber, die kranke Verpflichtung verspürt hatte, nichts über Skyes perfide Pläne zu sagen. Aber auf einer tieferen Ebene: hätte ich verdammt noch mal sterben können.
»Du hegst jetzt aber nicht immer noch diesen kleinlichen Groll, oder?«, fragte auf einmal Thea Calligaris, die sich auf dem von Rebecca freigelassenen Stuhl niederließ.
»Kleinlicher Groll?«, wiederholte ich scharf. Bei unserer letzten Begegnung hatte Thea mir gestanden, mich hereingelegt zu haben, sodass ich meinen ersten Auftritt in der texanischen High Society in der Verkleidung eines toten Mädchens absolviert hatte. »Du ziehst deine Psychospielchen ab. Und wegen Rebecca wäre ich beinahe abgeknallt worden!«
»Tja, was soll ich sagen?« Theas Fingerspitzen streiften leicht die von Rebecca. »Wir sind eben komplizierte Mädchen.«
Da lag eine unterschwellige Botschaft in diesen Worten, in der Berührung ihrer Haut. Rebecca schaute zu Thea, schaute auf ihre Hände – dann zog sie die Finger ein und legte ihre Hand in den Schoß.
Thea ließ ihren Blick drei lange Sekunden auf Rebecca verweilen, dann wandte sie sich wieder mir zu. »Außerdem«, sagte sie kokett, »dachte ich, das hier soll ein privates Mittagessen werden.«
Privat. Nur Rebecca, Thea und Xander. Die drei also, die, soweit ich wusste, kaum ein Wort miteinander sprachen – aus komplizierten Gründen, zu denen, wie Xander gerne sagte, eine schicksalhafte Liebe, falsche Verehrer und Tragik gehörten.
»Entgeht mir hier gerade was?«, fragte ich Xander. Das Notizbuch. Sein Ausweichen auf meine Frage nach Toby. Die »Sache«, mit der Rebecca ihm helfen wollte. Und nun auch noch Thea.
Xander rettete sich vor einer Antwort, indem er sich den Rest vom Cookie in den Mund stopfte.
»Also?«, drängte ich, während er kaute.
»Freitag ist Emilys Geburtstag«, sagte Rebecca plötzlich. Ihre Stimme war ruhig, aber ihre Worte hatten soeben allen Sauerstoff aus dem Raum gesogen.
»Es gibt eine Spendengala zu ihrem Andenken«, fügte Thea hinzu und bedachte mich mit einem stechenden Blick. »Xander, Rebecca und ich haben dieses private Mittagessen anberaumt, um Pläne zu schmieden.«
Ich war mir nicht sicher, ob ich ihr glaubte, aber so oder so war es mein Stichwort, zu gehen.
KAPITEL 6
Mein Versuch, mit Xander zu reden, war ein Reinfall gewesen. Was den Brand auf der Insel betraf, hatte ich alles gelesen, was es dazu gab. Was nun?, überlegte ich, während ich über den langen Korridor zu meinem Spind ging. Mit jemandem reden, der Toby kannte? Skye war aus offensichtlichen Gründen raus. Zara traute ich ebenfalls nicht. Wer blieb da noch übrig? Nash vielleicht? Er muss bei Tobys Verschwinden etwa fünf gewesen sein. Nan, Tobys Großmutter? Vielleicht die Laughlins. Rebeccas Großeltern führten das Anwesen immerhin seit etlichen Jahrzehnten. Mit wem redet Jameson wohl gerade? Was ist sein Hinweis?
Frustriert zog ich mein Handy hervor und schickte eine SMS an Max. Ich erwartete nicht wirklich eine Antwort, weil meine beste Freundin unter Handy-Hausarrest stand, seit mein unverhoffter Geldsegen – und die damit einhergehende Aufmerksamkeit der Presse – ihr Leben ruiniert hatten. Aber selbst mit meinem schlechten Gewissen darüber, was meine plötzliche Berühmtheit Max angetan hatte, fühlte ich mich, nachdem ich ihr geschrieben hatte, gleich ein bisschen weniger einsam. Ich versuchte, mir vorzustellen, was meine Freundin wohl sagen würde, wenn sie hier wäre, aber alles, was dabei rauskam, war ein Schwall Pseudo-Schimpfwörter – weil ihre strengen Eltern kein Fluchen duldeten – und der strikte Befehl, mich ja nicht umbringen zu lassen.
»Hast du die Nachrichten gesehen?«, hörte ich ein Mädchen ein Stück weiter weg mit gedämpfter Stimme fragen, als ich vor meinem Schließfach stehen blieb. »Das mit ihrem Vater?«
Mit knirschenden Zähnen blendete ich das Getratsche aus. Ich schloss meinen Spind auf … und da blickte mir ein Foto von Ricky Grambs entgegen. Es musste aus einem Zeitungsartikel herausgeschnitten worden sein, denn darüber prangte eine fette Schlagzeile: Ich möchte doch nur mit meiner Tochter reden.
Wut köchelte in meiner Magengrube hoch – Wut darüber, dass mein abwesender Versager-Vater es überhaupt gewagt hatte, mit der Presse zu sprechen, Wut, dass jemand den Artikel an die Rückwand meines Schließfachs geklebt hatte. Ich schaute mich um, ob der Täter sich zu erkennen geben würde. Die Spinde in der Heights Country Day waren aus Holz und hatten keine Schlösser. Es war eine subtile Art und Weise zu sagen: Leute wie wir stehlen nicht. Was für Sicherheitsvorkehrungen bedurfte es schon innerhalb der Elite?
Schwachkinn!, wie Max sich ausdrücken würde. Jeder hätte sich Zugang zu meinem Schließfach verschaffen können, doch niemand im Flur beobachtete gerade meine Reaktion. Ich drehte mich wieder meinem Spind zu, um das Bild runterzureißen, und da bemerkte ich, dass, wer auch immer es aufgehängt hatte, auch den Boden meines Schließfachs mit blutroten Papierfetzen gepflastert hatte.
Keine Fetzen, wurde mir klar, als ich einen aufhob. Kommentare. Die letzten drei Wochen hatte ich mich brav vom Internet ferngehalten, um nicht mitzubekommen, was online über mich verzapft wurde. Für die einen wirst du Aschenputtel sein, hatte Oren mir gesagt, als ich geerbt hatte. Für die anderen Marie-Antoinette.
Der Kommentar in meiner Hand, ganz in Großbuchstaben, lautete: JEMAND MUSS DIESER ARROGANTEN SCHLAMPE MAL EINE LEKTION ERTEILEN. Ich hätte da aufhören sollen, tat es aber nicht. Meine Hand zitterte leicht, als ich nach dem nächsten Kommentar griff. Wann wird diese NUTTE endlich sterben? Es gab Dutzende davon, manche sehr bildlich und grausam.
Jemand hatte nur ein bearbeitetes Foto gepostet: mein Gesicht mit einer Zielscheibe darüber, als wäre ich in das Visier eines Gewehrs geraten.
»Das war mit ziemlicher Sicherheit nur ein gelangweilter Teenager, der die Grenzen ausloten wollte«, beruhigte mich Oren, als wir am Nachmittag auf Hawthorne House eintrafen.
»Aber die Kommentare …« Ich schluckte, da sich einige der Drohungen in mein Gehirn gebrannt hatten. »Die sind doch echt?«
»Aber nichts, weswegen du dir Sorgen machen müsstest«, versicherte mir Oren. »Mein Team führt Buch über diese Vorkommnisse. Sämtliche Drohungen werden dokumentiert und ausgewertet. Von den hundert schlimmsten Übeltätern sind da nur zwei, drei, die es wert sind, weiter verfolgt zu werden.«
Ich gab mir Mühe, mich nicht an den Zahlen aufzuhängen. »Was meinen Sie mit verfolgen?«
»Wenn ich mich nicht irre«, sagte eine kühle, gleichmütige Stimme, »meint er damit die Liste.«
Ich schaute auf und sah Grayson ein paar Meter entfernt in einem dunklen Anzug dastehen. Seine Miene war unmöglich zu entziffern, bis auf die leichte Anspannung in seinem Kiefer.
»Was für eine Liste?«, fragte ich, wobei ich mir Mühe gab, nicht allzu sehr auf seinen Kiefer zu achten.
»Wollen Sie sie ihr zeigen?«, fragte Grayson ruhig an Oren gewandt. »Oder soll ich?«
Ich hatte schon gehört, dass Hawthorne House sicherer sei als das Weiße Haus. Ich hatte Orens Männer gesehen. Ich wusste, dass niemand ohne gründlichen Hintergrund-Check auf das Anwesen kam und dass es über ein weitläufiges Überwachungssystem verfügte. Aber es bestand ein Unterschied dazwischen, es rein theoretisch zu wissen und es tatsächlich zu sehen. Der Überwachungsraum war mit Monitoren gesäumt. Die meisten Security-Kameras waren auf die nähere Umgebung und die Tore gerichtet, aber es gab auch eine Handvoll Bildschirme, auf welchen die Flure von Hawthorne House aufflackerten, einer nach dem anderen.
»Eli«, sagte Oren, und einer der Wachmänner, der die Aufnahmen im Blick behielt, stand auf. Er sah aus wie Anfang zwanzig, das Haar kurz geschoren wie ein Soldat, dazu mehrere Narben und strahlend blaue Augen mit einem bernsteinfarbenen Ring um die Pupillen. »Avery«, verkündete Oren, »darf ich vorstellen, das ist Eli. Er wird ab sofort an der Schule ein Auge auf dich haben – zumindest bis die Prüfung des Spind-Vorfalls vollständig abgeschlossen ist. Er ist das jüngste Mitglied unseres Teams, also wird er sich besser einfügen als der Rest von uns.«
Eli sah aus wie vom Militär. Er sah aus wie ein Bodyguard. Und er sah definitiv nicht aus, als würde er sich an meiner Privatschule einfügen. »Ich dachte, Sie machen sich keine Sorgen wegen des Spinds«, sagte ich zu Oren.
Mein Sicherheitschef begegnete meinem Blick. »Tu ich nicht.« Aber er ging auch keine Risiken ein.
»Was genau«, meldete sich Grayson und trat hinter mir vor, »ist an deinem Spind passiert?«
Ich verspürte den kurzen, ärgerlichen Impuls, es ihm zu sagen, mich von ihm beschützen zu lassen, so wie er es geschworen hatte. Aber nicht alles ging Grayson Hawthorne etwas an. »Wo ist jetzt diese Liste?«, fragte ich anstelle einer Antwort, wandte mich von ihm ab und lenkte das Gespräch auf den eigentlichen Grund, warum ich hier war.
Oren gab Eli ein knappes Nicken, und der jüngere Mann reichte mir tatsächlich ein simples Blatt Papier mit einer Liste. Allesamt Namen. Der oberste war RICKY GRAMBS. Ich verzog das Gesicht, schaffte es jedoch, den Rest der Liste ruhig durchzugehen. Es waren insgesamt etwa dreißig Namen. »Wer sind diese Menschen?«, fragte ich, wobei sich meine Kehle um die Worte schloss.
»Möchtegern-Stalker«, erwiderte Oren. »Leute, die versucht haben, auf das Anwesen einzudringen. Übereifrige Fans.« Er kniff die Augen zusammen. »Skye Hawthorne.«
Das bedeutete wohl, dass mein Sicherheitschef wusste, warum Skye Hawthorne überstürzt ausgezogen war. Ich hatte Grayson Geheimhaltung versprochen, aber das hier war Hawthorne House. Die meisten Bewohner waren viel zu clever, als gut für sie war – oder für irgendwen sonst.
»Könnte ich einen Moment allein mit Avery haben?« Grayson ließ es höflicherweise wie eine Frage klingen. Unbeeindruckt schaute Oren zu mir und hob eine Augenbraue. Ich war durchaus versucht, meinen Bodyguard aus reinem Trotz dazubehalten, doch stattdessen nickte ich ihm zu, und er und seine Männer verließen schweigend den Raum. Ich erwartete schon, dass Grayson mich einem Kreuzverhör unterziehen würde – darüber, was ich Oren über Skye erzählt hatte –, aber als wir schließlich allein waren, blieb es aus.
»Bist du okay?«, fragte Grayson stattdessen. »Ich kann absolut verstehen, dass das viel auf einmal ist.«
»Mir geht’s gut«, behauptete ich, doch diesmal brachte ich nicht die Kraft auf, ihm zu sagen, dass ich seinen Schutz nicht brauchte. Rein theoretisch war mir schon klar gewesen, dass ich den Rest meines Lebens Security benötigen würde, aber die Bedrohungen so auf dem Papier gelistet zu sehen, fühlte sich anders an.
»Mein Großvater hatte ebenfalls eine Liste«, sagte Grayson leise. »Das geht eben damit einher.«
Mit dem Berühmtsein? Mit dem Reichsein?
»Bezüglich der Sache, die wir gestern Abend besprochen haben«, fuhr Grayson leiser fort, »verstehst du jetzt, warum du sie ruhen lassen musst?« Er sprach Tobys Namen nicht aus. »Die meisten dieser Leute auf der Liste würden das Interesse an dir verlieren, wenn du das Vermögen verlierst. Die meisten.«
Aber nicht alle. Einen Moment verweilten meine Augen auf Graysons Gesicht. Sollte ich das Vermögen verlieren, würde ich mein Security-Team verlieren. Das wollte er mir damit begreiflich machen.
»Ich verstehe«, erwiderte ich, wobei ich den Blick von Grayson losriss, denn ich verstand auch Folgendes: Ich war eine Überlebenskünstlerin. Ich passte auf mich selbst auf. Und ich würde mir nicht erlauben, irgendwas von ihm zu wollen oder zu erwarten.
Ich drehte mich zu den Monitoren um. Eine hastige Bewegung auf einer der Aufnahmen fiel mir ins Auge. Jameson. Ich versuchte, nicht allzu auffällig hinzustarren, als ich ihn entschlossen durch einen der Flure schreiten sah, den ich nicht verorten konnte. Was führst du im Schilde, Jameson Hawthorne?
Graysons Aufmerksamkeit galt immer noch mir, nicht den Monitoren. »Avery?« Er klang beinahe zögernd. Ich hatte ja keine Ahnung gehabt, dass Grayson Davenport Hawthorne – ehemaliger Erbe in spe – überhaupt dazu in der Lage war, zu zögern.
»Mir geht’s gut«, versicherte ich noch einmal, wobei ich ein Auge auf den Bildschirm gerichtet hielt. Einen Moment später schaltete die Aufnahme zu einem anderen Flur, und ich sah Xander, der mit ebensolcher Entschlossenheit voranschritt wie Jameson. Er trug etwas in seinen Händen.
Ein Vorschlaghammer? Wozu bitte braucht er …?
Die Frage in meinem Kopf verstummte abrupt, als ich Xanders Umgebung erkannte – plötzlich wusste ich ganz genau, wohin er ging. Und ich hätte meinen letzten Dollar verwettet, dass Jameson sich ebenfalls auf dem Weg dorthin befand.