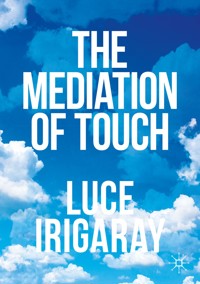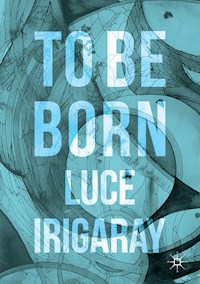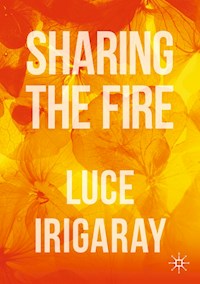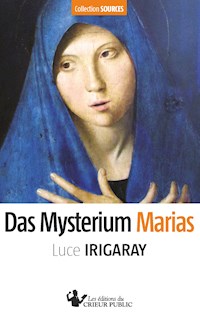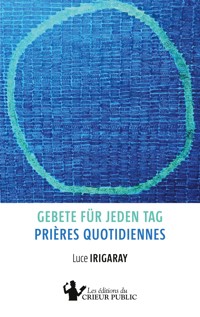
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Les Éditions du Crieur Public
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In Gebete für jeden Tag - Prières quotidiennes widmet sich Irigaray der spirituellen Dimension der menschlichen Existenz, indem sie die Beziehung zwischen dem Selbst, dem Anderen sowie der Natur hinterfragt. Diese Sammlung von Gebeten und Reflexionen zeichnet sich durch einen sensiblen und introspektiven Ansatz aus, in dem sie Themen wie Achtsamkeit, Verbundenheit und das Heilige im Alltag erforscht. Sie verbindet ihre feministische Perspektive mit spirituellen Überlegungen und betont die Bedeutung von Empathie, Fürsorge und gegenseitigem Respekt. Dieses Buch präsentiert sich als philosophischer und spiritueller Leitfaden, der einen universellen Ansatz für Respekt und Verbindung zum Anderen propagiert und zu einer inneren Reflexion einlädt, die ein bewussteres und aufmerksameres Leben fördert. Dans Gebete für jeden Tag - Prières quotidiennes, Irigaray se penche sur la dimension spirituelle de l'existence humaine, en interrogeant la relation entre soi, l'autre et la nature. Ce recueil de prières et de réflexions se distingue par une approche sensible et introspective, où elle explore des thématiques telles que l'attention, la connexion et le sacré dans la vie quotidienne. Elle associe sa perspective féministe à des considérations spirituelles, soulignant l'importance de l'empathie, du soin et du respect mutuel. Ce livre se présente comme un guide philosophique et spirituel, prônant une approche universelle du respect et de la connexion à l'autre, et invite à une réflexion intérieure, encourageant une manière de vivre plus consciente et attentive.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
TABLE DES MATIÈRES
GEBETE FÜR JEDEN TAG
Vorwort
PRIÈRES QUOTIDIENNES
Préface
DIE GEBETE IN DEUTSCHER UND FRANZÖSISCHER SPRACHE / LES PRIÈRES EN ALLEMAND ET EN FRANÇAIS
GEBETE FÜR JEDEN TAG
LUCE IRIGARAY
VORWORT
Die Anfänge – die realen Grundlagen? – einer Kultur sind poetisch, zumindest künstlerisch. Das trifft auch auf den Westen zu. Ob wir uns wirklich in der Morgendämmerung einer neuen Kultur befinden oder einer wichtigen Übergangsepoche beiwohnen, die Kunst spielt eine Rolle, damit der Übergang gelingt. Für Hegel ist in diesem Fall der Krieg nützlich. Ich ziehe es vor, auf die Kunst zurückzugreifen, ein Prolog für andere Anfänge, nach der Interpretation von Mythen der Vergangenheit.
Wenn die Kunst anzuwenden ist, um der historischen Ebene neue Horizonte zu eröffnen, kann sie dies auch auf der persönlichen Ebene. Indem ich gewisse Gedichte schreibe, skizziere ich ein Gerüst, entdecke Wörter, die eine neue Etappe meines Denkens einleiten. Außer der täglichen Beobachtung individueller und kollektiver Realität wende ich zwei Methoden an: das poetische Schreiben und die logische Analyse des Diskurses. Dienlich ist mir auch die Lektüre von philosophischen, literarischen, wissenschaftlichen Texten, die verschiedenen Traditionen angehören. Eine andere Vermittlung – wenn ich sie so nennen kann – ist der Aufenthalt in der Natur, die den Körper und den Geist re-virginisiert und neue Perspektiven bietet für das, was gedacht worden und was zu denken ist.
Der Reiz des poetischen Schreibens besteht meines Erachtens darin, Materie und Form nicht zu trennen. Körper und Geist? In Begriffen indischer Philosophie würde man sagen, prakrti nicht von purusha zu trennen. Die Form vermählt sich dann eher mit der Materie statt sie zu beherrschen. Sie wertet sie auf, kultiviert sie durch Rhythmen, durch Skandierungen, den Rückgriff auf Farben, auf Töne und durch ein anderes Wachrufen sinnlicher Wahrnehmungen, statt sie in Konzepten zu dominieren. Die Kommentare Hölderlins zu Sophokles‘ Antigone enthalten einige Beispiele dieser Behandlung sinnlicher Materie.
Das poetische Schreiben, das ich praktiziere, versucht ein phuein zu bewahren und zu begünstigen, ein Werden, das sich nicht vom natürlichen Ursprung trennt. Die Form gibt nicht vor, die Materie zu dominieren, sondern sie stellt sich in den Dienst ihrer Entfaltung, ihres Wachsens. Purusha beherrscht nicht prakrti: Sie vermählen sich und befruchten sich gegenseitig. Der Körper wird Geist, und der Geist Körper, oder vielmehr werden sie beide zu Fleisch, der eine durch den anderen. Statt auf eine kulturelle Vermittlung zurückzugreifen oder auf ein Schreiben, das von Formalismus dominiert wird, bemühe ich mich, das Sagen immer offen zu lassen: einem multiplen Aufkeimen und einem multiplen Hören hingegeben. Vielfältig, aber gebunden an eine reale, fleischliche Erzeugung.
Der Gebrauch der Wörter, des Schweigens, der Rhythmen ist bestrebt, die Natur eher zu offenbaren als sie zu beherrschen. Das trifft für den Makrokosmos und für den Mikrokosmos zu, für das Universum und für den (die) K(örper. Die Natur sein zu lassen, sie gewissermaßen sich sagen zu lassen und sie damit ihrem utilitären Schicksal oder Status zu entziehen, entspricht gewiss einer – mehr oder weniger bewussten – Intention der Texte. In diesem Sinn wischt derjenige, der schreibt, eine westlich erlernte Subjektivität aus, um sich wieder in weniger logisch-formalen Ebenen des Sprechens zu verwurzeln oder daran wieder anzuknüpfen. Dieses Sprechen gibt nicht mehr vor zu nehmen, sondern zu geben, zu übermitteln, das zurückzugeben, was ihn die Wahrnehmung von der natürlichen Welt gelehrt hat.
Weit davon entfernt arrogant, gelehrt zu sein, sind die Worte ein Vehikel, das sich bemüht, auf beste Weise das zu transportieren, was sie empfangen haben. Sie werden zu einem Medium, das disponibel sein will für all das, was zu sagen ist: Farben, Töne, Gerüche, Geschmack … All diese Qualitäten finden ihre Quelle und ihre Ähnlichkeit im Berühren, ein Berühren, das sich auszudrücken versucht, um sich und den anderen zu feiern, zu bewahren und für das zu wecken, was im Gelebten vergessen ist.
Die Erinnerung, die sich somit herausbildet, ist nicht nur eine persönliche Erinnerung. Wenn sie manchmal als roter Faden für das eigene Werden dient, ist sie auch Manifestation der Beziehungen des menschlichen Bewusstseins zur natürlichen Welt, Vermächtnis gegenüber den Lesenden für die Gegenwart und die Zukunft.
Sie ist gleichfalls Offenlegung einer weiblichen Wahrnehmungs- und Denkweise. Als ich anlässlich dieses Gedichtbandes wieder die Werke von männlichen Dichtern las, denen ich mich nahe glaubte, wurde ich durch das frappiert, was uns trennte. So erschien mir Rilke, der zugegebenermaßen meine Jugend begleitete, von dem einige Sätze Teil meines wertvollsten kulturellen Erbes sind, weit entfernt. Die Duineser Elegien wieder öffnend, dachte ich zunächst, mich einer Welt zu nähern, die der meinigen ähnlich ist. Aber wenn auch gewisse Themen die gleichen sind – zum Beispiel die des Engels oder der Blume – hat das Erscheinen im Text nicht die gleiche Bedeutung, die gleichen Konnotationen. „Meine“ Engel sind Diener des Lebens, der Liebe: zärtlich, fast fleischlich. Die Engel Rilkes sind schrecklich, erschreckend in der Begegnung, die er mit ihnen unterhält oder es ihm nicht gelingt, sie aufrechtzuerhalten. Rilke würde kaum einen Engel imaginieren, der von einem Liebenden zum anderen fliegt, um ihnen in ihrer Einsamkeit und ihrer beider Annäherung beizustehen. Rilkes Engel scheint ein furchterregender Bote eines weit entfernten, gegenüber dem Pathetischen der Inkarnation fremden Gott- Vaters, im Gegensatz zu dem, was ich diesen spirituellen Geschöpfen zuschreibe.
Allgemeiner gesagt, das Gedicht, das ich schreibe, zelebriert das Leben, versucht ihm beizustehen, während ich in den Texten männlicher Autoren vor allem den Tod, den Schmerz, die Trauer gefunden habe. Wo ich eine liebevollere und glücklichere Liebe lobpreise und vorzubereiten versuche, beweint der Dichter oft eine unglückliche Vergangenheit, deren Niederlage und Schmerz er ausarbeitet, indem er auf die Form rekurriert wie auf das, was das unbefriedigte Begehren heilt oder womöglich zerstört. Demgegenüber versuche ich, diese formale Komposition auf ein Minimum zu reduzieren, damit die Armut oder die Einfachheit der Wörter zum andern, diesseits oder jenseits unserer Unterschiede sprechen kann. Ein gewisser Rhythmus oder ein Vibrieren bleibt, das durch die Luft ruft. So tun es die Vögel mittels der Erde, so wird gesagt.
Das, was gesagt wird, ist Lobpreisung von ihr – der Natur – oder von ihm – dem Geliebten – statt Klagelied. Eine Hommage an das Leben statt Grabinschrift für den Tod. Hoffnung auf eine Zukunft, für die die Gegenwart ihre Erfahrung öffnet, und keine Krönung des Heute, um das Vergangene zu beweinen. „Wir verlangen vom Nichtvorhersagbaren, das Erwartete zu enttäuschen“, schreibt René Char. Ich verlange vielmehr von der Natur oder vom anderen, den Horizont der Erwartung weiter zu öffnen, das zu offenbaren, was wir nicht imaginieren. Nicht durch außergewöhnliche Ereignisse, sondern durch die noch zu kommende Enthüllung des unscheinbarsten Alltäglichen: in uns und außerhalb von uns.
In diesem Sinn fühle ich mich zuweilen der Armut Hölderlins nahe, der im „Blau des Himmels“ das wunderbarste Geschenk der Erde sah. Zweifellos befasst sich Hölderlin mehr mit dem Außen als mit dem Innen oder markiert mehr die Schwelle zwischen dem, wovon er spricht, und ihm selbst. Er lebt weniger in der Kontinuität zwischen Natur und sich, dem Dialog mit ihr, selbst wenn er einer der Dichter ist, der sich am weitesten in dieser Vertrautheit mit dem Einfachsten fortbewegt hat. Die Natur ist ihm eine Wohnstätte und eine Begleitung, aber als der Mann, der er ist, bleibt er mehr vor ihr, in ihr als mit ihr: in Vereinigung und im Austausch mit ihr. Sein Metabolismus zwischen Mikro-und Makrokosmos ist anders. Nostalgischer, weil ihm eine konstante Syntonie mit ihr fremd ist? Die Landschaft, die Frau beschreibend, um sie zu betrachten, dahin zurückzukehren, aber ausgehend von einer Rückkehr in sich. Gewissermaßen von weitem genießen, ohne in die Nähe einzutauchen? Für die er keinen Maßstab erbringen könnte, selbst wenn er weiß, wie sehr er notwendig ist. Mangelnd an Schemata, um darin die Vertrautheit einzuschreiben, indem sie gleichzeitig als solche bewahrt würde? Oder sich darauf beschränkend, das Vertraute in ihr – Natur oder Frau – zu leben, ohne es mit ihr zu leben? Allein in einem Universum von Erinnerungen und von Nostalgie, wo Schreiben einer Zukunft des Zusammenlebens gedenkt, aber sie nicht konstruiert.
Die Gewissheit, dass wir different sind, enthüllt einen Horizont oder entdeckt eine Quelle für das Sagen. Die Worte schneiden nicht das Reale, um es auszudrücken, es entströmt einer Spalte und in einer bereits existierenden Spalte: das, was uns trennt. Wir sind keine Kinder [enfants] einer gleichen Sprache, die uns eines Tages eine menschliche Wohnstätte gebaut hat, wir sind Infanten einer Differenz zwischen uns, die wir noch nicht begonnen haben, uns zu sagen: das einzig wirklich notwendige Sprechen. Es bändigt nicht in den Worten eine wilde Natur, die uns vorausgegangen ist, um uns die Welt bewohnbar zu machen, es sagt jeden und uns gegenseitig, wer wir sind. Zwischen uns die un-endliche Tiefe unserer Differenz niemals offenbarend, in deren Namen es zu sprechen ist, um zu sein. Und um zu werden, wer wir sind oder noch nicht sind: in uns, zwischen uns. Ein solches Sagen ist noch nirgendwo eingeschrieben, in irgendeinem Buch verschriftlicht. Es ist an uns, es zu formulieren, zu kreieren, zu übermitteln. Die Kreation ist hier kein Werk der Fiktion, sondern Offenbarung des Realsten der Realität, ein Reales, das wir noch nicht kennen, weil sich unsere Kultur mit anderem als mit unserem Sein und der Beziehung zwischen uns beschäftigt hat.
Es handelt sich also darum, ausgehend von den Anfängen den Weg wiederaufzunehmen: andere Wahrnehmungen, andere Gesten, andere Worte zu finden, um die Beziehung zur Natur, zu uns selbst, zum anderen auszudrücken. Indem das vergessen oder vielmehr aufgegeben wird, was beansprucht, derartige Beziehungen gründen zu wollen, ist es nun angebracht, zu hören und einander zuzuhören, um sich gegenüber der Welt, sich, dem anderen auf andere Weise zu situieren. Das setzt voraus, sich von Repräsentationen und Gewohnheiten zu lösen, nicht um sich alltäglich dem Abgrund auszusetzen, sondern um zu entdecken, welche mangelnden Bindungen er ersetzte.
Gewiss, die so geknüpften Beziehungen werden weniger rigide und weniger endgültig sein als die Beziehungen, die aufgegeben wurden: Sie werden entsprechend des Ortes und der Zeit, in denen sie sich durchsetzen, verbunden sein, weniger um für immer, unabhängig vom Kontext, eine Erfahrung zu fixieren, die dann an einer abstrakten Ordnung teilnimmt, als vielmehr, dem Ereignis zu erlauben, zwischen Augenblick und Ewigkeit zu existieren, um es in seiner einzigartigen Manifestation bestehen zu lassen. Das Gedicht zelebriert dieses einzelne Ereignis, macht aus den Worten nicht etwas, das ein für alle Mal benannt wird, sondern etwas, das zuweilen besser als ein anderes künstlerisches Medium die verschiedenen Dimensionen des Stattfindens vereinigt. Das Gedicht komponiert sie, indem es ihnen ihre Existenz und ihre eigenen Bewegungen zurückgibt. Fern davon zu erstarren sind die Worte bestrebt, dem Existierenden das Werden zurückzugeben, dessen Entfaltung zu respektieren.
So werden die Wolken wolken, der Wind wird winden, der Sommer wird sommern usw. Jedes Element des Realen wird das entfalten, was es konstituiert, bis dahin zu erscheinen, was es ist.
Manche werden zu Recht an das Gespräch Heideggers mit einem Japaner denken. Die fernöstliche Kultur ist in meinen Texten mehr und mehr präsent. Ich praktiziere seit mehr als zwanzig Jahren Yoga und das, was mich eine solche Praxis, begleitet von der Lektüre von Werken dieser Tradition, als Möglichkeit hat entdecken lassen, ist entscheidend. Das alltägliche Schreiben eines Gedichts ist wahrscheinlich durch die östliche Kultur inspiriert, ebenso sehr was den prägnanten Charakter des Textes als auch seine Bestimmung betrifft: zwischen Meditation, Gebet, Kontemplation, Hommage an eine örtliche „Gottheit“. Keinerlei endgültige Grabinschrift für die Ereignisse der Vergangenheit, sondern eine bescheidene und leichte Zelebrierung der Gegenwart, sowohl sich als auch den anderen einladend, hier anzuhalten, wahrzunehmen und vielleicht im so entdeckten Realen Zwiesprache zu halten, und sei es nur für einen Moment.
Die Intention besteht niemals darin, ein für alle Mal als Wahrheit das aufzuzeigen, was sich heute gezeigt hat, sondern diesen oder jenen Aspekt des Realen zu besingen, der sich mir heute offenbart hat.
Das gilt für die Welt, das gilt auch für uns als Welten – keine Welt wird als äußerlich gegenüber dem anderen, als Objekt für den anderen definiert. Jeder wird in seinem eigenen Leben wahrgenommen, wird in seiner Autonomie und in seiner Interaktion mit meiner Existenz begrüßt.