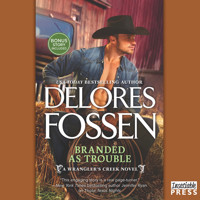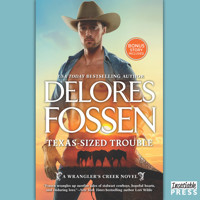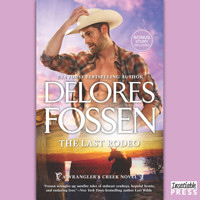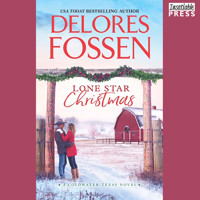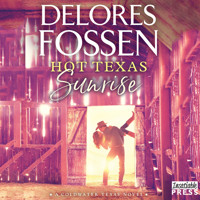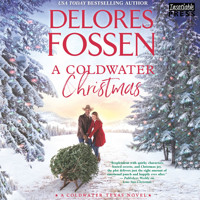2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Digital Edition
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Leigh ist verzweifelt. Sie hat ihr Gedächtnis verloren und kann sich noch nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern - geschweige denn an den sexy Fremden, der behauptet, ihr Ehemann zu sein. Gabe Sanchez hat sie aus dem Lake Pontchartrain gerettet, nachdem jemand versucht hatte, sie umzubringen. Aber kann sie ihm allein deshalb vertrauen? Und ist er wirklich FBI-Agent? Sicher weiß sie nur, dass er eine überaus starke erotische Anziehungskraft auf sie ausübt - weshalb sie ihm besser aus dem Weg gehen sollte. Doch als ihr erneut ein Killer auf den Fersen ist, muss sie gemeinsam mit Gabe fliehen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Ähnliche
IMPRESSUM
Gefährliche Erinnerung erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© 2002 by Delores Fossen Originaltitel: „A Man Worth Remembering“ erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd., Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe JULIA LOVE & CRIMEBand 21 - 2005 by CORA Verlag GmbH, Hamburg Übersetzung: Michael Große
Umschlagsmotive: OSTILL, Olesya22 / Getty Images
Veröffentlicht im ePub Format in 11/2017 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733753986
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, ROMANA, HISTORICAL, MYSTERY, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Man wollte sie töten.
Sie war im Wasser aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht. Kaltes, tiefes, dunkles Wasser. Es war über ihr, neben ihr, um sie herum. Erstickte sie.
Entsetzen durchzuckte sie. Hektisch versuchte sie zu schwimmen. Unmöglich. Hände und Füße waren gefesselt. Wasser drang ihr in Mund und Nase. Ihre Kehle schnürte sich zusammen. Schmerzte heftig. Ihr Herz hämmerte, als würde es gleich zerspringen.
Jemand hatte sie hierher gebracht. Aber wer? Sie konnte sich nur noch undeutlich an eine Brücke über Wasser erinnern. Kein Gesicht. Kein Name. Nur jemand, der offensichtlich ihren Tod wollte.
Zentimeter um Zentimeter sank sie tiefer. Sie kämpfte gegen das Verlangen an, aufzugeben, die Augen zu schließen, das Leben loszulassen, damit der Schrecken ein Ende hatte. Nein. Sie würde nicht aufgeben. Konnte nicht. Gott, sie wollte nicht sterben.
Sie wand sich, benutzte den letzten Rest Atemluft bei dem Versuch, nicht noch tiefer zu sinken. Erfolglos. Bald berührten ihre Füße den schlammigen Grund.
Sie sah den Mann nicht, bevor er den Arm um sie schlang, aber sie fühlte seinen festen Griff. Hoffnung. Hoffnung keimte in ihr auf, klammerte sich an diesen Mann.
Er verhinderte, dass der Schlamm sie verschluckte, und zog sie Richtung Wasseroberfläche. Sie versuchte, ihn zu unterstützen, aber Füße und Hände waren immer noch gebunden. Trotz aller verzweifelten Bemühungen bekam sie sie nicht frei.
Doch irgendwie gelang es ihm, sie beide aus dem Wasser zu holen, sie ans modrige Ufer zu schleppen. Und dann küsste er sie. Zumindest dachte sie das, bis sie fühlte, wie ihr Luft in den Mund geblasen wurde. Nein, kein Kuss. Mund-zu-Mund-Beatmung.
„Alles okay“, sagte der Mann. „Du brauchst keine Angst mehr zu haben.“
Er kniete sich neben sie und löste mit wenigen schnellen Handgriffen ihre Fesseln. Dabei schaute er sich ständig um, als suche er etwas.
Nicht etwas, begriff sie.
Jemand.
Es war durchaus möglich, dass ihr Peiniger zurückkehrte, um seine Arbeit zu vollenden.
Diese Erkenntnis traf sie wie ein Schock. Ihre Zähne begannen aufeinander zu schlagen. Sie fing an zu zittern. Ihr war kalt, sie war nass, und schlagartig überfielen sie massive Kopfschmerzen. Ihr tat alles weh. Immerhin lebte sie. Das hatte sie diesem Mann zu verdanken.
Er beugte sich über sie, um ihre Stirn zu untersuchen. Im letzten Tageslicht konnte sie sein entschlossenes Gesicht sehen. Kannte sie ihn?
Nein.
Es war ein Fremder.
„Sie haben mir das Leben gerettet“, brachte sie mühsam hervor.
Wasser tropfte von ihm auf ihr Gesicht, und mit der gleichen Sanftheit wie bei der Untersuchung ihrer Stirn wischte er ihr die Tropfen von der Wange.
„Ja, das habe ich.“ Er murmelte undeutlich etwas vor sich hin. Auf Spanisch. Und er schüttelte den Kopf. „Ich könnte dich übers Knie legen für das, was du da durchgezogen hast. Aber darauf kommen wir später zurück.“
Sie verstand nicht, was er meinte. Durchgezogen? Bestimmt hatte sie nicht darum gebeten, ins Wasser geworfen zu werden. Oder? Nein, da war sie sich sicher. Sie hatte keinen Selbstmordversuch unternommen. Sie hatte um ihr Leben gekämpft.
„Wer sind Sie?“, fragte sie.
Ein seltsamer Ausdruck zuckte in seinen Augen auf. „Was zum Teufel meinst du damit? Und wieso siezt du mich die ganze Zeit?“
„Ich möchte gern Ihren Namen wissen“, beharrte sie.
Er hockte sich auf die Fersen und bedachte sie mit finsterem Blick. „Was für ein geschmackloses Spielchen soll das jetzt sein?“ Sie konnte gerade abwehrend den Kopf schütteln, da fuhr er schon fort. „Glaub mir, es wird nicht funktionieren!“ Mit jedem Wort wurde er lauter. „Ich will Antworten. Ich habe ein Recht auf Antworten.“
„Ich hätte auch gern Antworten. Zum Beispiel, dass Sie mir sagen, wer Sie sind.“
„Gabe“, stieß er hervor. „Aber das weißt du.“
Nein, sie wusste es nicht. Sie schob sich mit den Fingern das nasse Haar aus den Augen. Wenn doch nur diese fürchterlichen Kopfschmerzen nachlassen würden … Sie konnte kaum denken.
„Gabe Sanchez“, fügte er nach einem kurzen Moment hinzu.
„Nun, vielen Dank, Mr. Sanchez, dass Sie mich gerettet haben. Ich war drauf und dran, mit dem Leben abzuschließen.“
Er saß da, und ihm lief immer noch das Wasser übers Gesicht. Es schien es nicht wahrzunehmen, ebenso wenig seine klatschnasse Kleidung. Nichts um sie herum schien er wahrzunehmen. Nichts außer ihr. Er betrachtete sie durchdringend.
„Du wärst tot, wenn ich nicht hier gewesen wäre“, versicherte er ihr. „Irgendjemand hat auf dich geschossen, dann wurdest du ohnmächtig geschlagen und in den See geworfen.“
Sie starrte ihn entsetzt an. „Man hat auf mich geschossen?“
„Sieht so aus. Es ist nur ein Kratzer, aber zusammen mit der dicken Beule müsstest du eigentlich böse Kopfschmerzen haben.“
Müsstest? Sie hatte böse Kopfschmerzen.
„Wer war das?“, wollte er wissen. „Wer hat versucht, dich umzubringen?“
Er schien wütend auf sie zu sein, und sie hatte keinen blassen Schimmer, warum. Noch schlimmer, sie begriff eigentlich gar nichts. Wer hatte sie töten wollen? Und wer war dieser Fremde, der all diese Fragen beantwortet haben wollte?
„Ich weiß es nicht.“ Vorsichtig berührte sie ihre Stirn. Als sie die Hand zurückzog, klebte Blut an den Fingern. Sie war verletzt, konnte sich aber nicht erinnern, wie es geschehen war. „Haben Sie jemand gesehen, bevor Sie sich ins Wasser stürzten?“
„Nur einen Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit davonraste. Das Nummernschild konnte ich nicht erkennen.“ Wachsam schaute er sich wieder um. „Als ich Luftblasen aufsteigen sah, bin ich hineingesprungen.“
Gott sei Dank, dass er es getan hat, dachte sie, sonst wäre ich bereits tot. „Wo sind wir?“
„Am Lake Pontchartrain.“ Er kniff die Augen halb zusammen und blickte sie an. „Willst du mir wirklich erzählen, du weißt es nicht?“
Sie blickte sich um. Sie sah nur die Sonne, die gerade an einem ganz gewöhnlichen See unterging. Ansonsten kam ihr nichts bekannt vor. „Sind wir in der Nähe von Houston?“
„Houston? Wir befinden uns am Rand von New Orleans!“
Du lieber Himmel. Darauf wäre sie im Leben nicht gekommen. Was zum Teufel machte sie hier?
„Du erinnerst dich wirklich nicht?“, fragte er.
„Nein.“ Es war die einzige Antwort, der sie sich sicher sein konnte.
„Also gut, versuchen wir etwas Einfacheres. Welchen Tag haben wir heute?“
Wieder versuchte sie sich zu konzentrieren. „Irgendwann im Juni?“
Geräuschvoll stieß er den angehaltenen Atem aus. „Nicht ganz. Wir haben den zwölften August. Okay. Nun eine Frage, die niemand falsch beantworten kann. Wie heißt du?“
Sie öffnete den Mund, aber es fiel ihr nicht ein. Beim besten Willen nicht. Ihr Gehirn war wie leer gefegt.
Nun sah er sie aufrichtig besorgt an. „Du weißt nicht einmal deinen Namen?“
Sie schüttelte den Kopf, versuchte die Benommenheit zu vertreiben. „Ich habe keine Ahnung.“ Und das war die Wahrheit. Sie wusste überhaupt nichts.
Panik stieg in ihr auf. Dies musste ein Traum sein. Ja, ein Traum. Das war die einzige logische Erklärung. Ein absolut entsetzlicher Albtraum. Sicher würde sie gleich aufwachen und sich wieder an alles erinnern. Wer weiß, vielleicht befand sie sich nicht einmal an diesem See, sondern lag gemütlich zu Haus in ihrem eigenen Bett!
Wo immer dieses Zuhause auch sein mochte.
Sie zwinkerte einige Male, versuchte ein anderes Bild vor ihrem Auge erstehen zu lassen, aber der Albtraum war immer noch da. Und Gabe Sanchez auch. Er starrte sie an, in seinen dunklen misstrauischen Augen las sie die Frage, ob sie ihm nicht etwas vormachte.
Noch immer den schlammigen Seewassergeschmack im Mund, schloss sie die Augen und überließ sich willenlos dem Traum.
Stimmen weckten sie. Sie schnappte ein paar Worte auf, aber die meisten ergaben keinen Sinn. Philip. Frank Templeton. Sanchez.
Gabe Sanchez.
Der Mann, der sie gerettet hatte. Es waren mindestens noch zwei weitere Stimmen zu hören. Ein Mann und eine Frau. Alle drei sprachen mit gesenkten Stimmen, aber sie schienen sich zu streiten.
Sie zwang sich die Augen zu öffnen, zuckte aber zusammen, weil sie in grelles Licht blickte. Ein heftiger Schmerz fuhr ihr durch den Kopf. Sie war benommen, fast wie betrunken, aber schließlich schaffte sie es, das Trio nahe dem Eingang deutlich zu sehen: Sanchez, eine attraktive Frau mit hochgestecktem dunklem Haar und ein großer blonder Mann.
Die Frau trug ein unauffälliges Kostüm, der Mann einen Anzug im gleichen gedeckten Farbton. Sanchez nichts dergleichen. Er hatte eine ausgeblichene Jeans, ein schlichtes weißes T-Shirt an. Aus einem Schulterhalfter ragte ein Pistolengriff. An seinem Gürtel war ein Pager befestigt.
Sie warf einen Blick auf ihre eigene Kleidung. Jemand hatte ihr grüne OP-Kleidung angezogen. Und sie lag auf einer fahrbaren Krankentrage.
„Ich bin nicht auf der Intensivstation“, sagte sie zu sich. „Und auch nicht in einer Notaufnahme.“
Es sah eher aus wie ein riesiger Vorratsraum. Mit mehreren Metallregalen, voll gestellt mit Kartons. Am anderen Ende des Raums ein einziges Fenster, dessen Läden geschlossen waren. So konnte sie nicht sagen, ob es Tag oder Nacht war. Sie befürchtete, es könnte vergittert sein.
„Das musst du ihr erzählen“, drängte die Frau.
Sanchez schüttelte den Kopf. „Nein.“
Die Frau verschränkte die Arme vor der Brust und tippte gereizt mit der Fußspitze auf den Boden. „Das war keine Bitte. Möchtest du, dass sie umgebracht wird? Denn genau das wird passieren. Verdammt, es war fast so weit, oder hast du das bereits vergessen?“
„Gar nichts habe ich vergessen. Ich bin schließlich derjenige, der sie aus dem See gezogen hat.“ Sanchez murmelte etwas vor sich hin. „Verflucht, sie wäre beinahe in meinen Armen gestorben.“
Sie hob den Kopf. „Wer sind Sie?“
Die drei warfen ihr einen Blick zu, antworteten aber nicht. Sie musterte jeden genau, versuchte ihre Mimik und die Unterhaltungsfetzen einzuordnen, die sie mitbekommen hatte.
Dem Blonden traute sie auf keinen Fall, und doch konnte sie nicht sagen, warum. Auch die Frau war keine Verbündete. Aus Sanchez wurde sie nicht ganz schlau, aber da er sie vor dem Ertrinken gerettet hatte, würde sie auf ihn setzen, wenn es darauf ankam, die Wahl zu treffen.
Denn sie befürchtete, dass es dazu kommen würde.
„Oder vielleicht sollte ich besser fragen, wer ich bin?“, fügte sie hinzu, als die anderen weiterhin schwiegen.
Gabe Sanchez kam mit geschmeidigem Gang auf sie zu. Er war groß, bestimmt einen Meter fünfundachtzig, und athletisch gebaut. Unter den kurzen Ärmeln des T-Shirts wölbten sich kräftige Muskeln. Er hatte dunkelbraunes, kurz geschnittenes Haar.
Als er näher zu herangekommen war, sah sie in dunkelblaue Augen. Intelligente Augen, die sie kurz, aber eindringlich musterten.
Die anderen folgten Sanchez, blieben stehen, als er stehen blieb. Sie waren Freunde. Nein, mehr als das. Oder weniger. Vielleicht viel, viel weniger.
Mein Gott, warum nur war es so schwierig für sie, solche Dinge einzuschätzen?
„Du weißt immer noch nicht, wer du bist?“, fragte Sanchez, der sie weiterhin beharrlich duzte.
„Nein. Wie kommt das? Was ist mit mir los?“
„Du hast einen kräftigen Schlag auf den Schädel bekommen. Es kann eine Weile dauern, bis du dich wieder erinnerst.“
Sie berührte den Verband an ihrer Stirn. Unter dem weichen Stoff fühlte sie deutlich eine Beule. Zweifelsohne der Grund für ihre heftigen Kopfschmerzen.
„Habe ich eine Gehirnerschütterung?“, fragte sie.
Sanchez nickte. „Und eine feine Naht an der Stirn und am Fußgelenk, weil das Seil die Haut aufgerissen hatte. Der Arzt hat dich untersucht und meint, der Gedächtnisverlust hätte nichts mit der Kopfverletzung zu tun. Mit anderen Worten, keine Hirnschädigung. Er sagt, der Grund ist ein emotionales Trauma.“
„Psychogene Amnesie“, fügte sie leise hinzu. „Wie lange wird sie anhalten?“ Die Antwort war da, noch ehe er etwas sagen konnte. So wie ihre Abneigung gegen den blonden Mann und die Frau. Sie wusste nur nicht, woher sie es wusste.
„Der Arzt ist nicht sicher“, erwiderte Gabe Sanchez. „Stunden, aber auch Tage.“
„Vielleicht auch für immer“, ergänzte sie.
Sie senkte den Kopf und versuchte, mit dieser Vorstellung zurechtzukommen. Aber es gelang ihr nicht, in ihrem Kopf wirbelte heillos alles durcheinander.
Mein Gott, wie würde es weitergehen? Sie wusste nicht, wer sie war, nicht ihren Namen, nicht ihr Alter. Absolut nichts. Sie wusste nicht, ob sie sich noch in Gefahr befand oder ob sie überhaupt jemand trauen konnte. Wusste nicht einmal, was diese Leute mit ihr zu tun hatten.
Sie hingegen wussten es.
„Wie ist mein Name?“ Sie wollte Antworten, und sie wollte sie jetzt.
„Leigh O’Brien.“
Es sagte ihr absolut nichts. Nur das Wasser und Sanchez sagten ihr etwas. Ihr Leben hatte in dem Moment begonnen, als sie zu ertrinken drohte. Kein sehr tröstlicher Gedanke, wie sie fand. „Wo bin ich?“
„In einer Privatklinik in der Nähe von New Orleans.“
Dann hatten sie also die Gegend nicht verlassen. Dessen war sie sich sicher. „Sind Sie Polizist?“
„Nein.“
„Bin ich Polizistin?“
Schweigen breitete sich aus. „Nein“, antwortete der Blonde schließlich.
Leigh gefiel das Zögern nicht. Panik wallte in ihr auf. „Eine Kriminelle?“, hakte sie nach und wappnete sich.
Es konnte gut sein, dass diese Leute sie hier gefangen hielten für etwas, was sie getan hatte. Hatte jemand sie in den See geworfen, weil ein Drogendeal schief gelaufen war? Eine interne Abrechnung des organisierten Verbrechens? Was hatte sie Schreckliches angestellt, dass man sie ermorden wollte?
Der Blonde trat einen Schritt auf sie zu. „Sie sind keine Kriminelle.“
Einen Moment lang gestattete sie sich Erleichterung. Nur ganz kurz. Dann stellte sie die nächste Frage. „Da wir dieses Frage- und Antwortspiel bis in alle Ewigkeiten fortsetzen könnten – warum erzählen Sie mir nicht einfach, wer Sie sind?“
Die drei blickten sich an, dann sprach der Blonde. „Ich bin Wade Jenkins. Die Leute nennen mich Jinx. Special Agent Sanchez und ich sind beim FBI. Agent Teresa Walters ist Agentin beim ATF – dem Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.“
„FBI. ATF“, wiederholte Leigh. Dass neben dem FBI auch die dem Finanzministerium unterstellte US-Kontrollbehörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoff involviert war, machte sie hellhörig. Das ATF beschäftigte Polizisten und Spezialagenten im Kampf gegen Gewaltverbrechen und für den Schutz der Öffentlichkeit. „Was ist mit mir? Bin ich auch eine Art Agentin?“
„Sie sind eine betroffene Bürgerin.“ Der Blonde presste einen Zeigefinger auf die Augenbrauen. „Eine betroffene Bürgerin mit einem ziemlich großen Problem.“
„Was Sie nicht sagen!“, fuhr Leigh auf. „Nach allem, was passiert ist, glaube ich das gerne. Aber was bin ich noch außer einer betroffene Bürgerin? Wenn ich nicht bei einer dieser Organisationen mit den drei Initialen arbeite, für wen dann?“
„Sie arbeiten in einem Buchladen in Austin im Bundesstaat Texas“, erwiderte Jinx.
„Ein Buchladen?“ Das konnte nicht stimmen. Irgendwie fühlte sie es.
Doch er gab keine weiteren Erklärungen. „Erinnern Sie sich noch genau daran, im Wasser gewesen zu sein?“
Eine gute Frage. Schade, dass sie keine so gute Antwort hatte. „Nur daran, dass Agent Sanchez mich rettete. Ansonsten erinnere ich nur undeutliche Bilder und wirre Emotionen bei einem verzweifelten Kampf, nicht tiefer zu sinken.“
„Irgendeine Ahnung, wer Sie in den See geworfen hat?“
Sie versuchte die Antwort aus ihrem Gedächtnis zu zwingen. Es funktionierte nicht. Die Tür zur Vergangenheit blieb geschlossen. „Nein. Ich habe ein schemenhaftes Bild von einem Menschen auf einer Brücke im Kopf, sehe aber sein Gesicht nicht vor mir. Jemand, der etwas Helles trägt. Aber das hilft Ihnen wohl nicht weiter, oder?“
„Nein“, erwiderte Teresa, und es klang frustriert. „Ihre Amnesie ist leider nur ein Teil des Problems. Es könnte gut sein, dass man erneut einen Anschlag auf Sie verübt.“
Leigh musste schlucken. Daran hatte sie noch gar nicht gedacht.
Sie wandte sich an Sanchez. „Wer will meinen Tod?“
Er zuckte mit den Schultern. „Das wissen wir leider nicht.“
„Können Sie mir denn wenigstens sagen, worum es geht? Was …“
„Je weniger Sie wissen, desto besser“, unterbrach Jinx sie.
„Vielleicht sehen Sie das so, aber ich bin anderer Meinung! Jemand hat versucht mich umzubringen, und ich finde, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, wer.“
„Leider kann ich Jinx nur zustimmen, Leigh“, mischte sich Sanchez ein. „Selbst wenn wir dir alles erzählten, wärest du dadurch nicht sicherer. Deswegen werden wir dich auch beschützen.“
Sie schüttelte abwehrend den Kopf. „Nein, warten Sie. Ich kenne Sie nicht einmal und soll Ihnen mein Leben anvertrauen? Woher weiß ich, dass Sie nicht zu denen gehören, die mich umbringen wollten?“
„Das ergibt doch keinen Sinn“, erwiderte Sanchez. „Wenn dem so wäre, hätte ich dich kaum aus dem See gezogen.“
„Aber die beiden hier haben mit der Rettungsaktion nichts zu tun.“ Sie deutete auf Wade Jenkins und Teresa Walters. „Meiner Ansicht nach sitze ich ziemlich in der Tinte. Was ist, wenn ich irgendein Geheimnis in meinen Kopf bewahre, und Sie halten mich nur hin, um es aus mir herauszuholen – und bringen mich um, sobald ich es ausgeplaudert habe?“
Agent Walters hob beide Hände. „Ich gebe auf. Sagt mir Bescheid, wenn ihr ihr wieder etwas Verstand eingetrichtert habt.“
Leigh hatte bereits eine scharfe Bemerkung auf der Zunge, da sagte Sanchez: „Du kannst mir vertrauen, Leigh.“ Die Worte schienen ihm seltsamerweise nicht leicht zu fallen. Sie sah es an seinem Blick.
„Warum? Weil Sie mir das Leben gerettet haben?“
Er antwortete nicht, aber Jinx sagte: „Nicht nur deswegen. Sie können ihm vertrauen, weil Gabe Sanchez Ihr Mann ist.“
2. KAPITEL
Gabe beobachtete, wie sie ihn musterte. Ihr Blick kroch förmlich über seinen Körper. Gleich würde ihn das Donnerwetter mit voller Wucht treffen. Schließlich kannte er Leigh. Sie konnte Leute mit Fragen bombardieren, bis ihnen schwindlig wurde.
„Mein Mann?“, wiederholte sie ungläubig.
Er nickte nur. Die Liste mit den Details zum Zustand ihrer Ehe war ellenlang, und er verspürte nicht die geringste Lust, mit ihr darüber zu reden. Aber wie es aussah, würde er es letztendlich doch tun müssen.
„Stimmt das?“, fragte sie. „Sind wir wirklich verheiratet?“
Er trat an die schmale Liege heran und fixierte sie scharf. „Wenn du mir die Wahrheit sagst, werde ich deine Fragen beantworten. Spielst du uns diesen Gedächtnisverlust nur vor?“
„Nein.“ Ärger blitzte in ihren Augen auf. „Ich wünschte, es wäre so, denn dann wäre ich längst nicht mehr hier. Mir gefällt es hier nicht.“
„Ja, ich verstehe, was du meinst.“ Gabe schaute sich kurz im Raum um. „Geht mir ebenso.“
Leigh machte es ihm nach, und dann trafen sich ihre Blicke, hielten einander fest. „Bist du wirklich mein Mann?“
Also, diesen Teil der Unterhaltung konnte er wirklich nicht vermeiden. In ihrer Situation hätte er das Gleiche gefragt. „So ist es. Passt es dir nicht?“
„Das Urteil steht noch aus. Was soll ich auch sagen, wenn ich dich nicht einmal kenne? Also, wie lange sind wir schon miteinander verheiratet?“
Aha, die Fangfrage. Auch damit hatte er gerechnet. „Vier Jahre, sechs Monate.“ Er überlegte. „Und achtzehn Tage.“
Würde sie fragen, könnte er ihr auch die Stunden nennen. Gabe verfluchte sich stumm. Es gefiel ihm nicht, dass er sich haargenau an solch schmerzhafte Einzelheiten erinnern konnte.
„So lange …“, murmelte sie.
Ja, so lange. Aber die Hälfte der Zeit war sie nicht da gewesen. Und nun war sie zurück … wieder in seinem Leben. Das letzte Mal hatte es zu lange gedauert, über sie hinwegzukommen. Sie hatte sein Leben auf den Kopf gestellt und ihn dann am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Einmal reichte ihm.
Trotz der gefärbten Haare hatte sie sich nicht verändert. Sie war ein wenig dünner geworden. Und die alte Leigh war selbstbewusster gewesen. Schön, es gab einen guten Grund dafür. Schließlich hatte man versucht, sie umzubringen. Dieser Mordversuch hatte eindeutig mit dem zu tun, was sie zu ihm zurückgebracht hatte. Das Schicksal machte Überstunden.
Manchmal aber wusste das Schicksal nicht, wo Anfang und wo Ende war.
Leigh ließ ihn nicht aus den Augen.
„Warum hast du mir nicht eher gesagt, dass du mein Mann bist?“
„Bisher bot sich keine Gelegenheit. Du warst ohnmächtig, als ich dich hierher brachte.“ Er wusste, es würde nicht ihre letzte Frage sein, und er behielt recht.
Leigh warf einen Blick auf seine Hand. „Warum trägt keiner von uns einen Ehering?“
Verdammt. Diese Frau verstand es wirklich, alte Wunden aufzureißen. Gabe zog die Halskette aus dem T-Shirt, so dass sie den schlichten Goldring daran sehen konnte. „Ich bin Linkshänder, und der Ring verfängt sich leicht am Schulterhalfter. Aber wo dein Ring ist, kann ich nicht sicher sagen. Vielleicht ist er dir im See vom Finger gerutscht.“
Oder sie hatte ihn einfach weggeworfen. So etwas traute er ihr zu. Offensichtlich bedeutete ihr ihr Eheversprechen nicht viel. Für sich persönlich konnte er das nicht sagen. Und das war wohl die einzige Erklärung, warum er seinen Ring noch immer trug. Eigentlich hätte er ihn schon vor Monaten ablegen sollen.
„Zeit, zu gehen“, verkündete Jinx und brach damit das drückende Schweigen. „Ich muss noch ein paar Leute auf den neuesten Stand bringen und herausfinden, wie es weitergeht. Gabe, warte du hier bei Leigh.“
Natürlich. Gabe hatte es nicht anders erwartet.
„Ich sollte mich auch vom Acker machen.“ Agent Walters warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Dann zupfte sie kurz an Gabes Ärmel. „Keine Experimente, ja?“
„Wartet, ich bringe euch hinaus.“ Er stand auf und behielt seine rebellischen Gedanken für sich. „Bleib, wo du bist“, sagte er zu Leigh.
Sie zog die unbandagierte Augenbraue hoch. „Mir bleibt wohl kaum etwas anderes übrig, oder?“
„Richtig“, stellte er über die Schulter hinweg klar.
„Ich habe dir gesagt, du sollst nett zu ihr sein“, sagte Jinx zu ihm, kaum, dass sie die Tür hinter sich geschlossen hatten. „Ich sagte, gewinn ihr Vertrauen.“
Gabe hätte beinahe schallend gelacht. „Wunder kann ich nicht vollbringen.“
„Nein, aber du wirst deinen Job erledigen.“
Jinx’ Worte trafen ihn wie ein Hieb in den Bauch, obwohl er versucht hatte, sich darauf einzustellen. „Und was genau meinst du damit?“
„Ich meine damit, du wirst sie beschützen, bis wir etwas anderes arrangieren konnten.“ Es lag kein Zögern in seiner Stimme, und dieser Ton zog eine scharfe Trennlinie zwischen ihrer Freundschaft und seiner Rolle als Gabes Boss.
Gabe fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. „Das heißt, ich soll bei ihr den Bodyguard spielen.“
„Wenn nötig“, erklärte Teresa, und Jinx nickte.
Es würde notwendig werden. Daran gab es keinen Zweifel.
Es gab allerdings ein paar Probleme mit diesem besonderen Plan, den Jinx und Teresa für ihn ausgeheckt hatten. Er bedeutete, dass er viel Zeit mit seiner Frau verbringen musste. Einer Frau, die er nicht wollte. Einer Frau, die ihn nicht wollte. Aber sie war in Lebensgefahr, ein Killer hatte es auf sie abgesehen.
Verdammt.
Er würde tun, was das Justizministerium von ihm verlangte, und dann war Schluss. Danach konnte Leigh machen, was sie wollte, und er würde ebenfalls seiner Wege gehen. Es kam nur darauf an, sie am Leben zu erhalten, den Kerl dingfest zu machen und dann zu verschwinden. Das ganz besonders.
Auf keinen Fall würde er sich wieder in ihr Leben hineinziehen lassen. Auf keinen Fall.
Leigh schaute Sanchez und den anderen nach, während sie hinausgingen. Bleib, wo du bist, hatte er befohlen. „Als hätte ich eine Wahl“, murmelte sie.
Ihre Entscheidungskompetenz war tatsächlich extrem eingeschränkt. Womöglich gleich null. Sie litt an Gedächtnisverlust, war verletzt und wusste nicht, wie sie sich aus dieser gefährlichen Situation befreien sollte. Das hieß allerdings nicht, dass sie den dreien traute. Oder ihnen glaubte.
Das musst du ihr erzählen, hatte Teresa Walters gesagt, bevor sie bemerkt hatten, dass sie aufgewacht war. Solche Ratschläge erteilte man im Allgemeinen nicht, wenn man vorhatte, die Wahrheit zu sagen.
Die ganze Wahrheit, wohlgemerkt.
Leigh schwang die Beine von der Liege, um zur Toilette zu gehen. Ihr Körper schmerzte überall, und vor ihren Augen flimmerten Sterne. Ihr rechtes Fußgelenk war dick bandagiert.
Sie benutzte die grünen Badelatschen unter der Liege und ging ins Badezimmer. Schwer war es nicht zu finden. Außer der Tür, durch die ihre drei furchtlosen Beschützer verschwunden waren, gab es nur noch eine.
Das Badezimmer war riesig. Zwei große Wäschebehälter standen darin, gefüllt mit benutzten Laken und Krankenhauskleidung. Die Rutsche für die Schmutzwäsche war so breit wie die Behälter, ein Hinweis darauf, dass hier Berge von Schmutzwäsche anfielen. Eine normale Klinik hatte keinen solchen Bedarf.
Also, was war das hier?
Da sie bislang weder Verkehr noch andere, für ein Krankenhaus typische Geräusche gehört hatte, ging sie davon aus, dass die Anlage abgelegen lag. Vielleicht eine militärische Einrichtung oder ein Zufluchtsort des FBI.
Aber was wollten FBI oder ATF von einer kleinen Buchhändlerin aus Austin? Vielleicht führte diese Buchhandlung ganz besondere Bücher. Falls ja, dann war sie eindeutig mehr als nur eine besorgte Bürgerin.
Leigh schob diesen Gedanken beiseite, als sie den Spiegel über dem Waschbecken sah. Zögernd ging sie darauf zu, fürchtete sich vor dem Bild, das sie gleich sehen würde.
Ein fremdes Gesicht starrte ihr entgegen.
Das Gesicht einer verstörten Unbekannten.
Mit klopfendem Herzen suchte sie in den Zügen nach etwas Vertrautem. Sie war blass, die Haut um den Verband herum geschwollen. Der Bluterguss an ihrem Wangenknochen zeigte, dass sie offenbar einen kräftigen Hieb abbekommen hatte. Mit einem stumpfen Gegenstand, vermutete sie.
Ihr Gesichtsschnitt war nicht besonders auffällig. Ein ganz normales Gesicht. Eine Schönheit war sie nicht. Das rötliche Haar trug sie kinnlang, doch der hellbraune Haaransatz ließ vermuten, dass es gefärbt war. Um sich zu vergewissern, schaute sie dort nach, wo es am einfachsten war, zog den elastischen Bund der Hose ein wenig fort.
Nein, sie war keine Rothaarige.
Leigh beugte sich weiter vor, musterte verwundert ihre Augen. Sie hatten nicht dieselbe Farbe. Das eine war dunkelbraun, das andere hellgrün. Automatisch, als wüsste sie, warum, griff sie nach dem braunen Auge und nahm die Kontaktlinse fort, die ihre Iris verdeckte. Sie hatte also wirklich grüne Augen, und da sie hervorragend ohne die Linse sehen konnte, war davon auszugehen, dass sie sie aus kosmetischen Gründen getragen hatte.
Warum?
Farbige Kontaktlinsen. Gefärbtes Haar. Sie hatte ihr Äußeres verändert. Wahrscheinlich, um sich vor jemandem zu verstecken, der ihren Tod wollte. Zu schade, dass es nicht funktioniert hatte. Er musste ihre Deckung durchschaut und sie verfolgt haben.
Da fiel Leigh die Narbe auf. Eine Vertiefung im rechten Unterarm. Gut verheilt, aber es sah nach einer Schusswunde aus. Oder ihre Fantasie ging mit ihr durch. Allein der Anblick der Narbe löste einen unangenehmen Druck im Magen aus. Eine weitere Erinnerung an ihre Vergangenheit, die sie nicht kannte und die ihr eine Gänsehaut verursachte.
Wenig später kehrte sie in den anderen Raum zurück, zur Liege. Kurz darauf kam Gabe herein, in jeder Hand einen Pappbecher.
„Kaffee“, verkündete er. „Ich dachte, du könntest jetzt deine Ladung Koffein gut gebrauchen.“
Der braune Trank duftete köstlich. „Bin ich ein exzessiver Kaffeetrinker?“
Er nickte, schaute von einem Becher zum anderen. Dann hielt er ihr einen hin und verzog das Gesicht dabei. „Deiner. Drei Stück Zucker, so wie du es magst.“
Sie nahm den Becher und wusste, sie würde den Kaffee mögen. Seltsam. Warum kam ihr gesüßter Kaffee so vertraut vor, aber ihr Ehemann nicht?
Mein Ehemann, dachte sie.
So wie sie ihre eigenen Züge im Spiegel geprüft hatte, tat sie es jetzt auch mit seinen. Schlecht sah er nicht aus. Ein wenig grob geschnitten, und die kleine Narbe am Kinn betonte es noch. Die Haut war wie helle Bronze, sehr wahrscheinlich ein Erbe seiner hispanischen Vorfahren, worauf der Nachname hindeutete. Die dunkelblauen Augen ließen auf mitteleuropäische Vorfahren schließen. Alles in allem eine gute Mischung, die ein interessantes Gesicht ergab.
Seine Augen waren … nein, kein Schlafzimmerblick, auch wenn ihr dieser Begriff als Erstes einfiel. Durch die dichten dunklen Wimpern wirkten sie halb geschlossen, träumerisch, aber ihr Gegenüber dachte absolut nicht an Schlafzimmer, so viel war klar.
„Ist der Kaffee richtig?“, fragte Gabe nach ihrem ersten Schluck.
„Ja, danke. Du weißt also, wie ich meinen Kaffee mag – aber das heißt noch lange nicht, dass ich dir alles abnehme, was du mir erzählt hast.“ Als sie den Becher auf dem Tisch neben ihm abstellte, bemerkte sie einen schwachen hellen Streifen an ihrem Ringfinger. Nicht unbedingt von einem Ring. Aber es war möglich. „Hatte ich irgendeine Art Ausweis bei mir, als du mich aus dem See zogst?“
Er streckte die langen Beine aus, so dass er in seine Hosentasche greifen konnte, und holte einen einzelnen Schlüssel heraus. „Der hier war unter der Fußmatte im Wagen befestigt. Wir fanden deine Fingerabdrücke darauf.“
„Ist es ein Wagenschlüssel?“
Sanchez schüttelte den Kopf. „Den Wagenschlüssel hattest du im Zündschloss stecken lassen. Dieser hier sieht eher aus wie ein Wohnungsschlüssel. Kommt er dir bekannt vor?“
„Nein.“ Er sah aus wie ein Schlüssel, mehr nicht. Ein Schlüssel zu einem Haus, und sie hatte keine Ahnung, wo dieses Haus sein könnte. Möglicherweise in Austin, da sie dort vermutlich arbeitete. „Eine Börse oder Handtasche hast du nicht im Wagen gefunden?“
„Ich schätze, die hat der Kerl mitgenommen, der dich umbringen wollte.“
Das war möglich, und sie fragte sich, ob der Angriff auf sie nur ein Raubüberfall gewesen war. Nein, eher nicht. Sie wäre wohl nicht hier, wenn es ein einfacher Raubüberfall gewesen wäre.
Leigh schaute ihn an. Bislang hatte er ihre Fragen willig beantwortet. Nun, zumindest einige davon. Allerdings wusste sie nicht, ob er die Wahrheit sprach, oder wie viel davon er verriet. Und doch begann sie allmählich zu glauben, dass er wirklich ihr Mann war.