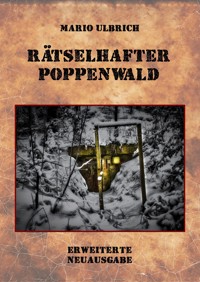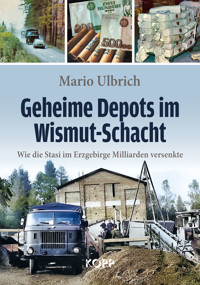
16,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was versteckte die Stasi in alten Wismut-Schächten?
Im Herbst 1989 und den Monaten danach vermeldete der Buschfunk im Erzgebirge, dass die Stasi Teile ihrer Akten in einem stillgelegten Schacht des Uranbergbauunternehmens »Wismut« versenkt haben soll. Von offizieller Seite wurde das immer dementiert.
Tatsächlich hat es aber verschwiegene Operationen der DDR-Staatssicherheit in alten Bergwerken am Stadtrand von Schneeberg gegeben. Bewacht durch Soldaten des Eliteregiments »Feliks Dzierzynski« wurden dabei Milliarden von Ostmark entsorgt - neben ausgemusterten Banknoten auch Fehldrucke aus der Wertpapierdruckerei Leipzig.
Doch weshalb die Geheimhaltung, die selbst vor dem eigenen Sicherheitsapparat nicht Halt machte? Und was geschah 1989 wirklich, nachdem die letzte Aktion um fast ein Jahr verschoben und kurz vor der deutschen Wiedervereinigung noch rasch über die Bühne gebracht wurde?
Das reich bebilderte Buch spürt den mysteriösen Vorgängen anhand von Stasiakten und Zeitzeugenaussagen nach. Neben den Ereignissen im Erzgebirge enthüllt es Wissenswertes über die Geldproduktion der DDR für befreundete Staaten, die Werttransporte des Ministeriums für Staatssicherheit und über den ostdeutschen 200- und den 500-Mark-Schein - zwei Phantombanknoten, die millionenfach gedruckt, aber nie unters Volk gebracht wurden.
Ulbrichs Enthüllungen liegen mehr als 500 Seiten Stasiakten sowie bislang nicht veröffentlichte Dokumente zugrunde, die dem Autor durch die heutige Wismut GmbH zur Verfügung gestellt wurden. Gestützt wird Ulbrichs Report auch durch exklusive Zeitzeugeninterviews und eine aufschlussreiche Bilddokumentation.
Ein ebenso spannendes wie informatives Sachbuch, das nicht nur Heimatforscher begeistert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1. Auflage Juli 2024
Copyright © 2024 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christina Neuhaus Satz und Layout: Karas Grafik, Wien Covergestaltung: Nicole Lechner
ISBN E-Book 978-3-98992-032-3 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11
Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Übersicht über das Gesamtgelände
Vorwort: Ein Rätsel aus der Wendezeit
Vorwort
Ein Rätsel aus der Wendezeit
Im Jahr 1992 begann ich in der Lokalredaktion Zwickau der Freien Presse zu arbeiten, einer großen Tageszeitung in Sachsen, wo mir eine spannende Verschwörungstheorie zu Ohren kam. Es ging um die Stasi. In der DDR allgegenwärtig und nur hinter vorgehaltener Hand beflüstert, war das einst gefürchtete Mielke-Ministerium nunmehr in aller Munde und lieferte Stoff für brisante Enthüllungen und wilde Spekulationen.
Die Kollegen der Zwickauer Landredaktion erzählten mir damals folgende Geschichte: Vor ungefähr 2 Jahren seien bei Nacht und Nebel mehrere Lastkraftwagen nach Hartenstein gefahren und hätten geheime Akten des Ministeriums für Staatssicherheit in einem Wismut-Schacht versenkt. Die Leute vom »Neuen Forum« – der Bürgerrechtsbewegung in der DDR – seien total aus dem Häuschen gewesen.
© Adobe Stock: jovannig
Stasimuseum Leipzig in der »Runden Ecke«
Gemeint war der Schacht 311 bei Schneeberg. Die alte Bergstadt lag zwar im Nachbarlandkreis Aue, doch weil sich der Hauptförderschacht der Wismut, der Schacht 371, nahe der Kleinstadt Hartenstein am Südzipfel des Kreises Zwickau befand, sagten die Menschen in der Region meistens »die Wismut in Hartenstein«.
Ein weiterer Grund, weshalb sich die Zwickauer Lokalredaktion zuständig fühlte, war der Umstand, dass der Koordinator des Neuen Forums im Bezirk Karl-Marx-Stadt, Martin Böttger, in Cainsdorf bei Zwickau lebte, wodurch viele Nachrichten hier zusammenliefen.
Aber auch die Bürgerbewegung wusste nichts Genaues über die geheimen Aktivitäten der Stasi im Wismut-Reich und war auf Spekulationen und Buschfunkdurchsagen angewiesen.
Ich selbst hatte mit dieser Story nichts zu tun und nahm sie lediglich interessiert zur Kenntnis, so wie 4 Jahre später auch einen großen Artikel in der Berliner Zeitung, geschrieben von Investigativ-Reporter Andreas Förster, der mit der Schlagzeile »Das Geheimnis von Schacht 311« überschrieben war. Andreas, den ich damals noch nicht persönlich kannte, war in den Besitz von Unterlagen gekommen, die belegten, dass ein hoher Stasioffizier im Jahr 1990 tatsächlich vorgeschlagen hatte, den eigentlich längst verschlossenen Wismut-Schacht 311 als Endlager für »Materialien des ehemaligen MfS/ANS« zu nutzen. Letztere Abkürzung (korrekt: AfNS) steht für das Amt für Nationale Sicherheit, das im November 1989 unter der Regierung Modrow für wenige Wochen der offizielle Stasinachfolger wurde.
Andreas’ Artikel kam zu keinem endgültigen Ergebnis. Gerüchte und Verlautbarungen passten nicht so recht zusammen. Natürlich sind Gerüchte oft nicht mehr als Märchen mit einem mehr oder weniger wahren Kern, aber in diesem Fall ergaben auch die offiziellen Bekanntmachungen kein klares Bild, sodass der Kern der Klatschgeschichten um den Schacht 311 vielleicht doch härter war, als sich beweisen ließ.
© Adobe Stock: scottimage
Kopfbedeckung eines Stasioffiziers
Was damals weder meine Zwickauer Kollegen noch der Berliner Reporter wussten: Die Stasioperation zur Wendezeit in Schneeberg war nur der letzte Akt in einer Reihe von insgesamt drei Aktionen, bei denen Altgeld und Wertpapiere in alten Uranschächten entsorgt worden sind: 1983 im Schindlerschacht, 1984 im Schacht 311 und 1990 ein weiteres Mal im Schacht 311. Von diesen Vorgängen hatten nur wenige Insider Kenntnis.
Hinzu kamen einige zufällige Beobachter, denen schwer bewachte Transportkolonnen und abgeschirmte Aktivitäten aufgefallen waren. Ihre Aussagen enthielten jedoch widersprüchliche Informationen, die zum Teil auch heute noch die Runde machen. Zum Beispiel wird behauptet, es müsse Mitte der 1980er-Jahre mindestens zwei zeitgleiche Transporte gegeben haben, weil eine Kolonne aus Richtung Stützengrün nach Schneeberg hineingefahren sei und eine weitere aus Richtung Wildbach. Tatsächlich haben manche Augenzeugen die eine Kolonne gesehen, andere die zweite; jedoch lagen zwischen beiden Sichtungen 11 Monate. Nachdem das Ganze nun an die 40 Jahre zurückliegt, werden die Ereignisse von 1983 und 1984 heute mitunter zu einer Aktion vermengt. Während der Wendezeit wiederum wurde behauptet, am Schindlerschacht sei vor 3 Jahren ein geheimnisvoller Konvoi angekommen. Tatsächlich lag das, woran die Leute sich erinnerten, zu diesem Zeitpunkt bereits 6 Jahre zurück.
Was 1983 am Schindlerschacht und 1984 am Schacht 311 wirklich geschah, wurde durch das Ministerium für Staatssicherheit, das für die Sicherung der Transporte verantwortlich zeichnete, akribisch dokumentiert. Auch für das, was 1989 geplant war, gibt es ausreichend Belege. Die Beweiskette endet allerdings im Herbst 1989, als in der DDR die friedliche Revolution ausbrach und die Stasi plötzlich mehr mit dem Schreddern alter Akten als dem Anlegen neuer Dossiers zu tun hatte.
Der hier vorliegenden Darstellung liegen mehr als 500 Seiten Stasiakten sowie einige Dokumente zugrunde, die mir freundlicherweise durch die heutige Wismut GmbH zur Verfügung gestellt worden sind. Ergänzt wurde das Geschehen durch Zeitzeugeninterviews, wobei letztere sich teils schwierig gestalteten und am Ende wenig Neues beitrugen. Die regionalen Geheimnisträger der Wismut und der Bergsicherung Schneeberg, die damals dabei waren, sind inzwischen alle verstorben. Darüber hinaus gab es nur noch schätzungsweise zwei Dutzend Angehörige der Wismut und der Bergsicherung, die als Arbeitskräfte bei einer der insgesamt drei Aktionen zugegen waren. Ihre Namen sind in den Akten nicht verzeichnet oder wurden geschwärzt. Es gelang mir lediglich, einen dieser Männer zu identifizieren; ein Gespräch mit ihm kam jedoch nicht zustande. Auch zwei andere Personen, die möglicherweise über die Aktion von 1989/90 informiert waren, wollten sich nicht äußern.
Dieses Schweigen ist gelinde gesagt irritierend. Es sind fast 35 Jahre vergangen, die Stasi existiert nicht mehr, alle Geheimhaltungsauflagen sollten inzwischen nichtig sein. Dachte ich zumindest. Und überhaupt: Wenn 1990 wirklich nur das, was in Protokollen und Frachtbriefen verzeichnet ist, im Schacht 311 versenkt wurde, was gibt es da noch unter dem Deckel zu halten?
Insofern ist es vielleicht ein Fingerzeig, dass mein Kollege Andreas Förster die Stasiakten zu den drei Schneeberger Vernichtungsaktionen im Zusammenhang mit einem anderen Geheimnis gefunden hat, das uns beide beschäftigt: dem Poppenwald. In dem 80 Hektar großen Buchenforst zwischen Aue, Schneeberg und Hartenstein soll sich ja bekanntlich ein Depot aus den letzten Tagen des Dritten Reiches befinden, für das sich auch schon die Bernsteinzimmerfahnder der Stasi interessierten (siehe dazu mein Sachbuch Rätselhafter Poppenwald1).
Andreas war im Stasi-Unterlagen-Archiv Berlin auf der Suche nach Akten über den Poppenwald. Eine Sachbearbeiterin legte ihm dabei auch die Dokumente über die drei Wertpapiervernichtungsvorgänge vor, obwohl sich diese erst 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg abgespielt hatten. Das Bindeglied zwischen all diesen Ereignissen ist allerdings in der Tat der Wald: 1984 kam der Transportzug am Eisenbahnhaltepunkt »Poppenwald« bei Niederschlema an. Die für den Weitertransport bereitstehenden Lkw fuhren danach unter anderem durch eben dieses Waldgebiet im Westerzgebirge. Letzteres traf vielleicht auch auf die 1990 eingesetzten Lastkraftwagen zu.
»Das ist doch eine prima Schlagzeile für dich«, meinte Andreas. »Jetzt nachgewiesen: Millionenwerte durch den Poppenwald transportiert.« In dem Zeitungsartikel, der daraus entstanden ist, habe ich diese augenzwinkernde Überschrift allerdings nicht verwendet, denn sie wäre leider falsch gewesen. Die Lastkraftwagen fuhren nämlich erst nach ihrer Entladung am Schacht 311 durch den Poppenwald zurück zum Bahnhof, also leer.
Aber: Selbst dieses unbedeutende Detail findet sich in den Stasiakten. Noch spannender ist natürlich die Frage: Was geschah ab dem Zeitpunkt, an dem die Akten enden?
Mario Ulbrich, Grünhain im Sommer 2024
Prolog im Schindlerschacht: Zwei streng geheime Transporte im Dezember 1983
Prolog im Schindlerschacht
Zwei streng geheime Transporte im Dezember 1983
© Mario Ulbrich
Blick auf das Gelände des Schindlerschachts in Schneeberg. Heute hat hier die Bergsicherung Sachsen ihren Sitz.
Aus Sicht der Stasi war in dieser Geheimoperation der Wurm drin. Allerdings begann die Pannenserie mit einem Hasen, der sich dem schwer bewachten Konvoi auf der Autobahn ohne Rücksicht auf Verluste in den Weg warf.
Es war der 20. Dezember 1983, ein Dienstag. Eine Kolonne aus elf Fahrzeugen befand sich von Leipzig aus auf dem Weg ins Erzgebirge: sechs olivgrüne W50-Sattelauflieger, eskortiert von drei Barkas-B-1000-Kleinbussen, Letztere besetzt mit 23 Angehörigen des Berliner Wachregiments »Feliks Dzierzynski«. Die Dzierzynski-Soldaten galten als die militärische Elite des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Für diesen Einsatz waren sie mit Kalaschnikow-Sturmgewehren ausgerüstet, ihre beiden befehlshabenden Offiziere trugen Makarow-Pistolen am Koppel.
Den Schluss der Kolonne bildete ein Robur-Bus mit 15 weiteren Männern, denen es bei der Erfüllung dieses Auftrags vor allem zukam, ihre Muskeln spielen zu lassen. Vorneweg fuhr ein Lada mit drei Offizieren der Stasihauptabteilung XVIII, die für den Schutz der DDR-Volkswirtschaft zuständig war.
Die Aktion war tags zuvor in Berlin angelaufen. Nach einem Zwischenstopp in Leipzig in der Johannisgasse 16, nur 200 Meter vom Gewandhaus entfernt, hatten die Fahrzeuge des Konvois in den Morgenstunden erneut die Motoren angelassen. Ihr Ziel war jetzt Schneeberg. Bis hierher war alles wie am Schnürchen gelaufen. Aber dann kam der Hase.
Etwa 20 Kilometer von Leipzig entfernt flitzte er über die Autobahn und geriet unter einen der schwerbeladenen Lkw. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, aber die Kolonne musste Halt machen. Ein 2 Wochen später gefertigtes Stasiprotokoll vermerkt als Unfallfolge eine »technische Panne«, die zu einer 30-minütigen Fahrtunterbrechung führte. Der bewaffnete Begleitschutz hatte absolut nichts dagegen tun können.
Nach einer Rast etwa 15 Kilometer vor Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) sprang einer der B 1000 nicht mehr an und musste bis Schneeberg an den Abschlepphaken des Robur-Busses genommen werden. Feixen bei den Muskelmännern, die bis dahin neidisch auf die Sicherungskräfte geschaut hatten, denen diese vermeintlich prestigeträchtigere Aufgabe zugeteilt geworden war.
An der Autobahnabfahrt Reichenbach bog die Kolonne auf die Fernverkehrsstraße 169 ab und rollte über Rodewisch und Wernesgrün durch Stützengrün und Hundshübel bis zur Stadtgrenze von Schneeberg, wo sich eine Kaserne der Nationalen Volksarmee (NVA) befand.
Gleich nebenan zogen in diesen Tagen Bauarbeiter neue Plattenbauten für das Wohngebiet »Hohes Gebirge« hoch. Im Bereich der Baustelle war die Straße gesperrt. Die Fahrer der Militärlaster ignorierten die Warnschilder. »Die Strecke wurde von der Kolonne ohne Behinderung durchfahren«, vermeldete der Transportverantwortliche, Unterleutnant Schönrock von der Hauptabteilung XVIII, später in seinem Abschlussbericht.
Die Bauarbeiter konnten nicht sehen, wohin die Lkw entschwanden, aber sie hatten genug mitbekommen, um sich ihren eigenen Reim auf das Geschehen zu machen.
In der Schneeberger Kaserne wurden seit kurzem Unteroffiziere an Raketen ausgebildet. Es war die Zeit des Nato-Doppelbeschlusses. Erst einen Monat zuvor hatte der Bundestag der BRD der umstrittenen Stationierung neuer Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen (Pershing II) auf westdeutschem Territorium zugestimmt. Es schien logisch, dass die Warschauer Vertragsstaaten reagieren würden, auch auf dem Gebiet der DDR. Und in dieser Situation tauchten in der Nähe einer Kaserne mit einer eigenen Raketenabteilung schwer beladene und scharf bewachte Militärtransporter auf. Was konnte das schon bedeuten?
Tags darauf, am Mittwoch, den 21. Dezember 1983, rollten die Lastkraftwagen ein weiteres Mal von Stützengrün aus kommend an der Wohngebietsbaustelle vorbei. Transportleiter Schönrock hatte kurz zuvor eine weitere Panne verkraften müssen: An der Autobahnabfahrt Reichenbach ließ er einen Lkw mit einem Platten sowie mehrere Soldaten zu seiner Bewachung zurück. Nun kam auch noch Pech dazu, denn diesmal traf die Kolonne auf Bauarbeiter, die sich für Friedenskämpfer hielten.
»Durch einen Arbeiter wurde ein Stahlgestell von circa 3 Metern Länge und 1,50 Metern Höhe auf die Straße gekippt«, schrieb der Stasioffizier später in seinen Bericht. Doch auch ohne diesen Affront gab es kein Durchkommen, denn zusätzlich versperrte ein Tieflader mit Fertigteilen die Durchfahrt. Arbeiter entluden mithilfe eines Drehkrans die im Wohnungsbaukombinat »Wilhelm Pieck« Karl-Marx-Stadt gegossenen Betonplatten – und sie ließen sich viel Zeit damit.
Der Fahrzeugkonvoi kam zum Stehen. Soldaten des Wachregiments sprangen aus den B 1000 und sicherten die Ladung. Schönrock lief zum Kran und »versuchte, die Durchfahrt der Kolonne zu erreichen«. In seinem Bericht verwies der Unterleutnant darauf, dass die Arbeiter »sich weigerten«.
Anscheinend besaßen sie nicht die Befugnis, einen Tieflader mit wohnungspolitisch bedeutsamen Fertigteilen einfach zur Seite zu fahren und damit den weiteren Aufbau des Sozialismus in Schneeberg zu verzögern. Das schien Schönrock sogar einzuleuchten, denn er begab sich auf die Suche nach dem Bauleiter, dessen Aufenthaltsort ihm »bereitwillig erklärt« wurde.
Bloß waren in dem Bauwagen weder der Bauleiter noch sein Stellvertreter anzutreffen. Ein Polier erklärte dem Offizier, beide seien »zu einer Beratung gegangen und nicht auf der Baustelle«. Wann sie wiederkämen? Keine Ahnung. Ob der Brigadier die Arbeiter vielleicht anweisen könne, das Eisengestell und den Tieflader von der Straße zu entfernen? Konnte er nicht, da die widerspenstigen Männer nicht in seinen Verantwortungsbereich gehörten. Er könne mithin keinen Einfluss auf sie nehmen, behauptete er.
Zähneknirschend lief Schönrock zurück zum Kran und forderte die Arbeiter erneut auf, die Straße zu räumen. »Daraufhin wurde mir geantwortet, das Entladen dauere noch circa eine halbe Stunde, die Standgebühren für die Zugmaschine wären zu hoch, und die Raketen, die wir transportieren, hätten diese halbe Stunde auch noch Zeit«, berichtete der Stasioffizier später an seinen Vorgesetzten. Er verstand nur Bahnhof.
Da die schwerfälligen Sattelauflieger (Traglast 25 Tonnen) auf der Fahrbahn nicht wenden konnten, ließ er sie langsam auf die F 196 zurückstoßen. Anstatt die Durchfahrt auf der gesperrten Straße zu erzwingen, nahm die Kolonne nun die reguläre Umleitung um die Baustelle herum.
Das ging beim ersten Mal gut.
Als Schönrock 5 Stunden später den inzwischen reparierten Sattelzug von der Autobahnanschlussstelle Reichenbach heranführen ließ, raste am Ende der Umleitung plötzlich ein Baufahrzeug auf die Kreuzung, wobei es der kleinen Kolonne die Vorfahrt nahm. In den Augen der Stasi ein klarer Akt der Aggression. Den Genossen vom Wachregiment platzte die Hutschnur. Die Begleitmannschaft sprang mit schussbereiten Kalaschnikows aus ihrem B 1000, der Kipperfahrer ergriff die Flucht.
Erst Mitte Januar erfuhr Transportleiter Schönrock, was die Bauarbeiter in Schneeberg 3 Wochen zuvor geritten hatte, sich dem allmächtigen MfS in den Weg zu stellen, und was es mit der kryptischen Bemerkung über einen Raketentransport auf sich hatte. Am 11. Januar 1984 waren der Unterleutnant und sein Vorgesetzter, Major Mein, zu Besuch bei Oberstleutnant Heinz Hattann, dem Leiter der Stasikreisdienststelle Aue. Es war eine Art Canossagang, bei dem die Genossen aus Berlin Abbitte für überzogene Geheimhaltung leisten mussten.
© Bundesarchiv
Diese Skizze fertigte der Transportleiter zum Ärger mit Bauarbeitern im Schneeberger Neubaugebiet Hohes Gebirge an
Hattann war sauer. Weder seine Dienststelle noch die Bezirksverwaltung des MfS in Karl-Marx-Stadt waren vorab über den Geheimtransport nach Schneeberg in Kenntnis gesetzt worden. Die Genossen aus der Hauptstadt hatten sogar zwei verdeckte Dienstreisen ins Revier der Provinztschekisten 2 unternommen, um ihre Aktion vorzubereiten. Lediglich der Direktor der Bergsicherung Schneeberg, Gerd Clauß, war im Bilde gewesen – und hatte gegenüber dem Kreis-MfS wochenlang dichtgehalten. Ganz offensichtlich war er von den Berlinern zu strengstem Stillschweigen verdonnert worden. Ans Licht gekommen war deren Husarenritt am Ende nur, weil der Ärger mit den aufmüpfigen Bauarbeitern – im Stasijargon ein »Vorkommnis« – in Unterleutnant Schönrocks Abschlussbericht an prominenter Stelle erwähnt wurde.
Nun waren Erklärungen fällig.
Hattann dürfte sich eine gewisse Schadenfreude verkniffen haben, als er den Genossen aus der Zentrale auseinandersetzte, dass in der Schneeberger Kaserne Unteroffiziere an Flugabwehrraketen ausgebildet wurden. Diese Marschflugkörper trugen zwar keine Atomsprengköpfe, doch im Kontext mit der Weltlage ergab der Verdacht der Bauleute, die sich mit einem militärisch anmutenden Schwerlasttransport konfrontiert sahen, durchaus Sinn. Heute würde man von einer Verschwörungstheorie sprechen, damals nannte man es einfach ein Gerücht. Mit besseren Vorkenntnissen über die örtlichen Befindlichkeiten sowie die an beiden Transporttagen geltende Umleitung hätten die Stasitransporteure eine Konfrontation vermeiden können. Hattanns Haltung im nun notwendigen Krisengespräch dürfte vorwurfsvoll gewesen sein: Hättet ihr doch mal uns gefragt …
Danach war es an den Berliner Genossen, die Karten auf den Tisch zu legen. Wie sich herausstellte, hatten sich die Bauarbeiter auch hinsichtlich des Ziels der Kolonne getäuscht. Die Lastkraftwagen waren nicht zur NVA-Kaserne unterwegs gewesen, sondern zum Schindlerschacht, der einen halben Kilometer Luftlinie entfernt lag. Dort hatte damals die Bergsicherung Schneeberg ihren Sitz. Deren Direktor Clauß war von den Hauptstädtern nur deshalb eingeweiht worden, weil die Operation ohne den Hausherrn und ohne Bergbaukenntnisse nicht durchführbar gewesen wäre.
Der Schindlerschacht im Schneeberger Ortsteil Wolfgangmaßen ist ein Bergwerk aus dem späten Mittelalter. Ende des 15. Jahrhunderts wurde hier Silber gefunden, 100 Jahre später förderten Bergleute Kobalt zutage. In der wilden Zeit der Wismut, von 1948 bis 1956, folgte der Abbau von Uran. Damals lautete die Bezeichnung der Grube »Schacht 72«, doch der Name »Schindlerschacht« hat sich bis heute gehalten. Seine größte Tiefe beträgt 255 Meter. Nach dem Ende der Uranförderung war in circa 70 Metern Tiefe eine Betonplombe eingezogen worden. Eine Münze, die man im Dezember 1983 in die Schachtröhre warf, erzeugte nach etwa 4 Sekunden ein leises Klimpern. Und tatsächlich hatte die Stasi genau das getan: Sie hatte Geld im Schindlerschacht versenkt, allerdings keine Münzen, sondern Scheine.
Der Ort, von dem aus die Transportkolonne sich in aller Herrgottsfrühe auf den Weg gemacht hatte, war der VEB Wertpapierdruckerei Leipzig. Dieser Betrieb produzierte sämtliche Banknoten und Pässe der DDR. Und nicht nur die. Gegen Devisen wurden hier auch Geldscheine und Ausweisdokumente für andere sozialistische Staaten gefertigt (mehr dazu in Kapitel II »Geld für die Welt: Die Werttransporte des MfS«).
Das Drucken von Banknoten gilt als Königsdisziplin der Wertpapierherstellung, weil in mehreren Durchgängen verschiedene Verfahren zur Anwendung kommen. Nach dem Untergrunddesign folgt beispielsweise ein Stichtiefdruck, bei dem Farbe leicht erhaben aufs Papier gebracht werden muss. Hologramme werden mit einem Heißprägeverfahren auf den Schein gedampft und Kippeffekte mit Farbwechsel durch das Siebdruckverfahren erzeugt. Kurzum: Eine Banknote ist ein komplexes Ding, und bei ihrer Herstellung kann schon mal etwas schiefgehen.
Alle paar Jahre stapelte sich diese Makulatur in den Lagern der Druckerei. Einfach in den Müll werfen kam nicht infrage. Zu groß war die Angst der verantwortlichen Genossen, dass ein Finder mit leicht vermurksten, auf den ersten Blick aber eben doch echt aussehenden Scheinen Schindluder treiben könnte. Ein Recycling des Spezialpapiers war damals noch nicht möglich, und zum Schreddern und Verbrennen fehlten in der DDR die Kapazitäten (siehe Kapitel III »Generalstabsmäßig durchgeplant: Die Aktion ›Vernichtung‹ im November 1984«).
Allein im Dezember 1983 ging es um rund 200 Tonnen Wertpapierabfälle. Im Ministerium der Finanzen war man daher auf eine andere Idee gekommen: Ab in den Schacht damit! Da für Werttransporte innerhalb der DDR das MfS mit seinem Wachregiment zuständig war, wurde aus der Abfalllieferung ein hochgeheimer Militärkonvoi. Stasi – das hieß immer höchste Konspiration.
Obwohl die Genossen von der Hauptabteilung XVIII den Leiter der MfS-Kreisdienststelle am Ende doch noch informieren mussten, taten sie das anscheinend nur höchst widerwillig und unter Zündung verbaler Nebelgranaten.
Nach dem Gespräch meldete Oberstleutnant Hattann an seinen Vorgesetzten in Karl-Marx-Stadt, Generalmajor Siegfried Gehlert, nicht etwa kurz und bündig, dass im Schindlerschacht 200 Tonnen Ausschussgeld abgekippt wurden. Stattdessen schrieb er, es habe sich um »Wertpapiere geheim zu haltenden Charakters des Ministeriums der Finanzen der DDR über ökonomische und finanzpolitische Geschäfte und Beziehungen der DDR mit Entwicklungsländern« gehandelt.
Derart verklausuliert hatten es ihm die Genossen Schönrock und Mein vermutlich dargelegt. Sämtliche Bestandteile dieser so wortreich wie vage gehaltenen Unterrichtung spielten im Hintergrund des klammheimlichen Entsorgungsauftrags zwar eine Rolle, wie wir noch sehen werden, doch Hattanns Meldung brachte die Wahrheit nicht auf den Punkt.
In einem nachgereichten Informationsschreiben wurde die Berliner Zentrale gegenüber der MfS-Bezirksverwaltung später etwas deutlicher. Dort war von »circa 200 Tonnen nichtverwendungsfähigen Geldes aus der Produktion der VEB Wertpapierdruckerei Leipzig« die Rede. Der Stasibezirkschef durfte offenbar ein wenig mehr wissen als sein Kreisleiter.
Aufgrund des »Bauarbeiteraufstandes« von Schneeberg band Berlin die Dienststellen in Karl-Marx-Stadt und Aue in die späteren Geldvernichtungsaktionen im Westerzgebirge ein. Allerdings wurde noch immer höchste Heimlichtuerei praktiziert. Jürgen Tschiedel, früher Major der Staatssicherheit in der Kreisdienststelle Aue, sagte dem Autor, er habe zwar gehört, dass es solche Maßnahmen in alten Schächten gegeben habe, »aber bis zum Ende meiner Dienstzeit habe ich nichts Konkretes darüber erfahren. Da herrschte auch innerhalb unserer Dienststelle strikte Geheimhaltung.«
Ein anderer ehemaliger Offizier des MfS in Aue, von dem es hieß, er sei möglicherweise an den beiden späteren Aktionen beteiligt gewesen, ließ den Autor zwar wissen, dass vor allem über die Operation von 1989/90 »viel Blödsinn erzählt« worden sei. Zum tatsächlichen Geschehen ließ der Mann sich jedoch auch 3 1/2 Jahrzehnte nach dem Ende der Stasi im Interview nicht dazu bewegen, eine Stellungnahme dazu abzugeben: »Damit möchte ich nichts zu tun haben.«
© Mario Ulbrich
Blick aufs Gelände des Schindlerschachts. Unter dem Holzgebäude befindet sich heute die Schachtöffnung.
Welche Geldscheine im Dezember 1983 konkret im Schindlerschacht entsorgt worden sind, geht auch aus den erhalten gebliebenen Stasiakten nicht eindeutig hervor. Eine an den Einsatzbericht von Unterleutnant Schönrock geheftete Aktennotiz legt nahe, dass es sich um Mark der DDR, vietnamesische Dong, angolanische Kwanzas und mosambikanische Meticais handelte.