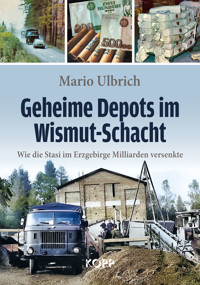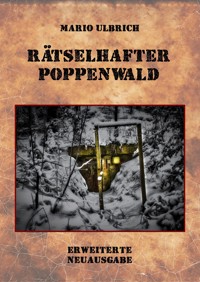
Rätselhafter Poppenwald. Eine Expedition auf den Spuren des verschollenen Bernsteinzimmers. E-Book
Mario Ulbrich
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Wald voller Geheimnisse: Kryptische Baumzeichen, seltsame Steine und mysteriöse Geschichten – seit vielen Jahren beflügelt der Poppenwald die Fantasie von Schatzsuchern und Heimatforschern und heizt die Gerüchteküche an: Wurde hier am Ende des Zweiten Weltkriegs in einem alten Bergwerk das legendäre Bernsteinzimmer versteckt? Ist der ebenfalls bei Kriegsende verschwundene Familienschatz der Hohenzollern hierher gelangt? Befand sich im Poppenwald eine geheime Anlage der Hochtechnologieforschung des Dritten Reichs? Oder ging es um die Falschgeldproduktion der Nazis? Um den Schleier zu lüften, hat der Autor mit mehr als 100 Schatzsuchern, Heimatforschern, Zeitzeugen und unabhängigen Experten gesprochen. Nachdem die Ausgabe von 2011 seit Jahren vergriffen und auch antiquarisch kaum zu bekommen ist, legt er hier eine deutlich erweiterte Neuausgabe mit vielen zusätzlichen Informationen und Fotos vor. Das Buch erscheint in zwei verschiedenen Ausgaben: Als Hardcover mit farbigen Abbildungen und Lesebändchen sowie als Softcover mit Schwarzweiß-Abbildungen zu einem reduzierten Preis. Inhaltlich sind beide Ausgaben identisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mario Ulbrich
Rätselhafter Poppenwald
Eine Expedition auf den Spuren des verschollenen Bernsteinzimmers
© 2023 Mario Ulbrich
Satz & Layout von: Mironde Satzstudio, Niederfrohna
Verlagslabel: Electric Books
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
ISBN
Hardcover
978-3-384-02194-6
Softcover
978-3-384-02193-9
E-Book
978-3-384-02195-3
Fotos: Mario Ulbrich, soweit nicht anders vermerkt
Historische Luftaufnahmen: Luftbilddatenbank Würzburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung »Impressumservice«, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Mario Ulbrich
RÄTSELHAFTER POPPENWALD
EINE EXPEDITION AUF DEN SPUREN DES VERSCHOLLENEN BERNSTEINZIMMERS
Erweiterte Neuausgabe
Im Andenken an Dietmar B. Reimann (1948–2011). Ohne ihn wäre dieser Wald nicht halb so interessant.
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Urheberrechte
Titelblatt
VORBEMERKUNGEN ZUR ERWEITERTEN NEUAUFLAGE
VORWORT
EINFÜHRUNG: DER POPPENWALD
I. RUSSENLIEBCHEN. DIE TOTE FRAU IM WALD.
HINTERGRUND: DAS BERNSTEINZIMMER
II. HIER IST ES! AM WASSERBEHÄLTER DER WISMUT AG
III. REIMANNS FELS. DER TRESOR, DER NICHT ZU KNACKEN IST.
HINTERGRUND: DIE FREIE REPUBLIK SCHWARZENBERG
IV. DACHSBAU INS DUNKEL. VON WEGEN KEIN ALTBERGBAU!
V. HIER WAR ES! ZEITZEUGEN, DIE DAS VERSTECK SAHEN.
VI. STUMME WÄCHTER. RÄTSELHAFTE STEINE IM POPPENWALD.
HINTERGRUND: DER SÄCHSISCHE PRINZENRAUB
VII. HÖHLENRAUB. FÄLSCHUNG EINES HISTORISCHEN ORTES?
VIII. ERSATZSCHÄTZE. FUNDE, DIE MIT DER POPPENWALD-STORY IN VERBINDUNG STEHEN.
IX. GERITZTE BOTSCHAFTEN. MYSTERIÖSE ZEICHEN IN DER BAUMRINDE.
HINTERGRUND: DIE KOCHSCHE RAUBSAMMLUNG
X. GESPENSTER. UNGLAUBLICH WAHRE WALDLEGENDEN.
XI. SINKENDE SCHIFFE. DER GRALSWÄCHTER VOM POPPENWALD.
XII. DER ZWEITE STEINBRUCH. EINE GANZ ANDERE THEORIE.
HINTERGRUND: HOCHTECHNOLOGIEFORSCHUNG IM DRITTEN REICH
XIII. FALSCHMÜNZER IM ERZGEBIRGE. NOCH EINE ALTERNATIVE.
XIV. DIE VERSCHWUNDENE HÖHLE. EINE SPUR AM STOLLENWEG.
KAPITEL XV. FORSCHERSTERBEN. PARANOIA IN DER SCHATZSUCHERSZENE.
EXKURSION I: DIE ISENBURG. EIN RÄTSEL IM RÄTSELHAFTEN WALD.
EXKURSION II: DORNRÖSCHENS ERWACHEN. DAS SCHLOSS IM HARTENSTEINER FORST.
EXKURSION III: NEBEL ÜBER EINEM KRIEGSVERBRECHEN. AM KOHLWEG IN BAD SCHLEMA.
BONUS-EXKURSION: KELLERGEISTER. DIE VERSCHOLLENEN GEWÖLBE DES KLOSTERS GRÜNHAIN.
EIN AUSBLICK WIRD ES WEITERE GRABUNGEN IM POPPENWALD GEBEN?
ANHANG I: KOORDINATEN INTERESSANTER PUNKTE
Orientierungskarte: Wichtige Punkte im Poppenwald
ANHANG II: BAUMGUTACHTEN
DANKSAGUNG
Rätselhafter Poppenwald. Eine Expedition auf den Spuren des verschollenen Bernsteinzimmers.
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
VORBEMERKUNGEN ZUR ERWEITERTEN NEUAUFLAGE
DANKSAGUNG
Rätselhafter Poppenwald. Eine Expedition auf den Spuren des verschollenen Bernsteinzimmers.
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
VORBEMERKUNGEN ZUR ERWEITERTEN NEUAUFLAGE
Die Poppenwaldforschung ist immer für eine spannende Geschichte gut, und so haben sich in den zwölf Jahren seit Erscheinen meines Buches eine Reihe neuer Erkenntnisse angesammelt, die das Bild des rätselhaften Buchenforstes ergänzen. Zahlreiche Hinweise gingen in den Monaten unmittelbar nach der Veröffentlichung von »Rätselhafter Poppenwald« bei mir ein, aber auch später gab es eine Reihe interessanter Entwicklungen, die dem Forschungsstand Aufschlussreiches hinzufügten. In dieser Neuausgabe finden Sie daher weitere Informationen zu Baumzeichen, ergänzende Überlegungen zu den geheimnisvollen Schiffszeichnungen des mutmaßlichen Gralshüters Wolfgang Köhler, zusätzliche Indizien, die für die Suche nach einem Altbergwerk am Stollenweg sowie für eine Untersuchung des sogenannten zweiten Steinbruchs sprechen. Auch neue Überlegungen zum Standort der wahren Prinzenhöhle sind hinzugekommen. All diese Informationen ändern nichts an der Geschichte des Poppenwaldes wie sie in der ersten Auflage dargestellt worden ist, aber sie schienen mir es wert zu sein, aufgeschrieben zu werden.
Hinzugekommen sind auch zahlreiche neue Abbildungen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz besonders bei Dr. Oliver Titzmann aus Bad Schlema, Jürgen Tschiedel aus Aue und Frank Demmler aus Lauter bedanken, die mir drei aufschlussreiche, bis heute nie in einem Buch veröffentlichte historische Fotos zur Verfügung gestellt haben. An den betreffenden Stellen im Text gehe ich darauf ein. Ein mindestens ebenso großer Dank geht an Detlef Köhler, der mir einen kompletten Satz der mysteriösen Schiffszeichnungen aus dem Nachlass seines Vaters zur Verfügung gestellt hat. Über die Bedeutung der Skizzen, die nach Meinung etlicher Forscher verschlüsselte Lagepläne darstellen, rätselt man in der Schatzsucherszene seit 20 Jahren. Hier werden sie nun erstmals gemeinsam abgebildet. Vielleicht kommt ja einem Leser die entscheidende Idee, wie die Zeichnungen zu lesen sind.
Des weiteren habe ich Fehler der Erstauflage korrigiert, für die ich mich bei meinen Lesern entschuldigen möchte. (Um ein Beispiel zu nennen: Natürlich wussten sowohl ich als auch meine damaligen Korrekturleser, dass der Arbeiteraufstand in der DDR am 17. Juni 1953 stattfand, nicht 1957, dennoch ist dieser Tippfehler durchgegangen.)
Einer Korrektur bedurften leider auch alle Passagen, die den Poppenwald als einen der schönsten Laubmischwälder des Erzgebirges bezeichnet haben. Nach drei großflächigen Holzernten, bei denen Wege zerstört, bedeutungsvolle Bäume beschädigt und der Waldboden durch liegengelassenes Totholz stellenweise schwer passierbar gemacht wurde, ist er das nicht mehr. Alle Aspekte, die mit Spaziergängen im Poppenwald zu tun hatten, wurden deshalb gestrichen. Beibehalten habe ich die Koordinaten von Objekten und Wegmarken, die mit der Schatzsuche zu tun haben. An vielen Punkten werden Sie den beschriebenen Zustand heute leider nicht mehr vorfinden, trotzdem ist es für Interessierte hilfreich, die einstigen Positionen der Sachzeugen ausfindig machen zu können.
Manche Forscher sind der Überzeugung, dass diese Geländemarken absichtlich zerstört oder bis zur Unkenntlichkeit verändert wurden, um die weitere Suche nach der von Dietmar Reimann postulierten Untertageanlage zu erschweren und ihr Auffinden vielleicht sogar zu verhindern. Ich selbst glaube nicht, dass wir es mit einer Verschwörung zu tun haben. Ich halte die unschöne Entwicklung im Poppenwald für eine Begleiterscheinung des modernen Waldbaus, bei der Forstarbeiter wie die sprichwörtliche Axt, oder besser: wie der Harvester im Walde hausen. Das Ergebnis ist freilich das gleiche. Andererseits: Die neuralgischen Punkte im Poppenwald sind wohlbekannt. Man muss sie bloß endlich konsequent untersuchen.
Eine Reihe Leser fragten mich, wieso ich die anderthalb Jahre von Dietmar Reimanns Grabungen nach dem Bernsteinzimmer im früheren Zisterzienser-Kloster Grünhain ausgelassen habe. Der Grund war, dass ich in einem Buch über den Poppenwald räumlich nicht so weit abschweifen wollte, aber natürlich stellt auch das Kloster eine Fassette dieser Geschichte dar, zumal es im Sommer 2012 und danach weitere Bestrebungen gab, die Suche nach einem historischen Kellergewölbe fortzusetzen, das am Ende des Zweiten Weltkriegs als potenzielles Versteck für Raubkunst in Frage gekommen wäre. Entgegen seinen Behauptungen hat der Bernsteinzimmerdetektiv dieses Rätsel nämlich keinesfalls gelöst. Deshalb reiche ich die Schatzsucher-Geschichte zum Kloster Grünhain in dieser Neuauflage als Bonus-Kapitel nach.
Was mir beim Aktualisieren meines Buchmanuskripts aufgefallen ist: Hinter viele Namen von Zeitzeugen und Akteuren musste ich das Kreuz für »verstorben« (†) machen und ihre Aussagen ins Präteritum setzen, da sie nicht mehr unter uns weilen. Viele Menschen, mit denen ich während meiner Recherchen gesprochen habe, die ich persönlich gut kannte und die teilweise über Jahre hinweg ebenso wie ich Begleiter des Poppenwald-Mysteriums waren, sind inzwischen tot. Umso wichtiger erscheint es mir, dass ihre Hinweise, Ansichten und Theorien mit dieser Neuauflage für kommende Forschergenerationen wieder verfügbar gemacht werden. Das alte Buch ist heute selbst antiquarisch kaum noch zu bekommen.
Nicht zuletzt habe ich mit dieser Arbeit dem Drängen einiger Poppenwald-Fans nachgegeben, die um mein Vorhaben wussten, eine erweiterte Fassung des Buches herauszubringen. Jahrelang haben sie mir in den Ohren gelegen, der Idee endlich die Tat folgen zu lassen. Also, Torsten und Micha, das hier ist ein bisschen auch euer Werk. Ich hoffe, die neuen Informationen und Abbildungen haben zu spannenden Seiten geführt.
Mario Ulbrich
Grünhain im Herbst 2023
VORWORT
Begegnungen zwischen Wanderern im Poppenwald sind anders als Begegnungen in anderen Wäldern. Selten ein neutrales »Glück auf!«, kein gleichgültiges Wegsehen. Stattdessen wissende, neugierige, misstrauische Blicke: Wer bist du und was suchst du hier?
Dabei ist Letzteres durchaus wörtlich zu verstehen. Als 1997 der frühere Pionieroffizier und Privatdetektiv Dietmar Reimann im Poppenwald die erste Baggerschaufel auf der Suche nach dem legendären Bernsteinzimmer kreisen ließ, war das der Auftakt für ein Schatzsuche-Fieber, das trotz aller Misserfolge bis heute nicht abgeklungen ist. Die im Zweiten Weltkrieg verschollene Bernsteintäfelung, der Familienschatz der Hohenzollern, eine geheime Anlage der Wunderwaffenforschung des Dritten Reichs, Beutekunst unbestimmter Herkunft – im Poppenwald wird vieles vermutet. Deshalb werfen Wanderer einander seltsame Blicke zu. Könnte ja sein, dass der andere drauf und dran ist, einen Schatz zu heben.
Manchmal beinhalten die Blicke eine stumme Frage: Kennt sich der fremde Wanderer in diesem Wald aus? Weiß er über die möglichen Verstecke Bescheid, über die verschlüsselten Zeichen in den Bäumen, über die Geschichten, die Insider sich zuraunen?
Dieses Buch soll den Schleier ein wenig lüften. Es ist als Wegweiser und anregende Lektüre für den interessierten Waldgänger gedacht, der selbst nicht zu den Eingeweihten zählt.
Die endgültige Antwort darauf, welcher Schatz im Poppenwald zu finden ist und welche der vielen Theorien ins Schwarze trifft, liefert das Buch nicht. Diese Antwort kennt der Autor selbst nicht. Seiner Ansicht nach hat jede dieser Überlegungen ihre Berechtigung – so lange bis ihr Sinn oder Unsinn durch einen Fund bewiesen ist.
EINFÜHRUNG: DER POPPENWALD
Der Poppenwald birgt ein Geheimnis aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs – davon sind viele Menschen überzeugt. Zahlreiche mysteriöse Geschichten ranken sich um ihn. Bevor wir uns diesen Rätseln zuwenden, wollen wir kurz rekapitulieren, was wir unzweifelhaft über den faszinierenden Buchenforst wissen.
Der Poppenwald zwischen Wildbach und Hartenstein ist einer der wenigen Wälder im Erzgebirge, die nicht von Nadelhölzern dominiert werden. Er erstreckt sich zwischen dem Borbachtal und dem Höhenzug, auf dem die Isenburgruine liegt. Er ist 80 Hektar groß und besteht zu drei Vierteln aus Laubbäumen. Eichen, Buchen und Birken sind am stärksten vertreten. Die Hälfte der Bäume sind 50 bis 80 Jahre alt. Im Poppenwald gibt es Reh- und Schwarzwild, viele Spechte und unzählige Eichelhäher, der Uhu kommt vor, und vom Luchs heißt es, dass er das Gebiet hin und wieder durchstreift. Bekannt sind auch mindestens zwei Vorkommen des geschützten Feuersalamanders. Teile des Poppenwaldes gehören zum europäischen Schutzgebiet »Muldental bei Aue«, einem Flora-Fauna-Habitat (FFH-Gebiet).
Nicht weit von hier, im Hartensteiner Bärengrund, wurde Mitte des 18. Jahrhunderts der letzte Braunbär der Region geschossen. Auch im Poppenwald selbst soll es Bären gegeben haben. Eine Höhle, die hier existierte, wurde Bärenhöhle genannt, und der Name des Borbachtals, das den Wald im Südosten begrenzt, leitet sich ebenfalls von den zotteligen Großraubtieren ab. Einen Bären nannte man im Mittelalter einen »Bor«.
Der Poppenwald ist voll beeindruckender Buchen und knorriger Eichen. Viele von ihnen sind krumm und verdreht gewachsen und haben so genannte Augen, wo schmale Triebe sich zu Ästen entwickelt haben. Das macht ihren Reiz aus, aber als Holz für Bretter sind solche Bäume kaum geeignet. »Ökologisch gesehen sind unsere Bäume erstklassig, aber wirtschaftlich ist der Wald ein Zuschussgebiet«, erklärt Leila Reuter, die zuständige Revierförsterin. Deshalb wird der Poppenwald seit Ende der 1990er-Jahre umgestaltet. Schlanke Bäume mit wenigen Ästen sollen herangezogen werden, wozu Dickicht vonnöten ist. Weil es dort nicht viel Licht gibt, wachsen die Schösslinge langsam, sodass ihr Holz nicht reißt. Und im Bestreben, mehr Licht zu tanken, wachsen sie in der Regel kerzengerade nach oben. Reuters Vorgänger Wolfgang Schlegel hat mit diesem Umbau begonnen. »Und nach mir werden viele Förster so weitermachen müssen, bis wir wirtschaftlich interessante Bäume haben«, sagt die Försterin. In 100 bis 200 Jahren werde der Wald Gewinne abwerfen, schätzt sie.
Leila Reuter ist Försterin der Kirchlichen Waldgemeinschaft Westerzgebirge, einem Zusammenschluss von 39 Kirchgemeinden zwischen Großwaltersdorf bei Freiberg und Stangengrün im Vogtland, zwischen Niederwiesa bei Chemnitz und Johanngeorgenstadt an der Grenze zu Tschechien. Alle Gemeinden haben ein Stück Wald eingebracht, 1000 Hektar insgesamt. Der Lößnitzer Kirchenwald ist mit 440 Hektar das größte Waldgebiet der Gemeinschaft, der Poppenwald mit 80 Hektar Forstfläche das zweitgrößte. Eigentümerin des Areals ist die Evangelisch-Lutherische Stadtkirchgemeinde (bis vor kurzem noch: Nicolaikirchgemeinde) Zwickau, die Gottesdienste im imposanten Marien-Dom der Robert-Schumann-Stadt abhält.
Der Name des Waldes wird oft auf seine Eigentümerin, die Kirche, zurückgeführt. Poppenwald komme von »Pope«, heißt es dann, doch ob das stimmt, ist fraglich. Popen waren Priester der orthodoxen osteuropäischen Kirchen, und von denen gab es hier keine.
Der Schatzsucher Dietmar Reimann, der mehr als 15 Jahre in Sachen Poppenwald forschte, hat einen anderen Ursprung für die Bezeichnung angeboten: Karl Wilhelm Popp, Oberforstmeister am Hofe der Fürsten von Sachsen-Coburg-Gotha, wollte 1854 Auguste Amalie von Herder, eine junge Frau aus Schneeberg und Urenkelin des Dichters Johann Gottfried von Herder, heiraten. Das Problem der Liebenden: Sie war eine Protestantin, er ein Katholik. Um die Ehe zu ermöglichen, ließ Popp von der Zwickauer Domkirche seine Konfession ändern. Als Gegenleistung überschrieb die Familie Herder der Kirche ein Stück Wald – den heutigen Poppenwald, der demzufolge nach Karl Wilhelm Popp benannt wurde, dessen Konfessionswechsel der Kirchgemeinde den neuen Besitz eingebracht hatte.
Der Name Popp ist es dann auch, der laut Reimann einen Bogen zu den im Poppenwald vermuteten Schätzen schlägt. Karl Wilhelm war ein Vorfahr des Chefs der Deutschen Abwehr im Zweiten Weltkrieg, Admiral Wilhelm Canaris, und zugleich ein Vorfahr von Minna Mutschmann, der Ehefrau des sächsischen Nazi-Gauleiters Martin Mutschmann. Diese beiden wiederum besaßen einen Verwandten namens Albert Popp. Albert war Standartenführer im Nationalsozialistischen Fliegerkorps Sachsen, ein Neffe von Mutschmann und zudem ein Vetter von Admiral Canaris. Er wurde bereits von Paul Enke, dem Chef-Bernsteinzimmersucher des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR, als einer der Männer ausgemacht, die mit der Verbringung des heute weltberühmten Kunstwerks zu tun haben sollen. Reimanns Überlegung lautete also: Ein Popp nutzte den Wald seiner Vorfahren, um eine geheime Mission zu erfüllen …
Gut zusammengereimt, offenbar aber daneben. Glaubt man Reimanns Version, hatte die Familie Herder den Wald von seinem früheren Besitzer geerbt – keinem geringeren als Martin Römer, dem Zwickauer Amtshauptmann, der im 15. Jahrhundert nach der Entdeckung der Schneeberger Silbervorkommen als Bergwerksbesitzer reich wurde. »Römer kaufte den Wald im März 1478 von den benachbarten Schönburgern«, weiß der Wildbacher Heimatforscher Jürgen Hüller. »Direkt nach dem Kauf verschenkte er die Hälfte des Areals an das Spital St. Georgen in Zwickau. Das belegen historische Dokumente.«
Martin Römer wollte im Poppenwald Bergbau betreiben, doch als ihm klar wurde, dass es hier kein Silber gab, veräußerte er die zweite Hälfte des Waldes für 320 Gulden ebenfalls an das Zwickauer Krankenhaus, das damals zur Moritzkirche gehörte. Von dort aus muss der Wald in den Besitz der Domkirche gekommen sein, mutmaßt Hüller. Und mehr noch: Als Martin Römer das Flurstück 1478 bei Friedrich von Schönburg erwarb, hieß dieses bereits »Poppenholz«. Auch das geht aus den alten Unterlagen hervor. Karl Wilhelm Popp hatte damit ebenso wenig zu tun wie irgendwelche ominösen Popen. »Wo der Name wirklich herkommt, konnten wir bislang nicht ermitteln«, fügt Jürgen Hüller hinzu.
Er hat aber weitergeforscht und eine neue Erklärung ins Spiel gebracht: Demnach könnte der Wald im 9. oder 10. Jahrhundert nach einem der Würzburger Bischöfe benannt worden sein, die damals die durch den Forst führende fränkische Straße nutzten, um Mönche zu den heidnischen Slawen zu schicken, die christianisiert werden sollten. Möglicherweise, so Hüller, hatten die Bischöfe im strategisch günstig gelegenen Wald sogar eine Einsiedelei errichtet. Mehrere der infrage kommenden Bischöfe trugen den Namen Poppo …
Der Wildbacher Genealoge Stefan Espig findet Hüllers Gedankengang interessant, meint aber, dass es auch ein paar Nummern kleiner gehen müsse: »Poppo ist ein Spitzname für Volkmar. Nehmen wir doch einfach an, dass der einstige Besitzer der Isenburg, den wir nicht kennen, Volkmar hieß. Dann haben wir vielleicht den Ursprung des Namens Poppenholz gefunden.«
Nicht einmal die Nicolaikirchgemeinde selbst kann heute nachvollziehen, wo der Name herkommt und wie sie in den Besitz des Waldstücks gekommen ist. Das Kirchenarchiv sei zu ungeordnet, um diese Frage kurzfristig zu beantworten, teilte der damalige Kirchenvorstandsvorsitzende Frank Bliesener dem Autor dieses Buches im Jahr 2011 auf eine entsprechende Anfrage mit.
Obwohl Jürgen Hüller die Recherchen von Detektiv Reimann für nicht stichhaltig hält, zweifelt auch er nicht daran, dass es im Poppenwald ein Rätsel aus den letzten Kriegstagen gibt.
Reimann und Hüller sind nicht die einzigen.
»Ich habe immer gespürt, dass es mit diesem Wald etwas auf sich hat«, sagt Frank Schröder, der im benachbarten Wildbach wohnt und ein Experte für die Rätsel des Poppenwaldes ist. Schröder kennt jeden Weg, jeden Baum, jede seltsame Einritzung in den mächtigen Buchenstämmen, und wenn jemand einen Stein im Poppenwald umwendet, kann er sicher sein, dass Frank Schröder lange vor ihm darunter nachgesehen hat. Der Wildbacher hat die Arbeiten von Schatzsucher Reimann praktisch von der ersten Stunde an begleitet. Er ist überzeugt, dass eines Tages jemand Erfolg haben und ein bedeutendes Geheimnis enthüllen wird.
Schröder hat mit zahlreichen Zeitzeugen gesprochen. Manche berichteten ihm, dass bei Kriegsende im Poppenwald etwas vorgegangen sei. Andere weigerten sich, etwas zu sagen. Doch immer wieder hörte er, dass der Wald im März und April 1945 eine Zeitlang abgesperrt war. Oft ist die Rede von SS-Posten. Was haben sie bewacht? Was geschah in dem abgeriegelten Gelände? Es gibt verschiedene Aussagen darüber, wo genau die Postenkette verlief und wie undurchlässig sie wirklich war (einige Einheimische scheinen sie überwunden zu haben), doch unterm Strich kann man festhalten, dass im Poppenwald etwas Heimliches vor sich gegangen ist.
Eine Geschichte aus dieser Zeit wurde Schröder in der eigenen Familie überliefert. »Ein 14-Jähriger Junge schlich sich in den Wald«, erzählt er. »Er kam nicht wieder, zwei Tage lang. Am dritten Tag ging der Ortsbauernführer in den Wald, redete mit den Soldaten und brachte den Jungen zurück.« Der Ortsbauernführer war Frank Schröders Schwiegeropa. Was sie im Wald gesehen haben, wollten weder er noch der Junge jemals verraten.
Natürlich gibt es viele Menschen, die nicht daran glauben, dass der Poppenwald ein Geheimnis hütet. Doch wurden Skeptiker schon häufig umgestimmt, wenn sie mit offenen Augen durch diesen Buchenforst mit seiner mystischen Ausstrahlung gegangen sind.
Möglicherweise ist an den Geschichten ja doch etwas dran.
Der Poppenwald. Links oben Bad Schlema. Foto: Stefan Unger
Nebulöser Poppenwald im Herbst, immer wieder geheimnisvoll.
Im Poppenwald gibt es unzählige beeindruckende Bäume.
I. RUSSENLIEBCHEN. DIE TOTE FRAU IM WALD.
Jahrelang kam ein Mann aus Chemnitz nach Bad Schlema im Westerzgebirge, immer am 5. März. Zwischen dem Ortsteil Niederschlema und Hartenstein betrat er den Poppenwald, orientierte sich kurz, bis er einen bestimmten Baum gefunden hatte, und legte einen Strauß Blumen in den verharschten Schnee. Ihre Blüten waren weit und breit der einzige Farbtupfer in dem um diese Jahreszeit noch trostlosen Winterwald. 60 Jahre zuvor war diese Stelle ein Tatort. Am Vormittag des 5. März 1952 wurde hier die Leiche einer jungen Frau gefunden.
Dieser Mord ist eines der vielen Poppenwald-Rätsel.
Der Name der Toten war Christine Müller, sie wohnte in Schneeberg und arbeitete in Lauter als Dolmetscherin für die Sowjetische Aktiengesellschaft (SAG) Wismut, dem Bergbauunternehmen, das Uran für Stalins Atombombe förderte. Als Christine Müller ihrem Mörder begegnete, war sie auf dem Weg zum Bahnhof in Niederschlema. Es war stockfinster, ein damals noch unbefestigter Fahrweg führte durch den Poppenwald. Etwa 150 Meter von der Hauptstraße und nur einen Kilometer vom Bahnhof entfernt, schlug der Mörder zu. Er würgte die 24-Jährige, zerrte sie von der Straße in den Wald und schlang ihr ihren Kleidergürtel um den Hals. Er zog sein Opfer rücklings gegen einen Baum und verknotete den Gürtel hinter dem Stamm.
Als man die Leiche fand, war sie über und über mit Dreck beschmiert, auch in ihren Haaren und im Gesicht klebte Schlamm. Die Tote saß auf dem Waldboden, gegen den schmalen Fichtenstamm gelehnt, den Kleidergürtel noch um den Hals. Der Gürtel hielt ihren Körper in aufrechter Position, sodass einer der Zeugen, der später am Tatort vorbeilief, sich täuschen ließ. Der Mann dachte, da hocke eine Frau zwischen den Sträuchern, die sich erleichtert. Er senkte den Blick und ging rasch weiter.
Die vermutlich erste Person, die an der Leiche vorbeikam, war Ruth Meier (†), eine von zwei Töchtern des Poppenwald-Försters Arthur Praus. Sie war damals 25 Jahre alt, kaum ein Jahr älter als die Tote, und auch sie war auf dem Weg zum Bahnhof. Seit dem Mord mochten zwei Stunden vergangen sein. Ruth Meier war in Eile, sie musste zur Arbeit. In der Morgendämmerung sah sie etwas Unförmiges im Wald liegen. »Ich dachte, dort hätten sie nachts wieder Unrat abgeladen«, erinnerte sie sich im Gespräch mit dem Autor. »Als ich abends erneut an der Stelle vorbeikam, standen Kriminalbeamte da. Ein Mann fragte mich, ob ich das tote Mädel am Morgen nicht gesehen habe.«
Gefürchtet habe sie sich nach dem Mord nicht, erklärte Ruth Meier. »Angst, was ist das? Ich kenne keine Angst.« Aber eine Frage ging ihr immer wieder durch den Kopf: Warum musste Christine Müller sterben?
Der Leipziger Autor Henner Kotte hat die Ermittlungen in seinem Buch »Vergessene Akten: Ungelöste Kriminalfälle« ausführlich beschrieben. Christine Müller hatte nicht nur im Rahmen ihrer Dolmetschertätigkeit Kontakte zur sowjetischen Besatzungsmacht. Auch privat pflegte sie Beziehungen zu russischen Offizieren und Soldaten. Mit mehreren dieser Männer unterhielt sie Liebschaften, von einem hatte sie ein Kind. Offenbar litt die junge Frau seit geraumer Zeit unter der Geschlechtskrankheit Syphilis, die bereits ihre zersetzende Wirkung im Gehirn begonnen hatte.
Die Arbeit der deutschen Kriminalisten wurde von den sowjetischen Behörden behindert, Befragungen der Liebhaber kamen nicht zu Stande. In der Hoffnung, doch noch Hinweise auf den Täter zu erhalten, lobte der zuständige Bezirksstaatsanwalt einen Monat nach dem Mord 3000 Mark Belohnung aus. Damals eine hohe Summe. Es half nichts: Der Fall wurde nie aufgeklärt.
Das öffnete Spekulationen Tür und Tor. »Es ging das Gerücht um, die Müller habe zu viel gewusst und sei deshalb um die Ecke gebracht worden«, erinnerte sich Ruth Meier.
Zu viel gewusst – worüber?
Frau Meier zuckte mit den Schultern: »Irgendwas von den Russen?«
Der inzwischen verstorbene Privatdetektiv und Schatzsucher Dietmar Reimann glaubte, dass das Mordmotiv in Ereignissen zu suchen ist, die sieben Jahre zurücklagen. Im April 1945 waren bewaffnete Posten im Poppenwald aufgezogen, nahe dem Wildbach lagerte eine Einheit der Organisation Todt. Das war die militärische Bautruppe des Dritten Reiches. Deren Angehörige haben Luftschutzbunker, unterirdische Hallen für die von Luftangriffen gefährdete Rüstungsproduktion und Kunstschutzdepots errichtet. Auch KZ-Häftlinge sollen im Poppenwald gearbeitet haben. Eine Reihe von Forschern sind überzeugt, dass damals eines oder mehrere Geheimverstecke angelegt worden sind.
Kommandeur der Bausoldaten war Gottfried Brunner, der Sohn des damaligen Poppenwald-Jagdpächters Willi Brunner. Möglicherweise, so Reimanns Theorie, hatte er den Wald für die Geheimoperation ausgewählt, weil er sich dort auskannte.
Während seine Soldaten in Zelten schliefen, logierte Gottfried Brunner in der Jagdhütte seines Vaters. Diese stand gut 600 Meter von Zeltplatz entfernt – ein halbwegs verschwiegener Ort, an dem es sich der Anführer zusammen mit einem oder zwei Freunden gut gehen ließ. An den Abenden erhielten sie Besuch von Mädchen aus der Gegend. Diese Geschichte hat Schatzsucher Reimann von mehreren Frauen erzählt bekommen, wobei freilich jede der Zeitzeuginnen betonte, sie selbst sei niemals in der Jagdhütte gewesen, einige andere aber schon.
Christine Müller war bei Kriegsende 17. Ein Alter, in dem sie durchaus an nächtlichen Vergnügungen teilgenommen haben könnte, wie Reimann glaubte. Zumal, wenn man ihren Ruf als loses Mädchen bedenkt. »Man nannte sie eine Offiziersmatratze«, sagte er.
Sieben Jahre später erzählte dann eine Krankenschwester den Mordermittlern, Christine Müller habe an den Spätfolgen einer Syphilis gelitten. Zu neurologischen Störungen, der sogenannten Spätsyphilis, kann es laut Robert-Koch-Institut bereits ab einem Jahr nach der Infektion kommen, wobei häufig 10 oder sogar 20 Jahre vergehen. Im Alter von 17 könnte das Mädchen somit bereits einen lockeren Lebenswandel gewohnt gewesen sein, was sie zur Kandidatin für nächtliche Besuche bei jungen Offizieren in einer Jagdhütte machte.
Möglicherweise hatte sie dabei etwas über den Auftrag der Männer aufgeschnappt oder etwas gesehen, das auf die Geheimdepots hinwies, die im Poppenwald angelegt wurden. Vielleicht war sie 1952 drauf und dran, ihren sowjetischen Freunden das Geheimnis anzuvertrauen und musste deshalb zum Schweigen gebracht werden. Dietmar Reimann dachte in diese Richtung.
Der Mund der 24-Jährigen soll beim Auffinden der Leiche ebenfalls voller Dreck gewesen sein. »Das ist ein klares Signal an Eingeweihte«, erklärte der Detektiv. »Es bedeutet: Verräterin. Sie musste zum Schweigen gebracht werden. Schweigen wie im Grab.«
Eine schaurige Geschichte, die ihre Wirkung auf Zuhörer nicht verfehlt, und die deshalb immer wieder als Erklärung für den Tod der Dolmetscherin herangezogen wird. Ein Tötungsdelikt aus den 1950er-Jahren ist auf diese Weise Teil der rätselhaften Vorgänge im Poppenwald geworden, die sich am Ende des Zweiten Weltkriegs abgespielt haben. Möglich ist diese Version natürlich.
Aber ist sie auch wahrscheinlich?
Liest man den Bericht, den Autor Henner Kotte mithilfe der Polizeiakten verfasst hat, gelangt man zu dem Schluss, dass Raub das naheliegende Motiv für den Mord gewesen ist.
Christine Müller war in jener Nacht auf dem Weg zum Bahnhof, weil sie den Fernzug nach Westberlin erreichen wollte. Im Auftrag ihrer Mutter sollte sie Wertpapiere aus einer Erbschaft zu Geld machen. Außerdem hatte sie mindestens 400 Mark in bar bei sich, vermutlich jedoch weit mehr. So erhielt die Staatsanwaltschaft den Hinweis, dass sowjetische Offiziere der Dolmetscherin zirka 20.000 Mark mitgegeben hätten. Sie sollte im Westen der geteilten Hauptstadt für ihre Vorgesetzten einkaufen. Von dem Geld und den Wertpapieren fehlte nach Entdeckung der Leiche jede Spur.
Ein anderes logisches Motiv ist ein Beziehungsstreit. Christines Schwester, ihre Mutter sowie diverse Nachbarn und Bekannte berichteten den Ermittlern von lautstarken Auseinandersetzungen im Umfeld der Ermordeten. Mal zankte sich die junge Frau mit einem Liebhaber, dann wieder hatten Angehörige der sowjetischen Streitkräfte untereinander Krach, weil sie mitbekamen, dass es die zungenfertige Deutsche offenbar mit ihnen allen getrieben hatte. Auch war es zu einer Konfrontation mit einem Offizier gekommen, nachdem dieser herausgefunden hatte, dass er sich bei Christine Müller mit der Syphilis infiziert hatte.
Eifersuchtsdrama oder Raubmord – diese Erklärungen sind wahrscheinlicher als die Verschwörungstheorie vom Landserflittchen, das zum Russenliebchen wurde und sterben musste, weil es ein Geheimnis hütete, oder besser gesagt: nicht genug hütete. Dennoch gehört die Theorie, dass Christine Müller Zeugin einer Geheimaktion im April 1945 war, heute fest zum Kanon der mysteriösen Poppenwald-Geschichten.
Auch der Mann, der am Jahrestag des Mordes wiederholt Blumen am Tatort niederlegte, hat über diese Theorie nachgegrübelt. Er heißt Hans-Jürgen Hänßchen, hat die Akten ebenfalls studiert und alle Möglichkeiten wieder und wieder im Kopf gewälzt. Eines Tages, so hoffte er immer, wird er den Fall lösen. Vermutlich gelingt es ihm nicht, den Mörder einer Strafe zuzuführen, aber vielleicht wird er wenigstens eine zufriedenstellende Erklärung finden.
Der Mittsiebziger aus Chemnitz ist fasziniert von Geheimnissen, die mit Schätzen, Verschwörungen und alternativer Geschichtsschreibung zu tun haben. Seine Wohnung ist vollgestopft mit tausenden Sachbüchern, und bei der Wahl seiner Forschungsgebiete ist Hans-Jürgen Hänßchen ein Hans Dampf in allen Gassen. Er engagierte sich bei den Untersuchungen um das geheimnisvolle Jonastal in Thüringen, wo nach Meinung etlicher Hobby-Historiker im Zweiten Weltkrieg eine deutsche Atombombe entwickelt wurde. Er beobachtet die Ausgrabungen in Deutschneudorf (Mittleres Erzgebirge), wo nahe der tschechischen Grenze ebenfalls nach dem Bernsteinzimmer, aber auch nach Goldbarren und jüdischen Familienreichtümern gefahndet wird. Gibt es irgendwo in Mitteldeutschland Gerüchte über eine unter mysteriösen Umständen versiegelte Gruft, ist Hans-Jürgen Hänßchen nicht weit.
Dietmar Reimanns Suche nach dem Bernsteinzimmer hat ihn zum Zaungast im Poppenwald gemacht, doch es ist vor allem die Geschichte der erwürgten Christine Müller, die ihn immer wieder in den schaurig-schönen Buchenforst lockte. Hänßchen glaubt, dass ihn eine Verwandtschaftsbeziehung mit der Ermordeten verbindet, doch er verrät nicht, wie diese aussehen soll. »Das habe ich noch nicht vollends aufgeklärt«, sagt er. »Das ist nicht spruchreif.«
Mit den Blumen am Tatort wollte er der Toten Ehre erweisen. »Sie war eine hübsche Frau – und klug dazu«, erklärt er. »Obwohl sie noch jung war, sprach sie so gut Russisch, dass sie als Dolmetscherin arbeiten konnte. Das dürfen Sie nicht vergessen.« Ein leidenschaftliches Statement, das dem schlechten Ruf der Ermordeten etwas entgegensetzen will.
Jedes Jahr am 5. März legte Hänßchen also Blumen nieder. Dann lief er eine halbe Stunde durch die Gegend, nahm den Strauß wieder an sich und ging Ruth und Manfred Meier besuchen, die nicht weit entfernt im alten Forsthaus lebten. Von Ruth Meier ließ er sich noch einmal alles berichten, was diese über den Mord vor 70 Jahren wusste, und erzählte seinerseits, was er Neues herausgefunden hatte. Wenn Hans-Jürgen Hänßchen dann nach Hause ging, ließ er die Blumen bei Meiers im Forsthaus zurück. Eine rührende Tradition, die mit dem Tod des Rentnerehepaars vor einigen Jahren endete.
Dass Christine Müllers Ermordung mit dem Versteck des Bernsteinzimmers zu tun hatte, bezweifelten Ruth und Manfred Meier allerdings.
An diesen Baum soll die tote Christine Müller geknotet gewesen sein. Laut Polizeiakten handelte es sich aber um eine Fichte.
Auch dieser Baum, etwa 100 Meter vom ersten entfernt, gilt als Tatort. Der wirkliche Tatort-Baum wurde vermutlich gefällt.
Im Poppenwald gibt es viele Plätze, die unheimlich wirken.
HINTERGRUND: DAS BERNSTEINZIMMER
Mehr als 300 Jahre alt und seit beinahe acht Jahrzehnten verschollen: Das Bernsteinzimmer ist zu einem Mythos geworden. Ohne sein Verschwinden wäre es kaum so berühmt geworden. Sein Wert wurde auf 130 Millionen Euro hochgeredet. Wird es gefunden, dürfte sich diese Summe rasch verflüchtigen, denn der Mythos Bernsteinzimmer speist sich aus den Rätseln, die es umgeben.
Das Bernsteinzimmer wurde von 1701 bis 1712 im Auftrag des Preußenkönigs Friedrich I. angefertigt: 55 Quadratmeter Wandtäfelung aus Sonnenstein. Dazu Spiegel, Leuchter, Leim und Eichenbohlen. Zunächst zierte die Wandverkleidung das Tabakskollegium im Berliner Stadtschloss. 1716 überließ Friedrichs Sohn, Friedrich Wilhelm I., das Kunstwerk dem russischen Zaren Peter I, vermutlich um das Bündnis beider Mächte gegen die Schweden zu besiegeln. So kam die Wandverkleidung ins Zarenpalais bei St. Petersburg. Um 1755 wurde sie in die Sommerresidenz der Zarenfamilie bei Zarskoje Selo eingebaut. In diese Zeit fallen erhebliche Erweiterungen des Prachtkabinetts, die von Zarin Katharina der Großen in Auftrag gegeben wurden. Zuletzt bestand das Bernsteinzimmer aus 144 Einzelteilen (nur 22 davon waren preußische »Originale« aus der Zeit des Barock, die restlichen 122 Teile russische Erweiterungen aus dem Rokoko, darunter auch Spiegel, Leuchter und vier Steinmosaike.) 1941 wurde das Kunstwerk von deutschen Soldaten nach Königsberg abtransportiert, wo sich die Spur bei Kriegsende verliert.
Manche Experten glauben, das Bernsteinzimmer sei Ende August 1944 bei einem Angriff englischer Bomber auf Königsberg verbrannt. Die britischen Journalisten Adrian Levy und Catherine Scott-Clark fanden in russischen Archiven unveröffentlichte Dokumente, die eine andere Zerstörungs-These stützen: der sowjetische Kunstsachverständige Anatoli Kutschumow, der gleich nach Kriegsende beauftragt war, das Schicksal des Bernsteinzimmers zu ermitteln, kam in einer ersten Untersuchung zu dem Schluss, dass die in Kisten verpackte Wandtäfelung im April 1945 nach der Eroberung Königsbergs durch die Rote Armee bei einem Feuer verbrannte, das sowjetische Soldaten gelegt hatten, entweder aus Rache oder aus Disziplinlosigkeit. Sein Bericht soll Diktator Stalin jedoch nicht gefallen haben. So wurde eine zweite Untersuchung veranlasst, die dann zu dem Ergebnis kam, das Bernsteinzimmer müsse Königsberg verlassen haben und noch immer existieren. Das Motiv dafür sei politischer Natur gewesen, glauben Levy und Clark. Denn so konnte das von den Nazis in Zarskoje Selo geraubte Kunstwerk zum zentralen Argument der Sowjets werden, ihre eigene Beutekunst nicht an Deutschland zurückzugeben.
Andere Forscher freilich meinen, das Bernsteinzimmer sei Ende 1944/Anfang 1945 tatsächlich von Königsberg aus in Richtung Westen abtransportiert worden. Auch die Ermittler des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR vertraten diese These. Kurz vor der Wende favorisierten sie das Westerzgebirge als Verbringungsort.
Zuletzt machte der Mecklenburger Autor Hartwig Niemann mit einer Version von sich reden, die sowohl die Verbrennungs- als auch die Erhaltungs-These in sich vereint:
In Königsberg seien die Rokoko-Teile des Bernsteinzimmers verbrannt, weil die Schlossverwaltung sie für nebensächlich erachtete und nur nachlässig sicherte – im Gegensatz zu den Barock-Teilen, die das britische Bombardement im Wesentlichen überstanden hätten und später abtransportiert worden sind. Niemann geht davon aus, dass 16 barocke Teile (von 22) erhalten geblieben sind.
Der Bernsteinzimmer-Experte Wolfgang Eichwede, der bis 2008 Leiter der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen war, kennt nach eigenem Bekunden 300 Theorien, was mit dem Zimmer passiert sein könnte, und 180 Orte, an dem nach ihm gesucht worden ist. Einer davon ist der Poppenwald bei Wildbach, zwei weitere sind der Nikolaistollen in Katharinaberg (Tschechien) und der benachbarte Katharinenstollen im erzgebirgischen Deutschneudorf. Weitere Orte in Sachsen, Thüringen und nach der deutschen Wiedervereinigung auch in den alten Bundesländern kommen hinzu. Gefunden wurde das Bernsteinzimmer bis heute nicht. Wo wurde es versteckt? Historiker Eichwede urteilt: »Die Spuren, die man hat, besitzen den Wert einer 100 Jahre alten Wettervorhersage. Es ist alles Spekulation.«
Dennoch sind zwei Inventarstücke aus dem Bernsteinzimmer 1997 wieder aufgetaucht. Es handelt sich um ein Mosaik aus Halbedelsteinen und eine Holzkommode, die beide um 1760 in das ursprüngliche Bernsteinkabinett eingefügt worden sind. Das Steinmosaik sollte auf dem Schwarzmarkt für 2,5 Millionen Dollar verkauft werden. Die Behörden kamen dahinter, Kommandopolizisten der Landeseinsatzeinheit Brandenburg schlugen bei der Übergabe in Bremen zu. Der Notar, der den Verkauf für einen Bremer Rentner einfädeln wollte, wurde später zu 50.000 Mark Geldstrafe verurteilt. Der Rentner starb vor Prozessbeginn.
Durch die Schlagzeilen verunsichert, übergab eine Berliner Immobilienmaklerin den Behörden die Kommode, die einst im Bernsteinzimmer gestanden hatte. Die Frau hatte das Möbelstück 1978 von der Abteilung Kommerzielle Koordinierung (KoKo) des DDR-Außenhandelsministeriums, deren Aufgabe die Beschaffung von Devisen war, für 20.000 Westmark erworben. Der Leipziger Tischler Johannes Elste erinnerte sich, dass er die Kommode 1978 im Auftrag des Staatlichen Kunsthandels restauriert hatte. Die DDR-Kunsthändler schalteten damals regelmäßig Anzeigen in Tageszeitungen, mit denen sie nach Antiquitäten suchten. Bei einer dieser Aktionen müssen sie auf die Kommode gestoßen sein. Aus dem Zustand des Möbelstücks schloss Elste, dass dieses lange Zeit in einer Scheune gestanden hatte. Der Amateur-Schatzsucher Ralf Puschmann aus Chemnitz behauptet, die Scheune habe zu einem Gehöft im Raum Aue-Hartenstein gehört. Der Mann, auf dessen Hof das Möbelstück gestanden haben soll, sei 1974 gestorben. »Danach fing seine Frau an, Wertsachen zu verkaufen, die ihr Gatte zuvor nicht angetastet hatte«, sagt Puschmann. Da er die Identität der Familie nicht preisgibt, sind seine Informationen nicht nachprüfbar.
Kommode und Steinmosaik sind durch die Bundesregierung an Russland zurückgegeben worden. Im Katharinenpalast, der heute ein Museum ist, kann seit 31. Mai 2003 ein neues Bernsteinzimmer besichtigt werden. Russische Bernsteinkünstler hatten bereits seit 1976 an der Rekonstruktion des sogenannten Achten Weltwunders gearbeitet. Sie stützten sich dabei auf noch vorhandene Fotografien des Originals. Die deutsche Ruhrgas AG hatte für die Wiederherstellung sieben Millionen Mark spendiert.
Eine zunehmende Anzahl von Forschern glaubt heute, das alte Bernsteinzimmer sei nach den Krieg von den Russen gefunden und heimlich in die Sowjetunion zurückgeführt worden, wo es möglicherweise im neuen Bernsteinzimmer aufgegangen ist.
Was wäre, würden die verschollenen Wandverkleidungen doch noch gefunden? Iwan Sautow, der damalige Direktor des Museumparks von Zarskoje Selo, erklärte dazu während der Präsentation des rekonstruierten Weltwunders: »Das alte Bernsteinzimmer wird in einem Zustand sein, in dem eine Wiederherstellung aussichtslos ist.« Sautow hoffte dennoch, dass das Original eines Tages aus seinem Versteck auftaucht. Er hatte sogar einen Plan für diesen Tag: »Man sollte es so, wie es ist, konservieren und zusammen mit unserem neuen Kunstwerk ausstellen.«
II. HIER IST ES! AM WASSERBEHÄLTER DER WISMUT AG
Der Poppenwald wird durch die Wildbacher Hauptstraße in zwei Hälften geteilt, eine im Südosten, die andere im Nordwesten gelegen. Mehr als ein Jahrzehnt lang galt der südöstliche Teil (landläufig »der obere Teil« genannt) als der mit den Schätzen. Das lag daran, dass der Ex-NVA-Offizier, Privatdetektiv und Schatzsucher Dietmar Reimann in dieser Hälfte des Waldes ganz offen nach dem Bernsteinzimmer und dem Hohenzollernschatz suchte. Reimanns Interesse galt ausschließlich diesem Gebiet und innerhalb dessen wiederum einem eng umrissenen Areal um einen markanten Felsen. Jedes Jahr kam Reimann mit neuen Aspekten seiner Theorie an, die er freimütig kundtat, und die allesamt um seinen Felsen kreisten. Dadurch wurde das kleine Gebiet äußerst populär. Das Versteck im Poppenwald? Das ist die Stelle oben am Wasserbehälter!
Der Hochbehälter wurde im Herbst 2015 durch die Wismut GmbH im Zuge der Bergbausanierung abgerissen. Zurückgeblieben ist nur ein Holzlagerplatz voller Schotter, der allmählich zuwuchert, doch jahrelang reichte allein schon das mysteriös anmutende Bauwerk aus, um die Fantasie von Spaziergängern zu beflügeln. Ein Portal aus Beton, das sich unter einen künstlich aufgeschütteten Hügel kauerte, verschlossen mit einer rostigen Eisentür, halb versteckt unter Moos und Farnen – wo, wenn nicht hier, sollte sich der Eingang zu der vermuteten unterirdischen Anlage befinden?
Überall, bloß nicht an einem so offensichtlichen Ort! Denn natürlich würde der Zugang eines heimlichen Verstecks kaum so offen daliegen. Tatsächlich ist der Wasserbehälter auch erst in den Jahren 1953 bis 1956 erbaut wurden, also ein Jahrzehnt nach der mutmaßlichen Geheimoperation im Poppenwald. Er gehörte zu einem System von mindestens fünf Hochbehältern in der Region, die über eine Ringleitung miteinander verbunden waren und der Wismut AG zur Zeit des aktiven Uranbergbaus Brauchwasser lieferten. In Betrieb waren nach dem Ende der Uranförderung nur noch zwei dieser Hochbehälter – einer auf dem Gleesberg zwischen Aue und Schneeberg, der andere im Poppenwald.
»Der Speicher bezog sein Wasser aus dem Markus-Semmler-Stollen bei Bad Schlema. Es wurde zum Gleesberg gepumpt, von wo aus es über die Ringleitung zum Hochbehälter Poppenwald lief«, erläutert Frank Wolf, Unternehmenssprecher der Wismut GmbH Chemnitz. Das Unternehmen ist die Nachfolgerin der 1947 gegründeten Sowjetischen Aktiengesellschaft (SAG) Wismut, die 1954 zur Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft (SDAG) wurde und bis 1990 in Sachsen und Thüringen mehr als 250.000 Tonnen Uran produzierte, den Grundstoff für die sowjetische Atommacht. Mit der Einstellung der Uranerzförderung übernahm die Wismut GmbH die Rekultivierung der Bergbaulandschaften.
Auch der Hochbehälter im Poppenwald spielte dabei eine kleine Rolle: Er lieferte Wasser für eine Reifenwaschanlage im östlichen Teil des Waldes. In der Vergangenheit mussten Fahrzeuge, die den Bergbaubereich verließen, gewaschen werden, um kein radioaktives Material auf den Straßen zu verteilen. Zuletzt ging es vor allem noch darum, den Schlamm von den Lastkraftwagen zu spülen, die bei der Haldensanierung eingesetzt wurden.
Unweit des Wasserbehälters befinden sich zwei weitere Relikte aus der Wismut-Ära: Der ehemalige Schacht 372, beinahe einen Kilometer tief, der für die Be- und Entlüftung des Uranreviers Schlema-Alberoda zuständig war, sowie ein Bunker, der von der Zivilverteidigung der DDR genutzt worden ist. Nach der politischen Wende stand der Bunker wochenlang offen und wurde von Neugierigen ausgiebig unter die Lupe genommen. Heute liegt er unter Erdmassen verschüttet. Selbst ein vor wenigen Jahren noch gut sichtbares Entlüftungsrohr ist inzwischen verschwunden. Die Gemeinde Bad Schlema nutzte das Gelände noch jahrelang als Außenstelle ihres Bauhofes.
Der Schacht 372 wurde Anfang der 1990er-Jahre, lange vor den Bernsteinzimmer-Gerüchten, mit tausenden Tonnen Eisenbahnschotter verfüllt, das Schachtloch mit einer Betonplatte verschlossen. Die Wismut GmbH ließ eine Schicht Mutterboden auftragen und Bäume pflanzen. Dort, wo die Bergleute einst in die Tiefe fuhren, gibt es heute nur noch einen Kontrollpunkt, der wie der Einstieg in einen Abwasserschacht aussieht.
Obwohl hier also zwei nachgewiesene Untertageanlagen existiert haben, vermochten weder der Schacht noch der Bunker die Fantasie von Abenteuerlustigen so stark zu beflügeln wie der mysteriös anmutende Hochbehälter.
Die rostige Tür am Wasserbehälter führte in einen so genannten Schieberraum. Hinter ihr verbargen sich lediglich einige Handräder und Ventile zur Steuerung des Wasserflusses.
Was nicht heißt, dass das Bauwerk nicht doch von dem einen oder anderen Geheimnis umgeben war.
Da war zum einen die alte Buche am Weg vor dem Hochbehälter. Der gewaltige Baum ist unglaublich verästelt, und es ist nicht klar, wie er diese Form entwickeln konnte. Leila Reuter, die Försterin des Poppenwaldes, vermutet, dass der Haupttrieb vor langer Zeit kaputtgegangen ist und mehrere Seitentriebe danach zu mächtigen Stämmen heranwuchsen. Ebenso gut können sich aber auch zwei oder drei Stämme zu einem einzigen Baum verschlungen haben. Und nicht nur die Form der alten Buche ist ein Rätsel.
Auf halber Höhe sind eine Reihe Einritzungen zu erkennen – überwiegend kyrillische Buchstaben. Selbst der nüchterne Denker Reimann hat bei seinen ersten Besuchen im Poppenwald erregt auf diese Schriftzeichen gestarrt und überlegt, welche Botschaft sie wohl beinhalten mögen. Einen Hinweis, der irgendwie mit den Einlagerungen bei Kriegsende zu tun hat?
Es gilt heute jedoch als Konsens unter Poppenwaldforschern, dass die kyrillischen Lettern aus der Nachkriegszeit stammen. Die verbreitetste Meinung lautet, dass die Besatzer beim Bau des Wasserbehälters zum Strafdienst verdonnerte Rotarmisten einsetzten, die sich hier verewigt haben. Im richtigen Licht ist ein russischer Name mit dem Zusatz »Sowjetski Armi« zu lesen, dazu die Jahreszahl 1948. Das deutet auf russische Soldaten in der Anfangsphase der Wismut-Aktivitäten hin. Damals wurde unweit von hier ein Uranstollen aufgefahren. (Siehe auch Kapitel IV. Dachsbau ins Dunkel. Von wegen kein Altbergbau!)
Um den Wasserbehälter selbst freilich gab es einige Auffälligkeiten, die vielleicht doch etwas mit dem vermuteten Versteck zu tun hatten.
Beispielsweise der Unternehmer, dem die Sowjets die Leitung beim Bau des Hochbehälters übertrugen. Er stammte aus Oberschlema und besaß im Poppenwald einen kleinen Steinbruch. Nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR fiel er bei seinen Auftraggebern in Ungnade, seine Firma wurde durchsucht, sein Garten durchwühlt. »Die Russen hatten den Tipp bekommen, dass er 1945 mit Einlagerungen zu tun hatte«, wollte Schatzsucher Reimann in Erfahrung gebracht haben. »Sie suchten nach Waffen, fanden aber nichts, und der Unternehmer war erst einmal entlastet. Trotzdem zog er es vor, sich wenig später in den Westen abzusetzen.«
Mit einem Waffendepot hatte der Firmenchef Reimanns Meinung nach tatsächlich nichts zu tun. Die Anzeige soll von einem Mann gekommen sein, der sich 1945 in russischer Kriegsgefangenschaft befand und erst Monate später nach Wildbach zurückkehrte. Von möglichen Einlagerungen kann er persönlich also nichts mitbekommen haben, kombinierte der Detektiv. Seine Frau, die das Kriegsende alleine zu Hause verbrachte, hingegen schon.
»Ich denke, die Frau gehörte zu denen, die bei Gottfried Brunner und Konsorten in der Jagdhütte im Poppenwald zu Gast waren«, erklärte Reimann. »Dabei hat sie Gerüchte gehört, in denen auch der Name des Unternehmers fiel. Sie erzählte es ihrem Mann, der damit zu den Russen lief. Bloß wussten beide nicht, worum es wirklich ging, und die Sowjets konnten sich damals nichts anderes als Vorbereitungen für einen Umsturzversuch vorstellen. Dem Bauunternehmer wurde die Sache zu heiß, und er verschwand.«
Reimann versuchte, mit der Frau zu sprechen: »Sie weigerte sich, mit mir zu reden, ihr Mann verwies mich des Hofes.« Hatten die Leute Angst? Womöglich spielte dabei das Schicksal der ermordeten Christine Müller eine Rolle, spekulierte der Detektiv. Womit die Ereignisse von 1945 ihre Schatten nicht nur bis 1952 geworfen hätten, ins Todesjahr der Dolmetscherin, sondern bis in die heutige Zeit, in der es noch immer einige potenzielle Zeugen vorziehen, zu schweigen wie das sprichwörtliche Grab. Und auch die alte Jagdhütte spielte wieder eine Rolle …
Im August 2001 haben sich Reimann und seine Mannschaft auf die Suche nach den Resten der ominösen Kate gemacht. Von Ruth Meier, der Förstertochter, wussten sie den ungefähren Standort. Nachsehen konnte nicht schaden. Vielleicht hatte Gottfried Brunner, der Mann von der Organisation Todt, ja irgendwo im Umfeld der Hütte einen Hinweis hinterlassen.
Die Jagdhütte war eigentlich nur ein Eisenbahnwaggon, den sich der Jagdpächter Willi Brunner hatte in den Wald schaffen lassen. Dort stand er – ohne Räder –neben einem der kleinen Steinbrüche des Oberschlemaer Bauunternehmers. Der Waggon sei aber mehr als bloß ein Provisorium gewesen, erinnert sich Ruth Meier. Auch soll Willi Brunner sich die Mühe gemacht haben, einen Keller unter die Jagdhütte zu graben … Beim Baggern fanden Reimanns Männer diesen Keller tatsächlich – aus Ziegelsteinen gemauert, etwa 1,50 Meter breit, 1,50 Meter lang und 1,50 Meter tief. Im Boden der Jagdhütte hatte es früher eine Klappe gegeben, durch die man in den Verschlag hinuntersteigen konnte. Dort unten war es dem Besitzer möglich, Lebensmittel kühl aufzubewahren.
Zurückgeblieben waren von damals allerdings lediglich ein paar leere Weinflaschen. Obwohl Reimann auch neben und unter dem Ziegelsteinkeller großzügig Erde ausheben ließ, fanden seine Leute nichts von Bedeutung. Der gemauerte Keller wurde bei diesen Arbeiten zerstört. Geblieben sind nur ein paar Ziegelsteine im Erdreich. Dass die Stelle mit bloßem Auge heute nicht mehr zu erkennen ist, ist dem Können von Colin Fanghänel geschuldet, Reimanns langjährigem Baggerführer, einem Virtuosen seiner Zunft. Die kompliziertesten Wünsche des Schatzsuchers quittierte Colin mit einem abschätzenden Blick, einem tiefen Zug aus seiner Zigarette und einem Schulterzucken. Dann setzte er sich in die Kabine und legte los. Der Weg am Steinbruch, der während der Kellersuche arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, sah hinterher besser aus als zuvor. Colin handhabte den Arm eines Zehntonnenbaggers wie ein Florett, den eines Dreieinhalbtonners wie ein Skalpell.
»Ich möchte meinen Enkeln mal erzählen können, dass ich dabei war, als das Bernsteinzimmer gefunden wurde«, sagte er immer. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat.
Zumindest gibt es zu Willi Brunners Jagdhütte eine Geschichte, die den Verdacht nährt, dass im Frühjahr 1945 eine von langer Hand vorbereitete Geheimaktion im Poppenwald abgelaufen ist.
»Zuvor hatte man meinem Großvater die Jagdpacht für den Wald entzogen und ihm ein Austauschrevier zugewiesen«, berichtete Willi Brunners Enkel Alfred (†). »Als er wissen wollte, bis wann er seine Hütte abbauen muss, gab man ihm zu verstehen, dass er sie stehen lassen kann. Später werde er die Jagdpacht zurückbekommen.«
Offenbar wollten die Drahtzieher der Aktion den Jagdpächter, der ja ein ständiges Betretungsrecht für sein Revier besitzt, eine Zeit lang aus dem Weg haben. Allein dieser Geschichte wegen war Alfred Brunner überzeugt: »Im Poppenwald ist etwas.«
Die Chance, in den Überresten der Jagdhütte auf einen Hinweis zu stoßen, war von Dietmar Reimann als gering eingeschätzt worden. Doch er ließ sich nie davon abbringen, dass er in dem Bauunternehmer aus Oberschlema auf eine Person gestoßen ist, die mit der Geheimoperation im Poppenwald zu tun hatte. Wahrscheinlich nicht mit dem Verbringen der Schätze selbst, wohl aber mit ihrer endgültigen Verwahrung nach dem Zweiten Weltkrieg.
»Ursprünglich war das Versteck nur auf ein paar Monate oder wenige Jahre ausgelegt«, meinte Reimann. Doch als sich die Sowjets dauerhaft in der Gegend festsetzten, zwei deutsche Nachkriegsstaaten entstanden und der Kampf der Systeme begann, muss den Leuten, welche die Anlage hatten bauen lassen, klar geworden sein, dass sie sich auf eine lange Wartezeit einrichten müssen. »Mit dem Bau des Wasserbehälters ergab sich die Gelegenheit, das Depot in ein langfristiges Versteck umzuwandeln«, so Reimann. Und der Steinbruchbesitzer sei der Mann gewesen, der den Plan in die Tat umsetzte.
Tatsächlich spricht einiges für diese Hypothese.
Bis zuletzt stand die Überlegung im Raum, dass der Wasserbehälter über dem Lichtloch eines alten Bergbaustollens errichtet wurde. Dieser Stollen sei zum Versteck ausgebaut worden, und das verschüttete Lichtloch war möglicherweise ein Weg, um ohne allzu großen Aufwand an das Depot heranzukommen. Der Bauunternehmer, so die These, setzte dann den Hochbehälter über das Lichtloch und versiegelte das Versteck dauerhaft.
Hans Päßler (†), ein von der Schatzsuche infizierter Rentner aus Marienau bei Zwickau, bemühte sich, die Baupläne des Hochbehälters ausfindig zu machen. Päßler arbeitete viele Jahre bei der Wismut und nutzte seine Kontakte zu früheren Arbeitskollegen. Diese zeigten sich hilfsbereit, was die Schatzsucher aber nicht weiterbrachte. Denn: Die Baupläne für den Wasserbehälter im Poppenwald blieben unauffindbar. Die Wismut GmbH hatte später größte Mühe, verlässliche Angaben über das Bauwerk zu machen. So bezifferte Unternehmenssprecher Frank Wolf das Fassungsvermögen des Behälters auf »schätzungsweise 350 Kubikmeter«. Mangels Unterlagen war es ihm nicht möglich, genaue Werte zu nennen. Er musste sich auf das verlassen, was alteingesessene Kollegen aus ihrer Erinnerung hervorkramten.
Hans Päßler gelang es, eine Lageskizze aufzutreiben, auf welcher der Wasserbehälter verzeichnet ist. Etwa in der Mitte des Bauwerks ist eine Kritzelei zu erkennen, eine Art unregelmäßiges Kreuz. Einige Forscher halten dies für ein Markscheiderzeichen, das für einen verwahrten Schacht steht. Somit könnte das Symbol ein Hinweis sein, dass sich unter dem Hochbehälter tatsächlich das Lichtloch eines alten Stollens befunden hat.
Doch das Zeichen auf der Skizze ist nicht eindeutig. Üblicherweise wird ein aufgegebener Schacht durch die Bergmannswerkzeuge Schlägel und Eisen dargestellt, die auf dem Kopf stehen. Auf eine Skizze reduziert, sieht das dann wie zwei gekreuzte Striche aus, jeweils mit einem Haken daran. Das Symbol auf dem Poppenwald-Riss ähnelt diesem Zeichen, aber es gibt nur die gekreuzten Striche, die Haken fehlen.
Als der Heimatforscher Klaus-Dieter Karl vor Jahren mithilfe eines Metalldetektors die Zu- und Ableitungen des Wasserbehälters ausfindig machen wollte, winkte einer der alten Wismut-Mitarbeiter ab: Da könne er lange suchen, die Rohre seien aus Plastik.
Karl: »Alle anderen Hochbehälter der Wismut in der Region besaßen Eisenrohre. Nur im Poppenwald ist Kunststoff verwendet worden. Vielleicht, um das Aufspüren der Leitungen unmöglich zu machen?« Die meisten Poppenwaldforscher sind überzeugt davon.
Als Reimann während der Arbeiten an seinem Fels massive Probleme mit eindringendem Wasser bekam, stand für ihn fest: Der Wasserbehälter ist Teil einer raffinierten Falle. Dazu im nächsten Kapitel mehr. Anzumerken ist an dieser Stelle jedoch, dass beim Abriss des Hochbehälters im Herbst 2015 nichts entdeckt wurde, das Reimanns Vermutung bestätigt hätte. Die Wismut-Mitarbeiter haben in Absprache mit dem Autor damals eigens ein Auge darauf geworfen. Allerdings konnten sie nicht tiefer graben als ihr Auftrag das vorsah. Mach Meinung der Verfechter von Reimanns Theorie war das nicht tief genug. Noch ein, zwei Meter mehr und wir hätten es gehabt