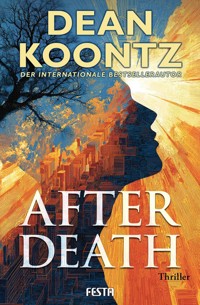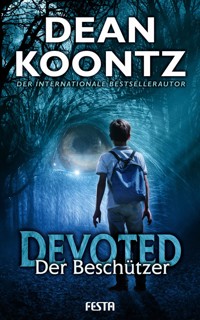Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HarperCollins bei Lübbe Audio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jane Hawk
- Sprache: Deutsch
Die allseits beliebte Lehrerin Cora Gundersun beendet ihr Leben und das vieler Unschuldiger in einem riesigen Feuerball. Als später nach Hinweisen für ihre Tat gesucht wird, findet man ein Tagebuch, das nur den Schluss zulässt, dass die Täterin geisteskrank war.
Jane Hawk weiß es besser - hat sich ihr Mann doch ebenfalls aus heiterem Himmel das Leben genommen. Auf ihrer Suche nach Antworten hat sie eine Verschwörung bis in höchste Regierungskreise entdeckt - und jagt nun deren Hintermänner. Mittlerweile ist die FBI-Agentin die meistgesuchte Person der USA. Doch ihre mächtigen Gegner haben nicht damit gerechnet, dass Jane bereit ist, alles zu riskieren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
»So gut Suizid war, dieses Buch ist noch besser.« Booklist
»Ein vielschichtiger Thriller, bei dem die Charaktere den Ton angeben und der fast unmöglich wegzulegen ist.« Bookreporter
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 52 min
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2019 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © 2017 by Dean Koontz Originaltitel: »The Whispering Room« Erschienen bei: Bantam Books, New York
Published by arrangement with Penguin Random House LLC, New York
Covergestaltung: Büro für Gestaltung / Cornelia Niere, München Coverabbildung: OneyWhyStudio / shutterstock Redaktion: Tobias Schumacher-Hernández E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959678018
www.harpercollins.de
Widmung
Dieses Buch ist Richard Heller gewidmet:
ein Fels in turbulenten Zeiten,
seit fast dreißig Jahren mein Freund,
Anwalt und kluger Berater,
der weiß, dass das wertvollste Gold
auf vier Pfoten daherkommt.
Zitat
Und dann haben sie gar keine Spielregeln, wenigstens wenn sie welche haben, so beobachtet sie Niemand.
LEWIS CARROLL,Alice’s Abenteuer im Wunderland
Im Bienenstock arbeiten die Bienen nur im Dunkel; Denken funktioniert nur im Stillen, und auch Tugend wirkt nur im Geheimen.
THOMAS CARLYLE,Sartor Resartus
TEIL EINS: DIE METHODE HAWK
EINS
Cora Gundersun schritt durch hoch aufloderndes Feuer, ohne zu verbrennen, und auch ihr weißes Kleid ging nicht in Flammen auf. Sie war nicht ängstlich, sondern im Gegenteil beschwingt, und die vielen Menschen, die dieses Schauspiel bewunderten, starrten sie an, während der Feuerschein auf ihren erstaunten Gesichtern flackerte. Sie riefen ihren Namen, aber nicht besorgt, sondern staunend, mit einem Unterton von Verehrung in ihren Stimmen, sodass Cora zu gleichen Teilen Entzücken und Demut darüber empfand, dass sie unverwundbar gemacht worden war.
Dixie, ihr gescheckter Langhaardackel, weckte Cora, indem er ihre Hand leckte. Die Hündin hatte keinen Respekt vor Träumen, nicht einmal vor diesem, den ihr Frauchen drei Nächte nacheinander genossen und Dixie in lebhaftesten Farben geschildert hatte. Der Tag war angebrochen, es wurde Zeit für Frühstück und Morgentoilette, die Dixie wichtiger waren als jeder Traum.
Cora war vierzig Jahre alt und agil wie ein Vogel. Während die kurzbeinige Hündin die Trittleiter am Bett hinuntertappte, sprang Cora auf, um sich dem Tag zu stellen. Sie schlüpfte in die knöchelhohen Pelzstiefel, die ihr im Winter als Hausschuhe dienten, und folgte dem watschelnden Dackel im Schlafanzug durchs Haus.
Kurz bevor sie die Küche betrat, glaubte sie plötzlich zu wissen, am Küchentisch würde ein fremder Mann sitzen – und etwas Schreckliches würde passieren.
Natürlich wartete dort niemand auf sie. Cora war eigentlich nie ängstlich gewesen. Sie schalt sich jetzt selbst, weil sie sich von nichts, absolut nichts hatte ins Bockshorn jagen lassen.
Als sie ihrer Gefährtin frisches Wasser und Trockenfutter hinstellte, wischte der langhaarige goldene Dackelschwanz voller Vorfreude über den Fußboden.
Bis Cora die Kaffeemaschine gefüllt und eingeschaltet hatte, hatte Dixie aufgefressen. An der Hintertür stehend blaffte die Hündin jetzt einmal höflich.
Cora riss ihren Mantel vom Haken und schlüpfte hinein. »Mal sehen, ob du dich so schnell entleeren kannst, wie du dich vollschlägst. Draußen ist’s höllisch kalt, meine Süße, also bitte nicht trödeln.«
Als sie aus der Wärme des Hauses auf die Veranda trat, bildete ihr Atem eine Dampfwolke, als werde ein Schwarm Geister, von dem sie lange besessen gewesen war, ausgetrieben. Sie blieb oben an der Treppe stehen, um für den Fall, dass sich hier noch ein übellauniger Waschbär nach seinem nächtlichen Beutezug herumtrieb, über die kostbare Dixie Belle zu wachen.
Seit gestern Morgen waren über dreißig Zentimeter spätwinterlicher Schnee gefallen. Weil es windstill war, trugen die Tannen noch immer Hermelin-Stolen auf allen Ästen. Cora hatte hinter dem Haus eine größere Fläche freigeschaufelt, damit Dixie nicht durch den tiefen Pulverschnee pflügen musste.
Dackel haben gute Nasen. Ohne sich darum zu kümmern, dass sie nicht trödeln sollte, lief Dixie Belle kreuz und quer über die geräumte Fläche, hatte die Nase am Boden und wollte wissen, welche Tiere hier nachts vorbeigekommen waren.
Mittwoch. Ein Schultag.
Obwohl Cora seit zwei Wochen nicht mehr unterrichtete, hatte sie noch immer das Gefühl, sich beeilen zu müssen, um nicht zu spät in die Schule zu kommen. Vor zwei Jahren war sie zu Minnesotas Lehrerin des Jahres gekürt worden. Die Kinder ihrer sechsten Klasse, die ihr sehr fehlten, liebte sie aufrichtig.
Plötzliche Migräneanfälle von fünf bis sechs Stunden Dauer, manchmal von üblem Gestank begleitet, den nur sie wahrnehmen konnte, hatten sie dienstunfähig gemacht. Die Medikamente gegen die Kopfschmerzen schienen allmählich anzuschlagen: Zolmitriptan und Soma, ein Muskelrelaxans. Cora war nie kränklich gewesen, und das zwangsweise Daheimbleiben langweilte sie.
Dixie Belle pinkelte endlich und hinterließ zwei kleine Würste, die Cora später mit einem Plastikbeutel einsammeln würde, wenn sie hart gefroren waren.
Als sie dem Dackel zurück ins Haus folgte, saß ein fremder Mann am Küchentisch und trank Kaffee, den er sich einfach selbst eingegossen hatte. Er trug eine Wollmütze. Den Reißverschluss seiner Fleecejacke hatte er geöffnet. Sein Gesicht war lang, seine Züge waren scharf, sein kalter blauer Blick direkt.
Bevor Cora erschrocken aufschreien oder flüchten konnte, sagte der Eindringling: »Spiel Manchurian mit mir.«
»Alles klar«, sagte sie, weil er plötzlich nicht mehr bedrohlich wirkte. Schließlich kannte sie ihn. Er war ein netter Mann. Er hatte sie letzte Woche mindestens zweimal besucht. Er war ein sehr netter Mann.
»Zieh deinen Mantel aus und häng ihn auf.«
Sie tat wie geheißen.
»Komm her, Cora. Setz dich.«
Sie zog einen Stuhl heraus, setzte sich an den Tisch.
Obwohl Dixie sonst jedermanns Freundin war, zog sie sich in eine Ecke zurück, um die Szene von dort aus mit einem hellblauen und einem braunen Auge wachsam zu beobachten.
»Hast du letzte Nacht geträumt?«, fragte der nette Mann.
»Ja.«
»Wieder den Feuertraum?«
»Ja.«
»War’s ein guter Traum, Cora?«
Sie nickte lächelnd. »Er war wundervoll, ein wundervoller Gang durch beruhigendes Feuer, völlig ohne Angst.«
»Heute Nacht wirst du den Traum wieder haben«, sagte er.
Sie lächelte und klatschte zweimal in die Hände. »Oh, gut! Das ist ein entzückender Traum. Ähnlich wie einer, den ich als Mädchen manchmal hatte – der Traum, wie ein Vogel fliegen zu können. Fliegen, ohne Angst vor einem Absturz zu haben.«
»Morgen ist der große Tag, Cora.«
»Wirklich? Was passiert dann?«
»Das weißt du, wenn du morgen aufstehst. Ich komme nicht wieder her. Auch wenn diese Sache sehr wichtig ist, brauchst du niemanden, der dich an der Hand führt.«
Er trank seinen Kaffee aus und stellte den Becher vor sie hin, stand auf und schob seinen Stuhl unter den Tisch. »Auf Wiedersehen, du blöde, dürre Schlampe.«
»Tschüs«, sagte sie.
Eine blinkende Zickzacklinie aus winzigen Lichtern schob sich in ihr Blickfeld: die Aura einer heraufziehenden Migräne. Sie schloss die Augen, fürchtete die bevorstehenden Schmerzen. Aber die Aura zog vorbei. Die Kopfschmerzen blieben aus.
Als sie die Augen öffnete, stand ihr Becher mit einem kleinen Rest Kaffee vor ihr. Sie stand auf, um sich selbst nachzugießen.
ZWEI
An einem Sonntagnachmittag im März hatte Jane Hawk – in Notwehr und großer Verzweiflung – einen guten Freund und Mentor erschossen.
Drei Tage später, an einem Mittwoch, als der Nachthimmel mit Sternen wie Brillanten besetzt war, die nicht einmal der Widerschein des Lichtermeers im San Gabriel Valley nordöstlich von Los Angeles ganz überstrahlen konnte, kam sie zu Fuß zu einem Haus, das sie zuvor vom Auto aus beobachtet hatte. Sie hatte eine große Tragetasche mit belastendem Inhalt bei sich. In dem Schulterholster unter ihrem Blazer steckte eine gestohlene Pistole, eine Colt .45 ACP, die einer der besten Büchsenmacher Amerikas generalüberholt und optimiert hatte.
Das Villenviertel war in diesen chaotischen Zeiten ruhig, in diesen lärmenden Zeiten still. Kalifornische Pfefferbäume flüsterten, und Palmwedel raschelten leise in einer nach Jasmin duftenden Brise. Hinein mischte sich jedoch auch süßlicher Verwesungsgeruch, der aus den Gullys aufstieg, vielleicht von den Kadavern vergifteter Eichhörnchen, die aus der Sonne geflüchtet waren, um im Dunkel zu sterben.
Ein Zu-verkaufen-Schild im Vorgarten des Hauses, das ihr Ziel war, der Schlüsselsafe eines Immobilienmaklers an der Klinke der Haustür und zugezogene Vorhänge ließen darauf schließen, dass das Haus unbewohnt war. Die Alarmanlage würde höchstwahrscheinlich außer Betrieb sein, weil es in einem leeren Haus nichts zu stehlen gab – und sie es komplizierter gemacht hätte, potenziellen Käufern das Objekt zu zeigen.
Die Terrasse hinter dem Haus war unmöbliert. Das schwach nach Chlor riechende pechschwarze Wasser im Swimmingpool war leicht bewegt, spiegelte den abnehmenden Mond.
Eine verputzte Mauer und Lorbeer-Feigen schirmten die Rückseite des Hauses gegen die Nachbarn ab. Selbst tagsüber wäre sie hier nicht gesehen worden.
Mit einem schwarz gekauften Entsperrgerät der Marke LockAid, das nur die Polizei verwenden durfte, überlistete Jane das Sicherheitsschloss der Hintertür. Sie verstaute das Gerät wieder in ihrer Tragetasche, öffnete die Tür und horchte in die unbeleuchtete Küche hinein.
Als sie davon überzeugt war, die Situation im Haus richtig eingeschätzt zu haben, schloss sie die Tür hinter sich und ließ den Riegel einschnappen. Aus der Tragetasche angelte sie eine LED-Taschenlampe mit zwei Helligkeitsstufen, wählte die schwächere aus und ließ den Lichtstrahl über eine stylische Küche mit glänzend weißen Fronten, Arbeitsplatten aus schwarzem Granit und Edelstahlarmaturen gleiten. Kochutensilien waren nirgends zu sehen. Auf den Regalen der wenigen Hängeschränke mit Glasböden wartete kein Designerporzellan darauf, bewundert zu werden.
Sie durchquerte weitläufige Räume, die dunkel wie geschlossene Särge und bar jeglicher Möbel waren. Obwohl alle Vorhänge zugezogen waren, benutzte sie nur das schwache Licht und ließ es auf den Fußboden gerichtet.
Auf der Treppe blieb sie dicht an der Wand, wo die Stufen weniger leicht knarren würden, aber sie wurde auf ihrem Weg nach oben trotzdem angekündigt.
Obwohl sie zur Straßenfront des Hauses wollte, suchte sie das ganze Obergeschoss ab, um sich zu vergewissern, dass sie allein war. Dies war ein Luxushaus – alle Schlafzimmer mit eigenem Bad – für die obere Mittelschicht in angesagter Wohnlage, aber die Kühle in seinen leeren Räumen weckte in Jane eine Ahnung vom Niedergang der Vorstädte und gesellschaftlichem Verfall.
Aber vielleicht wurden diese Befürchtungen doch nicht von den dunklen, kalten Räumen genährt. Tatsächlich wurde sie seit fast einer Woche von finsteren Vorahnungen heimgesucht, seit sie wusste, welche Pläne einige der mächtigsten Leute in dieser neuen Welt voller technologischer Wunder für ihre Mitbürger hatten.
Sie stellte ihre Tragetasche am Fenster eines zur Straße hinausführenden Schlafzimmers ab und öffnete den Vorhang einen Spalt weit. Sie studierte nicht das Haus direkt gegenüber, sondern das Nachbarhaus, ein schönes Beispiel für ein Wohnhaus im Craftsman-Stil.
Dort drüben wohnte Lawrence Hannafin, seit März letzten Jahres verwitwet. Seine Ehe war kinderlos geblieben. Obwohl Hannafin erst achtundvierzig war – zwanzig Jahre älter als Jane –, war er vermutlich allein zu Hause.
Sie wusste nicht, ob er sich als potenzieller Verbündeter erweisen würde. Wahrscheinlicher war, dass er ein Feigling ohne Überzeugungen war, der vor der Herausforderung zurückschrecken würde, mit der sie ihn konfrontieren wollte. Heutzutage war Feigheit die Standardeinstellung.
Sie hoffte, dass Hannafin nicht ihr Feind werden würde.
Als FBI-Agentin hatte sie sieben Jahre lang zur Critical Incident Response Group gehört, die vor allem für die Analystengruppen 3 und 4 ermittelte, die für Verhaltensanalysen von Massenmördern und Serienkillern zuständig waren. In dieser Eigenschaft hatte sie nur zweimal tödliche Schüsse abgegeben – in verzweifelter Lage auf einer abgelegenen Farm. Vom Bureau beurlaubt, hatte sie in der vergangenen Woche drei Männer in Notwehr erschossen. Sie galt jetzt als Abtrünnige und hatte vom Töten genug.
Besaß Lawrence Hannafin nicht den Mut und die Integrität, die sein Ruf suggerierte, hoffte Jane zumindest, dass er sie nur abweisen würde, ohne zu versuchen, sie der Justiz zu überstellen. Für sie würde es keine Gerechtigkeit geben. Keinen Strafverteidiger. Keine öffentliche Verhandlung. Bedachte man, was sie über bestimmte mächtige Leute wusste, konnte sie bestenfalls auf eine Kugel in den Kopf hoffen. Sie besaßen die Mittel, ihr etwas weit Schlimmeres anzutun: Sie konnten sie brechen, alle ihre Erinnerungen löschen, ihr den freien Willen rauben und sie zu einer gefügigen Sklavin machen.
DREI
Jane zog ihren Blazer aus, legte das Schulterholster ab und schlief – nicht sehr gut – auf dem Teppichboden mit ihrer Pistole in Reichweite. Als Kissen benutzte sie ein Fensterpolster, aber sie hatte nichts, was ihr als Bettdecke hätte dienen können.
Die Welt ihrer Träume war ein Reich schwankender Schatten in silbrig-blauem Dämmerlicht ohne bestimmten Ursprung, durch das sie vor böswilligen Gestalten flüchtete, die einst Menschen wie sie gewesen waren, nun aber unermüdlich wie für die Jagd programmierte Roboter waren, deren Blick bar jeglicher Gefühle war.
Der Wecker ihrer Armbanduhr weckte sie eine Stunde vor Tagesanbruch.
Zu ihren wenigen Toilettenartikeln gehörten Zahnbürste und Zahnpasta. In einem der Bäder, mit der gedimmten Taschenlampe in einer Ecke auf dem Fußboden, ihr Gesicht im halbdunklen Spiegel ein Gespenst mit tief in den Höhlen liegenden Augen, schrubbte sie den Geschmack von Traumängsten weg.
Im Schlafzimmer zog sie den Vorhang einen Spalt weit auf und beobachtete Hannafins Haus durch ein lichtstarkes kleines Fernglas, wobei ihr Pfefferminzatem die Fensterscheibe kurz anlaufen ließ.
Wie auf Facebook nachzulesen war, joggte Lawrence Hannafin jeden Morgen bei Tagesanbruch eine Stunde lang. In einem Zimmer im ersten Stock wurde Licht gemacht, und wenige Minuten später erhellte ein sanfter Lichtschein die Diele im Erdgeschoss. Als das erste Licht des kommenden Tages den Himmel im Osten rosig färbte, trat Hannafin in T-Shirt, Shorts, Laufschuhen und Stirnband aus der Haustür. Durch ihr Fernglas beobachtete Jane, wie er die Haustür absperrte und den Schlüssel in eine Reißverschlusstasche seiner Shorts steckte.
Am Vortag hatte sie ihn vom Auto aus beobachtet. Er war drei Blocks weit nach Süden gelaufen und war dann nach Osten in ein Gebiet mit Ranchhäusern abgebogen, um Reitwegen über die unbebauten grünen Hügel mit niedrigem Buschwerk zu folgen. Er war siebenundsechzig Minuten fort gewesen. Jane würde nur einen Bruchteil dieser Zeit brauchen, um zu tun, was getan werden musste.
VIER
Ein weiterer Wintermorgen in Minnesota. Eine geschlossene graue Wolkendecke wie aus schmutzigem Eis. Einzelne Schneeflocken in der stillen Luft, als entschlüpften sie den zusammengebissenen Zähnen eines widerstrebenden Sturms.
In Schlafanzug und knöchelhohen Pelzstiefeln bereitete Cora Gundersun ihr Frühstück zu: Toast mit Butter und etwas geriebenem Parmesan, Rühreier und Nueske’s Bacon, dem besten Frühstücksspeck der Welt, der in dünnen gebratenen Scheiben knusprig und aromatisch war.
Am Küchentisch las sie die Zeitung, während sie aß. Ab und zu brach sie ein kleines Stück Bacon für Dixie Belle ab, die geduldig neben ihrem Stuhl wartete und jeden Leckerbissen entzückt und dankbar winselnd in Empfang nahm.
Cora hatte wieder geträumt, sie schreite unversehrt durch hoch lodernde Flammen, während die Leute ihre Unverwundbarkeit bestaunten. Dieser Traum war erhebend, und sie fühlte sich gereinigt, als seien die Flammen das liebevolle Feuer Gottes gewesen.
Sie war über achtundvierzig Stunden lang von Migräne verschont geblieben, was die längste beschwerdefreie Zeit seit dem Einsetzen der Kopfschmerzen war. Sie wagte zu hoffen, ihr unerklärliches Leiden könnte beendet sein.
Weil ihr noch mehrere Stunden blieben, bevor sie duschen und sich anziehen und in die Stadt fahren musste, um zu tun, was getan werden musste, schlug sie das Tagebuch auf, das sie seit einigen Wochen führte. Ihre Handschrift war fast so ebenmäßig wie die einer Schreibmaschine, und der Text füllte eine Zeile nach der anderen.
Nach einer Stunde legte sie den Füller weg, klappte das Tagebuch zu und briet sich noch eine Portion Nueske’s Bacon – nur für den Fall, dass sie vielleicht nie mehr welchen bekommen würde. Ein seltsamer Gedanke! Nueske produzierte seit Jahrzehnten erstklassigen Bacon, und Cora hatte keinen Grund zu der Annahme, die Firma stehe vor der Pleite. Der Wirtschaft ging es schlecht, gewiss, und viele Unternehmen mussten zumachen, aber Nueske würde ewig fortbestehen. Trotzdem aß sie den Bacon mit Tomatenscheiben und Buttertoast und gab Dixie Belle wieder etwas davon ab.
FÜNF
Um zu Hannafins Haus zu gelangen, überquerte Jane die Straße nicht auf dem kürzesten Weg. Mit ihrer Tragetasche über der Schulter ging sie bis zum Ende des Blocks und noch einen halben Block weiter, bevor sie die Fahrbahn überquerte und sich dem Haus von Norden her näherte. So verringerte sich die Gefahr, dass jemand lange genug aus einem Fenster sah, um beobachten zu können, woher sie kam und wohin sie ging, ganz entscheidend.
Vor dem Haus im Craftsman-Stil führten mit Klinkersteinen eingefasste Steinstufen zu einem weit ausladenden Vordach, zu dem auf beiden Seiten früh blühende rote Glyzinien an Rankgittern hinaufwucherten, in deren Schutz man ungesehen eindringen konnte.
Sie klingelte dreimal. Keine Reaktion.
Sie führte den dünnen, flexiblen LockAid-Dietrich in das Sicherheitsschloss ein und betätigte viermal den Abzug, bis alle Stifte hochgedrückt waren.
Bevor sie drinnen die Tür hinter sich absperrte, rief sie in die Stille: »Hallo? Niemand zu Hause?«
Als ihr nur Schweigen antwortete, machte sie sich an die Arbeit.
Die Einrichtung war elegant auf die Architektur abgestimmt. Mit Schiefer verkleidete offene Kamine mit eingesetzten Keramikkacheln. Möbel im Stickley-Stil mit bedruckten Baumwollbezügen in Erdfarben. Geschmackvolle Arts-and-Crafts-Lampen. Orientteppiche.
Die angesagte Wohnlage, das große Haus und die elegante Einrichtung sprachen gegen ihre Hoffnung, Hannafin könnte ein gegen Korruption gefeiter Journalist sein. Er arbeitete bei einer Zeitung, und heutzutage, wo Zeitungen dünn waren wie magersüchtige Teenager und langsam ausstarben, bekamen ihre Journalisten, selbst die einer wichtigen Tageszeitung in Los Angeles, keine dicken Gehälter. Das wirklich große Geld ging an die TV-Journalisten, von denen die meisten genauso wenig Journalisten waren wie Astronauten.
Aber Hannafin hatte ein halbes Dutzend Sachbücher geschrieben, von denen drei mehrere Wochen lang im unteren Drittel der Bestsellerliste gestanden hatten. Das waren seriöse, gut geschriebene Bücher gewesen. Vielleicht hatte er sich dafür entschieden, seine Einnahmen als Autor in dieses Haus zu investieren.
Am Vortag hatte Jane von einem Computer in einer Bibliothek in Pasadena aus mühelos Hannafins Provider geknackt und festgestellt, dass er nicht nur ein Mobiltelefon, sondern auch einen Festnetzanschluss besaß, der ihr jetziges Vorhaben erleichtern würde. Das System der Telefongesellschaft hatte sie hacken können, weil sie eine Hintertür kannte, die Vikram Rangnekar, ein Supergeek im Bureau, entdeckt hatte. Vikram war lieb und amüsant – und er scherte sich nicht um geltende Gesetze, wenn der Direktor oder ein höheres Tier im Justizministerium ihn dazu aufforderte. Vor Janes Beurlaubung war Vikram harmlos in sie verknallt gewesen, obwohl sie damals noch verheiratet und für ihn so unerreichbar wie auf dem Mond gewesen war. Als gesetzestreue Agentin hatte sie nie illegale Methoden benutzt, aber sie hatte sich aus Neugier für die Methoden des korrupten Führungszirkels im Justizministerium interessiert und zugelassen, dass Vikram seine Magie praktizierte, wann immer er sie beeindrucken wollte.
Rückblickend betrachtet hätte man glauben können, sie habe instinktiv geahnt, dass ihr gutes Leben bald umschlagen, dass sie verzweifelt auf der Flucht sein und jeden Trick brauchen würde, den Vikram ihr zeigen konnte.
Nach den Unterlagen der Telefongesellschaft gab es hier außer dem Wandtelefon in der Küche drei weitere Apparate: je eines in Hannafins Schlafzimmer, dem Wohnzimmer und seinem Arbeitszimmer. Beginnend in der Küche, entfernte sie mit einem kleinen Schraubendreher von allen Geräten die Bodenplatte. Dann baute sie einen Chip ein, der über Funk gesteuert als Infinity Transmitter oder als Standardwanze arbeiten konnte, installierte einen Hook Switch, um das Telefon über Kopfhörer abhören zu können, und schraubte das Gehäuse wieder zu. Für die ganze Aktion brauchte sie nur neunzehn Minuten.
Hätte der begehbare Kleiderschrank im Schlafzimmer ihrem Plan nicht entsprochen, hätte sie ein anderes Versteck gefunden. Aber er war gut geeignet. Eine große Spiegeltür, keine Schiebetür. Die Tür stand offen, aber sie war abschließbar – vielleicht weil dort drinnen ein Wandsafe versteckt war oder die verstorbene Mrs. Hannafin wertvollen Schmuck besessen hatte. Von innen ließ das verdeckte Schloss sich allerdings nicht öffnen. Ein kleiner Tritthocker erleichterte den Zugang zu den höheren Regalfächern.
Hannafins Garderobe bestand fast nur aus Kleidungsstücken mit Luxuslabels: Anzüge von Brunello Cucinelli, zahlreiche Krawatten von Charvet, Schubladen voller Pullover von St. Croix. Jane versteckte einen Hammer unter einigen Pullovern und einen Schraubendreher in der Innentasche eines blauen Nadelstreifenanzugs.
Sie verbrachte weitere zehn Minuten damit, in verschiedenen Räumen alle möglichen Schubladen aufzuziehen, ohne etwas Spezifisches außer Hintergrundinformationen über den Mann zu suchen.
Verließ sie das Haus durch die Vordertür, würden die Sicherungsstifte des Schlosses wieder einrasten, aber der Riegel würde nicht wieder einschnappen. Stellte Hannafin das bei der Rückkehr fest, würde er wissen, dass während seiner Abwesenheit jemand im Haus gewesen war.
Also benutzte Jane stattdessen die Tür der Waschküche, die Haus und Garage miteinander verband, und ließ den Riegel dieser Tür offen, von der Hannafin viel eher glauben würde, er habe sie versehentlich nicht abgesperrt.
Die seitliche Garagentür hatte kein Sicherheitsschloss. Das einfache Schloss schnappte ein, als sie die Tür hinter sich zuzog.
SECHS
Wieder in dem verlassenen, zum Verkauf stehenden Haus und mit der Gewissheit, dass die Morgensonne sie tarnen würde, machte Jane in dem großen Bad Licht.
Wie häufig in letzter Zeit sah ihr Spiegelbild nicht so aus, wie sie erwartet hatte. Nach allem, was sie in den vergangenen vier Monaten durchgemacht hatte, fühlte sie sich von Angst, von Kummer und Sorgen abgenutzt und mitgenommen. Obwohl ihr Haar jetzt kürzer und kastanienbraun gefärbt war, sah sie nicht viel anders aus als zu Beginn ihrer Odyssee: eine jugendliche 27-Jährige, frisch, mit klaren Augen. Es kam ihr nicht richtig vor, dass ihr Mann tot war und sie ihr einziges Kind verstecken musste, um es am Leben zu erhalten, ohne dass Ängste und Verluste irgendwelche Spuren auf ihrem Gesicht hinterließen.
Ihre große Tragetasche enthielt auch eine blonde Langhaarperücke. Jane setzte sie auf, befestigte sie, bürstete sie aus und fasste die Haare mit einem Ponywrap von Scünci zu einem Pferdeschwanz zusammen. Dazu passte eine neutrale Basecap. In Jeans, Pullover und Blazer, dessen spezieller Schnitt das Schulterholster mit Pistole tarnte, hätte sie anonym ausgesehen, wenn die Medien in den letzten Tagen nicht dafür gesorgt hätten, dass die Öffentlichkeit ihr Gesicht fast so gut kannte wie das irgendeines Fernsehpromis.
Sie hätte einiges tun können, um sich besser zu tarnen, aber sie wollte, dass ihre Identität für Lawrence Hannafin außer Zweifel stand.
Im Schlafzimmer wartete sie am Fenster. Nach ihrer Uhr kam der Jogger zweiundsechzig Minuten nach dem Start seines Morgenlaufs zurück.
Weil er sich mit Bestsellern einen Namen gemacht hatte und der Zeitung viele Leser brachte, konnte er’s sich leisten, häufig zu Hause zu arbeiten. Aber weil er erhitzt und verschwitzt zurückgekommen war, würde er wahrscheinlich erst einmal unter die Dusche gehen. Jane wartete noch zehn Minuten, bevor sie aufbrach, um ihm einen Besuch abzustatten.
SIEBEN
Hannafin ist seit einem Jahr Witwer, aber er hat sich noch nicht völlig ans Alleinsein gewöhnt. Wenn er wie jetzt heimkommt, ruft er oft aus alter Gewohnheit nach Sakura. In der Stille, die ihm antwortet, steht er von ihrer Abwesenheit betroffen ganz still da.
Manchmal fragt er sich, auch wenn das irrational ist, ob sie wirklich tot ist. Er war zu Recherchen auf Reisen gewesen, als sie ganz plötzlich erkrankt und gestorben war. Weil er den Anblick der Toten nicht ertragen hätte, hatte er sie einäschern lassen. Das hat zur Folge, dass er sich manchmal mit der Überzeugung umdreht, sie stehe lebend und lächelnd hinter ihm.
Sakura. Ein japanischer Name, der Kirschblüte bedeutete. Er passte zu ihrer zarten Schönheit, wenn auch nicht zu ihrer starken Persönlichkeit …
Er war ein anderer Mann gewesen, bevor sie in sein Leben getreten war. Sie war so klug, so zärtlich. Ihre sanfte, stetige Ermunterung hatte ihm die Kraft und das Selbstvertrauen gegeben, die Bücher zu schreiben, von denen er bis dahin immer nur gesprochen hatte. Für einen Journalisten war er seltsam verschlossen gewesen, aber Sakura hatte ihn aus seinem »unglücklichen Schildkrötenpanzer« geholt, wie sie sagte, und ihm neue Erfahrungen erschlossen. Vor ihr hatte er gute Kleidung so wenig zu schätzen gewusst wie gute Weine, aber sie hatte ihn Stil gelehrt und seinen Geschmack gebildet, bis er gut aussehen und urban sein wollte, damit sie stolz darauf sein konnte, mit ihm gesehen zu werden.
Nach ihrem Tod hat er alle Fotos von ihnen beiden in Silberrahmen, die er liebevoll arrangiert hier und dort im Haus aufgestellt hatte, weggesperrt. Diese Bilder hatten ihn verfolgt, wie andererseits kaum eine Nacht vergeht, in der sie ihm nicht im Traum erscheint.
»Sakura, Sakura, Sakura«, flüstert er in dem stillen Haus, dann geht er nach oben, um zu duschen.
Als begeisterte Läuferin hatte sie darauf bestanden, dass er joggte, um fit zu bleiben, damit sie gemeinsam alt werden konnten. Ohne Sakura zu laufen, war ihm anfangs unmöglich erschienen, weil an jeder Wegbiegung ihrer gemeinsamen Strecken Erinnerungen wie Gespenster zu lauern schienen. Aber mit dem Laufen aufzuhören, fühlte sich wie Verrat an, als sei sie wirklich draußen auf ihren Strecken, außerstande, in dieses Haus der Lebenden zurückzukehren, auf ihn wartend, um ihn zu sehen und zu wissen, dass er gesund und vital war und sich getreu an die Routine hielt, die sie eingeführt hatte.
Sollte Hannafin es jemals wagen, Leuten bei der Zeitung von solchen Gedanken zu erzählen, würden sie ihn offen sentimental nennen – larmoyant und rührselig und Schlimmeres hinter seinem Rücken –, weil Sentimentalität im Herzen der meisten heutigen Journalisten keinen Platz mehr hat, außer sie hängt mit Politik zusammen. Trotzdem …
Im Bad dreht er die Dusche so heiß auf, wie er’s aushalten kann. Wegen Sakura benutzt er keine Flüssigseife, die der Haut schadet, sondern schäumt sich mit You Are Amazing ein. Sein Shampoo mit Cognac und Eigelb stammt von Hair Recipes, und er benutzt eine Haarspülung mit Arganöl. Alles dies ist ihm peinlich feminin erschienen, solange Sakura noch lebte. Aber jetzt ist’s seine Routine. Er erinnert sich daran, wie sie manchmal gemeinsam geduscht haben, und glaubt das mädchenhafte Kichern zu hören, mit dem sie sich auf diese häusliche Intimität einließ.
Als er aus der Dusche tritt und sich abtrocknet, ist der Spiegel über dem Waschbecken beschlagen. Sein verschwommenes Spiegelbild ist aus irgendeinem Grund beunruhigend, als sei die schemenhafte Gestalt, die jede seiner Bewegungen mitmacht, vielleicht nicht er selbst, sondern ein nicht ganz menschlicher Bewohner einer Parallelwelt hinter dem Glas. Wischt er jetzt den Spiegel ab, bleiben Streifen zurück. Also lässt er den Dampf verdunsten und geht nackt ins Schlafzimmer hinüber.
In einem der beiden Sessel sitzt eine höchst erstaunlich aussehende Frau. Obwohl sie abgewetzte Rockports und Jeans und einen nichts sagenden Pullover und einen markenlosen Blazer trägt, sieht sie aus wie der Vogue entstiegen. Sie ist so umwerfend wie das Model, das für das Parfüm Black Opium wirbt, nur dass sie keine Brünette, sondern blond ist.
Er steht einen Augenblick wie vor den Kopf geschlagen da, ist sich beinahe sicher, dass mit seinem Gehirn etwas nicht stimmt, dass er halluziniert.
Sie zeigt auf seinen Bademantel, den sie aus dem Schrank geholt und aufs Bett gelegt hat. »Ziehen Sie den an und setzen Sie sich. Wir müssen miteinander reden.«
ACHT
Als Cora Gundersun die letzte Scheibe Bacon aufspießte, wurde ihr zu ihrer Verblüffung klar, dass sie ein ganzes Pfund aufgegessen hatte – abzüglich der paar Scheiben, die Dixie bekommen hatte. Sie hatte das Gefühl, sich wegen ihrer Gefräßigkeit genieren zu müssen, die zumindest leichte Übelkeit hätte hervorrufen sollen, aber beides war nicht der Fall. Diese Völlerei erschien ihr im Gegenteil berechtigt, obwohl sie keinen Grund dafür hätte angeben können.
Gewöhnlich wusch sie nach jeder Mahlzeit alles Geschirr und Besteck ab, trocknete es ab und räumte es wieder ein. Diesmal hatte sie jedoch das Gefühl, damit kostbare Zeit zu vergeuden. Sie ließ Teller und Besteck auf dem Tisch zurück und ignorierte die fettige Bratpfanne auf dem Herd.
Während sie sich die Finger ableckte, fiel ihr Blick auf das Tagebuch, in das sie zuvor so emsig geschrieben hatte. Aber sie konnte sich um nichts in der Welt daran erinnern, wovon ihr letzter Eintrag gehandelt hatte. Sie schob ihren Teller verwundert beiseite und zögerte dann, das Tagebuch aufzuschlagen.
Als sie vor fast zwanzig Jahren ihr Studium abgeschlossen hatte, hatte sie gehofft, eine erfolgreiche Schriftstellerin, eine ernsthafte Romanautorin von gewisser Bedeutung werden zu können. Im Nachhinein hatte dieser große Traum sich als kindische Fantasie erwiesen. Manchmal schien das Leben eine Maschine zu sein, die Träume so wirkungsvoll zermalmte, wie eine hydraulische Schrottpresse Autos in kompakte Würfel verwandelte. Sie musste sich ihren Lebensunterhalt verdienen, und nachdem sie zu unterrichten begonnen hatte, war ihr Wunsch, schriftstellerisch tätig zu sein, von Jahr zu Jahr schwächer geworden.
Obwohl sie sich nicht daran erinnern konnte, was sie ihrem Tagebuch erst vor Kurzem anvertraut hatte, machte diese Gedächtnislücke ihr keine Sorgen und ließ sie auch nicht an eine früh einsetzende Alzheimer-Krankheit denken. Stattdessen neigte sie dazu, auf eine leise innere Stimme zu hören, die ihr suggerierte, die Qualität des Geschriebenen könnte deprimierend schlecht sein. Vielleicht war diese Gedächtnislücke nur das Werk der nüchternen Kritikerin Cora Gundersun, die der Autorin Cora Gundersun die betrübliche Erkenntnis ersparte, dass ihrem Stil Witz und Eleganz fehlten.
Sie schob das Tagebuch beiseite, ohne einen Blick hineinzuwerfen.
Sie sah auf Dixie Belle hinunter, die neben dem Küchenstuhl saß. Die Dackelhündin erwiderte den Blick ihres Frauchens mit ihren schönen, wenn auch nicht zusammenpassenden Augen: ein blassblaues und ein dunkelbraunes Oval in einem sanften goldenen Gesicht.
Viele Hunde, nicht nur die gute Dixie, betrachten ihre Menschen manchmal mit einem Ausdruck liebevoller Besorgnis, in die sich zartes Mitleid mischt, als kennten sie nicht nur die geheimsten Ängste und Hoffnungen der Menschen, sondern auch die Wahrheit über das Leben und das Los aller Dinge, als wünschten sie sich, reden zu können, um durch ihr Wissen Trost zu spenden.
Das war der Ausdruck, mit dem Dixie sie betrachtete, und er bewegte Cora zutiefst. Kummer ohne ersichtlichen Grund überwältigte sie; dazu kam eine Existenzangst, die sie nur allzu gut kannte. Sie streckte eine Hand aus, um den Hundekopf zu tätscheln. Als Dixie ihr die Hand leckte, hatte Cora plötzlich Tränen in den Augen.
Sie fragte: »Was ist nur mit mir los, meine Süße? Mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung.«
Ihre leise innere Stimme ermahnte sie, ruhig zu bleiben, sich keine Sorgen zu machen, sich auf den vor ihr liegenden ereignisreichen Tag vorzubereiten.
Ihre Tränen trockneten.
Die Leuchtziffern der Digitaluhr des Küchenherds zeigten 10:31 an.
Ihr blieben noch eineinhalb Stunden, bevor sie in die Stadt fahren musste. Die Idee, so viel Zeit totschlagen zu müssen, machte sie unerklärlich nervös, als müsse sie sich irgendwie beschäftigen, um nicht daran zu denken, was … Woran sollte sie nicht denken?
Ihre Hände zitterten, als sie eine neue Seite des Tagebuchs aufschlug und nach dem Füller griff, aber das Zittern hörte auf, sobald sie zu schreiben begann. Wie in Trance füllte Cora rasch eine Zeile nach der anderen mit stilistisch guter Prosa, hielt sich nicht lange damit auf, das Geschriebene noch einmal zu lesen, verschwendete auch keinen Gedanken darauf, was sie als Nächstes schreiben würde, und bekämpfte so ihre Nervosität.
Dixie stellte sich auf die Hinterläufe, legte die Vorderpfoten auf Coras Sitzfläche und winselte, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Still!«, forderte Cora sie auf. »Bleib ruhig. Bleib ganz ruhig. Bereite dich auf den bevorstehenden ereignisreichen Tag vor.«
NEUN
Lawrence Hannafins Schock wurde zu peinlicher Verlegenheit, als er nackt nach seinem Bademantel griff. Während er hineinschlüpfte und den Gürtel verknotete, gewann er genügend Fassung zurück, um besorgt zu sein. »Wer zum Teufel sind Sie?«
Jane sprach energisch, aber nicht bedrohlich. »Bleiben Sie cool. Setzen Sie sich.«
Er war es gewohnt, sich durchzusetzen, und sein Selbstvertrauen kehrte rasch zurück. »Wie sind Sie hier reingekommen? Das ist ein Einbruch!«
»Hausfriedensbruch«, korrigierte sie ihn. Sie schlug den Blazer zurück, damit er ihr Schulterhalfter und die Pistole sah. »Setzen Sie sich, Hannafin.«
Nach kurzem Zögern wollte er widerstrebend zu dem zweiten Sessel gehen, der schräg vor ihrem stand.
»Nein, aufs Bett«, wies sie ihn an, weil der Sessel ihr zu nahe war.
Sie entdeckte eiskalte Berechnung in seinen jadegrünen Augen, aber falls er überlegte, ob er sich auf sie stürzen sollte, siegte doch seine Vernunft. Er setzte sich auf die Bettkante. »Ich habe kein Geld im Haus.«
»Sehe ich wie eine Diebin aus?«
»Ich weiß nicht, was Sie sind.«
»Aber Sie wissen, wer ich bin.«
Er runzelte die Stirn. »Ich kenne Sie nicht.«
Sie nahm die Basecap ab und wartete.
Im nächsten Moment machte er große Augen. »Sie sind beim FBI. Oder waren es. Die abtrünnige Agentin, auf die alle Jagd machen. Jane Hawk.«
»Was halten Sie von alledem?«, fragte sie.
»Wovon?«
»Von all dem Scheiß über mich im Fernsehen, in den Zeitungen.«
Selbst unter den gegenwärtigen Umständen verfiel er rasch wieder in die Rolle des investigativen Journalisten. »Was soll ich davon halten?«
»Glauben Sie dieses Zeug?«
»Würde ich alles glauben, was ich in den Nachrichten sehe, wäre ich kein Journalist, sondern ein Idiot.«
»Glauben Sie wirklich, dass ich letzte Woche zwei Männer erschossen habe? Diesen schmierigen Darknet-Unternehmer und den Staranwalt aus Beverly Hills?«
»Vielleicht ist’s wahr, wenn Sie sagen, dass Sie’s nicht waren. Überzeugen Sie mich.«
»Nein, ich habe beide erschossen«, sagte sie. »Und um ihn von seinen Qualen zu erlösen, habe ich auch Nathan Silverman erschossen, meinen Abteilungsleiter im Bureau, der mein guter Freund und Mentor war. Aber davon haben Sie noch nichts gehört. Das soll nicht bekannt werden.«
»Wer will das nicht?«
»Bestimmte Leute im FBI. Und im Justizministerium. Ich habe eine Story für Sie. Eine große Sache.«
Sein Blick war so wenig zu deuten wie der eines Buddhas aus Jade. Er schwieg nachdenklich, bevor er sagte: »Lassen Sie mich meinen Notizblock und etwas zum Schreiben holen, dann können Sie mir alles erzählen.«
»Nein, bleiben Sie. Wir wollen erst miteinander reden. Vielleicht können Sie anschließend Ihren Notizblock holen.«
Sein Haar war noch nicht trocken. Dünne Wasserfäden liefen über seine Stirn, seine Schläfen. Wasser oder Schweiß.
Hannafin erwiderte ihren Blick und fragte nach einer weiteren Pause: »Wieso ich?«
»Ich traue nicht vielen Journalisten. Die wenigen aus der jüngeren Generation, denen ich vielleicht vertraut hätte, sind plötzlich alle tot. Aber Sie nicht.«
»Meine einzige Qualifikation ist, dass ich lebe?«
»Sie haben ein Porträt über David James Michael geschrieben.«
»Den Silicon-Valley-Milliardär.«
David Michael hatte Milliarden geerbt, die nicht aus dem Valley stammten. In der Folge hatte er weitere Milliarden verdient: mit Data-Mining, mit Biotechnologie, mit praktisch allem, in das er investiert hatte.
Sie sagte: »Ihr Porträt war fair.«
»Das versuche ich immer zu sein.«
»Aber es war an einigen Stellen durchaus kritisch.«
Hannafin zuckte mit den Schultern. »Er ist ein Philanthrop, ein Progressiver, ein bodenständiger Kerl, geistreich und charmant. Aber ich mochte ihn nicht. Ich bin nicht mit ihm warm geworden. Nichts hat den Verdacht nahegelegt, er spiele vielleicht nur eine Rolle. Aber ein guter Reporter hat seine … Intuition.«
Sie sagte: »David Michael hat in die Firma Shenneck Technology investiert, ein Forschungslabor in Menlo Park. Später hat er gemeinsam mit Bertold Shenneck das Biotech-Start-up Far Horizons gegründet.«
Er wartete darauf, dass sie fortfahren würde, und als sie schwieg, ergänzte er: »Dr. Shenneck und seine Frau Inga sind letzten Sonntag beim Brand ihres Hauses im Napa Valley umgekommen.«
»Nein. Sie wurden erschossen. Der Brand ist nur zur Vertuschung gelegt worden.«
Unabhängig davon, wie viel Selbstbeherrschung ein Mann besaß, gab es winzige Angstzeichen, die seinen emotionalen Zustand verrieten, wenn er besorgt genug war: ein Tic unter einem Auge, ein plötzlich an der Schläfe sichtbarer Puls, ein wiederholtes Befeuchten der Lippen, irgendetwas in dieser Art. Bei Hannafin konnte sie jedoch nichts dergleichen entdecken.
Er fragte: »Waren Sie das auch?«
»Nein. Aber sie hatten den Tod verdient.«
»Sie sind Richterin und Geschworene in einer Person?«
»Ich kann nicht wie ein Richter bestochen oder wie eine Geschworene getäuscht werden. Übrigens mussten Bertold Shenneck und seine Frau sterben, weil Far Horizons – also der geistreiche und charmante David Michael – keine Verwendung mehr für sie hatte.«
Er starrte einen Herzschlag lang in ihre Augen, als könnte er die Wahrheit am Durchmesser der Pupillen, an den blauen Streifen der Iris erkennen. Plötzlich stand er auf. »Verdammt noch mal, ich brauche was zu schreiben.«
Jane zog ihre Pistole. »Hinsetzen!«
Er blieb stehen. »Ich kann mir unmöglich alles merken.«
»Und ich kann Ihnen nicht trauen«, sagte sie. »Noch nicht. Setzen Sie sich.«
Er sank widerstrebend auf die Bettkante. Die Pistole schien ihn nicht sonderlich einzuschüchtern. Was ihm über die Stirn lief, war anscheinend wirklich Wasser, kein Schweiß.
»Sie wissen von meinem Mann«, sagte sie.
»Die Nachrichten waren voll von ihm. Er war ein vielfach ausgezeichneter Offizier der Marines. Vor ungefähr vier Monaten hat er Selbstmord verübt.«
»Nein. Sie haben ihn ermordet.«
»Wer?«
»Bertold Shenneck, David James Michael und all die übrigen Dreckskerle bei Far Horizons. Wissen Sie, was Nanomaschinen sind?«
Der Themenwechsel verblüffte Hannafin. »Nanotechnologie? Mikroskopisch kleine Maschinen, die nur aus einigen Molekülen bestehen. Bisher kaum Anwendungen in der realen Welt. Hauptsächlich Science-Fiction.«
»Science-Fact«, korrigierte sie ihn. »Bertold Shenneck hat Nanomaschinen entwickelt, die in einem Serum in die Blutbahn gespritzt werden: Hunderttausende von unglaublich winzigen Gebilden, die ins Gehirn wandern. Sobald sie durch die Kapillarwände ins Gehirngewebe gelangt sind, bilden sie ein größeres Netzwerk.«
»Ein Netzwerk?« Er runzelte skeptisch die Stirn, und in seinen Augenwinkeln bildeten sich Fältchen. »Was für ein Netzwerk?«
»Ein Kontrollmechanismus.«
ZEHN
Falls Lawrence Hannafin glaubte, Jane sei paranoid wie Leute, die sich mit Hüten aus Alufolie vor Strahlen schützen zu können glaubten, ließ er sich nichts davon anmerken. Er saß auf der Bettkante und schaffte es, in seinem flauschigen Bademantel, barfuß, beide Hände entspannt auf den Oberschenkeln, seriös zu wirken. Er hörte aufmerksam zu.
Sie sagte: »Historisch gesehen beträgt die Selbstmordrate in den USA zwölf pro hunderttausend. Seit ungefähr einem Jahr ist sie auf fünfzehn gestiegen.«
»Nehmen wir mal an, Sie hätten recht und sie ist tatsächlich höher. Na und? Für viele Leute sind dies schwere Zeiten. Mit lahmender Wirtschaft und sozialen Umwälzungen.«
»Aber die Zunahme betrifft fast nur erfolgreiche Männer und Frauen, die meisten glücklich verheiratet, nie wegen Depressionen in Behandlung. Offiziere wie mein Mann Nick, Journalisten, Ärzte, Wissenschaftler, Banker, Rechtsanwälte, Polizeibeamte, Lehrer … Diese Fanatiker eliminieren Leute, von denen ihr Computermodell behauptet, sie würden die Zivilisation in die falsche Richtung lenken.«
»Wessen Computermodell?«
»Shennecks. David Michaels. Far Horizons’. Das irgendwelcher staatlicher Stellen, die mit ihnen gemeinsame Sache machen. Ihr Computermodell.«
»Wie werden sie eliminiert?«
»Haben Sie nicht zugehört?«, fragte sie und war für einen Augenblick nicht mehr die beherrschte FBI-Agentin. »Nanomaschinen als Kontrollmechanismen. Gehirnimplantate, die sich selbst zusammenbauen. Sie werden den Opfern injiziert, die dann …«
Er unterbrach sie. »Wer würde sich das freiwillig injizieren lassen?«
Jane hielt es nicht länger auf ihrem Platz. Sie sprang auf, trat ein paar Schritte von Hannafin weg und betrachtete ihn stirnrunzelnd, wobei ihre Pistole lässig auf einen Punkt vor seinen Füßen zielte. »Natürlich wissen sie nicht, dass sie eine Injektion bekommen haben. Irgendwie werden sie vorher sediert, erhalten die Injektion im Schlaf. Auf Tagungen, an denen sie teilnehmen. Wenn sie auf Reisen sind, allein und verwundbar. Im Gehirn entsteht der Kontrollmechanismus binnen weniger Stunden nach der Injektion, und später haben die Opfer keine Erinnerung mehr daran.«
Mit einem Ausdruck, der so wenig zu enträtseln war wie Hieroglyphen in einem Pharaonengrab, starrte Hannafin sie an, als sei sie eine Prophetin, die das von ihm längst erwartete Schicksal der Menschheit voraussagte – oder eine Verrückte, die Fieberträume für Tatsachen hielt. Was davon zutraf, konnte sie nicht beurteilen. Vielleicht verarbeitete er, was sie gesagt hatte, versuchte es zu begreifen. Oder vielleicht dachte er an den Revolver in der Nachttischschublade, den sie bei ihrem ersten Besuch gefunden hatte.
Zuletzt sagte er: »Und dann werden diese Leute, die Injektionen erhalten haben … sie werden gesteuert?« Er konnte nicht verhindern, dass seine Stimme ungläubig klang. »Wie Roboter, meinen Sie? Wie Zombies?«
»So augenfällig ist das nicht«, sagte Jane ungeduldig. »Sie wissen nicht, dass sie gelenkt werden. Aber Wochen oder sogar Monate später erhalten sie den Befehl, sich umzubringen, und können ihm nicht widerstehen. Ich kann Ihnen ganze Stapel Unterlagen zeigen. Unheimliche Abschiedsbriefe. Beweise dafür, dass die Justizminister von mindestens zwei Bundesstaaten illegal zusammenarbeiten, um diese Fälle unter den Teppich zu kehren. Ich habe mit einer Gerichtsärztin gesprochen, die bei einer Autopsie gesehen hat, dass beide Gehirnhälften mit einem Nanomaschinennetz überzogen waren.«
Sie hatte so viele Informationen zu vermitteln und wollte Hannafins Vertrauen gewinnen. Aber wenn sie zu schnell sprach, war sie weniger überzeugend. Sie merkte selbst, dass sie Gefahr lief, nur noch zu schwatzen. Fast hätte sie ihre Pistole weggesteckt, um ihn zu beruhigen, kam dann aber doch wieder davon ab. Er war ein großer Kerl, der gut in Form war. Sie fühlte sich ihm notfalls gewachsen, aber es gab keinen Grund, ihm eine Chance zu geben, wenn auch nur entfernt denkbar war, dass er sie ergreifen würde.
Sie atmete tief durch, sprach ruhig weiter. »Ihr Computermodell errechnet für jede Generation eine kritische Zahl von Amerikanern, die in der Lage sein sollen, die Kultur in eine falsche Richtung zu steuern, die Zivilisation mit gefährlichen Ideen an den Rand des Abgrunds zu bringen.«
»Ein Computermodell kann so angelegt werden, dass es jedes beliebige Ergebnis liefert.«
»Ach was. Aber dieses Computermodell liefert ihnen eine Rechtfertigung. Die kritische Zahl ist zweihundertzehntausend. Sie rechnen mit fünfundzwanzig Jahren pro Generation. Dann, sagt der Computer, reicht es aus, pro Jahr die richtigen achttausendvierhundert Störenfriede zu eliminieren, um eine perfekte Welt voller Frieden und Harmonie zu erschaffen.«
»Das ist verrückt!«
»Haben Sie noch nicht gemerkt, dass Verrückt das neue Normal ist?«
»Gefährliche Ideen? Welche gefährlichen Ideen?«
»Die werden nicht näher definiert. Aber die Verantwortlichen erkennen sie, wenn sie sie sehen.«
»Sie wollen Leute ermorden, um die Welt zu retten?«
»Sie haben Menschen ermordet. Ziemlich viele. Morden, um die Welt zu retten – wieso ist das so schwer zu glauben? Diese Idee ist so alt wie die Menschheit selbst.«
Vielleicht musste er sich bewegen, um diese schockierenden Ungeheuerlichkeiten zu verarbeiten. Er stand wieder auf, ohne jedoch aggressiv zu wirken, und versuchte auch nicht, an die Schublade mit dem Revolver zu gelangen. Jane trat an die Tür zum Flur, als er sich von ihr entfernte und am näheren der beiden Fenster stehen blieb. Er starrte auf die ruhige Wohnstraße hinunter und zog sich dabei mit einer Hand am Kinn, als sei er gerade erst aufgewacht und spüre noch einen Rest Schlaf, der wie eine Maske vor seinem Gesicht hing.
Er sagte: »Sie sind eine heiße Nummer auf der Webseite des National Crime Information Centers. Fotos. Ein landesweiter Haftbefehl. Sie sind angeblich eine Gefahr für die nationale Sicherheit, weil Sie Militärgeheimnisse gestohlen haben.«
»Lauter Lügen! Wollen Sie die Story des Jahrhunderts oder nicht?«
»Alle Polizeibehörden Amerikas nutzen das NCIC.«
»Sie brauchen mir nicht zu erklären, wie schwierig meine Lage ist.«
»Niemand entgeht dem FBI lange. Oder der Homeland Security. Nicht heutzutage, wo’s überall Kameras gibt und Drohnen und Autos, die über GPS ihren Standort melden.«
»Ich weiß, wie das funktioniert – und wie nicht.«
Er wandte sich vom Fenster ab, um Jane anzusehen. »Sie gegen den Rest der Welt, nur um Ihren Mann zu rächen.«
»Mir geht’s nicht um Rache. Ich will seinen guten Ruf wiederherstellen.«
»Wo liegt da der Unterschied? Und dann ist ein Kind in diese Sache verwickelt. Ihr Sohn. Travis, nicht wahr? Wie alt ist er – fünf? Ich will in nichts hineingezogen werden, was einen kleinen Jungen gefährden könnte.«
»Er ist jetzt in Gefahr, Hannafin. Als ich nicht aufgehört habe, wegen Nicks Tod und der übrigen Selbstmorde zu ermitteln, haben die Verbrecher mir gedroht, Travis zu ermorden. Ihn zu vergewaltigen und zu ermorden. Also bin ich mit ihm geflüchtet.«
»Er ist in Sicherheit?«
»Ja, vorläufig. Er ist in guten Händen. Aber damit er für immer sicher ist, muss ich diese Verschwörung restlos aufdecken. Die Beweise habe ich schon. USB-Sticks mit Shennecks Forschungsunterlagen, alle Stadien seiner Entwürfe für Gehirnimplantate, die Kontrollmechanismen. Protokolle seiner Versuche. Ampullen mit einsatzbereiten Mechanismen. Aber ich weiß nicht, wem ich im Bureau, bei der Polizei und sonst wo trauen kann. Ich brauche Sie, damit Sie die Story öffentlich machen. Ich habe Beweise. Aber ich darf sie nicht mit Leuten teilen, die sie mir wegnehmen und vernichten könnten.«
»Sie sind auf der Flucht vor der Justiz. Arbeite ich mit Ihnen zusammen, statt Sie der Polizei zu übergeben, bin ich ein Komplize.«
»Für Journalisten gilt eine Ausnahmeregelung.«
»Aber nur, wenn sie mir zugebilligt wird – und erst recht nicht, wenn Sie mir Lügen erzählen. Nicht, wenn alles nur Hirngespinste sind.«
Erbitterung ließ sie erröten und ihre Stimme rauer klingen. »Nano-Implantate werden nicht nur dazu benutzt, Tausende von Unerwünschten zu keulen. Es gibt weitere Verwendungen, die Sie anwidern werden, wenn ich sie Ihnen erläutere. Anwidern und erschrecken. Hier geht’s um Freiheit, Hannafin, um Ihre nicht weniger als meine. Um eine Zukunft voller Hoffnung oder in Sklaverei.«
Er wich ihrem Blick aus, sah wieder auf die Straße hinunter und stand schweigend da.
Jane sagte: »Ich dachte, ich hätte ein Paar Eier gesehen, als Sie aus der Dusche gekommen sind. Vielleicht sind die nur zur Dekoration da.«
Seine Hände hingen zu Fäusten geballt herab, was darauf hindeuten konnte, dass er seinen Zorn unterdrückte und sie am liebsten geschlagen hätte – oder dass ihn seine Unfähigkeit frustrierte, der furchtlose Journalist zu sein, der er in jüngeren Jahren gewesen war.
Aus der Tasche ihres Schulterholsters zog sie einen Schalldämpfer, den sie auf die Pistole schraubte. »Weg vom Fenster.« Als er sich nicht rührte, sagte sie: »Sofort!« und umfasste den Griff mit beiden Händen.
Ihre Haltung und der Schalldämpfer bewogen ihn, sich zu bewegen.
»Los, in den Kleiderschrank«, sagte sie.
Sein gerötetes Gesicht wurde sichtbar blass. »Was hat das zu bedeuten?«
»Keine Panik. Sie bekommen nur etwas Zeit zum Nachdenken.«
»Sie wollen mich umbringen.«
»Reden Sie keinen Unsinn. Ich schließe Sie im Kleiderschrank ein, damit Sie darüber nachdenken können, was ich Ihnen erzählt habe.«
Vor dem Duschen hatte er Geldbörse und Schlüsselbund auf den Nachttisch gelegt. Der kleinste Schlüssel steckte jetzt in der Tür des begehbaren Kleiderschranks.
Hannafin zögerte, einzutreten.
»Sie haben keine andere Wahl«, sagte Jane. »Setzen Sie sich an der Rückseite auf den Boden.«
»Wie lange wollen Sie mich hier einsperren?«
»Finden Sie den Hammer und den Schraubendreher, den ich vorhin im Schrank versteckt habe. Schlagen Sie damit die Drehzapfen der Angeln heraus, um eine Tür öffnen zu können. Das müsste in fünfzehn bis zwanzig Minuten zu schaffen sein. Ich will nicht, dass Sie beobachten, wie ich das Haus verlasse, und sehen, was für einen Wagen ich fahre.«
Hannafin, der erleichtert war, weil der Schrank nicht sein Sarg sein würde, trat hinein und setzte sich auf den Boden. »Hammer und Schraubendreher gibt es wirklich?«
»Wirklich. Tut mir leid, dass ich Sie so überfallen musste. Aber ich bin dieser Tage auf einem Hochseil unterwegs und will mich nicht runterschubsen lassen. Jetzt ist’s Viertel vor neun. Ich rufe Sie mittags an. Hoffentlich entscheiden Sie sich dafür, mir zu helfen. Aber wenn Sie nicht den Mumm haben, eine Story zu veröffentlichen, die Ihnen Legionen von Dämonen auf den Hals hetzen wird, sagen Sie’s mir einfach und steigen aus. Ich will mich nicht an jemanden binden, der womöglich auf halber Strecke schlappmacht.«
Sie gab ihm keine Gelegenheit, darauf zu antworten, sondern schloss die Tür, sperrte sie ab und ließ den Schlüssel im Schloss stecken.
Sofort war zu hören, dass er sich drinnen auf die Suche nach dem Werkzeug machte.
Jane schraubte den Schalldämpfer ab, steckte ihn mit der Pistole in ihr Schulterholster. Sie nahm ihre Tragetasche mit, als sie ins Erdgeschoss hinunterhastete. Beim Hinausgehen knallte sie die Haustür zu, damit Hannafin Bescheid wusste.
Nach dem glitzernden Sternenhimmel von vergangener Nacht und den Pastellfarben bei Tagesanbruch erlebte das blaue Himmelsgewölbe über dem San Gabriel Valley jetzt eine Invasion von Gewitterwolken, die mit Kurs auf Los Angeles aus Nordwesten heranzogen. Singammern, die schon jetzt Schutz im dichten Laub der Lorbeer-Feigen suchten, ließen Triller und einzelne Noten hören, um einander zu beruhigen. Aber die Krähen zogen als laut krächzende schwarze Herolde des aufziehenden Sturms weiter in Schwärmen über den Himmel.
ELF
In Minnesota, in gerader Linie über sechzehnhundert Meilen von Los Angeles entfernt, zeigte die Digitaluhr von Cora Gundersuns Küchenherd 11:02 Uhr an, als sie ihr Tagebuch zuklappte. Dieser plötzliche Schreibdrang war ihr ebenso rätselhaft wie der vorige. Sie wusste nicht, womit sie diese Seiten gefüllt hatte, was sie dazu gebracht hatte, so viel zu schreiben, oder weshalb sie nicht wagte, das Geschriebene noch einmal zu lesen.
Die ruhige, leise Stimme in ihrem Inneren riet zu heiterer Gelassenheit. Alles würde gut werden. Sie hatte seit über zwei Tagen keinen Migräneanfall mehr gehabt. Blieb sie weiter beschwerdefrei, konnte sie vielleicht schon kommende Woche wieder ihre sechste Klasse unterrichten, zu den Kindern zurückkehren, die sie fast so liebte, als wären es ihre eigenen.
Jetzt wurde es Zeit für Dixie Belles Zwischenmahlzeit und den zweiten Toilettengang des Tages. Wegen des Bacons, den sie zuvor bekommen hatte, gab es diesmal nur zwei statt vier Hundekuchen. Sie schien zu verstehen, dass die Kürzung berechtigt war, denn sie bettelte nicht um mehr, nörgelte auch nicht, sondern watschelte zur Hintertür, wobei ihre Krallen auf dem Linoleum klickten.
Als Cora in ihren Mantel schlüpfte, sagte sie: »Meine Güte, Dixie, sieh mich bloß an – noch im Schlafanzug, obwohl es fast Mittag ist. Unterrichte ich nicht bald wieder, werde ich eine hoffnungslose Faulenzerin.«
Seit Tagesanbruch war es nicht viel wärmer geworden. Der bleigraue Winterhimmel mit tief hängenden Wolken ließ nichts von dem vorhergesagten Schneesturm ahnen. Als Vorboten konnten nur vereinzelte weiße Flocken gelten, die träge durch die stille Luft herabkreiselten.
Nachdem Dixie gepinkelt hatte, kam sie nicht zum Haus zurückgeflitzt, sondern blieb stehen und starrte Cora auf der Veranda an. Dackel brauchten nicht viel Auslauf, und Dixie hatte eine besondere Abneigung gegen lange Spaziergänge und mehr als nur gelegentliche Aufenthalte im Freien. Außer bei ihrer ersten Exkursion am frühen Morgen hastete sie immer gleich zurück, sobald sie ihr Geschäft erledigt hatte. Aber dieses Mal brauchte sie gutes Zureden und kam nur zögernd zurück, fast als sei sie sich nicht sicher, ob ihr Frauchen ihr Frauchen sei, als erschienen Cora und das Haus ihr plötzlich fremd.
Nachdem Cora geduscht hatte, frottierte sie wenige Minuten später ihr Haar energisch trocken. Auf Föhn und Stylingbürste konnte sie verzichten, denn ihre Naturlocken widersetzten sich allen Versuchen, sie zu bändigen. Sie machte sich keine Illusionen, was ihr Aussehen betraf, und hatte sich längst damit abgefunden, kein Typ zu sein, nach dem Männer sich umdrehten. Immerhin sah sie ansprechend und vorzeigbar aus, was mehr war, als man von manchen weniger glücklichen Leuten behaupten konnte.
Obwohl es nicht zur Jahreszeit passte, wählte sie ein Kleid aus weißem Rayon-Krepp mit Dreiviertelärmeln, einem leicht figurbetonten Oberteil mit rundem Ausschnitt und einem Plisseerock. Von allen Kleidern, die sie jemals besessen hatte, war dies das einzige, in dem sie sich fast hübsch fühlte. Weil ihr hohe Absätze nicht besonders standen, trug sie dazu weiße Sneakers.
Erst nachdem sie die Schuhe angezogen hatte, wurde ihr klar, dass dieses Outfit genau dem entsprach, in dem sie im Traum durchs Feuer ging. In dem Traum, den sie diese Nacht wieder gehabt hatte – zum fünften Mal nacheinander. Sie fühlte sich nicht nur fast hübsch, sondern genoss jetzt zumindest einen Anflug von dem Gefühl, unverwundbar zu sein, das den Traum so köstlich machte.
Im Allgemeinen beobachtete Dixie Belle auf dem Bett liegend, wie ihr Frauchen sich anzog, aber dieses Mal war sie unter dem Bett, sodass nur ihr Kopf mit den langen Ohren unter dem als Tagesdecke dienenden Quilt hervorsah.
Cora sagte: »Du bist ein komischer Hund, Miss Dixie. Manchmal kannst du so albern sein.«
ZWÖLF
Ab neun Uhr bestand ein gewisses Risiko, dass ein Immobilienmakler Interessenten durch das leer stehende Haus führte. Aber an einem Wochentag wie diesem würden die meisten einen Besichtigungstermin nach 17 Uhr vereinbaren.
Aber selbst wenn ein Makler aufkreuzte, würde Jane ihnen nicht mit der Pistole in der Hand gegenübertreten müssen. In dem begehbaren Kleiderschrank des großen Schlafzimmers gab es einen Zugang zum Dachboden: eine ausziehbare Leiter, die sie jetzt für alle Fälle schon mal herunterzog. Sobald unten Stimmen zu hören waren, würde sie ins obere Reich von Spinnen und Silberfischen ausweichen und die Leiter einziehen.
Im Schlafzimmer holte sie ein kompaktes UKW-Radio aus ihrer Tragetasche und stellte es an das Fenster, von dem aus sie zuvor Hannafins Haus überwacht hatte. Dieser Spezialempfänger, der auch einen Verstärker und einen Recorder enthielt, arbeitete unterhalb der UKW-Frequenzen, auf denen kommerzielle Sender ihre Programme ausstrahlten. Voreingestellt war er auf eine ungenutzte Frequenz, die der Trägerwelle der Infinity Transmitter entsprach, mit denen sie Hannafins vier Telefone präpariert hatte.
Diesen Empfänger würde sie nur brauchen, wenn der Journalist im Festnetz telefonierte. Wollte er sich mit jemandem beraten, bevor sie ihn mittags anrief, würde er vermutlich sein Smartphone benutzen. Die meisten Leute glaubten, Handygespräche seien schwieriger abzuhören. Das war nicht unbedingt der Fall – vor allem nicht, wenn der Überwacher die nötigen Vorbereitungen getroffen hatte.
Aus ihrer Tragetasche holte Jane ein Wegwerfhandy, eines von dreien, die sie vor Wochen bei unterschiedlichen Discountern gekauft hatte. Eine programmierte elektronische Pfeife von der Größe einer Gewehrpatrone, mit der sich jeder beliebige Geräuschcode erzeugen ließ, war mit Klebeband neben dem Handymikrofon befestigt.
Nachdem sie den Vorhang eine Handbreit aufgezogen hatte, um Hannafins Haus beobachten zu können, wählte sie mit ihrem Billighandy die Festnetznummer des Journalisten. Und schon vor dem ersten Klingelton aktivierte sie die elektronische Pfeife.
Der Chip, den sie in Hannafins vier Telefone eingesetzt hatte, bot zwei Möglichkeiten: Er konnte erstens als gewöhnliche Wanze zum Abhören von Gesprächen und zweitens als Infinity Transmitter fungieren. Der Geräuschcode der elektronischen Pfeife aktivierte den Infinity Transmitter, der die Telefone am Klingeln hinderte. Gleichzeitig schaltete er ihre Mikrofone ein und sendete alle Geräusche im Haus an Janes Wegwerfhandy.
Die Telefone in Hannafins Küche, Wohnzimmer und Arbeitszimmer registrierten nur Stille, was bedeutete, dass sie deutlich hören konnte, was in seinem Schlafzimmer vor sich ging. Hammerschläge gegen den Griff eines Schraubendrehers und das leise Quietschen, mit dem ein Drehzapfen herausgeklopft wurde, bestätigten ihr, dass er die in seinen Sachen versteckten Werkzeuge gefunden hatte.
Nachdem das Hämmern aufgehört und die drei Stifte aus den Angeln gezogen waren, hörte sie die Tür im Rahmen rattern, als er sich dagegenwarf. Plötzlich trat Stille ein, auf die gemurmelte Flüche folgten, als Hannafin die ganze Wahrheit erkannte: Obwohl die Angeln – drei am Türblatt, zwei am Türrahmen – sich nun trennen ließen, seit die Drehzapfen herausgeklopft waren, konnte er die Tür nur einen Spalt weit öffnen, weil das Schloss nicht nachgab.
Aus diesem Grund hatte Jane kein leichtes Werkzeug, sondern einen kräftigen Schraubendreher und einen schweren Schlosserhammer für ihn zurückgelassen. Um die Tür aus Massivholz öffnen zu können, würde er jetzt die Angeln oder das Schloss herausmeißeln müssen. Eine anstrengende Arbeit.
Sie hatte behauptet, er werde sich in fünfzehn bis zwanzig Minuten befreien können, aber das war eine Lüge gewesen. Für seinen Ausbruch würde er eher eine Stunde brauchen. Jane wollte, dass er reichlich Zeit hatte, über ihren Vorschlag nachzudenken, bevor er das nächste Telefon erreichte. Und sie hoffte, dass er in seiner Erschöpfung erkennen würde, dass sie ihm in jedem Augenblick ihrer kurzen Bekanntschaft einige Schritte voraus gewesen war – und immer sein würde.
DREIZEHN
Vor fünf Jahren hatte Cora mit Dixie Belle einen Kurs mitgemacht, der den Dackel als Therapiehund qualifizierte. Seit damals hatte sie ihre beste Freundin jeden Tag in die Schule mitgenommen. Ihre Schüler, die unter Entwicklungsstörungen litten und vielfältige emotionale Probleme hatten, brauchten alle spezielle Förderung. Mit ihrem langhaarigen Schwanz, ihrem seelenvollen Blick und ihrer dynamischen Persönlichkeit leistete Miss Dixie im Klassenzimmer Heroisches, indem sie sich tätscheln, streicheln, drücken und mit sich spielen ließ, wodurch sie die Kinder beruhigte, ihre Ängste linderte und ihnen damit half, sich zu konzentrieren.
Tatsächlich nahm Cora Dixie überallhin mit.
In dem kleinen Wäscheraum neben der Küche stand die Hündin unter einer Lochplatte, an der mehrere Halsbänder und Leinen hingen. Sie wedelte mit dem Schwanz und sah erwartungsvoll zu ihrem Frauchen auf. Auch wenn Dixie nicht gern Gassi ging, liebte sie das Klassenzimmer und erst recht die Fahrten mit dem Ford Expedition.
Cora nahm ein rotes Halsband mit der dazugehörigen Leine vom Haken. Sie kniete sich hin, um es dem Dackel umzulegen … und musste erschrocken feststellen, dass ihre Hände so stark zitterten, dass sie die Hälften der Schließe nicht zusammenführen konnte.
Sie sollte den Hund mitbringen. Sie verstand, dass sie die kostbare Dixie Belle mitnehmen sollte. Verstand, dass die Begleitung durch ihre Hündin aus irgendeinem Grund ein krönendes Detail des Selbstporträts war, das sie an diesem ereignisreichen Tag malen sollte. Aber ihre Hände wollten ihr nicht gehorchen; die Schließe widersetzte sich ihr.
Dixie winselte und schob sich durch die offene Tür rückwärts in die Küche hinaus, in der sie stehen blieb und Cora beobachtete, ohne mit dem Schwanz zu wedeln.
»Ich weiß nicht«, hörte Cora sich sagen. »Ich weiß nicht … Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll.«
Die ruhige leise Stimme – die sie für den Ausdruck ihrer Intuition und ihres Gewissens gehalten hatte – war bisher nie hörbar gewesen. Sie hatte vielmehr Ähnlichkeit mit einer Textnachricht gehabt, die auf einem virtuellen Bildschirm in irgendeinem dunklen Winkel ihres Verstands mit Worten aus Licht zwingende Sätze entstehen ließ. Aber jetzt verwandelte das Licht sich in Töne, und eine verführerische Männerstimme flüsterte in ihrem Kopf.
Du darfst nicht länger trödeln. Beweg dich, beweg dich, beweg dich! Tu, wozu du geboren bist. Als Schriftstellerin bist du nicht berühmt geworden, aber dir winkt Ruhm, wenn du tust, wozu du geboren bist. Du wirst berühmt sein und bewundert werden.
Sie konnte dem Drang widerstehen, ihre Hündin mitzunehmen, aber dieser Stimme konnte sie nicht widerstehen. Tatsächlich spürte sie einen überwältigenden Drang, ihrem Gewissen, ihrer Intuition oder was es sonst war – Gott? – zu gehorchen, das zu ihr sprach und ihr Herz mit dem Versprechen einer großen Erfüllung anrührte, die ihr so lange versagt geblieben war.
Als sie Halsband und Leine wieder an den Haken hängte, hörten ihre Hände sofort zu zittern auf.
Zu Dixie sagte sie: »Mommy bleibt nicht lange fort, Schätzchen. Sei schön brav, ja? Mommy kommt bald wieder.«
Eiskalte Luft schlug ihr entgegen, als sie die Tür zwischen Wäscheraum und Garage öffnete. Sie hatte vergessen, ihren Mantel anzuziehen. Sie zögerte, aber ihr war bewusst, dass sie nicht trödeln durfte. Sie musste sich bewegen, bewegen, bewegen.
»Ich liebe dich, Dixie, ich liebe dich so sehr«, sagte Cora, und der Hund winselte, und Cora schloss die Tür, als sie in die Garage trat.
Sie machte sich nicht die Mühe, die Leuchtstoffröhren einzuschalten, sondern ging direkt zur Fahrertür des schneeweißen Ford Expedition, der sanft glänzend im Halbdunkel stand.
Sie setzte sich ans Steuer, ließ den Motor an und benutzte die Fernbedienung, um das Garagentor hochzufahren.
Winterliches Tageslicht flutete die Garage, als das Sektionaltor in seinen Führungen nach oben ratterte, und Cora hatte das Gefühl, es habe Ähnlichkeit mit dem funkelnden Lichteinfall in Filmen, der stets eine wundersame Erscheinung ankündigte, sei es die einer guten Fee oder eines gütigen Außerirdischen oder irgendeines Himmelsboten.
In ihrem stillen, schlichten Leben standen ungeheuerliche Ereignisse bevor, und sie genoss die Vorfreude auf einen noch nicht ganz definierten ruhmreichen Augenblick.
Schwacher Benzingeruch bewog Cora Gundersun dazu, einen Blick auf die Ladefläche des Expedition zu werfen. Die Rücksitzbank war umgeklappt. Auf der so erweiterten Ladefläche standen fünfzehn knallrote Zehnliterkanister in drei ordentlichen Reihen. Gestern Abend hatte sie die Einfüllstutzen und Ausgießer der vollen Behälter abgeschraubt und durch eine doppelte Lage Plastikfolie ersetzt, die sie mit Gummibändern gesichert hatte.
Sie hatte vergessen, dass sie diese Vorbereitungen getroffen hatte. Jetzt erinnerte sie sich daran, ohne schockiert zu sein. Sie betrachtete die Kanister und wusste, dass sie auf ihre Arbeit stolz sein konnte, denn die verführerische Stimme lobte sie und sprach davon, wozu sie geboren sei.
Vorn auf dem Beifahrersitz stand der große Kochtopf, in dem sie im Lauf der Jahre so viele Suppen und Irish Stews gekocht hatte. Seinen Boden bedeckten in einem Gartenzentrum gekaufte Ziegel des grünen Feinschaums, den Floristen als Grundlage für ihre Arrangements verwendeten. In dem Schaum steckten senkrecht drei Bündel Kaminstreichhölzer, zehn pro Bündel, die von jeweils zwei Gummibändern unter den Köpfen und am Fuß der Bündel zusammengehalten wurden. Neben dem Kochtopf lag ein kleines Gasfeuerzeug.
Die Streichhölzer sahen wie drei Bündel kleiner verwelkter Blumen aus, fand sie: magische Blumen, die auf ein Zauberwort hin zu feurigen Buketten erblühen würden.
Zwischen den Benzinkanistern hinter ihr lagen Hunderte von Streichholzköpfen verteilt, die sie mit einer Schere von ihren Hölzchen abgeschnitten hatte.
Als sie in den grauen Wintertag hinausfuhr, sparte sie sich die Mühe, nach der Fernbedienung zu greifen und das Garagentor hinter sich zu schließen. Die wundervolle Stimme sagte, nun komme es auf jede Sekunde an, und Cora war begierig, den Grund dafür zu erfahren.
Als sie das Ende der Zufahrt erreichte, begann heiße Luft aus den Heizdüsen ihre nackte Haut zu wärmen, sodass sie erst recht keinen Wintermantel brauchte.
Am Ende ihrer Einfahrt bog sie rechts auf die zweispurige County Road ab und fuhr in Richtung Stadt weiter.
VIERZEHN
Während Jane in dem leeren Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete und mit ihrem Wegwerfhandy lauschte, fand sie es interessant, dass Lawrence Hannafin in den siebenundvierzig Minuten, die er brauchte, um sich zu befreien, kein einziges Mal um Hilfe rief.