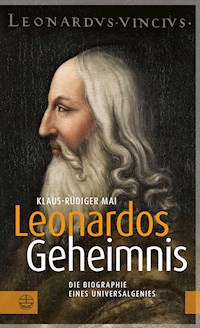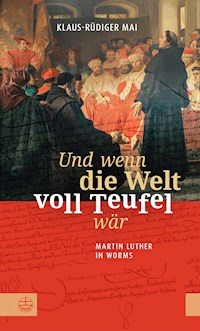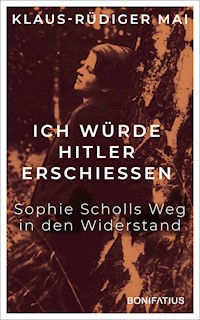Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hat die Kirche über ihr weltliches Engagement den Glauben verloren? Verliert sie sich in Politik? Verpasst sie den Aufbruch, der angesichts von Entchristlichung und Orientierungslosigkeit dringend erforderlich ist? Nie war Kirche notwendiger als heute, nie war sie weniger vorhanden als heute. Der bekannte Schriftsteller Klaus-Rüdiger Mai zeigt in seinem leidenschaftlichen Essay Fehlentwicklungen in den evangelischen Kirchen auf, aber auch Chancen von Kirche, und ermuntert zur freien Debatte ohne ideologische Scheuklappen. "Die Welt verändern" – hin zum Guten – ist der Slogan vieler. Aber muss man dafür nicht den Menschen selbst "verbessern" und die Kirche in eine Art "Moralagentur" verwandeln? Geht das überhaupt oder will der Mensch nur Gott spielen? In seiner pointierten Zeitgeistkritik plädiert Mai für die Rückbesinnung auf den Glauben. Der droht der Kirche auszugehen, wenn Traditionsabbruch und Missionsverzicht zum Markenzeichen der Protestanten werden. Dieses Buch soll einen Anstoß zur Diskussion über den künftigen Weg der evangelischen Kirche in Deutschland geben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KLAUS-RÜDIGER MAI
GEHT DER KIRCHE DER GLAUBE AUS?
Eine Streitschrift
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2018 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.
Cover: FRUEHBEETGRAFIK · Thomas Puschmann, Leipzig
Satz: makena plangrafik, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
ISBN 978-3-374-05307-0
www.eva-leipzig.de
»Mein Reich ist nicht von dieser Welt.«
Johannes 18,36
»Manchmal aber entsteht der Eindruck, als gehe es in der evangelischen Kirche primär um Politik, als seien politische Überzeugungen ein festeres Band als der gemeinsame Glaube. Das führt jedoch nicht nur dazu, dass sich Christen mit abweichenden politischen Auffassungen schnell ausgeschlossen fühlen, sondern auch – und weitaus bedenklicher – dazu, dass das Ziel politischer Einflussnahme letztlich verfehlt wird.«
Wolfgang Schäuble
»So ist dem einen Fortschritt, was der andere für Unglaube halten muss, und das bislang Undenkliche wird normal, dass Menschen, die das Credo der Kirche längst vergessen haben, sich guten Gewissens als die wahrhaft fortgeschrittenen Christen ansehen. […] Nicht Zeichen, das zum Glauben ruft, scheint so die Kirche, sondern eher das Haupthindernis, ihn anzunehmen.«
Papst Benedikt XVI.
»Nach meinem Dafürhalten ist ›liberale Theologie‹ ein hölzernes Eisen, eine contradictio in adjecto. Kulturbejahend und willig zur Anpassung an die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie ist, setzt sie das Religiöse zur Funktion der menschlichen Humanität herab und verwässert das Ekstatische und das Paradoxe, das dem religiösen Genius wesentlich ist, zu einer ethischen Fortschrittlichkeit. Das Religiöse geht im bloß Ethischen nicht auf, und so kommt es, dass der wissenschaftliche und der eigentlich theologische Gedanke sich wieder scheiden. Die wissenschaftliche Überlegenheit der liberalen Theologie, heißt es nun, sei zwar unbestreitbar, aber ihre theologische sei schwach, denn ihrem Moralismus und Humanismus mangle die Einsicht in den dämonischen Charakter der menschlichen Existenz. Sie sei zwar gebildet, aber seicht, und von dem wahren Verständnis der menschlichen Natur und der Tragik des Lebens habe die konservative Tradition sich im Grunde weit mehr bewahrt, habe darum aber auch zur Kultur ein tieferes, bedeutenderes Verhältnis als die fortschrittlich bürgerliche Ideologie.«
Thomas Mann, »Doktor Faustus«
VORAB
Jesus war kein Theologe. Matthäus, Lukas, Markus und Petrus wohl auch nicht, am ehesten noch Paulus. Man könnte einen großen Streit anzetteln, ab wann die Theologie als Lehre von Gott und den christlichen Glaubensinhalten entstand und wen wir als ersten Theologen anerkennen. Doch ist es für den Glaubenden überhaupt nötig, Theologe zu sein? Niemand, nicht einmal Theologen würden behaupten, dass eine Voraussetzung für den Glauben darin besteht, dass der Glaubende zugleich auch Theologe ist.
Dass die »Gotteswissenschaft« eine große, ernste und wichtige Wissenschaft ist, soll mit keiner Silbe in Abrede gestellt werden. Sie ist es aber nur, wenn sie nicht zu einer Art Politikwissenschaft mit eingebautem Heiligenschein verkommt, sondern Rede von Gott und seiner Beziehung zu den Menschen bleibt, wenn sie von den letzten und ersten Dingen menschlicher Existenz spricht und keine Rücksicht auf Applaus, Establishment und Mainstream nimmt.
Theologie ist eben kein Tänzchen im kurzen Sommerkleid der Illusionen, keine öffentliche Sause, kein schwelgerisch Sich-in-den-Armen-liegen von Funktionären, mithin auch keine Funktion des Politischen, sondern »Denkarbeit«.1 Insofern Theologie im weiteren Sinne immer auch öffentliche Rede ist, agiert sie im politischen Raum, sogar im Politischen selbst, doch bedeutet das nicht zugleich, dass sie selbst politisch sein muss, sondern indem Theologie Theologie betreibt, wirkt sie per se in der Gesellschaft, per se politisch. Zuallererst ist ihre Erkenntnis »nicht nur ein stufenweises Fortschreiten zur Entdeckung innerer tieferer Wirklichkeiten, sondern diese Erkenntnis ist der Wende- und Angelpunkt aller Wirklichkeitserkenntnis überhaupt. Die letzte Wirklichkeit erweist sich hier zugleich als die erste Wirklichkeit, Gott als der Erste und der Letzte, als das A und O«.2 Von dieser durch Dietrich Bonhoeffer skizzierten Tatsache hat Theologie stets auszugehen, wenn Theologie in ihrer wertvollen Weise sich in die gesellschaftlichen Diskurse einzubringen wünscht, hat sie das eben von ihren und nicht von politikwissenschaftlichen oder ethischen Voraussetzungen aus zu tun. Die Voraussetzung der Theologie ist Gott. Ersetzt sie diese Voraussetzung durch ethische oder politische Prämissen oder agiert sie parteipolitisch, verspielt sie ihre politischen Möglichkeiten, um die es ihr zu tun sein sollte. Das wäre tragisch, denn wenn sie die eschatologische Perspektive in die Gegenwart auflöste, verlöre sie Gott und würde stattdessen einem Götzen huldigen, der an eine Wandzeitung erinnert – und das in einer Zeit, in der Theologie als Theologie wie der Glaube als christlicher Glaube wichtiger denn je wird.
Wer den eigenen Glauben besser verstehen und erklären können möchte, dem sei Wilfried Härles weit verbreitetes Buch »Warum Gott. Für Menschen, die mehr wissen wollen« empfohlen, den Zweiflern Härles 2017 erschienenes Buch »… und hätten ihn gern gefunden. Gott auf der Spur«.
Angesichts der großen Umbrüche unserer Welt, die teilweise mit einer kaum erklärbaren Wirklichkeitsblindheit politisch Verantwortlicher einhergehen, bedarf es der Orientierung, die allein der Glaube bietet, so er nicht durch Ideologie verbogen oder ersetzt wird. Wie so oft schon besteht die Aufgabe der Theologie heute erneut darin, der Auflösung des Glaubens in die Vergänglichkeit der irdischen Welt und der Ideologisierung der Theologie selbst, ihrer Umwandlung in eine Staatsapologie, zu wehren.
Martin Luther hat der mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Gesellschaft in revolutionierender Weise eingeschrieben, dass der Glaube Gnade Gottes ist. Eigentlich galt die Philosophie als »Magd« der Theologie, doch die Scholastiker hatten das Verhältnis verkehrt. In Reaktion darauf wies Luther in seiner Disputation gegen die scholastische Theologie von 1517 der Philosophie die Tür, weil die »Magd« sich inzwischen zur Herrin aufgeschwungen hatte. Nicht nur die Philosophie musste sich von der Theologie unterscheiden, sondern auch die Theologie hatte sich von der Philosophie zu emanzipieren, denn die Methoden und Verfahrensweise beider Wissenschaften unterschieden sich doch beträchtlich. Heutzutage hat es den Anschein, als müsse sich die Theologie erneut befreien, um wieder zu ihrem eigenen Geschäft zurückzukehren, als hätte sie sich von den Zumutungen und Vereinnahmungsbestrebungen der Politik zu emanzipieren.
So, wie sich zu Luthers Zeiten die Theologie des mittelalterlichen Aristotelismus erwehren musste, der nicht über Gott nachdenken, sondern Gott in das Spiel der Syllogismen und Polysyllogismen einordnen wollte, haben Theologie und Kirche heute den Politikwissenschaften, genauer noch einem Ethizismus und Moralismus entgegenzustehen, die letztlich den Menschen an Gottes Stelle setzen. Dietrich Bonhoeffer hatte bereits in den Manuskripten zur christlichen Ethik davor gewarnt, Gott durch den Menschen zu ersetzen, wenn er ausführt: »Nicht, dass ich gut werde noch dass der Zustand der Welt durch mich gebessert werde, ist dann von letzter Wichtigkeit, sondern dass die Wirklichkeit Gottes sich überall als die letzte Wirklichkeit erweise. Dass sich also Gott als das Gute erweise, auf die Gefahr hin, dass ich und die Welt als nicht gut, sondern als durch und durch böse zu stehen kommen, wird mir dort zum Ursprung des ethischen Bemühens, wo Gott als letzte Wirklichkeit geglaubt wird.«3
Diese Streitschrift soll dazu beitragen, der Tendenz zur Selbstvergottung des Menschen und der damit einhergehenden Gefahr der Selbstsäkularisierung der Kirche zu wehren. Sie tut das, indem sie ganz unbefangen die Frage stellt: Geht der Kirche der Glaube aus?
Für den einen oder anderen stellt sich die Frage nicht, weil er entweder für sich zu der Überzeugung gelangt ist, dass die Kirche den Glauben längst verabschiedet hat, oder weil er der Meinung ist, dass die Kirche den Glauben nicht verlieren kann, weil jede Handlung der Kirche allein aus Glauben geschieht. Und wenn sie sich gegen den Glauben stellen sollte, dann wäre die Befreiung vom Glauben der höchste Glaubensakt. Allerdings ähnelt diese Haltung der des Mannes, der aus lauter Angst vor dem Tod Selbstmord begeht. Schon diese diametral entgegengesetzten Aussagen werfen die Frage auf, was der Glaube an Gott als Fundament der Kirche eigentlich ist.
Vielleicht aber ist inzwischen der gute alte Glaube an den trinitarischen Gott selbst auch nur noch ein antiquarischer Gegenstand – längst überholt –, und die Kirche muss sich nach etwas anderem umsehen als nach diesem alten, aus der Mode gekommenen und in einer bunten globalisierten Welt überflüssigen Glauben? Nach der richtigen ideologischen Gesinnung oder ethischen Haltung? Nach Seelenwellness oder nachhaltigem Lebensstil? Nach einem Leben, das in der Endlichkeit gelingen kann,4 wobei damit die Endlichkeit als Absolutum gesetzt wird, was letztlich nichts anderes ist als die Grundmaxime des Atheismus? Nach Patriotismus oder Totalitarismus? Nach einem Wohlfühlprotestantismus, der Sünde, Erlösung, Trinität nicht mehr kennen will?
Die Akzeptanz der Sündhaftigkeit des Menschen, die zu den christlichen Glaubenstatsachen gehört, stört in unserer hedonistischen Zeit nur. Also weg mit der Sünde, weg mit allem Kantigen, dem eigentlich Anspruchsvollen im Glauben!5 Weg mit Gottes Anspruch an uns. Selbst der Bischof von Rom, dessen nachsynodales Schreiben Amoris laetitia (»die Freude der Liebe«) durch seinen Vulgärsozialismus überrascht, will das Vaterunser abändern, um aus Gott eine Zeitgeistikone zu machen! Weg also mit der Zweinaturenlehre und dem Trinitätsaxiom, weg mit aller Transzendenz, her mit dem im Diesseits gelingenden Leben, das sich als Funktion einer totalitär-universalistischen Gesinnung im Alltag zur monolithischen Lebensnorm erhebt!
Diejenigen, die nicht müde werden, Vielfalt zu predigen, negieren oft genug alle Unterschiede, da in ihren Augen alles gleich gültig ist. Doch wem alles gleich gültig ist, dem ist auch alles gleichgültig, die Verschiedenheiten der Religionen und die Unterschiedlichkeit der Kulturen. Und auch hier lehrt uns die Sprachgeschichte in schnörkelloser Wissenschaftlichkeit, dass »gleichgültig« synonym steht für teilnahmslos, belanglos, unwesentlich. Kluges Etymologisches Wörterbuch definiert »gleichgültig« als »gleich viel geltend«, und da dies bedeutet: »es ist unwichtig, wie man sich entscheidet«, ist es eben auch »unwichtig, bedeutungslos«.
Doch es ist Gott, der die Vielfalt schuf und die Unterscheidung zur ersten geistigen Operation machte, dem nicht alles gleich gültig ist und der uns nicht gleichgültig sein darf. Der erträumte Universalismus, in dem alle Unterscheidung und aller Streit aufgelöst werden, ist der Universalismus des Friedhofes, ist der Ort der sterblichen Überreste, das Sinnbild der Endlichkeit. So ist jener falsche Universalismus letztlich ein Rüschenkleid des nackten Kaisers dieser Welt in der verdrängten Verzweiflung seiner Endlichkeit, dem Gott gestorben sein muss, weil er ihn nicht mehr findet. Kann das funktionieren? Oder würde nur die vergleichgültigte Vielfalt zur globalisierten Einfalt? Soll Kirche danach streben, Dienstleistungszentrum für eine globalisierungswillige Elite zu werden? Eine Art Moralagentur zum Auffüllen der Lücken, an denen ein blutleerer und begründungsfreier Verfassungspatriotismus versagt? Soll das Jenseits ganz ins Diesseits gezogen werden, nachdem die Gott-ist-tot-Theologie schon im letzten Jahrhundert den Schöpfer, Erhalter und Erlöser beerdigt hat zugunsten einer sich stets aufklären müssenden Aufklärung, die dadurch in ihr Gegenteil umschlägt? Das ist es nämlich, was aus der Aufklärung der Aufklärung folgt: der Umschlag in ihr Gegenteil. Der Ausgang aus dem Ausgang der selbstverschuldeten Unmündigkeit führt in die Unmündigkeit, die Kritik der Kritik in die Panegyrik. Die Aufklärung frisst wie Saturn ihre Kinder.
Vielleicht erleben wir gerade die Wiederkehr eines Kults des höchsten Wesens, wie ihn die Jakobiner dem Volk verordneten – nur dass an die Stelle der Vernunft eine Moral getreten ist, die umso weniger christlich ist, umso inflationärer sie christlich genannt wird. Dass Politiker wie Jürgen Trittin in der sogenannten Flüchtlingskrise die christliche Nächstenliebe anmahnen, weil ein falscher Begriff von christlicher Nächstenliebe ihre politischen Ambitionen zu begründen hilft, zeigt, wie sehr die Kirche bereits Hans im Glück ist und an Autonomie verloren hat.
Doch Hansens Glück zu stören, ist für die Kirche essenziell, wenn sie Kirche bleiben will. Sie muss sich aus den Niederungen der Parteipolitik erheben. Sie kann es, indem sie sich wieder auf ihre Aufgaben besinnt, deren vornehmste die Bezeugung des Evangeliums ist. Dabei spricht nichts gegen eine gute Beziehung zwischen Staat und Kirche. Niemand sehnt sich in die sozialistischen Zeiten der Diskriminierung und Unterdrückung von Glauben und Kirche zurück. Evangelische wie katholische Christen in Deutschland sollten froh über das Kooperationsmodell sein, das in unserem Land zwischen Staat und Kirche (noch) in Kraft ist. Liest man allerdings den Titel von Ellen Ueberschärs kürzlich erschienenem Buch »religiös & ruhelos. Die Zukunft des Christentums ist politisch« kann man sich schon fragen, ob es nicht mindestens den Kirchentagen inzwischen weniger um Glauben als vielmehr um sogenannte »Zivilreligion« geht. Doch Zivilreligion ist wie Zivilgesellschaft entweder eine Tautologie – denn die heutige Gesellschaft ist zumindest noch eine Bürgergesellschaft, während heutiges Christentum der Glaube von Bürgern eines demokratisch verfassten Staates ist – oder sie ist ein »totes Holz«, weil sie eine Schöpfung aus einer Art »reinem Geist« ist, der über Seminartischen und Vorlesungspulten kreist.
Das Kreuz als Skandalon scheint hier ausgedient zu haben. Vergessen scheint Jesu Ablehnung, sich politisch instrumentalisieren zu lassen. Sein Wort »Mein Reich ist nicht von dieser Welt« gilt zu vielen in ursprünglich kommunistischer Interpretationsmanier als lebensfeindliche Vertröstung denn als Hoffnung spendender Trost, der Handeln im christlichen Sinn erst ermöglicht.
Die evangelischen Kirchen müssen zum Glauben auf der Grundlage des Evangeliums und ihrer Bekenntnisse zurückfinden, von dieser Notwendigkeit handelt dieses Buch. Bisher hat Kirche das in der Vergangenheit immer wieder vermocht. Die Zuversicht des Glaubens vermittelt uns die Gewissheit, dass sie das auch in unserer Zeit wieder schaffen wird.
Ein persönliches »Vorab« sei noch hinzugefügt. Weder bin ich Theologe noch Pfarrer noch Bischof. Auch hege ich nicht den Wunsch, es zu werden. Ich bin nichts weiter als ein evangelischer Christ, Lutheraner. Aber als Lutheraner trage ich wie jeder andere Christ, wie jedes andere Glied unserer Kirche, für diese Kirche Verantwortung. Es kann mich nicht unberührt lassen, wenn Freunde und Bekannte, Christen, die ich schätze, die Kirche verlassen – oft, nachdem sie jahrelang mit sich gerungen haben. Es kann mich nicht kaltlassen, wenn andere, wie oft auch ich, sich damit quälen, dieser Kirche anzugehören, sie mitzutragen, weil in Christi Kirche an die Stelle des Glaubens immer stärker bloße Gesinnung – oft umschrieben mit »Werten« oder »Haltung« – tritt.
Ich kann und will und werde nicht dazu schweigen, wenn Exklusionen und Herabsetzungen von Christen erfolgen, weil ihre politischen Überzeugungen nicht in das Schema einer Gesinnung passen, die einem grundlosen Optimismus folgt, der nur aufrechtzuerhalten ist, wenn man die Realität verdrängt. Auf welch schwachen Füßen dieser sich »humanistisch« nennende Optimismus steht und wie realitätsblind er ist, führt die Behauptung vor, dass jeder »halbwegs intelligente Mensch weiß, dass ihre Parolen [die der Populisten] keine Probleme lösen«.6 Denn jeder »halbwegs intelligente Mensch weiß« auch, dass die »Populisten« diese Probleme nicht geschaffen haben. Sie sind da, real, und das hat mit den »Populisten« nichts zu tun.
In der schönen, hellen Welt des evangelischen Poesiealbums, in dem der Mensch »eigentlich« gut ist, kommt die Realität nur als finsterer Geselle vor. Sein grundloser Optimismus benötigt genau dort, wo er der Wirklichkeit nicht mehr auszuweichen vermag, den Notausgang der Verschwörungstheorie, muss die Grenzen seiner braven Vorstellung mit heimtückischen Konspirateuren, mit »Welteneindunklern«, die man in den »konservativen Ecken der Kirche« besonders oft anträfe,7 bevölkern. Diejenigen, die in dieser wenig christlichen Weise Menschen in Ecken stellen, sollten sich an den Psalm 118 erinnern: »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.« (Psalm 118,22)
Ich schreibe dieses Buch aus der Vollmacht heraus, die Martin Luther jedem Christen in der Freiheit eines Christenmenschen zuerkannte, aus Verantwortung der Kirche gegenüber und weil ich will, dass unsere Kinder eine Zukunft in diesem guten Land haben, eine Zukunft, in der sie sich frei und, ohne Repressalien zu fürchten, zum Christentum, zu Christus bekennen können. Das ist in diesem unseren Land nicht mehr zu allen Zeiten und nicht mehr aller Orten möglich. Das ist keine Angstmache, sondern leider Realität. Es tut der Kirche nicht gut, wenn Glieder der Kirche, Schwestern und Brüder in Christus, kirchenamtlich heruntermoralisiert werden! Im Gegenteil: Es spaltet die Kirche.
Ich wünsche mir, dass all jene, die ähnlich empfinden und denken, nicht die Kirche verlassen oder still weiter an ihrer Kirche leiden. Ich wünsche ihnen, dass sie die Angst verlieren, in Ecken gestellt zu werden, und in den Disput über den Zustand unserer Kirche eintreten. Denn die Kirche wurde nicht für die Frau Bischöfin oder den Herrn Pfarrer gestiftet, sondern für alle Christen gleichermaßen, sie ist »die Gemeinschaft der Heiligen«, die Gesamtheit ihrer Glieder. So haben auch alle Christen das Recht und die Pflicht, sich gleichberechtigt und mit gleichwertiger Stimme in diese Diskussion einzubringen.
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Gesinnung oder Glaube?
Moral statt Mission?
Braucht es Glauben?
Gesellschaft im Umbruch
Die neuen Kämpfe und die Kirche
Die Kirche und die neue Elite
Raus aus der Kirche oder rein die Kirche?
Mission: Wie Kirche Kirche ist
Anmerkungen
GESINNUNG ODER GLAUBE?
Ein Gerücht macht die Runde: Die Gesellschaft sei gespalten, und diese Spaltung vertiefe und diversifiziere sich. Alle Politiker warnen mit tiefbesorgten Mienen davor, alle Journalisten pfeifen es aus ihren Sendeanstalten, klagen in Zeitungen oder Posts über die Atomisierung der Gesellschaft, und von mancher Kanzel tönt die gleiche Litanei. Andere ziehen neue Mauern durchs Land, indem sie den jeweiligen politischen Gegner moralisch zu disqualifizieren suchen. Emotionen werden geschürt, Sachargumente spielen eine immer geringere Rolle. Doch stimmt das Gerücht? Ist die deutsche Gesellschaft wirklich so gespalten? Oder ist die These von der Spaltung nur ein hilfloser Versuch, durch kräftigen Manichäismus den wirklichen Zustand des Landes zu verdecken und damit die eigene Verantwortung auf andere als Sündenböcke abzuwälzen? Falls ja, vergisst man dabei, dass die Böcke selbst nicht sündigten, sondern nur die Sünde trugen – und zwar die der anderen. In vulgo: Die Vorstellung von der Spaltung der Gesellschaft suggeriert, dass zwei Lager existieren, und zwar die Guten und die Bösen, Helldeutschland und Dunkeldeutschland. Aber so einfach ist es nicht, weder mit den zwei Lagern noch mit dem Gutsein oder Bösesein noch mit dem hellen und dem dunklen Deutschland. Vielmehr durchziehen das Land viele Spaltungen, weshalb es inzwischen wie ein aufgeplatztes Sofakissen wirkt. Die Gemeinsamkeiten schwinden, die Bindekräfte, die jede Gesellschaft benötigt, verlieren sich. Christentum, Nation, Kultur könnten solche Bindekräfte sein. Doch sie stehen unter Vorbehalt oder werden abgelehnt. Eine Staatsministerin, die noch dazu für Integration zuständig ist, vermochte keine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache zu erkennen. Das wirft die Frage auf, wohinein denn integriert werden soll.
Um die Nation, die unbedingt zu überwindende, steht es noch schlimmer. Jedem Versuch, rational über Nation zu sprechen, wird irrational begegnet, indem er als »rechts« denunziert wird. Dabei gibt es wohl kein genuin linkeres Projekt als die Nation, doch dazu später. Bliebe also nur noch das Christentum. Das hat jedoch gerade einen schweren Stand. In dieser Gesellschaft, die ihre Bindekräfte verliert und sich zunehmend »desozialisiert«, agiert Kirche.
Die Grundthese der Streitschrift lautet: Nie war die Kirche wichtiger als heute. Und nie war Kirche bedrohter als heute, obwohl ihr an sich alle Wege offenstehen. Doch Teile der verfassten Kirche verwechseln den Zeitgeist mit dem Heiligen Geist und scheinen vergessen zu haben, dass Kirche nicht nur aus ihrer jeweiligen Zeit lebt, sondern aus allen Zeiten und über alle Zeiten hinweg.
Die zunächst gute Nachricht ist: Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet das Christentum. Doch trübt sich das Bild schnell ein, denn nur eine Minderheit der Deutschen besucht regelmäßig den Gottesdienst. Die Ergebnisse einer Allensbach-Studie im Rahmen der FAZ-Monatsberichte8 zeichnen auf den ersten Blick ein paradoxes Verhältnis der Deutschen zu Christentum und Kirche. Bei näherem Hinsehen stellt sich die Frage, ob sich nicht umgekehrt das Verhältnis der Kirche zum Christentum selbst als paradox, zumindest als zweideutig und daher verwirrend erweist. Es hat den Anschein, dass die Kirche ratlos vor dem Glauben steht, der doch ihr Grund ist – und zwar in doppelter Weise. Erstens bildet er das Fundament, auf dem sie steht, und zweitens ist er zugleich die Ursache dafür, dass es sie gibt. Aber die gesellschaftliche Akzeptanz des Christentums erstreckt sich nicht deckungsgleich auf die Kirche als Institution und auch nicht darauf, den Glauben zu leben.
Laut Allensbach sind 63 Prozent der Deutschen der Meinung, dass Deutschland stark vom Christentum geprägt ist, 56 Prozent votieren dafür, dass Deutschland in der Öffentlichkeit stärker zeigen sollte, dass es ein christliches Land ist. 85 Prozent der Befragten lehnen es ab, einen christlichen Feiertag für die Einführung eines islamischen Feiertags zu streichen. Allerdings wird nur in neun Prozent der Haushalte ein Tischgebet gesprochen.9
Einerseits existiert eine Hinwendung zum Religiösen, andererseits findet dieses Interesse am Religiösen nicht in den Kirchen seinen Ort. Schlimmer noch: Dieses Interesse geht an den Kirchen vorbei, Kirche kommt in diesem Zusammenhang kaum mehr vor. Dem Christentum wird zwar eine wichtige Rolle bei der Bewahrung von Identität und Heimat zugesprochen, aber diese Einschätzung bleibt im Nationalen oder Kulturellen stecken und erstreckt sich nicht auf seinen eigentlichen Bereich: auf den Glauben. Christentum und Kirche gehören zwar zusammen, werden aber anscheinend immer weniger als zusammengehörig wahrgenommen, weil der Abstand zwischen dem Christentum als glaubensbasierte Kulturgrundlage und der Kirche als politischem Akteur immer größer wird. Die Pole liegen nicht nur zu weit auseinander, mehr noch, sie streben weiter auseinander.
Ist es also so, dass die Kirche von dieser Hinneigung zum Religiösen und von der positiven Einschätzung des Christentums darum nicht zu profitieren vermag, weil sie immer mehr als Teil eines politischen Establishments erfahren wird, das zunehmend auf Kritik und Ablehnung, aber auch auf Enttäuschung und Ratlosigkeit stößt? Wird das Christentum weniger als Religion, denn mehr als bloßer Wertegarant im säkularen Raum gesehen? Als Bewahrer heimatlichen Brauchtums, als Garant für Heimat schlechthin? Immer öfter helfen auf den Dörfern und in den kleinen Städten in Thüringen und in Sachsen auch Atheisten mit, die Ortskirchen zu sanieren.
Um dem Christentum diese Rolle zuzusprechen, ist es nicht notwendig, Christ zu sein. Für die Berliner gehört der Fernsehturm zur Heimat, auch wenn die wenigsten Berliner die Kugel des Fernsehturms je besucht haben. Aber was wäre Berlin ohne den Fernsehturm? Es ist nicht entscheidend, dass man von etwas praktischen Gebrauch macht, sondern dass es das eigene Lebensgefühl stützt.
Wenn viele Befragte im Christentum den Bewahrer von Heimat und Identität sehen, dann ergäbe sich die Paradoxie, dass genau diejenigen in der Kirche, die einer Politisierung der Kirche das Wort reden, die von den Postulaten der Entgrenzung und Weltoffenheit in einem universalistischen Sinn ausgehen, sich exakt gegen das positionieren, was die Deutschen von einer christlichen Kirche erwarten: Bewahrung des Christlichen statt politisierendes Oberlehrertum. Weltoffenheit wurde immer mehr zu einem Synonym für Heimatlosigkeit. Da Heimat durch Herkunft und Tradition bestimmt wird, müssen Herkunft und Tradition von den neuen Universalisten abgewertet werden. Die Kirche hat sich dem Linksliberalismus als Ideologie geöffnet, der exakt diese Abwertung von Herkunft und Tradition vertritt.
Das geschieht in einer Situation, in der Verschiebungen an der gesellschaftlichen Oberfläche zunehmend tektonische Tiefen erreichen und zu ernsthaften Spannungen und Störungen führen. Diese Verwerfungen in der Gesellschaft sind weder mit Rhetorik noch mit Moral zu beheben. Die Lebensweise einer Mehrheit wird infrage gestellt zugunsten von immer neuen alternativen Lebensentwürfen immer neuer Minderheiten, ohne dass gefragt würde, inwieweit sich diese Alternativen auf Dauer bewähren. Dabei sind ein Teil der neuen Minderheiten reine Kunstprodukte, geschaffen in den Laboren der Genderideologen, Kreationen einer neuen Geschlechteralchemie. Die Amerikaner nennen das wag the dog (der Schwanz wedelt mit dem Hund). Dieser Vorgang destabilisiert die Gesellschaft, weil diese immer neuen Minderheiten nichts miteinander verbindet. »Als Folge der seit dem Zweiten Weltkrieg ausgeweiteten Minderheitenschutzbestimmungen ist die Verteidigung der Rechte nationaler Mehrheiten ›weitgehend in einen Bereich außerhalb der akzeptierten normativen Ordnung‹ geraten.«10 Im Gegenzug wird das Christentum immer stärker zum Symbol der Mehrheitsrechte, weil Deutschland christlich geprägt ist und die wichtigsten Feiertage dem Christentum entstammen, wie die Umfrage illustriert. Es drängt sich der Eindruck auf, dass ausgerechnet das Christentum das ist, was bleibt, wenn alles andere aufgebraucht oder zerstört wurde. Darin liegen, so ungewohnt die Betrachtungsweise auch sein mag, Chance und Aufgabe der christlichen Kirchen. Die Bedeutung des Christentums in der spätmodernen Gesellschaft Deutschlands findet sich weitaus stärker in der Kultur als in der Religion. Das muss kein Nachteil sein, denn es führt auch ein Weg über die Kultur zur Religion. Religion kann auch sehr stark und sehr nachhaltig im Kulturellen erfahren werden. Manch einer begegnet erstmalig oder wieder dem Christentum in der Kultur, weil Ersteres das Letztere geprägt hat.
Dass es so weit kommen konnte, ist Resultat einer Entwicklung, die zur Krise führt, die zugleich aber auch einen Weg aus der Krise weist. Die starke christliche Prägung steht für 63 Prozent der Befragten für etwas, für das ihnen durch die Hegemonie des Diskurses der Achtundsechziger und Nachachtundsechziger die Begriffe genommen oder tabuisiert wurden: für Nation, für Identität, für Heimat. In einem gesellschaftlichen Zustand, in dem die Lebenswirklichkeit der Mehrheitsgesellschaft nur noch als reaktionärer Widerborst vorkommt und viele Anstrengungen im öffentlichen Raum unternommen werden, eine gewünschte Realität durch einen Journalismus herbeizuschreiben, der nicht mehr der Objektivität, sondern dem Erwünschten verpflichtet ist, setzt Sprachverunsicherung und im nächsten Schritt Sprachverwirrung ein. Das zeigt sich nicht zuletzt an den Versuchen, Sprache angeblich gendergerecht oder politisch korrekt zu zerstören. Was man damit schafft, ist eine durchideologisierte Kunstsprache, die den Abstand zur »normalen« Bevölkerung ins Extrem treibt. Ist dieser Zustand erreicht, ist gesellschaftliche Verständigung kaum mehr möglich. Die Bibel kennt diesen Vorgang und hat ihn uns zur Lehre in der Geschichte vom Turmbau zu Babel aufbewahrt. »Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen.« (1. Mose 11,4) Der Himmel der neuen Turmbauer ist eine Hypermoral,