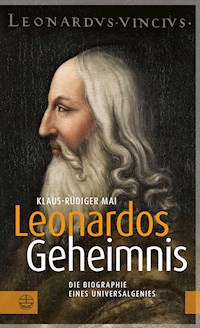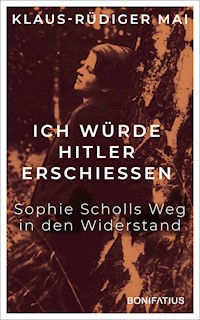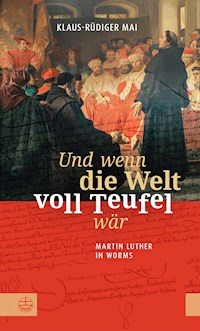
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen." Es ist einer der wichtigsten Momente in Martin Luthers Leben: 1521 reist er von Wittenberg nach Worms, um sich und seine Thesen auf dem Reichstag zu verteidigen. Kaiser Karl V. hat ihm zwar freies Geleit zugesichert, doch das hat 100 Jahre zuvor den Reformator Jan Hus in Konstanz auch nicht vor dem Scheiterhaufen gerettet. Der historische Roman ist Klaus-Rüdiger Mais drittes Buch über Martin Luther. Ausgehend von neuesten Forschungsergebnissen zeichnet er Luthers Weg nach Worms und seine Zeit auf der Wartburg nach. Kenntnisreich verbindet der Schriftsteller und Renaissance-Kenner dabei die theologische Analyse mit den historischen Fakten und den inneren Beweggründen Luthers. So lässt er ein herausragendes Ereignis der Reformation lebendig werden! - Von Wittenberg über Worms auf die Wartburg: ein Wendepunkt in Luthers Leben - Packend erzählt: Martin Luthers Kampf gegen kirchliche Korruption und Dekadenz - 500 Jahre Wormser Reichstag: seine Bedeutung für die religiöse Freiheit - Erzählendes Sachbuch mit ausführlichem Quellenverzeichnis und Personenregister - Autor Klaus-Rüdiger Mai ist bekannt für seine historischen Romane, Sachbücher und Biographien "Mönchlein, Mönchlein, Du gehst jetzt einen Gang ..." Bei seinem Auftritt in Worms war sich Luther bewusst, dass der Kaiser von ihm nichts anderes als den Widerruf seiner 95 Thesen gegen den Ablasshandel und die Unterwerfung unter den Papst erwartet. Mit seinem biographischen Roman lässt uns Mai nicht nur die Zweifel und Ängste Luthers nachempfinden. Er zeigt auch den Mut des Mannes, der in Zeiten von Korruption, Unterdrückung und Dekadenz für seinen Glauben und sein Gewissen einstand und damit den Lauf der Geschichte veränderte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KLAUS-RÜDIGER MAI
Und wenn
die Weltvoll Teufel
wär
MARTIN LUTHERIN WORMS
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2020 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Printed in Germany
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.
Cover: Anja Haß
Coverbild: © akg-images, Luther Reichstag in Worms / Thumann
Satz: makena plangrafik, Leipzig
Druck und Binden: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
ISBN 978-3-374-06617-9
eISBN (PDF) 978-3-374-06618-6 // eISBN (E-Pub) 978-3-374-06619-3
www.eva-leipzig.de
»Aber da ich jetzt sehe, dass meine Hoffnung ein bloßer Menschengedanke gewesen ist, und ich täglich in dieses große, tiefe Meer hineingezogen werde, in dem unzähliges Gewürm, die großen Tiere mit den kleinen ihre Kräfte und Bemühungen zusammensetzen, so sehe ich zugleich, dass der Satan durch die Anfechtung meiner Hoffnung nichts Anderes gesucht habe, als dass ich abgelenkt durch das Gefühl meiner Nichtigkeit, endlich ganz und gar von meinem Vornehmen abkäme, und ich eher nach Babylon wandern müsste, ehe ich mein Jerusalem mit Wehr und Speise versehen müsste.«
MARTIN LUTHER AM 3. MÄRZ 1521 AN KURFÜRST FRIEDRICH DEN WEISEN, DER BEREITS IN WORMS AUF DEM REICHSTAGE WEILT
»Wisst wohl, ich hatte viel zu kämpfen mit den Träumen, um ihnen nicht nachzuhängen. So träumte ich doch die Flucht des Papstes voraus, und als ich davon erzählte, sagte der Herr Chlum noch in derselben Nacht: »Der Papst wird zu Euch zurückkehren.« Ebenso träumte ich von der Einkerkerung des Magisters Hieronymus, allerdings nicht in der richtigen Weise. Alle Gefängnisse wohin ich geführt werden sollte und wie, zeigte sich mir vorher, wenn auch nicht in genauer Art. Öfters erschienen mir auch viele Schlangen mit Köpfen auch auf den Schwänzen, aber keine konnte mich beißen … Das schreibe ich nicht, weil ich mich für einen Propheten hielte und mich überheben wollte, sondern um Euch zu sagen, dass ich Anfechtungen an Leib und Seele hatte und ganz große Furcht, ich möchte das Gebot des Herrn Jesus Christus übertreten.«
JOHANNES HUS AN SEINE FREUNDE, KONSTANZ 9. JUNI 1415
»Mönchlein, Mönchlein, Du gehst jetzt einen Gang, dergleichen ich und mancher Obrist auch in der allerersten Schlachtordnung nicht getan haben. Bist Du aber der rechtlichen Meinung und Deiner Sache gewiss, so fahre in Gottes Namen fort und sei getrost, Gott wird dich nicht verlassen. Mut, Mönchlein, Mut!«
DER CONDOTTIERE GEORG VON FRUNDSBERG ZU MARTIN LUTHER, BEVOR ER VOR DEM REICHSTAG AUFTRAT
Inhalt
Prologus
I Der Kaiser bittet nach Worms (Kapitel 1–2)
II Aufbruch ins Ungewisse (Kapitel 3–20)
III Im Wort Gottes gefangen (Kapitel 21–24)
Epilogus
Zitationsnachweis
Verzeichnis der benutzten Literatur
Personenverzeichnis
Martin Luthers Leben in Daten
Prologus
»Aber zu unserer Zeit sind unsere Ohren durch die Menge der schändlichen Schmeichler gar so zart und weich geworden, dass wir, sobald wir nicht in allen Dingen gelobt werden, schreien, man sei bissig. Und wenn wir uns sonst gegen die Wahrheit nicht wehren können, halten wir uns sie vom Leib durch den erdichteten Vorwurf der Bissigkeit, der Ungeduld und der Unbescheidenheit. Was soll aber das Salz, wenn es keine Schärfe besitzt.«
MARTIN LUTHER
Der leichte Wind, der vom See wehte, machte sich ein Vergnügen daraus, die wie schlafende Hunde bräsig auf der Stadt Konstanz brütende Hitze immer wieder aufzujagen. Zwei Edelleute, denen vier Bischöfe folgten, hielten an diesem Freitag nach Prokop im Jahre 1415 nach Christi Geburt auf den Kerker des Franziskanerklosters zu, das unweit der Stelle lag, an der sich der Rhein aus der Umarmung des Bodensees befreite und sich auf den Weg durch Deutschlands Fürstentümer und Reichsstädte in die Nordsee begab. Die sechs Herren schauten, im Klosterhof wartend, auf die Tür, die zum Mönchsverlies führte. Die Bischöfe, die hinter den beiden Edelleuten standen, schienen einen erbitterten Wettstreit darüber zu führen, wem von ihnen es gelänge, die ernsteste Miene aufzusetzen, während der Herr Graf Johannes Slavata von Chlum und Kosmberk, der wegen seines geraden Wesens den Beinamen Kepka – zu Deutsch der Unverschämte – bekommen hatte, bekümmert dreinschaute, denn in seiner Unverschämtheit hielt er nach wie vor unbeirrt an seinem Magister Johannes Hus fest.
Ein Mönch führte den hageren Magister aus der Tür, dessen schwarzes langes Haar und sich unter dem Kinn verjüngender dicker Vollbart in den letzten Tagen deutlich grauer geworden waren. Trotz der schweren Ketten hob er die Arme, um seine rechte Hand schützend über die Augen zu halten – so rücksichtslos stach die Julisonne in die Augen des Magisters. Hus war im November des Vorjahres, kurz nach Eröffnung des Konzils in Konstanz, gefangen gesetzt und bald darauf von schwerer Krankheit befallen worden. Die Haft der Dominikaner hatte er nur überstanden, weil Kepka seinem Namen alle Ehre einlegte und durchsetzte, dass der Magister auf die Burg Gottlieben gebracht wurde, wo ihm eine gewisse Fürsorge zuteilwurde – und er genas. Doch wofür?
Nun hielten ihn die Franziskaner in Haft, weil man den Ketzer zwar nicht freigeben, ihn aber auch nicht töten wollte. Die Verwahrung des Theologen durch die Minderbrüder wurde darum schließlich als Kompromiss zwischen den allzu harten Haftbedingungen der Dominikaner und dem vergleichsweise laxen Arrest auf der Burg akzeptiert. Noch am Morgen hatte er seinen Freunden geschrieben: »Wenn ich Euer Liebden aus irgendeinem Grunde nicht wieder schreiben sollte, so behaltet mit allen Freunden mich bitte im Gedächtnis und betet, Gott möge mir und meinem lieben Bruder in Christus, dem Magister Hieronymus, Standhaftigkeit verleihen, der vermutlich ebenfalls den Tod erleiden wird, wie ich von den Abgesandten des Konzils erfuhr.«1
Ohne den treuen Robert, seinen Wärter, würden die Freunde seine Briefe nicht erhalten. Hus ermahnte ihn, um Gottes Willen die Briefe gut zu verbergen und vorsichtig nach Böhmen zu bringen, damit aus ihnen nicht große Gefahr für die Empfänger erwüchse. Ungeachtet dieser Gefahr sprach Johann von Chlum mit ruhiger Stimme, für alle gut hörbar zu ihm: »Siehe, Magister Johannes, wir sind Laien und wissen Dir nicht zu raten. Sieh also zu, wenn Du das Gefühl hast, dass Du in irgendwelchen Punkten von dem, was man Dir vorwirft, schuldig bist, schäme Dich nicht, darüber Dich belehren zu lassen und zu widerrufen.«2 Er sah ihm nun tief in die Augen und Johannes Hus nahm die Arme, die von den Ketten nach unten gezogen wurden, vor den Körper und schaute zurück. So als sprächen sie sich mit Blicken Mut zu, während der Edelmann fortfuhr: »Wenn Du aber nicht das Gefühl hast darin, was man Dir vorwirft, schuldig zu sein, und Dein Gewissen Dir gebietet, handle unter keinen Umständen gegen Dein Gewissen und lüge auch nicht im Angesicht Gottes, sondern steh viel mehr bis zum Tode in der Wahrheit, die Du erkannt hast.«3 Was den Mut stärken sollte, focht auch an. Mit ganzer Wucht spürte Hus die Ausweglosigkeit seiner Situation und Tränen sprangen ihm vor Mitleid mit sich selbst in die Augen, denn dass er recht gedacht, recht geschrieben, recht disputiert und recht gepredigt hatte, wusste er, so wie er nicht daran zweifelte, dass ihm die Wahrheit, in der er stand, den qualvollen Tod auf dem Scheiterhaufen einbringen würde. Aber durfte er Gott ins Gesicht lügen, die Wahrheit, die Christus war, verleugnen und das ewige Leben für eine längere Frist im Zeitlichen verlieren? Ein so großer Frevel würde ihn in die ewige Verdammnis führen, auch wenn seine Widersacher unter der Mitra in ihren gleißnerischen Worten die Hölle in den Himmel und den Himmel in die Hölle verwandelten. In seiner Ratlosigkeit hob er, nun, da sich seine Augen an das Licht gewöhnt hatten, den Blick zum Himmel und entdeckte einen Raubvogel, der mit ausgebreiteten Schwingen wie ein schwarzes Kreuz in das Blau des Himmels eingebaut schien. Könnte der Himmel in tausend Stücke zerfallen, wenn er nicht durch dieses Kreuz wie von einem Schlussstein zusammengehalten würde? Was wollte ihm Gott mit diesem Zeichen sagen? Hus wusste es nicht, darum antwortete er unter Tränen dem Grafen: »Herr Johannes, Ihr sollt wissen, wenn ich mir bewusst wäre, etwas Irriges gegen das Gesetz und die heilige Mutter Kirche geschrieben oder gepredigt zu haben, dass ich in Demut widerrufen wollte – Gott ist mein Zeuge. Habe ich mir denn nicht immer gewünscht, dass man mir bessere und beweiskräftigere Schriftbelege zeige, als das ist, was ich geschrieben und gelehrt habe? Und wenn man sie mir gezeigt hat, will ich auf das Bereitwilligste widerrufen.«4 In den Falten des verhärmten Gesichts stand die Verzweiflung.
Einer der Bischöfe, die den Zug begleiteten, hatte Hus beobachtet. Ihm riss die Geduld: »Willst Du vielleicht weiser sein als das gesamte Konzil?« Der Bischof, dessen kleiner Kopf auf dem massigen Leib schulterlos eingekeilt war, maß ihn mit kaltem Blick. Hus sah, dass dieser Mensch nichts verstanden hatte. War all sein Tun und Predigen vergeblich gewesen? Er fühlte sich von Gott verlassen und ohne jeden Trost.
»Ich will nicht weiser sein als das gesamte Konzil«, entgegnete der Magister müde. Er wusste: Weil sie keine Argumente besaßen, verketzerten sie ihn. Ihre Lügen dienten nur ihrer Macht, nicht aber der Wahrheit. Eher würden Rechtschaffenheit und Wahrheit, Glaube und Seligkeit zum Teufel gehen, eher schickten sie Christus auf den Scheiterhaufen, den sie mit den Trümmern seines Kreuzes entfachten, als dass sie nur ein Quäntchen ihrer Macht abgeben würden. Obwohl er das wusste, durfte er aber nicht von seinen Forderungen ablassen. Denn verfügten sie auch über die Herrschaft, so doch nicht über die Gerechtigkeit: »Aber ich bitte Dich, gebt mir den Geringsten von Seiten des Konzils, der mich durch bessere und beweiskräftigere Schriftstellen belehrt, und ich bin bereit, sofort zu widerrufen.«
»Wie verstockt Du doch bist in Deiner Häresie!«, ereiferte sich der Bischof mit fetter Stimme.5 »Es lohnt der Worte nicht!« Dagegen konnte auch der Herr von Chlum und Kosmberk nichts sagen. Die Bischöfe wandten sich ab und Robert, der treue Wärter, brachte den Magister in seine Zelle zurück. Graf Slavata von Chlum und Kosmberk starrte noch gedankenvoll einen Augenblick auf die Stelle, an der sein Magister in Ketten gestanden hatte. Ihm war, als lägen ein paar Tränen wie Perlen auf dem Sand des Klosterhofes. Er seufzte und wünschte, dass dem nicht so wäre. Dann riss er sich los und stapfte den Bischöfen hinterher. Würde sie doch nur aus blauem Himmel der Blitz treffen.
Johannes Hus indes, dem der treue Robert Papier und Tinte hingestellt hatte, fuhr mit dem Federkiel in lang gezogenen Buchstaben über das Blatt, auf dem kurz darauf zu lesen stand: »Der Brief ist geschrieben in Erwartung des Todesurteils im Kerker, in Ketten, die ich – das hoffe ich – für Gottes Gesetz erdulde. Um Gottes Willen lasst nicht zu, dass die guten Priester ausgetilgt werden!«6
Am Samstag nach Prokop, am achten Tag nach Peter und Paul, wurde der Prager Magister von Johann von Wallenrod, dem Erzbischof von Riga, zur Hauptkirche von Konstanz geführt, wo das Konzil bereits seiner harrte, um das Ärgernis nun ein für alle Mal auf die eine oder andere Art auszuräumen. Des Magisters Blick fiel auf einen Block in der Mitte der Kirche, der auf einem Tisch stand und auf dem zweierlei Kleider lagen: das Messornat und die Priesterkleidung für die Degradierung. Alles war möglich – Rückkehr ins Leben und in die Kirche oder der Tod auf dem Scheiterhaufen. Nachdem Johannes Hus vor dem Block lange gebetet und der Bischof von Lodi eine Predigt über die Häresie gehalten hatte, verkündete der Prokurator, dass heute das Konzil zu seinem Schlussurteil im Prozess gegen Johannes Hus komme. Doch man hinderte mit aller Gewalt den Angeklagten, auf die Vorwürfe, die verlesen wurden, zu antworten. Man schrie ihn an, wenn er etwas einwenden wollte: »Schweig jetzt!« »Wir haben schon genug gehört!« »Gebietet ihm zu schweigen!«7
Als der Magister einsah, dass man ihm das Rederecht verweigerte, beugte er die Knie, faltetet die Hände und betete innig zu Gott, derweil Anklagepunkt auf Anklagepunkt erbarmungslos auf ihn niederprasselten. Unter den Vorwürfen befanden sich auch von seinen Feinden erfundene Äußerungen, die er nie getätigt hatte. Zum Schluss warf man ihm vor, die Exkommunikation verstockt hingenommen zu haben. Diesen Vorwurf bestritt er mit den Worten:
»Ich habe sie nicht verstockt hingenommen, sondern ich habe unter Appellation gepredigt und die Messe gefeiert. Und obwohl ich zwei Prokuratoren an die römische Kurie verfügt und dabei vernünftige Gründe über mein persönliches Nichterscheinen angeführt habe, konnte ich trotzdem niemals Gehör bekommen, sondern von meinen Prokuratoren wurden die einen eingekerkert, die anderen übel behandelt. Und über alle diese Vorgänge beziehe ich mich auf die Prozessakten, in denen das alles ausführlicher enthalten ist. Schaut doch wenigstens nach! Obendrein bin ich auch zu diesem Konzil freiwillig gekommen im Besitz eines Geleitbriefes des hier gegenwärtigen Herrn, des Königs, da ich willens war, meine Schuldlosigkeit zu erweisen und von meinem Glauben Rechenschaft zu geben.«8
Wieder forderte er, dass man ihn widerlegen solle. Doch das Konzil ließ sich auf keine Disputation ein, es verlangte nur Antwort auf eine einzige Frage: ob er seinen Häresien abschwören und sich entschließen wolle, als reuiger Sünder in den Schoß der Kirche zurückzukehren.
»Wenn ich durch ein einziges Wort alle Irrtümer abbauen und überwinden würde, würde ich es am liebsten tun«, antwortete Johannes Hus, der seines Glaubens wegen nicht widerrufen konnte. Und während das Urteil über ihn als verstockten Ketzer erging, kniete er nieder und betete mit lauter Stimme: »Herr Jesus Christus! Vergib allen meinen Feinden um deiner großen Barmherzigkeit willen, so flehe ich dich an. Und du weißt, dass sie mich fälschlich angeklagt haben, falsche Zeugen vorgeführt und falsche Artikel gegen mich erfunden haben. Verzeihe ihnen um deiner unermesslichen Barmherzigkeit willen!« Da tobte der Konzilssaal und verspottete ihn. Auf Geheiß von sieben Bischöfen zog er die Messgewänder an.
Als er die Alba anlegte, sagte er: »Da mein Herr Jesus Christus von Herodes zu Pilatus geführt ward, hat man ihn mit seinem weißen Gewand verspottet.« Nun wurde er abermals aufgefordert zu widerrufen und abzuschwören. Da stieg er auf den Tisch und rief unter Tränen zunächst an die sieben Bischöfe gewandt und dann weiter zu den Konzilsteilnehmern: »Seht, diese Bischöfe fordern mich dazu auf, dass ich widerrufe und abschwöre. Ich scheue mich, es zu tun, um nicht ein Lügner zu sein im Angesicht des Herrn, und auch, um nicht gegen mein Gewissen und gegen Gottes Wahrheit zu verstoßen.«
»Alles, was wir sehen, ist, dass du in deiner Bosheit verhärtet und in deiner Häresie verstockt bist«, brüllte der Konzilsprokurator.
Nachdem Johannes Hus von dem Tisch gestiegen war, nahmen sie ihm den Kelch aus den Händen und verfluchten ihn: »Du verfluchter Judas, warum hast du den Rat des Friedens verlassen und hast Rat gehalten mit den Juden? Wir nehmen von dir diesen Kelch der Erlösung.« Dann degradierten sie ihn, nahmen ihm Stola und Messgewand, zerstörten schließlich seine Tonsur und übergaben ihn der weltlichen Gerichtsbarkeit. Bevor sie ihm die Schandkrone aufsetzten, sprachen sie: »Wir übergeben Deine Seele dem Teufel.« Auf der Krone, die eine Höhe von einer Elle maß, hatte man gräuliche Teufel gemalt und geschrieben: »Dieser ist ein Erzketzer.«
Während man ihn zur Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt brachte, auf halbem Weg zur Burg Gottlieben zwischen Wiesen und Gärten, verbrannte man auf dem Friedhof seine Bücher. Ein Priester, der zu Pferde saß, verweigerte ihm die Beichte mit den Worten »Er braucht nicht gehört zu werden und man braucht ihm auch keinen Beichtvater zu geben, denn er ist ein Ketzer.« Man zog ihm das Gewand aus, dann band man ihn mit einem Tau an einen Pfahl. Aber da er nun mit dem Gesicht nach Osten stand, sagte der Priester vom Pferd herab: »Man richte ihn nicht gegen Osten, denn er ist ein Häretiker. Richtet ihn nach Westen!«
Holzbündel mit Stroh vermischt hatte der Henker um Hussens Körper herum bis zur Höhe seines Halses aufgestapelt. Als er auch den letzten Appell zu widerrufen, verhallen ließ, zündete der Henker das Holz an. Johannes Hus sang in der Qual »Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner« und »Der du geboren bist aus Maria, der Jungfrau«. Als er schließlich zum dritten Mal zum Singen anhob, schlugen ihm die Flammen ins Gesicht – »und also in sich betend und Lippen und Haupt bewegend, verschied er im Herrn. Im Augenblick der Stille aber, bevor er verschied, schien er sich zu bewegen, und zwar so lange, als man zwei oder höchsten drei Vaterunser schnell sprechen kann«.9 Den Fleischblock, der noch am Pfahl stand und sichtbar wurde, nachdem das Holz der Bündel und das Tau verbrannt waren, stieß der Henker zu Boden und belebte das Feuer erneut. Um die Masse vollständig zu verbrennen, bedurfte es noch einer dritten Fuhre Holz. Als der Henker auf das Haupt des Johannes stieß, zerteilte er es und schob die Teile des Schädels in die Mitte der Flammen. Auch sein Herz, das sie in den Flammen entdeckten, zerschlugen sie, auf dass es vollständig verbrannte, und warfen die Kleidung des Magisters hinterher, denn sie wollten alles in Asche verwandeln, die sie später in den Rhein schütteten, weil sie fürchteten, dass irgendetwas von Johannes Hus zurückblieb, das den Ketzern als Reliquie dienen könnte.10
Am 6. Juli 1415 wurde der böhmische Theologe und Reformator Johannes Hus während des Konzils bei lebendigem Leib verbrannt, obwohl ihm König Sigismund freies Geleit zugesichert hatte.
IDer Kaiser bittet nach Worms
»Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen; sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott redet, so reden wir vor Gott in Christus.
2. KORINTHER 2,17
Übrigens hoffe ich, der durchlauchtigste Fürst werde so schreiben, dass diese römischen Häupter verstehen mögen, Deutschland sei bisher nicht durch seinen Mangel an wissenschaftlicher Bildung (ruditate), sondern den der Italiener, durch Gottes geheimen Ratschluss unterdrückt gewesen.«
MARTIN LUTHER
1.
Einhundertundsechs Jahre nach dem Flammentod des Prager Magisters Johannes Hus wartete ein Mönch des Ordens der Augustiner-Eremiten und Professor der Theologie an der Universität Friedrichs des Weisen von Sachsen in Wittenberg auf die Einladung des Kaisers, um auf dem Reichstag zu Worms seine Theologie zu verteidigen. Der Mann hieß Martin Luther. Eigentlich als Martin Luder geboren, hatte er im Jahr 1517 als Erinnerung an seinen Humanistennamen Eleutherius, der Befreier oder Befreite, das »d« durch ein »th« ersetzt. Martin nutzte die Zeit, um das Magnifikat, das Gotteslob aus dem Evangelium des Lukas, für den Prinzen Johann Friedrich, den Neffen seines Kurfürsten, zu übersetzen und zu erläutern. Für den äußeren Anlass, der ihn schließlich im November 1520 bewogen hatte, sich in diesen Text zu vertiefen, als würde ausgerechnet er ihm Schutz gewähren, fühlte er Dankbarkeit.
Oft und gern betete er auf Latein: »Magnificat anima mea Dominum,/ et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.« Doch nun stellte er fest, welch schönen Klang das Magnifikat auch in seiner Muttersprache hatte, wenn man das Deutsche nur genügend liebte und sich in ihm mühte wie ein Bergarbeiter unter Tage, der Stollen für Stollen in das Wortreich trieb, um kostbare Wörter zu finden, die er zu Sätzen verarbeitete: »Meine Seele erhebt Gott, den Herrn,// Und mein Geist freut sich an Gott, meinem Heiland« – so hatte er vor Kurzem die Zeile verdeutscht.11 In nichts standen die deutschen Verse den lateinischen nach. Vielleicht erwuchs in diesen Wochen und Monaten, in denen es ungewiss um sein Schicksal stand, die Liebe zum Übersetzen, denn keine anderen Tätigkeit ermöglichte es ihm, so tief in die Geheimnisse eines Textes vorzudringen. Wie gern hätte er die Übersetzung und Erläuterung vor seiner Reise nach Worms abgeschlossen, denn er wusste nicht, ob es ihm vergönnt sein würde, zurückzukehren und diese Arbeit abzuschließen. So arbeitete er sich im Ringen um die Balance zwischen Gründlichkeit und Effizienz im Winter und im Frühjahr 1521 durch den Evangelientext. Die Arbeit entspannte ihn, schuf Linderung in den Spannungen und Ängsten. Immer wieder ging ihm der Satz aus dem Magnifikat durch den Kopf: »O, das ist eine große Kühnheit und eine große Anmaßung von einem solch jungen, kleinen Mädchen! Sie wagt es, mit einem Wort alle Mächtigen schwach, alle, die große Dinge verrichten, kraftlos, alle Weisen zu Narren, alle Berühmten zu Ehrlosen zu machen und allein dem einzigen Gott alle Macht, Tat, Weisheit und Ruhm zuzueignen.«12 Glich er nicht – in aller Demut – in diesem Punkte der Jungfrau Maria? Hatte nicht auch er in seinen Schriften das Gotteslob angestimmt – in seinen Ablassthesen, in seinem »Sermon von dem Sakrament und der Buße«, in dem Schriftchen »Von den guten Werken« – und keine andere Autorität als Gottes Wort, wie es sich in der Bibel fand, gelten lassen? Nicht den Konzilen, wie man am Beispiel der Verurteilung des Johannes Hus sah, nicht den Päpsten, Königen und Kaisern durfte ein Christ vertrauen. Sie konnten irren und verfolgten oft eher weltliche Interessen denn die Absicht, Gott zu dienen. Verlässlich blieb allein die Schrift. All die Großen und Mächtigen, die Prälaten, die Doktoren und Magister besaßen keine Gewalt über die Heilige Schrift, sondern maßten sie sich nur an. Eigentlich galten sie nicht mehr als jeder andere Christ, auch wenn sie sich in ihrem Dünkel für etwas Besseres hielten. Vor Gott aber bestand kein Unterschied zwischen einem Bauern und dem Papst – vorausgesetzt, sie waren beide fromm. Aber was hieß es schon, fromm zu sein? Doch nur, sich ehrlich und nach besten Kräften im Glauben zu bemühen, denn alle Christen waren berufen, alle ein königlich Geschlecht von Priestern. Wie sang doch die heilige Jungfrau: »Er handelt mächtig mit seinem Arm und zerstört alle,/ die im Innersten ihres Herzens hochmütig sind.// Er setzt die großen Herren von ihrer Herrschaft ab und erhöht die,/ die niedrig und gering sind.«13 So hatte er den Vers: »Fecit potentiam in brachio suo,/dispersit superbos mente cordis sui.// Deposuit potentes de sede et/ exaltavit humiles« übersetzt. Maria stimmte ihr Gotteslob vor Jesu Geburt und vor der Geburt Johannes des Täufers an. Sie erhob ihre Stimme, da sie gerade von Gabriel, dem Engel des Herrn, erfahren hatte, dass ihr ein Sohn geboren werde, den sie Jesus nennen solle. Sie brauche sich nicht zu fürchten, versicherte ihr der Engel, denn sie habe Gnade beim Herrn gefunden. Und da sie dennoch zweifelte, antwortete der Engel: »Der Heilige Geist wird über dich kommen; und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten …«14. War der Heilige Geist nicht auch über ihn, Martin Luther, gekommen, hatte Gott nicht Großes an ihm getan, da er ihm die Erkenntnis gab? Hatte Gott ihn nicht begnadet? Was wollte er da zweifeln, wo es der Herr der Welt nicht tat?
Von seiner eigenen Liebe zum Lied der Maria abgesehen hoffte und wünschte er, mit der Übersetzung und Auslegung des Magnifikats den Neffen des Kurfürsten, den jungen Herzog Johann Friedrich, auf dessen Verantwortung für die Geschicke Kursachsen vorzubereiten, die ihm aufgrund seiner Stellung zukommen würde. Eines Tages würde das Heil vieler Menschen von ihm abhängen. Er wäre ein Segen für sie, wenn er seinem eigenen Willen entzogen und von Gott in Gnaden regiert werden würde. Umgekehrt aber würde es für viele Menschen Verderben bedeuten, wenn er als Fürst sich selbst überlassen bliebe und ohne Gnade regierte. Weil nun aber Herrscher Menschen nicht zu fürchten hatten, erwies es sich als umso dringlicher, dass die Fürsten Gott fürchteten. Gelingen konnte das gute Regiment nur, wenn die Herrscher Gott und seine Werke recht erkannten und sich fürsorglich verhielten.15 Um hierin Johann Friedrich, der in seinen Urteilen noch zu sehr von den Meinungen seiner Berater abhing, zu belehren, fiel ihm nichts Geeigneteres als das Magnifikat ein, in dem die Jungfrau von der Furcht Gottes und davon, was er für ein Herr sei, singt – vor allem jedoch davon, welche Werke er an den Hochgestellten und den Niedrigen tut. Eigentlich hatte Luther das Werk früher in Angriff nehmen wollen, doch hatten sich immer wieder dringlichere Arbeiten dazwischengeschoben. Als er im Herbst 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche schlagen ließ, ahnte er nicht im Geringsten, wie bekannt sie werden würden und welche Kämpfe ihm bevorstehen sollten. Nun aber empfand er es als Gnade, sich ausgerechnet in dieser Zeit mit dem Magnifikat zu beschäftigen – jetzt, wo er, der kleine Mönch, auf dem Reichstag zu Worms vor dem Kaiser und vor den Reichsständen reden sollte. Denn am Ende befand auch er sich, wie alle Menschen, in den Händen Gottes. Allerdings hatte es das noch nicht gegeben: dass ein einfacher Mönch den Großen des Reiches in deren weltlicher Versammlung Rede und Antwort stehen sollte. Deshalb suchte die Kurie, vor allem des Papstes Legat Hieronymus Aleander, Luthers Auftritt in Worm zu verhindern, um den Häretiker nicht durch das hohe Auditorium aufzuwerten. Aleander spann Intrigen und mühte sich auf den verschlungenen Pfaden der Diplomatie, um das Unabwendbare doch noch abzuwenden. Es bedeutete schon Ärgernis genug und ein böses Omen für Künftiges, dass der exkommunizierte und verurteilte Häretiker weder den Gang nach Rom noch den auf den Scheiterhaufen antrat, sondern jeden Tag, den der Herr werden ließ, unbehelligt auf das Podium stieg, um die Herzen und Hirne so vieler Studenten mit seinen Irrlehren zu vergiften. Wenn die Kirche nicht einmal mehr eines einfachen Mönchs habhaft werden konnte, um ihn zu bestrafen, was sollte dann aus der Kirche werden? Für die ecclesia militans, die wehrhafte Kirche, wurde die Causa Lutheri immer stärker zu einer Machtfrage.
So geriet in diesen unsicheren Tagen für Martin die Übersetzung und die Auslegung des Lobgesangs der Maria im Kampf gegen die Kurie, gegen Theologen wie Chochläus, Emser und Eck, gegen alle, die ihn brennen sehen wollten, immer mehr zu einer Selbstverständigung über Kirche und Politik und seine Rolle im Welttheater. Was eigentlich trieb ihn an, nicht wie verlangt zu widerrufen? Welche Folgen würde die bevorstehende große Auseinandersetzung haben, deren Mittelpunkt er bildete? Der Papst hatte ihn exkommuniziert und der König von England gegen ihn geschrieben. Wer also war er, dass er klüger als Könige und die Kurie und die vielen Doktoren und Magister, die Kardinäle und Bischöfe sein wollte? Sollte nicht die große Zahl seiner Gegner, gebildete und erlauchte Männer, ihn zur Demut und zum Einlenken bewegen? Was galt ihm die Zahl, was die Tatsache, dass sie mehr waren? Lag es nicht bei Gott, bei seiner Gnade, die Großen zu erniedrigen und die Geringen zu erhöhen? So wie ihn? Waren sie nicht alle einer Gnade teilhaftig, wenn sie es nur wollten? Wo Gott Gnade so voraussetzungslos schenkte, wie durften da Menschen, nur weil sie in der Welt eine erhöhte Stellung innehatten, sich anmaßen, Gottes Gnade zu verwalten und zuzuteilen? Der Glaube war eine Gnade, und in ihm blieb das Gewissen gefangen, denn nur im Glauben war man sich Gottes gewiss und nichts ging über den Glauben. Dass die Mächtigen die guten Seelen zwangen, ihre Erfindungen zu glauben, statt der Gnade Gottes zu vertrauen, war eine Schande! In den Geist des Gotteslobes einzutauchen, half ihm, Gottes Willen besser zu verstehen. Der schlichte Text überraschte ihn umso mehr, je tiefer er sich mit ihm beschäftigte. Durch die Arbeit des Übersetzens entstand in Martin Luther ein inniges Verständnis dieses in seiner Einfachheit und Geradheit großartigen Lobgesanges, das ihn in die Tiefe des Glaubens führte.
Am 24. März 1521, einen Tag vor der Ankunft des Reichsherolds in Wittenberg, hatte er noch einem Freund geschrieben: »Sie arbeiten daran, dass ich viele Artikel widerrufen soll, aber mein Widerruf wird dieser sein: Früher habe ich gesagt, der Papst sei der Statthalter Christi; jetzt widerrufe ich es, und sage: Der Papst ist Christi Widerwärtiger und der Apostel des Teufels.« Er zweifelte nicht daran, dass der »allerheiligste Widersacher Christi, der oberste Anstifter und Lehrer der Mörder« ihn vernichten wolle – so, wie er Johannes Hus auf den Scheiterhaufen geschickt hatte. Ungewiss blieb indes, ob dem Papst der Anschlag auf Martins Leben gelingen würde. Sicherheit in dieser schwierigen Situation fand er nur, wie so oft schon, im Glauben: »Es geschehe der Wille des Herrn. Mein Christus wird mir den Geist geben, dass ich die Diener des Satans im Leben verachte und im Sterben überwinde.«16
Einen Tag später, am 25. März, traf der Reichsherold in Wittenberg ein und wurde bei dem berühmten Maler und angesehenen Bürger der Residenzstadt, Lucas Cranach d. Ä., untergebracht. Wahrscheinlich wurde Martin von einem Diener Cranachs informiert und in sein Haus gebeten. Auf der langen Straße, die an der Universität, der Leucorea, vorbei zum Markt mit dem Rathaus und dem Cranachschen Anwesen gegenüber führte, knäulte und entknäulte sich das übliche Gewühl von Bettlern, Händlern, Mägden, Studenten und Knechten. In der frischen Frühlingsluft hing der strenge Duft des Fastens.
Kaspar Sturm, der als Herold den amtlichen Titel »Germania genand Teutschland« führte, weil er nicht für die spanischen, sondern für die deutschen Lande des Kaisers zuständig war, war von imposanter Erscheinung. Groß wie der ganze Mann war auch sein offenes, flächiges Gesicht mit der zierlichen Nase und dem erstaunlich kleinen Mund darunter. Erst im Oktober des vorherigen Jahres hatte ihn der junge Kaiser zu seinem Herold ernannt. Nachdem Martin das Siegel gebrochen und den Brief aufgerollt hatte, las er:
»Ehrsamer, Lieber, Andächtiger!
Nachdem Wir und die Stände des heiligen Reiches, die jetzt hier versammelt sind, uns vorgenommen und entschlossen haben, der Lehre und Bücher halber, die vor einiger Zeit von dir herausgegeben wurden, Erkundigung von dir einzuholen und diese zu bekommen, haben Wir dir für dein Herkommen und später wieder von hier zu deiner sicheren Bleibe Unser und des Reichs freie, ungeschmälerte Sicherheit und Geleit gegeben. Das senden Wir dir hiermit zu, mit dem Begehren, du mögest dich demnächst aufmachen, und zwar so, dass du in einundzwanzig Tagen, wie es unser Geleit bestimmt, mit Gewissheit hier bei uns sein mögest und nicht ausbleibst. Du sollst dir auch um keine Gewalt oder Unrecht Sorgen machen.
Karl V.«17
Anschließend übergab Kaspar Sturm ihm auch das Versprechen des freien Geleits des Kurfürsten Friedrich des Weisen und des Herzogs Georg von Sachsen für ihre Lande. Ein Kaiser, ein Kurfürst und ein Reichsfürst versprachen ihm freies Geleit. Doch wie wenig das im Ernstfall wert sein konnte, hatte die Hinrichtung des Johannes Hus gezeigt. König Sigismund rechtfertigte damals den Bruch des Versprechens mit der arg sophistischen Ausrede, dass er gegenüber einem Ketzer nicht an sein Wort gebunden sei. Und als Ketzer galt Martin nach dem Kirchnerecht bereits, denn mit der Bulle »Decet Romanum Pontificem« hatte der Papst ihn gebannt.
Kaiser Karls V. Einladung war allerdings in einem so freundlichen Ton gehalten, dass der päpstliche Nuntius in Worms, Hieronymus Aleander, darüber in Wut geriet. Den »Ehrsamen« und »Andächtigen« mochte der Römer noch mit viel Wehgeschrei ertragen, aber die persönliche und herzliche Anrede »Lieber« trieb den guten Mann zur Raserei. Die Kanzlisten fuhr er an: »Diesen Titel gebt ihr einem offenkundigen Ketzer gegen Gott und alle Vernunft.«18 Doch die Kanzlisten erwiderten nur zutreffend, dass, wenn sie unfreundlicher und schroffer geschrieben hätten, es dem Eingeladenen signalisiert hätte, dass er nicht willkommen sei. Und nach Worms kommen solle er doch.19 Wäre es nach Aleander gegangen, hätte man Martin verhaftet und nach Rom gebracht, um ihm dort den Prozess zu machen.20 Doch in den deutschen Landen stand inzwischen zu befürchten, dass ein Prozess gegen den Ketzer für Aufruhr sorgen würde. Allerdings gelang es dem päpstlichen Nuntius, durchzusetzen, dass Martin Luther auf dem Reichstag nur widerrufen, nicht aber disputieren durfte. Zu viel Erfahrung besaß der Doktor der Heiligen Schrift in der Kunst der Disputation.
Als Martin Luther die Einladung annahm, wusste er davon jedoch nichts, denn die Formulierung, dass man von ihm »Erkundigungen« einholen wolle, klang nicht nach Widerruf, sondern nach der Darlegung seines Standpunktes, nach einem Verhör. Karls Großkanzler Gattinara und sein Beichtvater Glapion spielten ein doppeltes Spiel.
Eigentlich erzürnte Hieronymus Aleander alles an dem Vorgang: erstens, dass man den Ketzer auf den Reichstag lud, zweitens die freundliche Einladung und drittens die Person dessen, der das Geleit überbringen sollte – ein Reichsherold mit deutlicher Sympathie für Luther.
Im Dom zu Worms hatte der Prior der Augsburger Dominikaner, Johann Faber, Anfang des Jahres die Leichenpredigt auf den Apostolischen Administrator des Erzbistums Toledo, Guillaume de Croÿ, gehalten. Der erst dreiundzwanzigjährige Kardinal von Santa Maria in Aquiro und Administrator der wichtigsten Erzdiözese Kastiliens verdankte diese hohe Stellung nicht seinen Gaben, sondern der Förderung seines einflussreichen Onkels Jacques, der in ihm den Sohn sah, der ihm verwehrt geblieben war. Doch der junge Herr, der sich unter den Feinden Luthers als einer der eifrigsten hervorgetan hatte, fiel bei einer Jagd in der Umgebung der Reichsstadt vom Pferd und starb. In seiner Predigt kam Faber auf die Notwendigkeit zu sprechen, die Kirche zu reformieren. Er rief den Kaiser und die Fürsten dazu auf, nach Rom zu gehen, um die Kirche zu ordnen. Erschrocken berichtete der Sondergesandte des Papstes, Raffaelo de Medici, dem Vizekanzler Giulio de Medici, dass sich der Dominikaner Johann Faber in Wut geredet hatte und dem Kaiser in »hochfahrendem Ton« zurief, »er müsse sich schämen, dass er nicht den Zug nach Italien unternehme, und wenn Kaiser Maximilian, Karls Großvater und Vorgänger als römischer König, zu dieser Stunde noch gelebt hätte, so würde er Italien erobert haben.« Und dann habe er – sich zu den Kurfürsten und Großen wendend – aus vollem Halse geschrien, sie sollten sich vereinigen und mit Sr. Majestät sich nach Italien aufmachen, um endlich zu erobern, »was ihr Eigentum wäre und ihnen so lange vorenthalten worden sei …«.21 Obwohl Johann Faber in dieser Predigt auch forderte, Martins Bücher zu verbieten, trat er für die Reform der Kirche ein wie auch der Wittenberger, den er ansonsten für einen Ketzer hielt. Mit der von Martin Luther im Jahr zuvor publizierten Schrift »An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung« stimmte er jedoch darin überein, dass der Kaiser und der deutsche Adel in der Pflicht standen, die Kirche zu reformieren. Die Opposition gegen Rom und das entstehende Nationalbewusstsein der Deutschen unterstützte Faber. So verliefen die Frontlinien unübersichtlich, weil eine Vielzahl von Konflikten sich überlagerten: theologische, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche. Bereits im Dom griff der Begleiter des Bischofs von Sitten, der Magister Michael Sander, den Dominikaner heftig an und verteidigte den Papst. Raffaelo de Medici wusste ferner nach Rom zu berichten, dass, als er in der Residenz des Kaisers am Tag darauf auf Messere Michael Sander wartete, einige Trabanten des Kaisers, allen voran der Reichsherold Kaspar Sturm, dem Magister in den Weg getreten seien und ihm gedroht hätten, ihn in den Rhein zu werfen oder ihm gar Schlimmeres anzutun, weil er den »Mönch getadelt hätte, der jene Predigt gehalten hatte«.22 Sturms zorniges Gesicht und seine kräftige Statur hatten keinen Zweifel daran gelassen, die Drohungen umzusetzen, wenn er sich nicht daran hielt. Aleander hielt den Reichsherold Sturm ohnehin für den falschen Mann am falschen Ort und beklagte sich in Rom über den übermütigen Narr und Tölpel, den grimmigen Feind des Klerus.
Während ganz Wittenberg auf Ostern schaute, besprach sich Martin Luther mit dem Bürgermeister, mit den Freunden in der Stadt und an der Universität. Schließlich kam man überein, dass er das Osterfest noch in Wittenberg feiern und am 2. April schließlich aufbrechen sollte. Der Goldschmied und Drucker Christian Döring stellte seinen Rollwagen, den man zum Schutz vor Sonne, Regen und Wind mit einem festen Tuch überzogen hatte, zur Verfügung. Der Rat der Stadt entlohnte dem Goldschmied die Leihgabe mit gutem Geld. Außerdem stellte er eine Reiseapanage von drei sächsischen Schillingen und 30 Gulden zur Verfügung, die Universität steuerte 20 Gulden bei. Die Großzügigkeit der Stadt verdankte Martin Luther dem einflussreichen Freund Lucas Cranach. Die Hilfe ermutigte ihn. Da Ordensleute nicht allein reisen durften, wurde sein Ordensbruder Johann Petzensteiner ihm zur Begleitung bestimmt, außerdem ließ es sich der Wittenberger Domherr Nikolaus von Amsdorff nicht nehmen, dem Freund beizustehen. Luthers und Melanchthons Vertrauter, Petrus von Suaven, ein Edelmann aus Pommern, komplettierte die kleine Reisegesellschaft. Melanchthon selbst, der 1518 nach Wittenberg kam, um die gerade eingerichtete Professur für griechische Sprache an der Leucorea zu übernehmen, und in auffallend kurzer Zeit zu Luthers wichtigstem Mitstreiter wurde, ließ man als Statthalter in der Residenzstadt zurück. Denn auch wenn Martin Luther sich in der besten Gesellschaft befinden würde, so blieb die Fahrt nach Worms doch eine Reise ins Ungewisse.
Am Karfreitag nun, nachdem das Datum der Abreise feststand, kündigte er dem Freund Johann Lang – dem Prior der Augustiner-Eremiten seines alten Klosters zu Erfurt, in dem er einst als Novize eingetreten und zum Mönch geweiht worden war – an, dass er Donnerstag oder Freitag in Erfurt zu ihm zu Gast käme. Da er jedoch exkommuniziert war, verfiel jeder, der ihn unterstützte, gleichfalls dem Kirchenbann. Deshalb schränkte er ein, um den Freund zu schützen, dass er nur komme, wenn ihm dadurch keine Gefahr entstünde oder ein unvorhersehbarer Umstand das verhindern sollte. In dem Falle würde er nach Eisenach weiterreisen und sie könnten einander dort treffen, um ausführlich zu reden. Er sehnte sich sehr nach dem Gespräch mit Johann Lang, gefährden wollte er ihn aber nicht.
Den Karfreitag verbrachte er im Gedenken an Jesu Passion und im intensiven Gebet, denn er wusste sich in der Nachfolge Christi. Es stand nicht in seiner Macht, die Reise nach Worms zu verweigern, wie es auch nicht in seiner Macht stand, abzuschwören. So dürfte ihm Christi Gebet im Garten von Gethsemane zu Herzen gegangen sein: »Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!«23
2.
Am Karsamstag schrieb Luther einen Brief an Herzog Johann Friedrich, denn er wollte ohne Schulden sein und seine Angelegenheiten geordnet wissen: »Ich schicke Euch, Eure Fürstliche Gnaden, das angefangene Magnifikat, ein Teil liegt noch in der Presse, einen anderen Teil muss ich noch fertigstellen. Doch jetzt, da ich auf den Reichstag nach Worms zitiert bin, muss alles bis zu meiner Rückkehr liegen bleiben.«24 Ostermontag traf aus Mansfeld sein Bruder Jacob ein, den er sehr liebte. Er war in der Kindheit sein liebster Spielkamerad.25 Im Unterschied zu seinem fast sieben Jahre jüngeren Bruder war Martin noch in Eisleben geboren und getauft worden. Doch ein halbes Jahr später ging Hans Luder nach Mansfeld, um als Partner des Eislebener Bergwerkunternehmers Hans Lüttich vor Ort nach dem Rechten zu sehen – und die Familie folgte ihm. Der gewiefte Unternehmer Lüttich vertraute dem jungen Familienvater aus mehreren Gründen. Hans Luder machte einen durchsetzungsfähigen und verlässlichen Eindruck und war der Sohn des reichen Möhraer Bauern Heine Luder, der neben seiner Bauernwirtschaft auch ein wenig Schwarzkupferförderung betrieb. Zudem dürfte der Onkel seiner Frau, der einflussreiche Antonio Lindemann, für ihn gebürgt haben. Hans Luders Frau entstammte einer angesehenen Kaufmannsfamilie, der das Rechnen im Blut lag. Zunächst mietete der junge Unternehmer vom Tischler Hans Dienstmann ein Haus am Stufenberg, denn für Hans Luder hieß es zunächst, sich in Mansfeld gegen die harte Konkurrenz und den rauen Menschenschlag der Bergleute durchzusetzen. Mit harter Arbeit und großer Selbstdisziplin erwarb er sich Achtung, der wirtschaftliche Erfolg ermöglichte es ihm, sich durchzusetzen und sich selbständig zu machen. Die Familie erwarb ein Haus mit Wirtschaftsgebäude innerhalb der Stadtmauern – unterhalb des Marktes. Ein Stück Land und ein großer Garten unweit des Hauses rundeten den Besitz ab. Vom Grafen Günther von Mansfeld-Vorderort pachtete Luder zwei Hüttenfeuer mit den dazugehörigen Kupfergruben am Möllendorfer Teich und wurde bald schon Ratsherr.26 Als ältester Sohn musste Martin sehr früh schon im Haushalt und vor allem im Garten mit anpacken. Die kleine Landwirtschaft, zu der auch der Garten gehörte, ernährte die Familie, die Bergleute und die für den Bergbau notwendigen Pferde. Sparsamkeit, Fleiß, aber auch Selbstvertrauen und Standhaftigkeit, Eigenverantwortung und Eigensinn lernte Martin von Kindesbeinen an. Sie waren das eigentliche Erbe, das Hans und Margarethe Luder ihrem Sohn fürs Leben mitgaben. In keinem Satz kommt die Mentalität des freien Unternehmers, der für sich stand und den keine Gilden und Zünfte nach außen absicherten, besser zum Ausdruck als in dem: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ohne den eigenen Standpunkt zu behaupten, hätte sich kein Unternehmer in der frühen Neuzeit durchgesetzt. Was der kleine Martin bei seinen Eltern sah, war eine Art praktischer Gleichberechtigung. Mutter und Vater, die sich in allem absprachen und gemeinsam den Kampf gegen den Unbill der Welt aufnahmen, bildeten eine Gemeinschaft. Der hohe Druck, unter dem der Vater stand, entlud sich gelegentlich im Jähzorn, der sich auch gegen Martin richtete. Diesen Jähzorn vererbte Hans Luder an seine Kinder: an Martin, der ihn weitgehend zu zügeln vermochte, auch wenn er sich in der einen oder anderen theologischen Fehde Luft verschaffte, und an den jüngeren Bruder »Klein-Hans«, der es nur bis zum Bergmann brachte, dafür aber mehr als ein dutzend Mal sich vor dem Gericht in Mansfeld wegen Körperverletzung zu verantworten hatte und schließlich 1536 ein unrühmliches Ende fand, als er in einer Wirtshausprügelei erschlagen wurde.
Eines Tages war der Zorn des Vaters, der für Martin gleich nach Gott kam, so groß, dass er ihn wegen einer Geringfügigkeit verprügelte. Auf diesen Vertrauensbruch folgte Angst und der Sohn zog sich vom Vater zurück. Der Vater, der seinen Fehler einsah und dem seine Grobheit von Herzen leidtat, bemühte sich dann geduldig, die Liebe seines Sohnes zurückzugewinnen, was ihm schließlich auch gelang. Hans Luder besaß auch eine weiche, eine sensible Seite. Wenn die drückenden Sorgen um die Existenz von ihm wichen und er mit Freunden am großen Tisch saß, erzählte er beim Bier Geschichten, schuf mit Worten eine ganz andere Realität, beschwor Vergangenes eindringlich herauf, als ereigne es sich gerade vor Martins Augen. Dann liebte und bewunderte der Sohn den Vater.27
Im Stillen dankte Luther nun seinem alten Herrn, dass er ihm zur Stärkung den Bruder geschickt hatte. Dass er mit dem Segen des Vaters reisen und sich nicht ohne den Beistand der Familie ins Ungewisse begeben musste, machte ihn in diesem Moment unverwundbar, es panzerte ihn gegen die Anfechtungen und Ängste. Wie oft war er mit Jacob und mit seinen Freunden, dem Oemler Nikolaus und dem Reinicke Hans, durch Mansfeld getobt. Wie oft hatten sie unter wildem, knäbisch hohem Kriegsgeschrei die Türken oder die Hussiten vertrieben oder sich einem der beliebten Wurfspiele hingegeben, die er so gut beherrschte. Zuweilen hatten die Knaben die Umgebung der Stadt erkundet, was ihnen eigentlich nicht gestattet war, weil sich allerlei fahrendes Volk auf den Straßen herumtrieb – düstere Köhler oder garstige Hexen, die kleine Kinder stahlen, sie in Schweine verzauberten und dann aßen. Dieses schöne, wilde Kinderleben endete für Martin Luther vor genau dreißig Jahren, zum Gregoriustag Anno Domini 1491, als der Vater ihn zur Lateinschule brachte. Der Weg führte bergauf, vorbei an den Häusern der Hüttenunternehmer Oemler und Reinicke, und bog vor Sankt Georg links auf den Kirchplatz, wo sich die Trivialschule unter dem Schatten der Kirche und zweier Kastanien befand. Damals konnte es, wenn es stark regnete und der Weg sich zusehends in einen wilden Schlammbach verwandelte, der den Unrat und Straßenkot mit sich ins Tal riss, vorkommen, dass ihn Freund Nikolaus, der kräftiger als der zarte Martin war, huckepack aufspringen hieß und ihn auf seinem breiten Rücken zur Schule trug, als wäre Martin leicht wie eine Feder. Diese Erinnerung zauberte ein Lächeln in sein Gesicht, das hemmungslos in lautes Lachen überging. Dafür stieg zeit seines Lebens Zorn in ihm auf, wenn er an den prügelnden Lehrer der Mansfelder Trivialschule mit seiner roten Schnapsnase und dem nach Alkohol stinkenden Atem dachte. Eigentlich sollte die Trivialschule die Knaben auf ein Studium an der Universität vorbereiten, indem man sie Latein und den ersten Teil der Sieben Freien Künste, das Trivium, lehrte. Davon leitete sich die Bezeichnung »Trivialschule« für die Lateinschule ab. Drei Fächer wurden gelehrt: Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Gern erinnerte Martin Luther sich eigentlich nur an den Beginn des Schultages, wenn sie zur Begrüßung sangen:
»Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.«
(»Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist,
besuch das Herz der Menschen dein,
mit Gnaden sie füll, denn du weißt,
dass sie dein Geschöpfe sein.«)
Zuweilen erteilte der Schulmeister auch Musikunterricht, allerdings viel zu selten und auch nicht regelmäßig, sondern nur, wenn ihm danach zumute war. Der Lateinunterricht taugte nichts. Wie sollte er auch, wo das Gestammel, Gebrumm und Genuschel des Lehrers beim besten Willen nicht als Latein, eigentlich überhaupt nicht als Sprache durchgehen konnte. Dabei liebte Martin die klassische Sprache, wenn denn etwas von ihrer Klassizität im Unterricht übrig blieb. Des Lehrers Wortbrocken, die nur entfernt an Latein erinnerten, verdarben die Reste seines Deutschs, und das verhunzte Deutsch, in dem es vor Wechselbälgern beider Sprachen nur so wimmelte – nicht selten wurde einem deutschen Wort nur eine lateinische Endung angehängt –, ruinierte wiederum das Latein. Im Grunde hatte sich so eine völlig neue Sprache herausgebildet, eine Alltagssprache der Halbgebildeten, die in den Ohren der Humanisten kakophonisch klang, zur Verständigung allerdings ausreichte.
Der Religionsunterricht erschöpfte sich im Auswendiglernen der unmerkbar vielen Heiligen und Märtyrer. Und um die Schüler und die Lehrer zu allem Verdruss auch noch zu verspotten, hatte sich ein Schalksnarr ein Merkgedicht ausgedacht – den »Cisiojanus«. Aus schafsköpfigem Schabernack imitierte es eine Art von Vulgärlatein mit Füllwörtern, die in einer Stunde höchster Geistesblitze erfunden worden sein dürften. Nur leider wurde die Satire nicht als solche erkannt und diente nun, wie ein alter Esel dem Müller beim Transport der Mehlsäcke, den Schülern beim Erlernen der kirchlichen Memoria, die sie dann ein Leben lang als toten Ballast mit sich herumschleppten. Des Verfassers Boshaftigkeit fand in der marternden Vollständigkeit sein Werkzeug, denn das Gedicht bestand aus so vielen Versen, wie das Jahr Tage besaß, und jeder Vers hatte so viele Silben wie der Monat Tage. Mit dem Vers: »Cisio janus epi sibi vendicat oc feli mar an prisca fab …« setzte der Schwank ein, erinnerte sich Martin. Cisio stand dabei für circumcisio domini, für das Beschneidungsfest des Herrn, das sie am 1. Januar feierten, wobei janus den Monat Januar bezeichnete und als Wort die Tage vom 1. bis zum 6. Januar im Kalender überbrückte. Die sechste und die siebente Silbe eilten bereits dem nächsten Feiertag entgegen, denn die Silbe epi posierte keck für Epiphanias, für das Erscheinungsfest, das die lateinische Christenheit am 6. Januar begeht. Die Füllwörter sibi und vendicat erinnerten an Steine in einem Bach, über die man zum anderen Ufer, nämlich zum 13. Januar gelangte, zu oc, was octava epiphaniae bedeutete, also acht Tage nach Epiphanias.28 Und so ging es immer weiter. Wozu das, fragte sich Martin. Was für ein elender Götzendienst, was für eine schändliche Werkerei, was für eine Vergeudung der jungen Gehirne, was für ein Verbrechen, ihre wache Neugier mit diesem Stumpfsinn abzutöten?
Im Lateinunterricht fiel kein deutsches Wort und eigentlich auch kein lateinisches, obwohl das, was der Schulmeister für Latein hielt, mechanisch und stumpf gepaukt wurde. Anhand einer Tafel mit einem öden Frage-Antwort-Schema lernten die Schüler in der fremden Sprache Lesen und Schreiben. Waren sie da noch nicht an Langeweile verblichen, ging es an die lateinische Grammatik, die nach den »artes grammaticae« des Aelius Donatus gebüffelt wurde, bevor man sich schließlich anhand des aus dem 12. Jahrhundert stammenden Lehrbuchs des Alexander von Villa Dei ausgiebig mit der Syntax beschäftigte. Da der Schulmeister eine so große Schülerschar unterschiedlichsten Alters nicht einmal bei gutem Willen, der ihm aber vollständig abging, zu überblicken vermochte, teilte er die Knaben in drei Gruppen ein, die jeweils von einem älteren Mitschüler, Wolf genannt, überwacht wurden. Dieses Denunziantensystem hasste Martin von Anfang an, obwohl er ein fleißiger Schüler war, denn die belohnte Spitzelei brachte die schlechten Eigenschaften der Kinder zum Vorschein. Der Wolf hatte jedenfalls zum Ende der Woche dem Schulmeister zu berichten, wie und ob die Knaben ihre Aufgaben erledigt, und vor allem, wer von ihnen wie oft deutsch gesprochen hatte.
Zum Glück gab es aber auch die seltenen Stunden, in denen sich Martin in die Reden des Ciceros, in Äsops Fabeln, die er besonders liebte, versenkte, und in denen er Vergils Aeneis las. Diese Zeit der Ruhe und des Lesens hätte ewig anhalten können. Den Büchern wohnte ein Zauber inne. Sobald er die ersten Worte las, spürte er einen leichten Windhauch, der ihn aus Mansfeld wegtrug. Er reiste in eine ferne, gute und gebildete Welt, in der das Niedere kein Hausrecht besaß. Mit einem Lächeln dachte er an die Distichen des Dionysios Cato zurück, an die Sammlung von Lehrsprüchen und Aphorismen, deren Stil er so viel verdankte. Wollte man lernen, sich klar und direkt, unverstellt und verständlich auszudrücken, fand man in den Distichen den rechten Lehrmeister. Wie heißt es doch darin?
»Wenn wer nicht lernt gern,
dem ist sein Leben wild,
recht als des Todes Bild.«
So jedenfalls hatte Martin sich die Zeilen übersetzt. Ja, er war begierig zu lernen, denn er hatte schon als Schüler in Mansfeld intuitiv entdeckt, was er erst viel später in Worte fassen konnte: Lernen bedeutet Freiheit. Im Studieren spürte er, wie die Fesseln des Ortes von ihm abfielen, wie er sich ungehindert in der Welt bewegen und jeden Ort erreichen konnte. Selbst dem Gefängnis der Zeit entkam er, wenn er in die Geschichte reiste. Wie ein Zauberer vermochte er, in alle Zeiten und zu allen Orten zu fliegen. Als es ihm wieder einmal zu langsam im Unterricht voranging wagte er es, dem Lehrer eine Frage zu stellen. Alle Schüler blickten erschrocken oder mitleidig, neugierig oder gar schadenfroh zu ihm, denn schon baute sich der Schulmeister in drohender Haltung vor dem schmalen Knaben auf und verlangte von ihm, zu konjugieren und zu deklinieren. Als Martin einzuwenden wagte, dass sie das im Unterricht noch nicht durchgenommen hatten, zog der brutale Schulmeister Martin am Ohr aus der Bank, stieß ihn zum Lehrertisch, hieß ihn, die Hose herunterzulassen und sich mit dem Oberkörper über den Tisch zu beugen. Dann hieb er mit dem Rohrstock fünfzehn Mal mit wahrer Berserkerwut auf Martins Gesäß ein. Jeden Streich, der auf seinen bald schon blutenden Po niederging, hatte er dabei laut mitzuzählen. Diese Lektion hatte der Schulmeister an Martins Beispiel allen gegeben, damit künftig keiner der Schüler mehr wagte, ihm Fragen zu stellen, denn er hielt das Verlangen nach Wissen für ganz und gar schädlich. Mehr wissen zu wollen, als einem zu- und anstand, erfüllte den Tatbestand der ersten und größten der sieben Todsünden – der Superbia. Denn wozu sollte das dienen, wenn nicht zur Befriedigung des Hochmuts, in den Eitelkeit, Stolz und Übermut eingeschlossen waren? Zudem war der Hochmut die Mutter jeder Häresie. Die Knaben davor zu bewahren, sich gegen Gottes Ordnung und den ihnen zugewiesenen Platz aufzulehnen, hielt der Schulmeister für seine vornehmste Pflicht. Damit aber nicht genug. Zeigte sich in dem Drang nach Wissen nicht auch die zweite Todsünde – die Habgier, Avaritia genannt? Und ließ der Wissensdurst nicht auch auf einen Hang zu Völlerei und Maßlosigkeit schließen? Das war die fünfte Todsünde, die Gula, die auf die Superbia zurückverwies. Bittere Tränen des Schmerzes und Zorns über die Demütigung schossen Martin in die Augen und er fragte sich, ob Gott so etwas wirklich wollen könne.29
Der Vater jedenfalls mochte es nicht mehr mit ansehen, wie die Zeit seines Sohnes von einem dummen und dem Alkohol ergebenen Schulmeister vergeudet wurde. Martin sollte schließlich studieren und Jurist werden, um einmal eine geachtete Stellung in der Welt einzunehmen, denn das Zeug hatte sein Ältester dafür. Und Juristen wurden gebraucht. Die Fürsten bauten ihre Landesherrschaften aus und benötigten Rechtskundige für ihre Verwaltungen, die Städte und die großen Wirtschaftsvereinigungen wie die Saigergesellschaften nicht minder. Im Gespräch mit seinem Freund, dem Hüttenmeister Reinicke, der nur zwei Häuser weiter wohnte, stellte sich heraus, dass auch er unzufrieden mit der örtlichen Trivialschule war. Reinicke wusste Rat. Von seinem Verwandten, dem erzbischöflichen Offizial Paul Moßhauer, erfuhr er, dass die Domschule zu Magdeburg einen ausgezeichneten Ruf besaß und die Brüder vom gemeinsamen Leben in der Domstadt ein Haus eröffnet hatten, in dem sie auch Schüler beherbergten und betreuten.
Die Brüder vom gemeinsamen Leben eröffneten unter dem Vorsteher Johannes von Düsseldorf 1488 gegen den Widerstand der Ratsherren der Stadt, aber mit der Protektion des Erzbischofs am Deveshorn, bei der Roten Pforte im Magdeburg eine Filiale des Brüderhauses von Hildesheim. Zum Zeitpunkt, als Hans Luder über die Idee nachdachte, Martin ins Magdeburger Brüderhaus zu geben, stand Johann Zeddeler bereits zwanzig Brüdern vor. Ins Leben gerufen wurde die Bewegung von dem Niederländer Geert Groote, der 1340 in Deventer ein Haus eröffnete, in dem Männer, die Gott dienen und ein frommes Leben führen wollten, eine Gemeinschaft bildeten. Sie wollten aber kein Mönchsgelübde ablegen und weder durch Bettelei noch durch priesterliche Tätigkeit ihren Lebensunterhalt verdienen, wie es beispielsweise die Franziskaner und Dominikaner taten, sondern nach dem Vorbild des Apostels Paulus einzig durch ihrer Hände Arbeit. Sie folgten weder der Weltflucht noch der Askese, sondern sahen in der Heiligung der Arbeit, im frommen Wirken in der Welt ihren Weg zu Gott. Groote hatte begriffen, dass in der Seele des Menschen der Kampf zwischen der civitas caelestis und der civitas terrena, zwischen dem Himmelreich und dem irdischen Jammertal, tobte – ein Kampf, in dem es um die richtige, die gottgefällige Art zu leben ging.30 Die Frage, wie man in der Welt leben solle, die Geert Groote aufwarf, sollte Martin Luther später in die existenzielle Suche nach dem gerechten Gott übersetzen.
Im Frühjahr 1496 wurden Martin Luther und Hans Reinicke von ihren Vätern nach Magdeburg gebracht. Die Brüder vom gemeinsamen Leben, die sich der Bildung verschrieben hatten, halfen den beiden Mansfeldern, Anschluss an das Niveau der Domschule zu bekommen. Wichtig für Martin Luther sollte die intensive Bibellektüre werden, die man im Brüderhaus pflegte, und die Hochschätzung des Apostels Paulus. Gerade weil die Brüder ihren Lebensunterhalt durch das handschriftliche Kopieren von Büchern bestritten und dem Studium der Bibel große Aufmerksamkeit widmeten, wurde Martin Luther bewusst, dass unterschiedliche Textvarianten existierten, so dass man sich, wie es die Humanisten bei nichtbiblischen Texten taten, um eine gesicherte Textbasis bemühen musste. Diese Sorge um die Authentizität des Textes beeindruckte ihn.
Der Tagesablauf im Brüderhaus erinnerte an ein Kloster. Die Brüder unterhielten auch eine enge Beziehung zu den Augustiner-Eremiten. Um drei Uhr morgens hieß es aufstehen, die Mette zu absolvieren und der Schriftauslegung, die eine Stunde dauerte, zu folgen, bevor es nach dem Frühstück zur Schule ging. Nachmittags standen gemeinsame Meditationen auf dem Programm. Auf das Abendessen folgte das Stundengebet, dem sich eine gemeinsame Gewissensprüfung anschloss. Schonungslos und für heutige Begriffe etwas exaltiert forschten die Brüder penibel nach Verfehlungen, die ihnen am Tage unterlaufen waren. Luthers skrupulöse Frömmigkeit der ersten Klosterjahre, die Vorstellung, Gott nicht genügen zu können, fand wohl hier ihren Anfang. In Magdeburg begegnete er einem ausgemergelten, in Lumpen gehüllten Franziskaner, dem keine Buße zu schwer, keine Askese zu streng sein konnte. Der Mönch verabscheute das Essen so wie das Waschwasser. Einige beteten ihn als Heiligen an, andere verachteten ihn als Narren. Bruder Ludwig, wie man den Asketen nannte, hieß in Wahrheit Wilhelm von Anhalt und war der Bruder des Dompropsts Adolf von Anhalt und Sohn des Reichsfürsten Adolf I. von Anhalt. Als Bischof von Merseburg gehörte Adolf von Anhalt inzwischen zu Martin Luthers ärgsten Feinden. Auch ihm würde er in Worms begegnen. Ob sein Weg nach Worms eigentlich in Magdeburg begann, bleibt der Spekulation überlassen, sein Streben nach Bildung und Frömmigkeit, seine Suche nach der Wahrheit Gottes begann auf jeden Fall in der Elbestadt.
Inzwischen war Martin Luther ein gestandener Mann und Gelehrter geworden, über dessen theologische Ansichten man in ganz Europa sprach. Längst stand für ihn fest, dass Gott Unrecht, wie es ihm durch den Schulmeister widerfahren war, nicht wollte. Der Teufel hatte im Schulmeister gesteckt, um die Menschen von Gottes Liebe zu entfremden. Nichts anderes führte der Teufel im Schilde, als den Menschen Gott verächtlich zu machen. Wie mit dem Schulmeister ging es auch mit dem Antichrist zu. Wenn der Papst Unrecht verübte, dann war das des Teufels und nicht Gottes Werk. Martin Luther hatte lange gebraucht, um zu begreifen, dass der Papst kein heiliger Mann, sondern der ärgste Sünder war. Früher hatte er sich eingeredet, dass dem Stellvertreter Christi die Wahrheit über den beklagenswerten Zustand der Kirche vorenthalten und er von den Kardinälen und Bischöfen in Rom belogen werde. Das ausschweifende Leben dieser Herren hatte er in der Ewigen Stadt ja mit eigenen Augen gesehen. Es existierte kein sündhafterer Ort auf dem Weltkreis des Papstes als dessen eigene Stadt. Die Diener des Teufels, die Luther aus seiner Kindheit kannte, waren einfacher Natur. Umso höher man aber in der Hierarchie der Welt kam, umso raffinierter wurde der Teufel, umso geschickter agierten seine Helfer.
Voller Zorn dachte er daran, wie sehr der Wert der Bildung, die doch mehr als alles Gold der Welt zählte, gerade in Rom unterschätzt, ja verächtlich gemacht wurde. Das, was am meisten zu loben war, galt am wenigsten. Der Antichrist in Rom warf ihm sogar vor, die Bibel zu lesen, denn in der Bulle »Exsurge Domini«, die ihm den Bann und die Exkommunikation androhte, war kein anderer mit »Einige« gemeint als er, Luther: