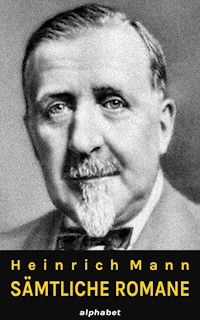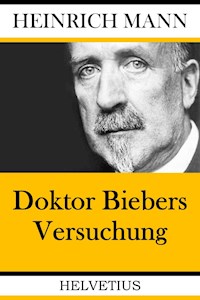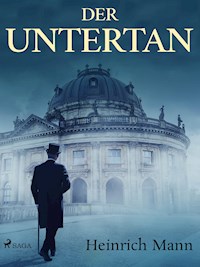Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Abrechnung mit dem deutschen Volk, die zum Zerwürfnis mit dem eigenen Bruder führte. In seinen 1910 entstandenen Essays vergleicht Mann Deutsche und Franzosen. Er betitelt das französische Volk als freiheitsliebend und tätig, während das deutsche Volk, bekannt für seiner Dichter und Denker, das vorherrschende Regime hinnimmt, zu träge, um etwas zu verändern. So setzt der Autor "Geist" mit den Idealen von Wahrheit und Gerechtigkeit gleich und argumentiert, dass die Deutschen diese Freiheit fürchten, da sie sie nicht kennen. Es fehlt ihnen das Selbstvertrauen eine Demokratie zu schaffen, in der jeder "Herr" ist. Diese "Tat" ist zu viel für das deutsche Volk.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Geist und Tat - Franzosen 1780-1930
Saga
Geist und Tat - Franzosen 1780-1930
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1946, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726894233
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
CHODERLOS DE LACLOS
I
Hier ist achtzehntes Jahrhundert: ein Geist, ein Schwert und der stürmische Umbau einer Gesellschaft.
Ein ganz junges Mädchen, frisch aus dem Kloster in die Welt versetzt, wird von zwei eleganten Verbrechern mit Rat und Tat, ohne dass sie ahnt, was ihr geschieht, bis zu den niedrigsten Verrichtungen der Dirne gebracht. Es entsteht ein Ungeheuer aus Lasterhaftigkeit und Naivität. Eine seit kurzem glücklich verheiratete, fromme Frau wird von demselben Verbrecherpaar, durch langsame Qualen geriebener Verführung hindurch, in Schande und Tod getrieben. Der Mann, der, geleitet von seiner Helfershelferin, dies vollbringt, beginnt beide Unternehmungen ohne eine Spur von Gefühlsdrang und nicht einmal aus Sinnlichkeit. Bei dem kleinen Mädchen kommt ihm niemals Liebe. Im Fall der jungen Frau entsteht sie unter dem Stachel langen Widerstandes; er unterdrückt sie, in der Besorgnis um seine Überlegenheit, aus Furcht vor dem Hohngelächter der Genossin, und wirft sich mit verdoppelter Wut auf die Zerstörung des liebenden Opfers. Liebe darf nur Mittel zur Herrschaft über Menschen, zum gesellschaftlichen Erfolg sein. Eine Frau verführen, ist erst halbe Arbeit; die andere Hälfte: sie verderben. Die beiden Bösen sind nur die Gelungensten eines Typus. Ein Offizier hat drei Frauen auf einmal unmöglich gemacht; die Marquise von Merteuil ist noch geschickter und besiegt ihn. „Ich will ihn haben und werde ihn haben; er will es sagen und wird es nicht sagen.“ Es geschieht, wie sie will. Der Ehrgeiz vieler Frauen ringsum richtet sich auf dasselbe, nur sind sie nicht so begabt. Die Männer sind sämtlich weniger glänzend als der Vicomte von Valmont; weil aber ihr Sieg in leichterem besteht als der Sieg der Frauen, brechen dennoch unter den Tritten manches Helden die weiblichen Existenzen zusammen . . . So ist, in dem Roman von den Liaisons dangereuses, die gute Gesellschaft unmittelbar vor der Französischen Revolution.
Die Grundlage von alledem ist ein durch nichts unterbrochener Müssiggang. Nicht einmal Vorzimmer-Intrigen in Versailles unterbrechen ihn; dieser Teil des Adels lebt ohne Ehrgeiz, erst recht ohne geistige Interessen und vollends ohne Selbstzucht. Dennoch arbeitet der Geist der Zeit noch in den leichtesten Köpfen: der Geist des Jahrhunderts der Vernunft, analytisch und gefühlsfeindlich, und das einzige, was sie kümmert, die Liebe, sie betreiben sie, als erfänden sie Musterbeispiele für eine Physiologie de l’amour. Sie sind Psychologen in Aktion. Sie greifen eine Frau an, um zu sehen, welche Stadien die gehetzte Seele durchlaufen wird, ehe sie erliegt. Sie schlürfen Gefühlsnuancen. Tischgenossen wetten für und gegen die Tugend einer Abwesenden, und wer sie zu Fall bringt, hat eine Geistestat hinter sich und einen glücklichen Feldzug. Der Klatsch ist unendlich bereichert und veredelt. Die Liebe ist das herrschende Gesellschaftsspiel von unbegreiflichem Reiz, weil es immer im Begriff steht, ernst zu werden und den Kopf zu kosten.
Denn es wäre verhängnisvoll für eine kürzlich Eingetroffene, für einen Neuling, wenn sie sich durch Ton und Schein in die Irre führen liessen. Offen werden die erstaunlichsten Geschichten erzählt, als sei es nur ein Spass. Der und jener gibt einem Kreis von Damen geistreich die Manier zum besten, in der die Gräfin Soundso sich ihm gewährt hat. In einer Schlossgesellschaft verabredet sich ein Paar für die kommende Nacht und zieht einen gemeinsamen Freund hinzu, der ihnen das Vergnügen ermöglichen soll. Lauter Geheimnisse Policinells: nur hüte man sich vor dem Augenblick, wo irgend etwas nötigt, die Fiktion des Nichtwissens fahren zu lassen. Dann schlägt unvermittelt der Spass in düstere Wirklichkeit um, die Skepsis in spanische Ehrliebe. Keine Frau darf bei der Einschiffung vergessen, dass an Cytheres anderem Ende ein grosses Kloster starrt, zu lebenslänglicher Einsperrung; kein Mann, dass in einem Haus, wo er erwischt wird, ein Haufe riesiger Lakaien ihn einfach totschlagen kann. Die persönliche Sicherheit ist erst unvollkommen verbürgt und endet beim Selbstschutz des anderen. Die nächtlich einander Geniessenden werden noch aufgestört zu angstvollem Durchshaushorchen und zu einem Ruck nach dem Degen. Und auch das schärft, wenn es einem Kulturmenschen geschieht, das Denken, macht umsichtiger und klarer. Man hat es so nötig, den inneren Gängen aller Beteiligten genau nachzutasten. Der erste Anlass, aus dem man Psychologe wurde, war der Müssiggang: aber der Zwang, durch den man es bleibt, ist die Gefahr.
Die notgedrungen erworbenen Eigenschaften vervollkommnet man bewusst; man verachtet das Gefühl, das man durch Vernünftelei zersetzt, unter Ausschweifungen erstickt hat; schämt sich sogar des Glückes, das einem unberechnet zufällt. Man kommt durch den Missbrauch der Analyse endlich zu ganz gefälschten Begriffen, glaubt, dass Wonnen gewollt und herbeigeführt werden müssen, und sagt: „Ich empfand eine unfreiwillige, aber köstliche Regung.“ Das Gehirn arbeitet so einseitig, dass man vor gewissen Erscheinungen aus Feinheit zum Dummkopf wird. In dem Augenblick, da jemandem wirkliche Liebe zugefallen ist, ruft er aus: „Man muss darauf verzichten, die Frauen kennen zu wollen!“ Denn diese ist geflohen, und das kann nur eine neue List, ein weiteres Mittel, um weh zu tun, sein. Wandelt einen eine echte Empfindung an, so beeilt man sich, sie dadurch zu rechtfertigen, dass man sie ausnutzt. Man hat Nerven und kann im Lauf einer kaltblütig eingeleiteten Verführungsszene in ehrliche Tränen ausbrechen. Einem Valmont aber fällt, noch während sie rinnen, ein, welche Wendung sie der Szene geben können, und er spielt in dieser Richtung weiter. Auch ihm kann geschehen, dass er sich verliebt und eine Frau glücklich machen möchte: aber doch nicht um ihretwillen. Sondern „das Experiment, das ich mit ihr anstellen will, erfordert, dass ich sie glücklich, vollkommen glücklich mache“. Das Experiment soll herausbringen, was aus einer schüchternen und leidenschaftlichen, sehr frommen und bis dahin streng tugendhaften Frau, die sich ihm endlich hingab, wohl wird, wenn man sie auf dem Gipfel des Glückes plötzlich mit einem Fusstritt entlässt.
Man ist vorurteilslos genug, um seine Experimente auch auf die Tugend auszudehnen, wenn man am Wege des Lasters einmal auf eine stösst. Valmont vollbringt, böser Zwecke wegen, eine gute Tat, spürt Vergnügen und ruft mit Genugtuung: „Ich bin versucht, zu glauben, dass, was man die tugendhaften Leute nennt, nicht so verdienstvoll ist, wie man uns gern vorredet.“ Er benimmt sich manchmal hochanständig. Das kommt dann daher, dass die Unanständigkeit zu leicht, also seiner nicht würdig gewesen wäre. Eine Dame, mit der er die Nacht verbracht hat, scheint, dank einem unvorhergesehenen Zwischenfall, verloren. „Man muss zugeben, es hätte Spass gemacht, sie in der Lage drin zu lassen; aber konnte ich dulden, dass eine Frau um mich und nicht durch mich ins Unglück käme? Und sollte ich mich, wie der Durchschnitt der Männer, von den Umständen meistern lassen?“ Die Schwierigkeit einer Sache ist immer das Ausschlaggebende. Valmont hat die tugendhafte Präsidentin früher lächerlich gefunden, schlecht angezogen, putenhaft; eines Tages aber fällt ihm auf, dass niemand sich mehr um sie kümmert; ihre Tugend, die „schon zwei Jahre des Triumphes“ hinter sich hat, gilt als unumstösslich; also muss Valmont sie umwerfen. Aber nicht durch Überrumpelung. Nicht auf „den albernen Vorteil, eine Frau mehr gehabt zu haben“, kommt es an, sondern auf „den Zauber langer Kämpfe und einer schwierigen Niederlage“. Sie soll kämpfen, grade weil für sie die Hölle noch etwas Wirkliches ist. Er will ihre Qualen schmecken, den Duft ihrer Angst einatmen. Was ein Mensch dem anderen zufügen kann, erfährt man im Laufe dieser Inquisition eines Psychologen. Er nimmt sie nie, sooft er es könnte; er hat Zeit, bis sie, sich klar bewusst, dass sie ihr ewiges Verdammungsurteil fällt, ihn in ihre Arme zieht. Über Gott siegen: das ist hier der Kitzel, dem zuliebe man sich Monate lang einen fälligen Genuss versagt.
In alledem ist ein kindisch grausamer Spieltrieb; aber auch ein sehr besonderer Stolz. Alles seinem frei schaltenden Willen zu verdanken, nichts Sinnesausbrüchen, nichts dem Gefühl. Durch Gefühl gewährt man anderen Macht über sich. Wer die Freiheit liebt und die Macht, hütet sich vor der Erniedrigung, „denken zu müssen, dass ich gewissermassen von eben der Sklavin abhängen könnte, die ich mir unterworfen habe, und dass die Fähigkeit, mir vollkräftige Genüsse zu verschaffen, der oder der Frau Vorbehalten sein sollte, unter Ausschluss jeder anderen“. Nur in kein anderes Wesen aufgehen, keinem Übergriffe gestatten! Im Gefängnis dieser Gesellschaft des achtzehnten Jahrhunderts, der wachsamsten, kleinlichsten, die je da war, wenigstens innerlich ganz kettenlos sich regen! Unter den Worten eines Roués, der sich gegen die Liebe sträubt, wird, dumpf dröhnend, der Aufstand der Persönlichkeit gegen die Gesellschaft vernehmlich. Dies Geschlecht wird die Revolution vollbringen, in der „Gleichheit“ nicht viel mehr als Redensart, aber „Freiheit“ wildester Ernst sein wird: Befreiung des Individuums. . . Nun ist es befreit; und der erste und grösste der neuen Menschen, Chateaubriand, hat sein einsames Empfinden und seine stolze Langeweile über Steppen, durch Urwälder und die Ränder von Ozeanen entlang getragen. Wenn jetzt Valmont zurückkehrte? Da ist er, in Mussets Confession d’un enfant du siècle: beträchtlich ermattet und vom Gewissen angekränkelt, aber mit derselben Neugier des durch Ausschweifungen Ernüchterten und wieder verliebt in eine, die sich ihm opfert. Und was entdeckt er nun auf dem Grunde dieser Liebe? Musset entdeckt: „Während deine Lippen die seinen berührten, während deine Arme seinen Hals umschlangen, während die Engel der ewigen Liebe euch, wie ein einziges Wesen, mit den Banden des Blutes und der Lust umwanden, waret ihr einander ferner als zwei Verbannte an den beiden Enden der Erde, getrennt durch die ganze Welt.“ Wie viele Liebende werden fortan dies wiederholen, wie viele Dichter! Als der Roman auf seine Höhe gelangt, deckt der Überdruss am Wissen um die eigene Einsamkeit den schwarzen Schleier über alle Schöpfungen Flauberts. Unverbrüchliche Einsamkeit ist die Tragik jeder Seele, die Maupassant beschreibt, — Einsamkeit, gegen die man sich den Kopf einrennt, Einsamkeit, die man weltmännisch verachtungsvoll weiterträgt. Jedes hochstehende Gefühl ist mit diesem Mal gezeichnet, während des ganzen neunzehnten Jahrhunderts.
Dem achtzehnten ist es unbekannt. Der Liebhaber von damals nimmt sein Alleinstehen leicht. Er macht sich ein Verdienst aus den egoistischen Ekstasen, zu denen das andere Wesen ihm nur Vorwand ist und in denen unvergessen bleibt, dass, was man in diesem Augenblick umarmt, im nächsten ein Mittel sein wird, die Aufmerksamkeit eines Salons auf sich zu ziehen; ein Gerät, sich hinaufzuhissen, ein Weg zum Ruhm, ein Unterdrückter, ein Feind. Unabhängig und ganz frei von Gemüt; leicht beweglich und immer in der Spannung vor dem Kampf; tapfer und überaus unbedenklich; ohne alle Sehnsucht; ein elegantes, gelassen auf sich selbst beschränktes Raubtier: so ist Valmont der jüngere Bruder des Pippo Spano und der Rokokomensch ein Nachzügler der Renaissance. Gewiss, er hat weniger Kraft und viel mehr Eitelkeit. Die Empfindungsform, wie der Kunststil, ist in den dreihundert Jahren, die vergingen, dünner und verschnörkelter geworden; doch ist die Grundlinie dieselbe und der Weg, den diese Kultur nahm, von keiner gewaltsamen Hand noch aufgerissen und abgebrochen. Ein Salon in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ist eine verkommene Republik des fünfzehnten, in Denkweise und herrschenden Trieben, in der Zähigkeit einer zum Kleinlichen entarteten Rachsucht, in manchem aus seidenem Geknister jäh hervorbrechenden krassen Wort, in hundert mit Spitzen besetzten Roheiten des Gefühles und skrupellosen Handlungen. Aus einer Liebesaffäre einen Hinterhalt zu machen, ist die wenigst gewaltsame, das Durchstöbern eines fremden Schreibtisches längst nicht die unzarteste. „Ich bedaure, dass ich nicht stehlen gelernt habe; aber unsere Eltern denken an nichts.“ Am anderen Ende der Skala liegt dieser Ton: „Habe ich erst diesen Triumph erreicht, dann will ich meinen Rivalen zurufen: Seht mein Werk und suchet ein zweites, das ihm gleicht, im Jahrhundert!“ Ein Römer konnte so sprechen, wenn er einen halben Weltteil erobert hatte; ein Condottiere nach der endlichen Einnahme einer jahrelang listig belauerten Landstadt. Der Cäsar des achtzehnten Jahrhunderts verkündet es bei der bevorstehenden Niederlage einer Frau.
Wie bös diese Zeiten waren! Welches niemals aussetzende Bewusstsein der Feindschaft von Mensch zu Mensch, welche Gefeitheit gegen jeden Anflug von Wohlwollen muss damals einem Manne eigen gewesen Sein, damit er kalten Blutes eine Unglückliche aus einem mörderischen Affekt in den anderen hetzen, dem Instrument dieser Seele Melodien der Qual entlocken konnte — zu seinem Ruhm! Welcher Spätere konnte das fassen? Als einmal die alte Gesellschaft zersprengt war? Denn nur sie, mit ihrem unablässigen Aneinanderreiben der Eitelkeiten, war imstande, solche Gehirne zu bilden. Böse wird der Mensch erst, wenn er unter seinesgleichen ist und auf das Handeln ausgeht. In seinem Zimmer ist er es nicht und nicht im Walde. Der einsam Betrachtende neigt zur Güte; und gutmütig und naiv kommen nun die romantischen Jahrzehnte, naiv und gutmütig bis in ihre Libertins. Der Wunsch nach Frieden zwischen den Geschlechtern wird sehr gross. Das Bewusstsein von ihrem Kriegszustand geht fast verloren; er muss künftig wiederentdeckt werden, wie eine neue Wahrheit. Wie dazu Valmont die Schultern gehoben hätte! Aber die Marquise von Merteuil hätte in ihrem geschulten Gesicht keine Miene verzogen.
Denn die Marquise äussert grundsätzlich nie, was sie gerade denkt; und sie hat dafür gesorgt, dass man es nicht errät. Gleich bei ihrem Eintritt in die Welt hat sie sich in Arbeit genommen, jede unwillkürliche Freude unterdrückt, sich Schmerzen beigebracht, um sie unter Heiterkeit verbergen zu lernen; liess in der Hochzeitsnacht sich kein Vergnügen anmerken, damit ihr Gatte sie für unempfindlich halte und Vertrauen fasse. Unter ihren Liebhabern ist keiner, der sich nicht für den einzigen hielte; denn keiner seiner Vorgänger oder Nebenmänner durfte etwas ausplaudern: von jedem kennt sie ein gefährliches Geheimnis, selbst von Valmont. Sie ist sich bewusst, die Leistungen Valmonts tausendmal zu überbieten. Er mag viele Frauen ins Unglück gebracht haben; wenn er aber unterlag? Dann war es eben ein Erfolg weniger; sie aber, sie wagt. Wieviel mehr Schlauheit hat sie nötig! „Glauben Sie mir, Vicomte, man erwirbt selten die Eigenschaften, die man entbehren kann.“ Auf den Ehrgeiz, ihre Liebhaber im Zaum zu halten und der Gesellschaft zum Trotz zu leben, verwendet sie den Willen einer Katharina. Sie ist in Wahrheit auf der Höhe des Jahrhunderts. Valmont vergleicht sich umsonst mit Turenne und Friedrich; er prahlt zu viel; auch ist der Stoff, in dem er arbeitet, zu unmännlich, wie er ein einziges Mal selbst zu fühlen scheint. Er kann in diesem weiblichen Zeitalter immer nur die zweite Rolle spielen. Die Merteuil erst, das weibliche Genie, erhebt die Liebesintrige zur hohen Philosophie und zum grossangelegten Spiel um die Macht. „Unser Programm heisst: erobern.“ „Ich stieg in mein eigenes Herz und dort studierte ich die Herzen der anderen.“ Valmont weiss nur, was ihn angeht, was die Praxis des Verführers ihn gelehrt hat. Er hat, zum Beispiel, grundfalsche Meinungen über alte Frauen. Er ahnt nicht einmal, was seine ehemalige Geliebte, die Merteuil, in Wirklichkeit für ihn fühlt, seit sie sich in Güte getrennt haben; er wähnt, eine solche Frau verzeihe dies. Nur sie sieht klar in allen und ist gerüstet, jeden zu treffen. Sie gelangt, libertine in jedem Sinn, im Lauf ihrer lasterhaften Überlegungen zu den vorgeschrittensten Maximen. Sie ist Ästhetin; bereitet sich durch wechselnde Lektüre auf die Stimmung vor, die die Liebesnacht ihr bringen soll; wird bei erotischen Seltsamkeiten landen. Sie hat einen Künstlerhass auf die Plattheit und auf jene Frauen, die leichtsinnig aus Dummheit und nichts weiter sind als Amüsiermaschinen. Um nur ja nicht im Gewöhnlichen stecken zu bleiben, geht sie, als Beraterin der Jugend, bis an die Grenzen der offenen Gemeinheit. Diese weise Korrumpierung eines vertrauenden kleinen Geschöpfes! Und der bewusste Todesstreich gegen seine Geliebte, zu dem sie Valmonts eitle Hand lenkt! Sie hält sich als Bundesgenossin zu dem Feinde ihres eigenen Geschlechtes. Erst sie bezeichnet wahrhaftig in der Menschheit die Stelle, wohin nichts Menschliches mehr dringt. Die Frau der Renaissance bleibt weit zurück. Das Leben der Katharina Sforza müsste ganz aus dem einen Moment auf dem Festungswall von Imola bestehen: „Mein Kind? Tötet es nur! Ich mache mehr!“ Und auch dann noch wäre sie keine Merteuil. Diese Frau ist unberührbar; das letzte Laster ist unberührbar gleich der äussersten Reinheit. Es gäbe nichts, woran sie zugrunde gehen könnte; nur ihr eigener Stolz bringt sie um. Und als dann alles am Licht ist und sie in einem Theaterfoyer ausgejohlt wird von eben der Gesellschaft, die sie gängelte, von den heuchlerischen Halbschurken, denen nur Mut und Genie fehlte, um zu werden, was sie ist: da wird ihre Grösse frei. Sie triumphiert noch im Untergehen; niemand kann glauben, dass sie sich getroffen fühlt, und man muss immer lauter werden und man erschrickt fast: rührt sich doch nichts in ihren Mienen!
Wo blieb sie, seit sie verschwand? Bis zur Stunde ist sie nie wiedergekehrt, nicht einmal mit verwässertem Blut, wie Valmont wiederkehrte. Im Werk des nächsten Bildners einer Gesellschaft, bei Balzac, ist die gefährlichste Frau keine Marquise; es ist eine kleinbürgerliche Dirne. Und diese Marneffe lässt nur zu, dass ein armer Alter an ihr sich zugrunde richtet. Kaum, dass sie nachhilft. Wenig Initiative der Sinne, gar keine des Geistes. Statt aller Philosophie ein paar Dirnenzynismen. Welch tiefer Fall, nachdem noch soeben auf dem Gipfel der Kultur die heftigste Bosheit geherrscht hatte! Nie war das Böse heftiger als in der Merteuil; und da für die Kunst Intensität alles ist, kann man zu dem Glauben kommen, die Merteuil sei eine der grossen Gestalten der Weltliteratur.
II
Ihr Dichter war ein Soldat der Revolution. Er war es als General bei der Rheinarmee und der in Italien; und er war es in seinem Buch. Es erschien 1772, noch drei Jahre vor „Figaros Hochzeit“, und es ist als Parteischrift gemeint. Valmont und die Merteuil bedeuten die Verkommenheit des Adels; als dritte Hauptfigur vertritt die von den beiden Verbrechern zu Tod gequälte Präsidentin Tugend und Frömmigkeit des Bürgertumes. Ohne Willen Laclos’ schillert aber sie erst recht von Zersetzung. Unredliche Sinnlichkeit blinkt in ihren tränenden Augenaufschlägen. Sie ist eine Zeitgenossin der Sünderinnen des Greuze und eine späte Verwandte der Magdalenen von Carlo Dolci. Sie ist, diese kleine Bürgergans, der ihres Mannes richterlicher Adel Zutritt in die Welt verschafft hat, ganz weg in den schlimmen, schneidigen Valmont; und, damit bei dem Kitzel, den sie sich nicht länger versagen kann, auch der Himmel nicht zu kurz komme, nimmt sie sich vor, den Ausgestossenen zu erlösen, für ihn das Martyrium zu erleiden. Laclos hat das gegeben, wie es ist, und jedem steht es frei, es widerlich zu finden; er selbst aber hat es schön gefunden, daran ist kein Zweifel. Er liebt Frau von Tourvel. Hat er sie immer geliebt?
Als junger Offizier, schmal und düster, hat er die ersten Blicke auf die glänzendste Gesellschaft Europas geworfen, und ein Mensch mit Künstlerinstinkten konnte sie schwerlich ansehen, ohne sie insgeheim an sich zu reissen, sie in seinen Träumen zu verschlingen. Er wird das alles begehrt haben, alle Eleganz, allen Ruhm der Roués, alle Frauen. Die Merteuil war die Krone von allem: er wollte sie haben. Sicher ist, dass niemand eine Frau so in Worte einfängt, er hätte sie denn geliebt. Es wird ihm in der Phantasie ergangen sein wie Valmont in der Wirklichkeit; er wird, sich hindurchträumend durch Verfeinerungen, von der Merteuil zu der Tourvel gelangt sein. War er doch Valmont! Wie hätte er sich später seiner so gut entsonnen, wenn er ihn damals nicht in sich gehabt hätte? Einige Jahre vielleicht, — während deren er vergebliche Anläufe gemacht haben wird, zu sein, als was er sich fühlt. Es halten ihn ab: Armut, Schüchternheit dessen, den nicht die Tat emporbringen soll, und Instinkt eines künftigen Berufes. Dann entscheidet die Zeitbewegung; seine enttäuschte Begierde richtet sich feindselig gegen die Klasse, in der er so gern triumphiert hätte. Jetzt erst hat er den Standpunkt, um sie zu schildern. Er fühlt: ich habe, ohne daran zu denken, erlebt, was die Zeit wollte, dass man erlebe. Und was in dieses Buch fliesst, ist alles, was mir beschieden war, bin ich ganz. Es heisst vorsichtig damit umgehen. Dies kehrt nicht wieder; mein ganzes Leben sieht auf diesen Moment; und meine Zeit. So trägt er sein einziges Buch lange aus, es kommt vollreif zutage, die Briefe, in denen er es komponiert, werden ohne ein Schwanken hingeschrieben, ohne ein Durchstreichen. Es ist das Werk eines Vierzigjährigen, ein Werk von der Lebenshöhe, und ein Meisterwerk. Es wäre unmöglich, feinere Intrigen ganz und gar aus seelischen Tatsachen abzuleiten, eine energische Katastrophe moralisch besser zu füllen. Der emphatische Briefstil der „Neuen Heloise“ liegt weitab; hier ist die bildlose Schärfe von Candide und dem Essai sur les Mœurs. Rapide Handlung, schneidende Reflexion. (Nur die kämpfende Tugend der Präsidentin hemmt. Zusammenführen aller Fäden, an denen zum Schluss lauter Leichen hängen, in der Hand der Ältesten, Überlebenden. Das Buch ist geschickt und tief, unangreifbar in der äusseren Mache wie im Spiel der inneren Federn.
Es ist abgestreift; nun hiesse es, weiterwachsen. Eins, was in Valmont war, darf der Mann der Revolution fortbilden: seinen Persönlichkeitsstolz. Valmont konnte die Gesellschaft noch nicht entbehren; der Schüler Rousseaus glaubt, es zu können. Ein Jahr nach den Liaisons schreibt er über die Erziehung der Frauen; und seine Erziehungsmethode beschränkt sich darauf, dass er ihnen das „Naturweib“ vorführt. Zwar hat den „Naturmenschen“ niemand je gesehen, Rousseau erfand ihn von Kopf bis Fuss; aber es gibt ein unerforschtes Afrika, wo er stecken könnte. Für alle ist sein Vorhandensein eine wahre Herzensangelegenheit. Er ist dem achtzehnten Jahrhundert so viel, wie dem neunzehnten der Pithekanthropos werden wird. Laclos ist ihm ganz ergeben. Die sündenschöne Bürgerdame liegt hinter ihm; jetzt ergeht er sich in verliebten Schilderungen des sonnenbraunen Naturmädchens, das, von unbekannter Glut verzehrt, in betauter Sonnenaufgangslandschaft sich wirren Blickes auf den ersten Mann stürzt. Besorgt um ihren Ruf, kommt er dem Verdacht zuvor, sie möchte nicht recht sauber sein; und das wirkt rührend bei dem Schöpfer der abgefeimtesten Romanfiguren, die je da waren. Gegen Buffon und Voltaire, die dem Naturmenschen nicht hold sind, verteidigt er das Verlassen von Frau und Kind, — was abstossen könnte, wenn es nicht von einem Träumer und von einem zum besten Familienvater Bestimmten käme.
Er bleibt Träumer. Den Beweis dafür, dass die Liaisons dangereuses nicht, wie man zu finden scheint, ein Kunststück kalter Beobachtung sind: das ganze folgende Leben Laclos’ erbringt ihn. Es ist köstlich ungeschickt. Noch 1789 nimmt er vom Herzog von Orleans ein Amt an. Nach der Flucht nach Varennes greift er, um seinem Herrn auf den Thron zu helfen, in einer Volksversammlung zu Gewaltmitteln, übertrieben, nach Art des Schüchternen, der sich in Handlung stürzt. Seine Phantasie und seine Zaghaftigkeit zeigen ihm die Tatmenschen noch viel unbedenklicher als sie sind. Er will mittun, sie überbieten; und fällt ab. Die Revolution bereitet ihm als einzelnem nur Enttäuschungen; er aber hängt an der grossen, geliebten Abstraktion; will niemals glauben, dass ausser einem kleinen Haufen Unverbesserlicher jemand ihr entgegen sein könne. Geblendet vom Starren in die weite Morgenröte, verliert sein Blick die Tatsachen. Er sieht nichts voraus und legt die Sache der Freiheit in die Hände Bonapartes. „Möge nur er leben!“ Seine Leiden kommen ihm nicht von ihr, von der Revolution, sie kommen von Menschen. In dem Kerker, wohinein sie ihn, als homme de génie, geworfen hat, begeht er ihre Feste, erfindet er Geschosse, die sie ausbreiten sollen, lehrt er seine Kinder, solange man ihm das Schreiben erlaubt, ihren Geist. „Die Tugenden sind auf der Tagesordnung.“ Mit der ruhigen Grösse, die den Menschen jener Tage als Preis ihrer Gläubigkeit zuteil ward, trifft er Bestimmungen, „für den Fall einer Krankheit oder eines anderen Unglücksfalles“. Der andere Unglücksfall ist die Guillotine.
Er entgeht ihr und wird zur Armee geschickt. Es ist Waffenstillstand, auch sind mehr als genug Generale vorhanden, und es hiesse, sich durch Ränke hinaufbringen. Laclos verzichtet und bleibt unten, trennt sich in seinem Bewusstsein immer von „denen dort oben“. Er behält im Alter die Neigung des sanften Dichters, die auch die Neigung ganz junger Menschen ist: die Leute danach zu beurteilen, wie sie ihn behandeln. Sobald man ihn verwendet, leistet er mit seiner Artillerie die tüchtigsten Dienste. Aber er ist ohne Ehrgeiz, sehr unentschlossen, hat einen etwas pedantischen Gerechtigkeitssinn, fremd den ungesetzlichen Kühnheiten, denen jetzt die Welt gehört, und sieht den Ruhm so fern, dass er es vermessen fände, die Hand nach ihm auszustrecken. Auch weiss er nichts von seiner Vergötterung, die jetzt aufkommt; er hat den menschlicheren Glauben seines Jahrhunderts: „Das Ziel ist Glück und Ruhm nur ein Mittel.“ Der Republik dienen: was kann ihr Bürger noch mehr wollen? Den Seinen anständigen Unterhalt erwerben. Denn er lebt jede Stunde seiner Kriegszüge mit den Seinen, wie er einst im Gefängnis in Gedanken mit ihnen seine Mahlzeiten teilte. In seiner Frau liebt er die Erinnerung an die Tourvel, bedauert, ein Wort von ihr nicht mehr der Präsidentin in den Mund legen zu können, erklärt seine Frau für seine Nachwelt, sein Pantheon, worin sein Gedächtnis ruhen wird. Trost des Enttäuschten; ständiges Zurücksinnen an die einzige Leistung, die ihm vergönnt war. Was er heute tut, er weiss es, ist subaltern; drum erträgt er gefasst die Zeiten zwischen zwei Briefen seiner Lieben, und seine Erholung ist es, wenn er als Eroberer in eine italienische Stadt eingezogen, hinter den stillen Mauern eines Bischofspalastes mit einem feinen Priester plaudern darf, der sein Buch gelesen hat.
Und so, mag er selbst seine Rolle auch bescheidener veranschlagen, hat er teil am Sinn dieser Tage: den Verfasser eines gesellschaftskritischen Romans tragen Bajonette durch unterworfene Länder. Der Soldat ist vom Herkommen abgewichen, er erhält nicht mehr das Bestehende, steht nicht länger der Tatwerdung von Ideen entgegen; er selbst tränkt sie, auf grossen Siegeszügen, Europa ein. Er war Scherge und ist nun Kulturbringer; der literarische Offizier, in dessen Briefen die Namen Voltaire und Rousseau so oft vorkommen wie die von Kriegsmännern, ist der siegende Typus; und in dem, der noch auf Sankt Helena von den Dichtern wie von seinesgleichen sprechen wird, bereitet das Genie selbst sich vor, den Thron zu besteigen.
Laclos, schon alt, erfasst wenig von dem um ihn her. Die Jetzigen ergreifen lärmend Besitz von der Aussenwelt. Diese Stürme haben Chateaubriand über das Meer geworfen, werden den Knaben Victor Hugo nach Spanien wehen und die Romantik, die Kunst der sichtbaren Dinge, entfachen. Er aber, der Artillerist und Erfinder, zieht den Feldstechern die Augen der Seele vor. Für seine Fahrt durch die Schweiz findet er in drei Zeilen Platz und hält Genua keines Besuches wert. Schon als Valmont hatte er gesagt: „So sind Sie denn auf dem Lande, das langweilig ist wie das Gefühl und traurig wie die Treue.“ Die schwierig zusammengesetzten Menschen, in einem Salon wohlverwahrt, die zu durchschauen und reinlich zu bestimmen ihm gegeben war, sie sind nicht mehr. Ein Übriggebliebener, der sich den Zopf aufgelöst hat und von seiner Träumerbegeisterung in lauter Neues, vor Rauheit Unentwirrbares verschlagen ist, lässt er aus seinem weichen, runden und roten Rokokogesicht seine melancholisch brennenden Beobachterblicke unbeschäftigt ausgehen über gleichgültiges Land. Könnte er wenigstens seine geliebten hohlen Kugeln bei einer ordentlichen Belagerung probieren! Lieber noch schriebe er den längst in ihm keimenden Roman, dessen Thema lautet: „Das Glück lebt nur in der Familie.“ Er sinnt darüber, während er seine langen Glieder mühsam im Reiten übt; und hinter ihm ist immer, mit Karossen, Livreen und aufgedonnertem Stab, der opernhafte Pomp eines Generals der Armée d’Italie.
Dann stirbt er, in Tarent, einem Ort des Fiebers, wo er nicht einmal nützen konnte; stirbt ausgeschieden und geopfert und richtet „in dem Augenblick, da für mich alles enden soll“, eine Bitte an den Ersten Konsul: um Hilfe für die unglücklichen Seinen. Denn er hinterlässt nichts als seine prunkvoll bestickte Generalsuniform. Und die Liaisons dangereuses.
Die ersten Leser des Buches konnten (wie gewöhnlich) nicht ertragen, ihre Gesten, die ihnen, über die Wirklichkeit verstreut, niemals Ekel einflössten, im Kunstwerk zusammengebunden, ihre Seelenverfassung darin anschaulich kommentiert zu sehen. Marie-Antoinette, die Keusche, verbot, dass auf das Exemplar, das sie einbinden liess, der Titel gedruckt werde. Der Ruf der Unsittlichkeit, den die Rache der Zeitgenossen dem Roman bereitete, hat fortgewirkt. Die moralische Absicht darin ist zwar eher zu deutlich. Glücklich wird man nur durch Liebe. Nicht durch Stolz; nicht durch Spielen mit anderer Schicksalen; nicht durch Verstand: nur durch gütige Liebe. Wer liebt, merkt es und ruft den übrigen die neue Wahrheit zu. Wer nicht empfindet, hegt Neid auf alle, die es können. „Ich bin empört“, sagt Valmont, der glänzende Verführer, „wenn ich denke, dass dieser Mensch, ohne zu überlegen, ohne sich die geringste Mühe zu geben, einfach dadurch, dass er ganz dumm dem Trieb seines Herzens folgt, eine Seligkeit findet, die ich nicht erreichen kann.“ Das geht bis zur Fälschung. Gegen Ende des Buches wandelt die Merteuil eine Reuestimmung an und sie wünscht, von einem naiven Jungen so geliebt zu werden, „wie wenn ich seiner würdig wäre“. Aber der Optimismus der meisten, der Schwäche ist, steht einem solchen Buch entgegen; und die Zeit, die es ertragen soll, braucht einen wagehalsigen Geist. Die zunächst Kommenden waren am wenigsten geeignet. So hat sich Charles Nodier albern und Michelet sich unverständig geäussert. Sainte-Beuve, den Analytiker von „Volupté“, hätten die Liaisons dangereuses nicht weniger anziehen müssen als Sainte-Beuve, den neugierigen Kritiker; aber beide schwiegen. In der Präsidentin Tourvel hätte George Sand leicht ihre eigene Rechtfertigung der Liebe als Diakonissinnenpflicht wiederzuerkennen vermocht; doch erklärt sie, der Seele gesünder als die Liaisons dangereuses finde sie den Pfarrer von Wakefield. Ihrem Feind Baudelaire dagegen, dem „Satanisten“, der sich als verkannten Moralisten fühlte, war Laclos’ Roman sympathisch. Und die Goncourt scheuen sich nicht, den Verfasser in die vorderste Reihe der klugen Reformatoren zu stellen.
Nicht das macht dem heutigen Geschlecht seiner Liebhaber sein Buch wert. Bei den Liaisons dangereuses verweilt, als bei einem frühen Bilde des eigenen Wesens, jeder, der sein Erlebtes gern ins Schlimme steigert, sich aus der Hoffnungslosigkeit seines Wissens um Seelen einen Trost macht und einen Rausch aus seinem Herrschergefühl vor Abgründen, die er vermisst. Laclos würde stutzen beim Anblick seiner Freunde. Er wollte versittlichen, und sie sind Immoralisten. Er dachte, zu der sanften Tourvel zu führen, und sie bewundern die ruchlose Merteuil. Aber er, der ehemals lachend den Lästerungen getrotzt hat, würde heute wohl mit Lächeln den Ruhm hinnehmen, der selten mehr ist als ein weit verbreiteter Irrtum über unsere Person.
STENDHAL
I
Er wurde früh genug geboren, um als Kind die Revolution echoartig mitzuerleben. Die Berichte der Ereignisse, die damals die Generationen auseinanderrissen, drangen von Paris nach Grenoble, wo heute sein Denkmal steht. Das Wohnhaus der Familie Beyle lag niedrig und hell am Ende einer Weinlaube. Er liebte seine Schwester, hasste seinen Vater und behauptete später, im zartesten Alter habe er erotische Eindrücke von seiner Mutter empfangen. Seine Beziehungen zu seinen Eltern werden beiläufig die gewesen sein, von denen 1920 so viele junge Leute grosses Aufheben machten. Er selbst hat sie in seinen Geheimbüchern aufgezeichnet; seine Romane tragen schwerlich die Spur davon.
Er war nicht in dem Masse Analytiker, um sich nur einfach der Selbstzergliederung zu widmen. Keiner seiner Charaktere ist einfach er selbst, ausgenommen vielleicht der Held eines kürzlich wiederaufgefundenen Romans, den er angefangen und bald abgebrochen hatte. Er nahm sich selbst zum Ausgang, setzte hinzu und zog ab; besonders zog er ab. Er verschob die Lebenslage, fragte: wie würde man handeln, wenn man erst 1805 geboren wäre? In jedem Fall sah er das Geschöpf handeln, wie er auch sich nur handelnd kannte. Er hatte seine Theorie des Glücks; aber das schlimmste Unglück, nicht handeln zu können, hat er kaum in Betracht gezogen. Den Helden seines ersten Romans hat er sich impotent gedacht, sagt es indessen nirgends im Buch. Warum nicht? Es muss ein verschwiegenes Opfer an das Unglück gewesen sein. Dann folgten nur noch Gestalten von äusserster Lebenskraft.
Die Energie, sein wichtigster Gegenstand und seine ewige Forderung, kann modern und leichtverständlich aufgefasst werden. Vielleicht war er nur, was auch heute wieder alle sind? Ein Sohn der gelockerten Gesellschaft und des Krieges, respektlos und entschlossen, durchzudringen, mit Gewalt und abenteuerlich oder dank den bürgerlichen Mitteln. Als junger Mensch versuchte er von dem verhassten Vater das Kapital zu erlangen, um mit Kolonialwaren zu handeln — und dies gewiss nicht im kleinen. Schnell und ohne Vorurteile reich zu werden, war damals sein Entschluss. Als er vorher mit siebzehn Jahren durchgegangen war zur Armee d’Italie, tat er das andere, was ein jugendlicher Drang nach Erfolg in jenem Zeitpunkt tun konnte. Es war unter dem General Bonaparte. Nach seinen Abwegen als Kaufmann, Verfasser eines komischen Stückes und Liebhaber der jungen Schauspielerin, für die er unbedingt reich werden wollte, trat er endgültig in den Dienst des Kaisers.
Dies waren, bis Napoleon stürzte, für Stendhal, einen seiner Soldaten, die Jahre des nach aussen gerichteten Lebens und einer solchen Fülle von Handlung, dass ihm in den folgenden Jahrzehnten schien, er handelte immer noch. Denn ihm strömte von dorther fortwährend Kraft zu. Die Energie, die er verlangte, er hatte sie gesehen; von ihrem Strom bewegt, hatte er gelebt. Sein übriges Leben arbeitete weiter mit der damals erworbenen Freudigkeit. Wollte sie in den trüber werdenden Tagen versagen, sofort rührte sich das Pflichtgefühl dessen, der siegreich und glücklich gewesen war und es bleiben musste. Nicht anders bestand zur gleichen Zeit sein verbannter und kranker Kaiser darauf, so genannt zu werden bis zuletzt vor der Welt, die seine unvergängliche Spur trug.
Henri Beyle war Intendant in Braunschweig und presste aus dem Land etwas mehr heraus, als er musste, nur, um Napoleon zu gefallen. Als Moskau brannte, nahm er aus dem Hause, das er bewohnte, allein einen Band Voltaire mit. Er bedauerte, dass die Ausgabe unvollständig wurde, aber ohnedies verbrannte die ganze Bibliothek. Am gleichen Tage sagte ihm der Kaiser: „Sie sind ein tapferer Mann, Sie haben sich rasiert.“ Das sind seine grossen Erinnerungen. Am Tage von Wagram hatte die Hand Napoleons einen Augenblick lang seine Brust berührt. Daran erinnerte er den Gefangenen auf Sankt Helena, als er ihm seine Geschichte der italienischen Malerei widmete: „Der Grenadier, den Sie am Knopf fassten.“ Er setzte sich im Rang herab, denn nur von diesem einen unter allen Menschen scheint der Abstand ihm unermesslich.
Als er Napoleon diente, hat er nichts geschrieben. Die Sicherheit, zu handeln, ersetzt vollauf jene andere Illusion, die das Schreiben ist. Auch beschreibt niemand, besonders nicht mit Kraft und letzter Hingabe, einen Zustand seines Lebens, der ihm völlig genehm ist; der richtig Verwendete muss über sich nicht nachdenken. Die Welt, unter der er nicht leidet, reizt ihn nicht zur Gegenwehr. Worte und Sätze sind unter anderem auch Gegenwehr, ein ganz und gar glückliches Zeitalter hätte keine Literatur. Seine Welt damals kreiste um den grössten Mann, der seit vielen Jahrhunderten erschienen war. Sie kreisen lassen, ihn bewundern und schweigen! Später, nach den Ereignissen, hat er Napoleon seinen Despotismus vorgeworfen, ihn aber auch dann noch entschuldigt mit seinem Genie.
Hier sind die Punkte, in denen der junge Stendhal zu vergleichen wäre mit seinen Altersgenossen einhundertzwanzig Jahre später. Er hat den Hass auf die Alten gepflegt. Es kam ihm nicht darauf an, wie man reich wird. Er nahm die Zeit und ihre Bedingungen sachlich. Geld verdienen und Krieg führen, erkannte er als das natürliche Gesetz der Revolution in ihrer imperialistischen Hälfte. Er hatte das Bedürfnis, sich in heftiger Bewegung zu erhalten und einem selbstgewählten Führer widerstandslos zu gehorchen. Es sieht aus, als wären dies Ähnlichkeiten genug. Der Unterschied dagegen liegt vor allem in der Produktivität — des Zeitalters, seines Helden und Stendhals, in dem sie noch schlief. Der Unterschied liegt auch in einer anderen Ideologie, der des 18. Jahrhunderts. Aber gerade auf Grund dieser schöpferischen Ideologie war Napoleon imstande, das Gesicht der Nachwelt zu formen, und Stendhal konnte solche Romane hinterlassen, dass bis an den letzten Schluss des bürgerlichen Zeitalters die wechselnden Geschlechter sich darin wiedererkennen werden.
Dies Zeitalter war sogleich ganz da und führte im Abriss unverzüglich alles vor, was es dann in hundertfünfzig Jahren weitschweifig wiederholt hat. Dem Führer, der seiner geistigen Herkunft das innere Recht verdankte, Kaiser zu sein, traten alsbald gegenüber die Spekulanten. Sie verdienten an seinen Ruhmestaten, er hasste sie, kam aber niemals los von ihnen, sie fassten ihn im Grunde als ihr Vollzugsorgan auf. Der Revolution war vom Kapital die faszistische Wendung gegeben — schon damals; und in jedem späteren Zeitpunkt, sooft das Kapital den Aufschub der demokratischen Verwirklichungen brauchte, was zeigte sich wieder? Die Affen Napoleons. Die tiefste und edelste aller Ideologien erstreckt sich über das Zeitalter, seine Helden sind in die Glorie unseres Menschentums getaucht, wie keine vorher. Zuletzt aber ist alles, was ihren Himmel rötet, doch nur wieder das Feuer der Schlachten. Sie waren Betrogene. Napoleon selbst ist dahingegangen im Irrtum über die von ihm veränderte Welt. Er glaubte ihr die Freiheit zu hinterlassen, und sie verfiel der Geldherrschaft.
Stendhal hätte entschieden, dass weniger die Freiheit zählt, die damals in den Vereinigten Staaten von Amerika ihre Stätte noch hatte und die er dort nicht anziehend fand. Was ihn ergriff, war der Kämpfer und Befreier, und Treue hielt er nur den Eigenschaften einer Seele. Sein Kaiser war ihm selbst verwandt durch die leichte Erregbarkeit des geistigen Menschen, durch Worte wie dieses: „Die literarische Bildung verdeutlicht den Ehrbegriff und beschämt die Niedrigen.“ Sein unerreichbares Vorbild hingegen blieb Napoleon durch die Festigkeit seiner Entschlusskraft, diesen „Zwei-Uhr-nachts-Mut“, den niemand hat. Er hielt sich für seinen Untertan auf Grund moralischer Hoheiten, niemals durch Erfolg und Macht. Napoleon war es, der ihn gelehrt hatte, das Handeln mit dem Denken und Fühlen als dieselbe Grösse anzusehen; denn er achtete Corneille gleich einem Fürsten und sein eigenes Gesetzbuch für höher als seine vierzig Siege. Dies hat auch Stendhal berechtigt, als die Tage des stark bewegten äusseren Lebens vorbei waren, das innere für nicht geringer zu nehmen.