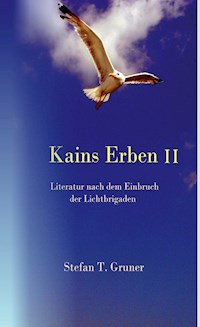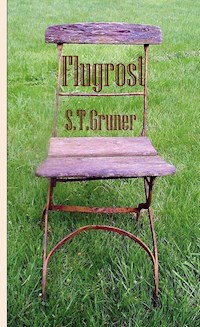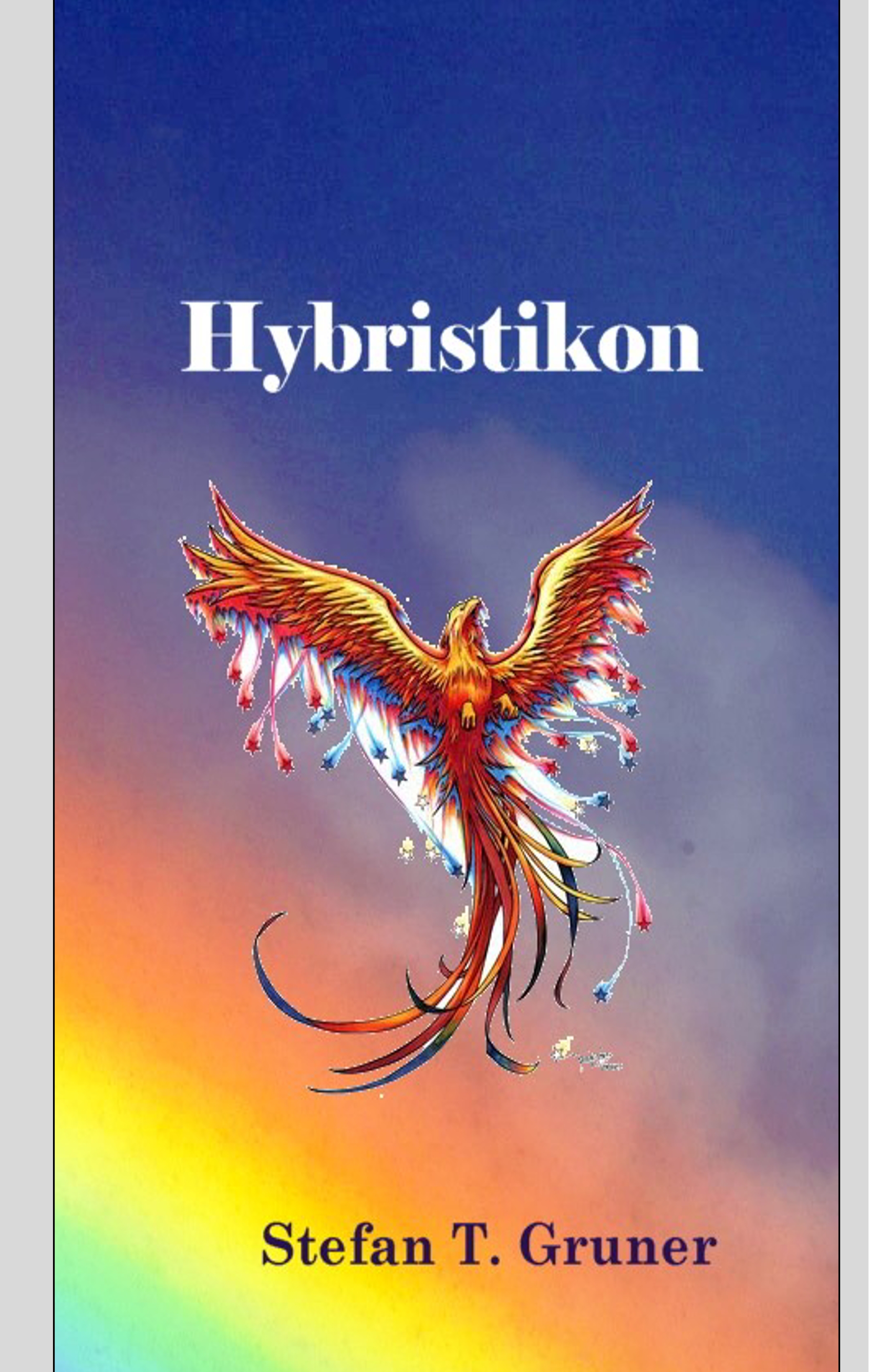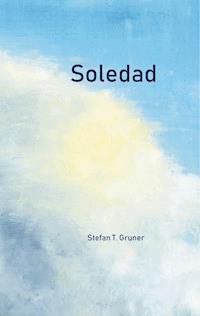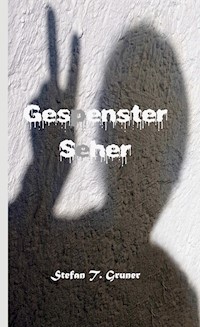
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gespensterseher Nr. 1 Rainer Pagel, ein Jugendlicher, der eine Alkoholikerkarriere hinlegt und seinem Freund in einem diffusen Gespräch von der leibhaftigen Existenz der sogenannten Sukkubi und Inkubi überzeugen will Gespensterseher Nr. 2 Ein Gespräch, bei dem es um die "Erweiterung" der Wahrnehmungsmöglichkeiten im digitalisierten, virtuellen Raum mit unterschiedlichen, zur Wahl stehenden Anderwelten Gespensterseher Nr. 3 Die als Warnung vorgebrachte Geschichte der Entstehung des Action-Comic Helden Superman, dem Vertreter einer (kindlichen) Allmachtsfantasie, einschließlich seiner religiösen Vorläufer-Figuren
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Körper der Inkubi und Sukkubi sind ätherischer als der menschliche Körper, und das kommt ihnen bei ihren Reisen im All sehr zugute.
(William Burroughs zum staunenden Victor Bockris)
Inhaltsverzeichnis
Für Rainer Pagel
Ein Austausch, ins Erzählbare übertragen:
Die Helfer an der Klippe zwischen Wollen und Können
Für Rainer Pagel
Ohne Vorwarnung Dahinsiechende, unvermutet ins Abseits Gleitende, vom Teufel Gerittene oder von Taranteln Gestochene haben mich zeitlebens begleitet.
Der Großvater mütterlicherseits: Ein angesehener Wissenschaftler, Schwerpunkt Pathologie, Gott in Weiß, faustischer Forscher, universell gebildet, penibel, Verächter aller Gedankenschwäche − und was passierte? Er wurde noch vor seiner Emeritierung „wunderlich“, verfolgte über zehn Jahre den Schnee in einem defekten Fernseher und hielt mich für den knabenhaften Liebhaber meiner Mutter, die er, wenn wir zusammen vor ihm standen, unfehlbar anfuhr: „Dass du mir das noch antun musstest…!“
Der Vater, Lieblingsschüler jenes Großvaters, wild auf die Wissenschaften, ehrgeizig und erfolgreich, erschoss sich in einem Anflug von Schwermut im Winter 1945, nachdem er noch einen Brief mit Reimen auf „frisch“, „froh“ und „vogelfrei“ abgeschickt hatte.
Der Großvater väterlicherseits ein verluderter Künstler, Pianist und Koksschniefer. In kindlicher Offenheit nannte ich den fanatischen Tastenhauer „Schwarzweißmaler“. Prügel folgten. Jähzornig und durch zwei Weltkriege traumatisiert, verfiel er dem Größenwahn, verbrauchte Tonnen von Papier für ein unentzifferbares Tagebuch, aus dem er jeden Abend den Wänden vorlas. Ich sprach die Befürchtung der Umwelt aus, nannte die dicken Mappen sein privates „Knöchelverzeichnis“. Ergebnis: Ohrfeigen. Ich blieb bei der Wahrheit, bezeichnete die endlosen Aufzählungen seiner Taten, die er im Tagebuch angab, als „komplette Liste aller ungefertigten Werke“, was ihn zum Rohrstock greifen ließ.
Er belästigte Politiker mit Dankesschreiben für Ehrungen, die sie ihm nie gegeben hatten. In seinen letzten Jahren verursachte er Straßenaufläufe durch unflätige − von Püffen und Schubsern abgerundete − Beschuldigungen vorbeiflanierender Passanten. Am liebsten stieg er in der Fußgängerzone auf eine Apfelsinenkiste, die er mit sich herumschleppte, und hielt in einem donnernden Stakkato obszöne Reden zur Verteidigung Satans, die ihm den Spitznamen Stötteritzer einbrachten. Spektakuläre Handgemenge im öffentlichen Raum mit ihm als zentralem Auslöser waren der Lokalpresse Zweispalter wert, ließen allerdings auch seine Polizeiakte ins Unüberschaubare anschwellen.
Die Mutter. Sie jagte mir schon als Kind durch ihre periodischen Entrückungen bleibende Schrecken ein. Sie arbeitete in den Städtischen Heilanstalten in Bonn. Irgendwann hörte sie auf, dort zu arbeiten und saß dort ein.
Die Kinderbetreuung? Bis zu Mutters eigener Verbringung in der Heilanstalt kamen wechselnde „Haushälterinnen“ von dort, um sich um uns Kinder zu kümmern. Es waren Freigängerinnen, die sich wieder ans Leben außerhalb der Anstalt gewöhnen sollten. Ihr therapeutischer Auftrag? Auf meine Geschwister und mich aufpassen, einkaufen, kochen, putzen.
Sie versuchten es. Entschlossen. Mutig. Herzzerreißend. Aber dann heulten sie doch nur wieder in den Ausguss, sangen in erfundenen Sprachen, entkleideten sich, riefen aus dem Fenster nach der Feuerwehr, umschritten imaginäre Staubsäulen im Treppenhaus, legten ihr Ohr auf die glühende Herdplatte, spielten Luftharfe oder malten dämonenbannende Symbole an die Türpfosten. Sie stellten meine Nerven auf Daueralarm…
(Andererseits war es eine dieser Freigängerinnen – nicht meine Mutter – die mir das erste und einzige Mal in meinem Leben über den Kopf strich, um ihre Anteilnahme zu zeigen, als ich wie üblich nachmittags mit der Stirn auf dem Küchentisch vor mich hin heulte. Ich war so überrascht, dass ich das Bewusstsein verlor).
Ich konnte noch keine Knoten in meine Schuhbänder machen, da hatte ich schon die wichtigsten Varianten des stillen Verdämmerns, schleichenden geistigen Beiseitetretens und offen schäumenden Wahnsinns gesehen.
Um den engeren Kern der entgleisten Figuren in meiner täglichen Umgebung − die mir mit offener Bluse auflauernde Nachbarin beziehungsweise ihren mich daraufhin mit einem Messer durch den Hof jagenden Ehemann nicht mitgerechnet − gruppierten sich auffällige, leicht spinöse bis gemeingefährlich ausrastende, letztlich immer abnorme Verwandte, wie unbeschwert sie sich zunächst auch präsentierten. Darunter selbstmordgefährdete Halbbrüder, ein depressiver Vetter, eine hypermotorische, sich auf ihr Dasein als Kolibri vorbereitende Kusine, eine karzinophobe Tante, die dann auch tatsächlich sehr jung, aber nicht an Krebs, sondern an einer Darmverschlingung starb, mich bis dahin aber durch ihre Schilderungen von organzerfressenden Zellenwucherungen in Albträume trieb.
Beängstigend auch zwei Onkel, Zwillingsbrüder, mit nur hinter der Hand zu flüsternden Tics. Man munkelte von nächtlichen Denkmalsbesudelungen in Tateinheit mit Taubenvergiftung und Glassplitter in den Kinderspielplatzsand streuen. Dazu der vorübergehenden Hausfreund, Lebensbegleiter und um ein Haar zweite Ehemann der Mutter, ein abgedrehter, in der Ausarbeitung eines neuen Menschenrechts verbissener Jurist, der abwechselnd beim Pförtner des Innenministeriums und der Sakristei im Dom zur Heiligen Dreifaltigkeit vorstellig wurde. Der Mensch war mit allen Gebrechen außer dem Selbstzweifel geschlagen. Sogar in einer Horde durcheinander brüllender Psychopathen wäre er fähig gewesen, die Führung an sich zu reißen.
Aus Sicht der Wissenschaft hätte ich nach genetischen Defekten unserer Familie suchen sollen. Um an der Basis zu beginnen! Soweit war ich damals nicht. Ich fragte mich noch kindlich gerührt: Welcher Fluch lastete auf unserer Sippe? Was, außer dem Blut, verband die Anfälligen, Abgedrehten und Ausgeklinkten um mich her? Ich stieß auf den Hang zu Drogen. Wie verzankt die Familie auch sein mochte – es gab interne Mordversuche – bei der Drogenbeschaffung unterstützen sie sich wie frisch Verliebte: legal, illegal, scheißegal. Hauptsache die Stoffe halfen, ihre Sinne entgleisen zu lassen.
Die Mitglieder des Klans – bei diesem Thema ein Herz und eine Seele – flüsterten sich pharmakologische Substanzen wie Zauberformeln zu, tauschten Arzt- und Apothekeradressen, auch Händlertreffs, pflegten bewährte Kontakte, suchten neue Quellen. Alle Reisen, die sie unternahmen, galten vordringlich der Beschaffung von Narkotika (Bernward Vesper, der sein Drogenbuch Der Trip nannte, hat sich dann für Die Reise entschieden, unverfänglicher, aber für Eingeweihte immer noch deutlich genug, um zu wissen, was hier mit „Reise“ gemeint war. Ich bin ihm in München begegnet, bevor er in die Psychiatrie kam, ohne zu wissen, neben wem ich da am Odeons-Brunnen saß).
Außer der Palette harter Drogen, die ihnen unter anderem auch gerichtlichen Ärger einbrachte, schluckten die Verwandten marktgängige Pillen von Atarax bis Zyprexa, soffen, schnieften, rauchten und drückten zur Not auch Mohnsud − Onkel A zu Onkel B: gimme dat bong water! − um sich in andere Welten zu verdrücken, zumindest von sich abzurücken.
Ein unverwechselbares Kennzeichen meiner Sippe? Okay. Da wäre ihre schneckenlangsame Fortbewegung. Ihr übervorsichtiger Gang. Ihr ständig aus dem Lot gleitendes Auftreten. Als kämpften sie gegen eine körperliche Unwucht, einen unsichtbaren Sturm oder einen bislang unbekannten magischen Magnetismus, der sie gegen ihre Laufrichtung in unheilvolle Winkel zu ziehen versuchte.
Auch eine gewisse Fallsucht schien unter ihnen verbreitet. Periodisch klatschten sie ohne Abwehrreflexe zu Boden und erwachten mit den kompliziertesten Brüchen. Damit nicht genug. Sie brauchten ein Netz von Mitmachern und Gleichgesinnten – eine Gefolgschaft. So schleppten sie zusätzlich einen Schwarm ähnlich Verwahnter hinter sich her, die mich ansummten, umstanken, bestichelten, immer neu verletzten und aufwühlten. Es gab in meiner Kindheit keine Tür, die ich ohne Zittern öffnete, weil ich nie wusste, was mich dahinter erwartete…
Meine jüngere Schwester nannte es unseren Zentraldefekt, bevor sie ihren Analytiker heiratete, der sich selbst nur noch stöhnend von einer Tischkante zur anderen schob.
Mich selbst überfielen, um nicht aus der Reihe zu tanzen, bei Schulantritt Lähmungserscheinungen in den Beinen, die jeder körperlichen Grundlage entbehrten und mich zum Gespött der Mitschüler machten.
Dabei hasse ich Kranke! Zur Strafe wurde ich sie nie los. Auch außerhalb der Familie nicht. Kaum hatte ich mich einem grundfröhlichen Wesen genähert, glitt es in eine Krise, entdeckte eine persönliche Existenzgefährdung, sah sich von lebenshemmenden Zweifeln beschlichen oder verirrte sich in einer Weltuntergangsahnung, aus der es nur noch mit verdrehten Augen und verknoteter Zunge erwachte.
Es passierte früher oder später. Meist früher. Aber unfehlbar. In meinem Umfeld kippten die Heitersten in überraschende Untiefen, als hätten sie nur auf mich gewartet, um sich fallen zu lassen. Ihre Beschwerden hatten, da sie niemand begriff, lange klinische Bezeichnungen. Ich buchstabierte sie gar nicht erst zu Ende. Mir reichte das Dauerfeuer der mit ihnen verbundenen Schrecken.
Bei allen Unterschieden der Zusammenbrüche glaubte ich ein Muster zu erkennen: eine Art Zwitschern oder Kreischen im Kopf. Etwas unkontrolliert Grillenhaftes. Die Zirpklänge, die entstehen, wenn Zikaden ihr Trommelorgan anwerfen oder Heuschrecken die Beine an der treffend benannten Schrillkante ihrer Flügel reiben. Nicht zu vergessen die sirrenden Laute, wenn Insektenflügel um sich schlagen. Eine gellende Invasion. Eine Hornissenattacke. Wahlweise ein den Himmel verfinsternder Krähenschwarm. Jedenfalls etwas Schallwirres, Vibrierendes, Herabstürzendes.
Die Verrückung war geflügelt, das stand für mich fest. Es hatte mit Federschwingen, Schnabelhacken, Krallenreißen zu tun...
einem gewitter gleich stürzen die erinnyen vom himmel unmenschliche schreie begleiten ihre gefiederte niederfahrt noch im flug schlagen sie ihre blitzenden krallen in die nacken der zu boden geschleuderten und verteilen berauscht schnabelhiebe für die einen für die anderen gefiederte küsse
Ich war gewarnt. Ich achtete darauf, nur die anzusprechen, die so selbstbewusst auftraten, dass sie meinem Idol, dem ewig lachenden Idioten, nahe kamen. Alles, nur keine kränkelnden Gemüter! Es gab ja genug von der heiteren Einfalt. Bis sie mich trafen. Und ihre Macken entdeckten. Und unsre unbeschwert begonnenen Tage verdüsterten.
Schließlich verdächtigte ich mich selber, die in den anderen schlummernden Verirrungen ans Tageslicht zu fördern.
Ja: Ich selber war es, der den Kippmechanismus bei anderen anwarf! Ich selber löste in ihnen die Schieflagen aus. Hatte ich den falschen Blick? Gab es – ständige Verletzung macht mystisch – doch so etwas wie eine schwarze Aura, die von mir ausging und sich über andere stülpte, sobald sie in meine Nähe kamen?
Vergebens wählte ich Bekanntschaften aus, denen „das Glück ins Gesicht geschrieben steht“, wie Volkes Mund sagt, denen „der Schalk im Nacken sitzt“, „die Gesundheit aus allen Poren lacht“ und so weiter. Ich zitterte schon, wenn sie zum ersten Mal die Stirne runzelten! Es blieb nie beim Stirnrunzeln. Nie! Sie brachen auseinander wie äußerlich perfekte Äpfel voller verborgener Maden. Sie faulten. Setzten Seelenschimmel an. Entwickelten einen Spleen. Verstrickten sich in unheilbare Leiden. Wechselten die Seiten…
Schon hätten sie auf meine Liste der Wunderlichen gehört, die ich als Kind begann, aber wieder aufgab, weil mir klar wurde, dass in meiner Nähe keiner unverwunderlich blieb, wie stabil er zunächst auch auftrat.
Möglicherweise beschwor die Liste ja erst, was sie festzuhalten vorgab? Eine interessante Theorie! Unglücklicherweise riss die Kette der Kranken in meinem Umkreis auch nach Aufgabe der Liste nicht ab.
Entfaltung? Verwirklichung? Eine wunderbare Sache. Für andere. Ich könnte übers Wasser wandeln, das haben schon weniger Talentierte geschafft, es brächte mir nichts: ich würde, kaum wieder an Land, vom herabfallenden Ast eines Uferbaums erschlagen.
Wo aber die Not am größten ist, naht das Rettende auch, schallt es vom Himmel herab. Für mich nahte das Rettende in der Gestalt von Rainer, einem Schulfreund, den ich in der Klasse kaum wahrnahm, weil er dort wie wir alle geduckt seine Zeit absaß. Es gehörte zur Selbsterhaltung, sich blind und taub zu stellen, um den kreuzbrechenden Ritualen der Kinderverderber zu entrinnen, die unter dem Tarnnamen Lehrer ihr Unwesen trieben. Okay. Wer vom Pult aus geistige Messer warf, sollte von den Bänken Steingesichter ernten.
Mittags begrüßten wir uns dann wie aus einem Tiefschlaf erwacht. Erst nach Schulschluss kam Menschwerdung.
Rainer. Ein patenter Freund. Der pfiffigste Mensch unter der Sonne. Rundum stabil. Schlank, wendig, witzig. In der ländlichen Eifel geboren (zeigte uns, wie man im Kottenforster Wald ein Wochenende durch frei laufende Kühe melken und zur Reife gelangte Zuckerrüben ausgraben überleben konnte) Verliebt in Eisdielen und Kinos. Der geborene Schwerenöter… Seine Milchkaffeeaugen, sein dichtes, schokoladenfarbenes Haar, ja doch: ein Mädchenschwarm. Ein Sorgenkiller! Vor allem auch ein kundiger Mopedbastler – besonders wichtig für mich, der ich die reparaturbedürftigste Marke fuhr, die je auf den Markt gelangte: Capri.
Bei meiner Capri handelte es sich – es gab keine andere Erklärung – um das Exemplar einer Spott & Hohnserie, die ein in den Ruin getriebener Fabrikant, von kriminellen Wettbewerbern ausgebootet, als letzte Rache auf den Markt geworfen hatte. Kein Händler kannte die Marke. Keine Werkstatt hatte Ersatzteile für meine Capri.
Rainer erkannte auf der Stelle den Schrott auf zwei Rädern, als er mich mit dem frisch erworbenen Gerät um die Ecke kurven sah. Er winkte mich in den Stand wie ein Polizeineuling seinen ersten Verkehrssünder − spreizbeinig auf die Fahrbahn geblockt. Es folgte ein Dankgebet an meinen Schutzengel, der mich trotz der 8 im Ritzel, defekter Bremskabel und eines um die bloße Faust gewickelten Gaszugs bis zu ihm hatte kommen lassen. Schließlich wollte er wissen, welcher Verbrecher mir die Mühle angedreht hatte.
Mir hätte schon der traumtreibende Name Capri als Kaufreiz genügt… Meeresplätschern, Mädchen am Strand, Sonne zwischen den Schenkeln… aber die letzte würdelose Wahrheit kam erst zutage, als ich Rainer das Verkaufsgespräch mit dem Vorbesitzer gestand, einem Jungen aus der Vivatsgasse, der nur alle paar Wochen in unserer Gegend auftauchte, um bislang noch nicht verfeindete Nachbarn gegeneinander aufzuhetzen.
„Du kennst doch die Bärbel?“ hatte er, der mich kannte, losgestochert. „Die von der Goebenstraße?“ fragte ich zurück, als ob es eine zweite erwähnenswerte Bärbel auf der Welt gäbe. „Genau“, meinte er, formte mit den Händen zwei verheißungsvolle Globen, ließ mich erröten und klatschte dann seine Rechte auf die Sitzbank : „Hier hat sie gestern noch mit nichts als einem Sonnenbrand unterm Rock draufgesessen!“
Der Kauf war perfekt.
Zum Schein bemeckerte ich noch irgendwelche fehlenden Schutzbleche und blies imaginären Ruß vom Zündkerzenkontakt, um meinen Pulsschlag zu beruhigen.
Von Rainer erwartete ich paar Ohrfeigen, er aber, Herr der Lage, Ausbund an Verständnis und Gelassenheit, starrte nur versonnen auf das jämmerliche Gerät mit dem saftigen Geheimnis, gab anschließend die fachliche Richtung vor: „Dann wollen wir mal was Fahrbares um den Muschifleck rum bauen!“
Es gelang. Wir knatterten durch Endenich, den Venusberg hoch, zum Freibad, den Venusberg runter, unter der Bahnunterführung über die Rheinbrücke zur Beueler Seite, auf staubigen Feldwegen zur Sieg, dort die Pappelalleen entlang, dass sich die Wipfel erschrocken aneinander klammerten, zum Rheinufer zurück, motto rasante an der Promenade lang, dass Passanten hinter Baumstämmen Schutz suchten und Flussmöwen aufkreischten – oder war‘s umgekehrt? Jedenfalls, Kuss der Abendsonne im Nacken in die Innenstadt zurück, unsere Erkennungsmelodie schmetternd:
wenn beim capri der ölstand
leise auf null absiiii-inkt…
So durchgerüttelt und mit Kettenschmiere unter den Fingernägeln in den Jazzkeller (wo sind all die Banjospieler hin?), um zwischen den Stechern, die „den Laden aufrollen“, „die Theke abräumen“, „Deutschland leer saufen“ und „die Frauen aufreißen“ wollten (Frauen waren damals noch Wundertüten), zwischen all diesen niederen Lüstlingen, sag ich, den einen oder anderen Petticoat mit verstörtem Inhalt vor weiteren Übergriffen in eine verschwiegene Ecke zu retten. Dort angelangt, verteidigten wir die Beute gegen alle Anzüglichkeiten – außer den eigenen – vierhändig.