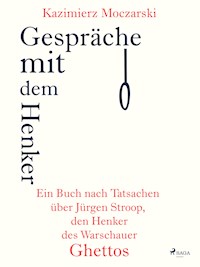
Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos E-Book
Kazimierz Moczarski
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Als Opfer des stalinistischen Terrors war der bürgerlich-demokratische Widerstandskämpfer Kazimierz Moczarski seit August 1945 eingekerkert. Um ihn psychisch zu brechen, pferchte ihn die polnische Stasi für neun Monate in eine Zelle mit Jürgen Stroop, dem SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei, der 1943 die Zerstörung des Warschauer Ghettos befehligte. Aus der Erinnerung zeichnete Moczarski die "Gespräche mit dem Henker" auf: die beklemmende Biografie und das zutiefst verstörende Psychogramm eines national-sozialistischen Massenmörders.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kazimierz Moczarski
Gespräche mit dem Henker
Das Leben des SS-Gruppenführers und Generalleutnants der Polizei Jürgen Stroop aufgezeichnet im Mokotów-Gefängnis zu Warschau
Mit einem Geleitwort zur Neuausgabe vonGesine Schwan
Saga
Gesine Schwan
Geleitwort
Dies ist ein ungewöhnliches Dokument: Gespräche, aus dem Gedächtnis aufgezeichnet – 25 Jahre, nachdem sie stattgefunden haben. Kein Tonbandmitschnitt, sondern die Wiedergabe von 255 Tagen und Nächten, die ein ungewöhnlicher Mensch – Kazimierz Moczarski – genau in seinem Gedächtnis gespeichert hatte. Unter kaum vorstellbar quälenden Bedingungen und wohl gerade wegen dieser Bedingungen, wie Moczarskis Freund Andrzej Szczypiorski vermutet.
Denn der engagiert demokratisch und sozial gesinnte Jurist und Journalist Moczarski, der sechs Jahre zwischen Leben und Tod im Untergrund die Unabhängigkeit Polens gegen die mörderische deutsche Besatzung zu verteidigen versucht hat, wird im stalinistischen Nachkriegspolen ausgerechnet der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt, unsäglich gefoltert und zum Tode verurteilt. Er gehörte der nichtkommunistischen »Heimatarmee« an und wollte sich den neuen Machthabern nicht beugen. Er ist ein ungewöhnlich standhafter Mann, auch unter höllischen Leiden nicht bereit, sein Gewissen, seine Kampfesgenossen aus dem Widerstand und seine Ehre zu verraten. Als solch unbeugsames Vorbild ist er Teil dessen, was man das »kollektive Gedächtnis« der Polen nennen könnte. Viele Jahre lang war das Buch in den polnischen Schulen Pflichtlektüre. Schon deswegen verdient dieses Dokument die Aufmerksamkeit der Deutschen.
Aber auch, weil es uns vor Augen führt, wie unsere östlichen Nachbarn zwischen nationalistischem und stalinistischem Terror zerrieben wurden durch den militärischen Überfall 1939 und den folgenden Zweiten Weltkrieg. In Deutschland haben wir das schneiler vergessen, als es unserer Verständigung mit Polen und überhaupt unserer moralischen Redlichkeit ansteht. Die Polen, die jungen zumal, wollen nicht, dass wir in Sack und Asche gehen, aber sie erwarten zu Recht, dass wir diesen schmerzvollen Einschnitt in die polnische wie die europäische Geschichte nicht einfach vergessen und schlichte Normalität einfordern, wo sie nicht möglich ist. Das wird uns schnell klar, wenn wir uns an die Stelle der Opfer des Nationalsozialismus und deren Nachkommen setzen.
Mit unglaublicher Perfidie haben die stalinistischen Folterer versucht, Moczarski neben den physischen auch noch psychische Qualen zuzufügen. Sie sperren ihn in eine Zelle mit dem SS-Generalleutnant Jürgen Stroop, wie Moczarski zum Tode verurteilt, der die Zerstörung des Warschauer Ghettos befehligt hat. 255 Tage und Nächte muss Moczarski mit Stroop verbringen. So unter Todesangst und auf engstem Raum zusammengesperrt mit einem Henker, ohne Aussicht auf Befreiung, entwickelt Moczarski eine beeindruckende Überlebensstrategie: Er führt mit Stroop eindringliche Gespräche, um die Psychologie seiner NS-Peiniger etwas besser zu begreifen und damit zugleich die seiner aktuellen Folterer. Die Analogien zwischen den Totalitarismen und den menschlichen Haltungen, die ihnen entsprechen, sind keine neue Erkenntnis. Aber ihr unkonventioneller Beleg geht unter die Haut.
Erschreckend erneut die im Buch dokumentierte Einsicht, dass die Verbrechen im Nationalsozialismus von »ganz normalen Männern« (wie Christopher Browning sie beschrieben hat), ebenfalls, wenn auch weniger, von »normalen« Frauen begangen worden sind, die unter anderen Bedingungen vielleicht unsympathisch und kleinbürgerlich gehandelt aber nicht so mörderische Taten vollbracht hätten. Damit bleiben sie durchaus verantwortlich für ihr Tun. Aber das Buch zeigt erneut, wie leicht Menschen sich daran gewöhnen können, Unrecht zu tun, andere zu quälen, und sich eine Selbstdeutung zurechtzulegen, die alles in einem harmlosen Licht erscheinen lässt.
Das Buch zeigt aber nicht nur diese allgemeine menschliche Verführbarkeit zum Bösen, sondern auch die besonderen deutschen Traditionen einer autoritären politischen Kultur, die bis in die Fasern der Privatheit eingedrungen war und die konkreten historischen Brücken zum Verbrechen gebaut hat: allem voran eine Idee von freiwilliger, fragloser und zuweilen sehnsüchtiger Unterwerfung unter die vorgegebene Obrigkeit und Ordnung, die das konkrete Individuum, als Täter wie als Opfer, seiner Menschlichkeit, seines Mitgefühls und seiner Verantwortung beraubt.
Es ist eine lang und vielfach diskutierte Frage, ob solche Täter wie Stroop ihr Gewissen verloren haben oder ob sie ihre Schuld doch zumindest ahnten. Gitta Sereny hat in ihren meisterhaften Befragungen von Franz Stangel, dem Kommandanten des Vernichtungslagers Treblinka, und Albert Speer gezeigt, wie vielschichtig ihre z.T. nur halb bewusste Selbstdeutung ist. Stimmt Hannah Arendts These aus den sechziger Jahren, dass den Deutschen, was man Gewissen nennt, im Nationalsozialismus verloren gegangen war? Ich glaube, es gibt viele Indizien dagegen. Das vorliegende Buch gibt keine eindeutige Antwort darauf.
Manche mag die Normalität und eine gewisse Vertrautheit, die sich in 255 Tagen des Zusammenlebens ergeben, befremden. Sie zeugen von der Macht des gewohnten Alltags auch dort, wo die außergewöhnliche Standhaftigkeit eines Kazimierz Moczarski sensibel Grenzen zu ziehen weiß. Ich wünsche dem Buch eine breite Leserschaft, gerade in Deutschland.
Andrzej Szczypiorski
Über Kazimierz Moczarski
I.
Am 1. September 1939 erfolgte der Überfall des Dritten Reiches auf Polen. Es ist der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg ausbrach. Am 3. September erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg. Damit lösten beide Staaten ihre Verträge ein, die sie zuvor mit Polen abgeschlossen hatten. Die glänzend ausgerüsteten Armeen Hitlers waren vom ersten Tag den polnischen Streitkräften weit überlegen. Trotzdem verteidigten sich die Polen mit großer Tapferkeit und leisteten bis zum 5. Oktober Widerstand. Als Folge einer lang vorbereiteten Einkreisungspolitik war Polen bereits am Tag des Kriegsausbruchs zur Niederlage verurteilt. Der deutschsowjetische Nichtangriffspakt, der »Hitler-Stalin-Pakt«, am 23. August 1939 in Moskau von Ribbentrop und Molotow unterzeichnet, war insbesondere auch gegen die Unabhängigkeit des polnischen Staates gerichtet und legte den Einflussbereich von Nazi-Deutschland sowie der Sowjetunion in Ost- und Südosteuropa fest. In Erfüllung dieses Paktes marschierten sowjetische Truppen ohne vorherige Kriegserklärung am 17. September in Polen ein und machten es den polnischen Armeen unmöglich, sich gegen die von Westen angreifenden Deutschen zu verteidigen. So kam es zur tragischen Teilung Polens zwischen Deutschen und Russen – der vierten in seiner Geschichte.
In dem von Hitler eroberten Gebiet von West- und Zentralpolen setzte ein furchtbarer Terror ein, der gegen die polnische Bevölkerung und gegen die in Polen besonders zahlreich lebenden Juden gerichtet war. Gleichzeitig wurden Hunderttausende polnischer Staatsbürger in sowjetische Gefängnisse geworfen oder tief nach Russland verschleppt. Im Sommer 1941 fiel das gesamte polnische Staatsgebiet von 1939 als Folge des deutsch-sowjetischen Krieges unter die Herrschaft des Dritten Reiches.
Sechs Millionen polnischer Bürger, darunter etwa drei Millionen Juden, waren durch Kriegshandlungen auf polnischem Boden sowie während der bis 1945 dauernden Besetzung gefallen oder umgebracht worden. Von allen Ländern, die am Weltkrieg 1939–1945 beteiligt waren, hatte Polen die schwersten Opfer und Verluste zu tragen.
Der Naziterror war in Polen von einer besonderen Grausamkeit geprägt, die sich gegen das ganze Volk richtete. Massenhinrichtungen in den Straßen, die Ausrottung ganzer Dörfer und Provinzorte durch Einheiten der SS und der Polizei, Konzentrationslager, Gaskammern und Krematorien, die Zerstörung von Städten, die Zwangsaussiedlung Tausender unter besonders harten Bedingungen – all dies bewirkte, dass das polnische Volk dezimiert, die gebildeten Schichten zum großen Teil hingemordet und die jüdische Bevölkerung Polens fast vollständig ausgerottet wurde.
Von der ersten Stunde an führten die Polen einen erbitterten Kampf gegen den Feind.
Nach der Zerschlagung der polnischen Armee formierten sich in den Wäldern Partisaneneinheiten, in den Städten entstanden konspirative Kampfgruppen. Diese Verbände bildeten die »Armia Krajowa«, die sogenannte »Heimatarmee«, die sich aus im Untergrund kämpfenden militärischen Einheiten zusammensetzte. Die polnische Regierung befand sich im verbündeten London im Exil. Ihr unterstand die Heimatarmee, die einige Hunderttausend mutige, kampfbereite Soldaten zählte.
Einer der verantwortlichen Offiziere dieser Armee war Kazimierz Moczarski.
II.
Im April 1943 wurde der berüchtigte Mord von Katyn aufgedeckt. Trotz des fortschreitenden Krieges und ungeachtet der Tatsache, dass die Gräber der erschossenen polnischen Offiziere bei Smolensk von Deutschen entdeckt worden waren, zweifelte die Mehrzahl der Polen keinen Augenblick daran, dass für dieses Verbrechen nicht Hitler, sondern Stalin, nicht die Gestapo, sondern die sowjetische Geheimpolizei verantwortlich war.
Als die Morde von Katyn bekannt geworden waren, brach Moskau die diplomatischen Beziehungen zur polnischen Exilregierung in London ab. Gleichzeitig begann Stalin, dessen Armeen nach anfänglichen Niederlagen immer größere Erfolge im Krieg gegen die Deutschen errangen, seine Nachkriegspläne hinsichtlich Polens zu verwirklichen.
Die Beherrschung Polens betrachtete Stalin als Voraussetzung für seinen Erfolg in Europa, da das Land geografisch zwischen der Sowjetunion und Deutschland lag. Die Macht über Polen könnte Russland eine militärische und politische Kontrolle Berlins und eines großen Teils Deutschlands ermöglichen.
Die immer stärkere militärische Rolle der Sowjetunion nach der Schlacht von Stalingrad im Februar 1943, die politische Gleichgültigkeit der USA und Großbritanniens während der Konferenz von Teheran, vor allem aber in Jalta, wo der Einflussbereich der Siegermächte abgesteckt würde, schließlich Potsdam im Jahre 1945 führten dazu, dass das entsetzlich zerstörte und dezimierte Polen in die Hände der Sowjetunion fiel.
Seit Juli 1944 begann man, in jenen Gebieten des Landes, aus denen sich die Deutschen zurückgezogen hatten, kommunistische Verwaltungen zu errichten, die sich auf die militärische Macht der Sowjetunion stützten. Das polnische Volk, allein gelassen, durch den Krieg geschwächt und durch pseudodemokratische Losungen verunsichert, die der stalinistisch-totalitäre Machtapparat verkündete, unterlag den unabwendbaren historischen Gegebenheiten.
Aus der historischen Perspektive gesehen, bedeutet das keinesfalls, dass die kommunistische Herrschaft in Polen stets ein Vollzugsorgan Russlands gewesen ist und auch bleiben sollte und dass sich das Land eindeutig in der Gewalt der Sowjetunion befand. Die Nachkriegsgeschichte Polens ist weder so einfach noch so eindeutig; die Veränderungen des Systems haben die gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur des Landes so nachhaltig verwandelt, dass die politische Neuorientierung der folgenden Generationen dadurch stark beeinflusst wurde.
Hier ist nicht der Ort, um diesen schwierigen nationalen Entwicklungsprozess zu analysieren. Bestimmte Tatsachen, von denen die Rede ist, bilden lediglich den Hintergrund, vor dem sich das Leben Kazimierz Moczarskis abspielte. Aber es ist unmöglich, sein Schicksal zu begreifen, ohne an jene Tatsache zu erinnern.
III.
Unmittelbar nach der von der Roten Armee kontrollierten Machtübernahme, begann die kommunistische Regierung, den aus Moskau kommenden Direktiven Stalins folgend, einen gnadenlosen Kampf gegen alle nationalen, unabhängigen Kräfte im Lande. Man verfolgte rücksichtslos Soldaten und Offiziere der Heimatarmee, denen es gelungen war, dem Tod von der Hand der Deutschen zu entgehen. Die polnischen Gefängnisse füllten sich mit den besten und tapfersten Kämpfern gegen die NS-Gewalt. Die unglaubliche Perfidie Stalins gab ihm ein Konzept ein, das für Menschen, die in einer normalen, demokratischen Welt aufgewachsen sind, schwer zu begreifen ist. Der Tyrann hielt es für richtig, Menschen, die in den Reihen der Heimatarmee gegen Hitler-Deutschland gekämpft hatten, wie Verbündete der Nazis zu behandeln. Die besten polnischen Patrioten erklärte die offizielle Propaganda plötzlich zu Faschisten und Handlangern der Gestapo. Sie wurden unter der Anklage der Zusammenarbeit mit dem Feind und des Verrats am polnischen Volk vor Gericht gestellt, der unglaublichsten Verbrechen für schuldig befunden und massenweise zum Tode beziehungsweise zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.
Natürlich fanden diese Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Angeklagten hatten kein Recht auf Verteidigung. Unter dem Einfluss furchtbarer körperlicher und seelischer Folterqualen wählten viele den Freitod, andere bekannten sich zu nie begangenen Verbrechen, nur um ihren Leiden ein Ende zu machen. Diese Menschen gingen durch eine Hölle.
Einer von ihnen war Kazimierz Moczarski. Am 18. Januar 1946 war er zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Aufgrund einer im Jahre 1947 in Kraft getretenen Amnestie wurde die Strafe zunächst auf fünf Jahre herabgesetzt. Im Januar 1949 begannen für ihn die »höllischen Verhöre« im Mokotów-Gefängnis zu Warschau. Sie dauerten mehr als zwei Jahre. Da er einen unbeugsamen Charakter besaß, wurde er mit besonderer Grausamkeit gequält. Seine Folterknechte waren unsicher und ratlos angesichts seiner Tapferkeit; das steigerte ihre verbissene Wut umso mehr.
Um ihn noch mehr zu demütigen und ihn moralisch zu zerbrechen, verlegten ihn die Schergen der Geheimpolizei in die Zelle des SS-Generals Jürgen Stroop.
Stroop hatte als einer der brutalsten SS-Führer besondere Berühmtheit erlangt. Auf seinem Gewissen lasteten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er hatte den Aufstand im Warschauer Ghetto, der am 19. April 1943 gegen die gewaltsame Räumung und den Abtransport der mehrere Hunderttausend dort zusammengetriebenen Juden in die KZs und Vernichtungslager ausgebrochen war, auf bestialische Weise liquidieren und Zehntausende von Juden an Ort und Stelle ermorden lassen. Die Amerikaner, die ihn nach dem Krieg gefangen nahmen, hatten ihn den polnischen Behörden ausgeliefert; in Warschau sah er seinem Prozess entgegen und wurde später, am 23. Juli 1951, zum Tode verurteilt und am 6. März 1952 hingerichtet.
In die Zelle dieses Mannes warfen die stalinistischen Folterknechte Kazimierz Moczarski.
So war eine in ihrer Art einmalige Situation entstanden, die an Shakespeares Dramen erinnerte: In der gleichen Zelle lebten neun Monate lang, vom 2. März bis 11. November 1949 zwei Todfeinde; ein SS-General, der Hunderttausende unschuldiger Opfer auf dem Gewissen hatte, und ein Offizier der Untergrundarmee, der fünf Jahre lang mutig gegen die Nazis gekämpft hatte, um sein Land und die elementaren Grundsätze der Menschlichkeit zu verteidigen.
Die brutale Skrupellosigkeit des Stalinismus setzte zwischen beide Männer ein Gleichheitszeichen. Der überführte Mörder Stroop wurde zum Leidensgenossen eines Mannes, der nicht das geringste Verbrechen begangen, sondern stets zu den tapfersten und opferbereitesten Patrioten gehört hatte. Den Stalinisten lag jedoch daran, seine Haltung zu zerstören, ihn zu zerbrechen.
Doch der teuflische Plan misslang. Moczarski überstand auch diese Tortur. Am 18. November 1952 aber wurde er vom Wojewodschaftsgericht zum Tode verurteilt. »Zweieinhalb Jahre wartete ich stündlich auf den Henker«, schreibt Moczarski. In Briefen an das Oberste Gericht schildert er unerschrocken die Vernehmungsmethoden, die 49 Folterarten. Vierzehn Monate bringt er in Einzel- und Dunkelhaft zu.
Im März 1953 starb Stalin, der Stalinismus geriet in eine Krise. Im Oktober wurde Moczarski zu lebenslänglichem Zuchthaus »begnadigt«. Erst zweieinhalb Jahre später wurde ihm das Urteil ausgehändigt, an das er vorher nicht mehr hatte glauben wollen. Stroop wurde hingerichtet.
Im März 1956 enthüllte Chruschtschow auf dem berühmten XX. Parteitag der KPdSU die Verbrechen Stalins. Das »Tauwetter« begann. Moczarskis Anwälte betrieben die Wiederaufnahme des Verfahrens. Moczarski wurde auf freien Fuß gesetzt.
Doch er war überzeugt: Dies durfte nicht das Ende sein. Er verlangte, endlich freigesprochen zu werden und forderte selbstverständliche menschliche Gerechtigkeit. Im Dezember 1956 fand in Warschau ein neuer Prozess statt, der eine öffentliche und offizielle Rehabilitierung zum Ziel hatte. »In diesem Saal bin nicht ich der Angeklagte – ich selbst klage an ...« Das Gericht entschied am 11. Dezember 1956, dass alle voraufgegangenen Urteile im Fall Moczarskis nicht rechtens waren, dass ihre Verhängung auf Grund von falschen Beschuldigungen erfolgte, dass Moczarski während der jahrelangen Haft unmenschlichen Folterungen ausgesetzt worden war, und dass er als ein Opfer stalinistischer Tyrannei zu gelten habe.
Kazimierz Moczarski wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen; in der Urteilsbegründung unterstrich das Gericht, dass seine Flaltung höchsten Respekt und volle Anerkennung verdiene.
IV.
Von 1957 arbeitete Moczarski als Journalist in Warschau; viel Zeit und Energie widmete er den sozialen Problemen, vor allem dem Kampf gegen Alkoholismus. Im Jahre 1971 begann er, die »Gespräche mit dem Henker« niederzuschreiben. Das Manuskript erschien in Fortsetzungen in der Breslauer literarischen Monatszeitschrift »Odra« (Die Oder) und fand sofort lebhafte Beachtung.
Doch zu dieser Zeit war das nachstalinistische »Tauwetter« in den kommunistischen Ländern längst wieder totalitären Tendenzen gewichen, in Polen wuchs abermals die Allmacht der geheimen Polizei. Das Jahr 1956, als die Gerechtigkeit ihren Sieg feierte und die vom Stalinismus Verfolgten endlich freier atmen konnten, gehörte der Vergangenheit an.
V.
Kazimierz Moczarski starb im Herbst 1975. Damals wartete das beim Verlag PIW in Warschau hinterlegte Manuskript der »Gespräche mit dem Henker« auf eine Entscheidung der Behörden.
Freunde des Verstorbenen, die sich zum Teil gar nicht persönlich kannten, taten alles Erdenkliche, um den »Gesprächen mit dem Henker«, diesem einzigartigen historischen Dokument, den Weg zum Leser zu ebnen. Jene Menschen verband die Überzeugung, dass der Tod nicht zum Schlusspunkt für dieses ungewöhnliche Schicksal werden durfte.
Zwei Probleme sind mit dem Buch Moczarskis verknüpft: Das eine betrifft den Inhalt und die Bedeutung des Werkes, das andere wird von der Person des Autors, seiner Haltung, seinem Charakter und seinen Überzeugungen bestimmt.
Dieses Buch beschreibt die dunkelste Lebensphase eines Menschen. Und doch wird es von der ersten bis zur letzten Seite von der Leuchtkraft einer erstaunlichen Persönlichkeit überstrahlt. Für das geschundene, kranke Europa, für die Menschen unserer Tage könnten die »Gespräche mit dem Henker« einen Weg zur Menschlichkeit weisen.
Heinrich Böll spricht in seiner Einleitung zum »Archipel Gulag« von der »göttlichen Bitterkeit Solschenizyns«. Im Falle Moczarskis muss man von der Unantastbarkeit und Tragik eines Menschenschicksals in den Zwängen eines totalitären Machtapparates sprechen.
Der Leser sollte sich dessen bewusst sein, dass das Schicksal von Kazimierz Moczarski in der Mitte unseres Jahrhunderts keinen Ausnahmefall bildet. In Kategorien eines historischen Objektivismus gedacht, war sein Leben sogar recht typisch. Moczarski gehörte zu der Vielzahl von Polen, denen nichts erspart wurde. Die Größe und das Außergewöhnliche dieses Menschen beruhen auf der Haltung, mit der er sein Schicksal annahm, es trug und besiegte.
VI.
Als im September 1939 der Krieg ausbrach, war Moczarski Jurist und Journalist. Wahrscheinlich unterschied er sich damals überhaupt nicht von seinen Mitbürgern, denn in jener Welt, die keine schweren Heimsuchungen kannte, lebte man jahrelang dahin, ohne eine Ahnung von der Existenz der Hölle zu haben.
Sicherlich war Moczarski schon damals ein aufrechter Mann mit klar umrissenen Ansichten. Er gehörte in Warschau zu den Gründern des Demokratischen Klubs, einer seit 1937 bestehenden betont fortschrittlichen, überparteilichen Organisation.
Schon in jenen Jahren stand er den Idealen des Sozialismus nahe, obwohl er niemals ein Marxist wurde. Er hatte überhaupt ein sehr skeptisches Verhältnis zur Theorie und vertraute mehr den praktischen Erfahrungen. Sicherlich besaß er schon vor dem Krieg feste Grundsätze und hasste jegliche Verschwommenheit. Er war unabhängig in seinem Denken, was jedoch damals keine ungewöhnliche Tugend war.
Hier stellt sich die Frage: Was versteht man unter einer moralischen Ordnung? Moczarski musste sein Gewissen in Anfechtungen stählen, von denen ein gegenwärtig im Westen lebender Mensch keine Vorstellung haben kann. Geholfen hat ihm das Festhalten an bestimmten Grundsätzen des Humanismus, seine persönliche Würde und sein ausgeprägtes Ehrgefühl. Irgendwann schrieb ich, wahrscheinlich unter dem Einfluss meiner Freundschaft mit dem Verfasser dieses Buches, dass man »ein Gewissen weder kaufen noch verkaufen, es auch nicht auf den Staat, die Nation, eine Klasse übertragen kann – oder wir hören auf, als Menschen zu existieren«. Diese Formulierung könnte gemischte Gefühle hervorrufen, unter Lesern, die gewohnt sind, mit einem ruhigen, zeitweilig eingeschläferten Gewissen zu leben, weil das Schicksal ihnen große Prüfungen erspart hat. Meine Stimme, wie auch Moczarskis Buch, hat einen fremden und fernen Klang, und man sollte wohl keine andere Reaktion erwarten als ein etwas melancholisches, höfliches und nicht sehr dauerhaftes Mitgefühl, das ein ausgeglichenes Gemüt angesichts einer weit entfernt stattgefundenen Katastrophe überkommt.
Hier aber handelt es sich nicht um ein Unglück, sondern um Heldentum. Wahrscheinlich stellt Heldentum für eine wohlgeordnete westliche Welt eine noch ferner liegende Erfahrung dar als ein Unglück. Denn ein Unglück kann jedem passieren, das ist menschlich. Aber Heldentum?
Kehren wir zum Verfasser dieses Buches zurück.
VII.
Moczarski macht den Septemberkrieg 1939 als Reserveoffizier an vorderster Front mit, und er geht unmittelbar nach der Zerschlagung Polens durch die Kriegsmaschinerie Hitlers in den Untergrund. Er kämpft dort tapfer und unerschrocken. Wegen seines Mutes und seiner Charakterfestigkeit werden ihm besonders schwierige und delikate Aufgaben übertragen: Innerhalb des »Führungsstabes des Zivilen Kampfes«, der von der Vertretung der Exilregierung ins Leben gerufen worden war, um den Widerstand der Bevölkerung zu organisieren und zu leiten, leitet er die Untersuchungen gegen Kollaborateure. Man kann sich vorstellen, wie schwierig diese Tätigkeit war. Unter tiefster Geheimhaltung sammelt er Material, das den Staatlichen Polnischen Gerichten, Teil der konspirativen Verwaltung des Untergrunds, als Grundlage für die Durchführung von Prozessen dient. In Moczarskis Händen ruht das Schicksal vieler Menschen. Er muss Ankläger und Verteidiger zugleich sein, denn die Verdächtigen hatten ja von den gegen sie geführten Untersuchungen keine Ahnung. Er muss diese Menschen unter Wahrung aller Regeln der Konspiration beobachten, Informationen über sie sammeln, die möglichst objektiv sein mussten. Stets ist er sich dessen bewusst, dass dem Verdächtigen das Todesurteil droht, denn so lautete die Strafe für Verrat am eigenen Volk.
Wie viel Selbstdisziplin und Verantwortungsgefühl, welch ein waches Gewissen gehörten dazu, in einer Atmosphäre ständiger Bedrohung sein Leben aufs Spiel zu setzen, um die Wahrheit über Menschen zu erfahren, auf denen nicht nur der Vorwurf der Schande, sondern auch die Anklage der Kollaboration mit Mördern lastete.
VIII.
Fünf Jahre lang, während der gesamten Besatzungszeit, kämpfte Moczarski, seinem Gewissen folgend, für Menschlichkeit, Demokratie und die Unabhängigkeit Polens und setzte Tag für Tag sein Leben aufs Spiel. Während des Warschauer Ghettoaufstandes war er an Sabotageakten beteiligt. Am 1. August 1944, beim Ausbruch des Warschauer Aufstandes der national polnischen Heimatarmee gegen die deutsche Besatzung, stand er in der vordersten Reihe der Barrikaden. Er nahm an den blutigen Kämpfen teil und überlebte. Als der Aufstand nach 63 Tagen von den Einheiten des Generals der Waffen-SS von dem Bach-Zelewski niedergeschlagen worden war, entging er der Gefangennahme und tauchte wieder unter. Die Heimatarmee war zerschlagen, 250000 Menschen waren in den Ruinen der völlig zerstörten Hauptstadt Polens gefallen. Das Land musste sich mit einem keineswegs neuen, nun immer brennender werdenden Problem auseinandersetzen: dem Heranrücken der Roten Armee. Vom anderen Weichselufer hatte sie tatenlos zugesehen, wie die Deutschen Warschau bis auf den letzten Stein zerstörten. Stalin wartete geduldig, bis Hitler alles vernichtet hatte, was im damaligen Polen patriotisch, idealistisch und vom Geist der Unabhängigkeit getragen war. In den ersten Monaten des Jahres 1945 hatten wir die Hölle der Hitlerzeit überstanden; nun erwarteten uns die Schrecken stalinistischer Tyrannei.
Am 11. August 1945 wird Kazimierz Moczarski verhaftet. Fünf Jahre lang war er den Schergen der Gestapo immer wieder entkommen; die Häscher der stalinistischen Polizei fassten ihn mühelos, am helllichten Tag, in einer Warschauer Straße – drei Monate nach der Kapitulation Berlins.
Es stimmt, dass Moczarski für Kommunisten keine besondere Sympathie empfand; er misstraute ihnen und glaubte nicht ihren Beteuerungen, sie wären die Garanten einer wahren Unabhängigkeit Polens. Aber er sah in der sowjetischen Armee lange Zeit einen Verbündeten, er zählte, wie Millionen Polen, auf ihre Hilfe im Kampf gegen Hitler-Deutschland und freute sich über ihre Erfolge an der Ostfront.
Damals, im Jahre 1945, wurden die Russen in Polen mit gemischten Gefühlen empfangen. Sie waren Verbündete, denn ihnen war es zu verdanken, dass Hitler besiegt worden war; aber sie waren auch mitschuldig an der Tragödie Polens, denn gemeinsam mit dem Dritten Reich waren sie im Jahre 1939 an der Teilung des Landes beteiligt gewesen. In den Gebieten Polens, die der Sowjetunion angegliedert wurden, herrschte vom ersten Tag an stalinistischer Terror, Hunderttausende wurden verschleppt, Zehntausende ermordet, wie die polnischen Kriegsgefangenen in Katyn. Tatenlos hatte die Rote Armee dem schrecklichen Sterben Warschaus während des Aufstandes von 1944 zugesehen; und schließlich wurde eine kommunistische polnische Regierung von Stalins Gnaden eingesetzt, die damals von niemandem in Polen als rechtmäßig angesehen wurde; die Bevölkerung hielt der legalen Regierung in London die Treue.
Die Geschichte der polnisch-russischen und der polnisch-sowjetischen Beziehungen ist seit über dreißig Jahren von unbeschreiblichem Betrug, von Verlogenheit und Täuschung geprägt. Nach jahrhundertelanger Feindseligkeit und Ablehnung ist die Wahrheit über diese Zeit die Grundvoraussetzung für eine Versöhnung zwischen Polen und Russen. Hier ist nicht der Ort, um eingehender darüber zu sprechen. Wenn ich dieses Thema in Bezug auf das Jahr 1945 überhaupt angeschnitten habe, so nur, um festzustellen, dass das Schicksal von Kazimierz Moczarski mit der Geschichte der polnischsowjetischen Beziehungen eng verknüpft ist und keineswegs eine Angelegenheit darstellt, die nur die Polen etwas angeht.
IX.
Moczarskis Verhaftung nahm die polnische Geheimpolizei vor, die damals in weit stärkerem Maße als später im Dienst des sowjetischen Geheimdienstes NKWD stand. Diese Feststellung rechtfertigt uns Polen in keiner Weise. Denn es waren Polen, die den polnischen Nationalhelden Kazimierz Moczarski elf Jahre lang physisch und moralisch misshandelten.
Ich hasse jede Art von Nationalismus. Diese Überzeugung bildete die Grundlage meiner Freundschaft mit Moczarski. Im Augenblick, da ich niederschreibe, dass es meine Landsleute waren, die ihn folterten, verdamme ich mein Volk nicht – ich will es aber auch nicht rechtfertigen. Meiner Meinung nach gibt es keine guten oder schlechten, edlen oder gemeinen Völker. Ich stelle lediglich fest, dass es überall auf dieser besten aller Welten Kanaillen gibt. Und ich denke, dass man auch anständige Menschen unter bestimmten Bedingungen dahin bringen kann, dass sie zum Werkzeug des Teufels werden. Denn niemand kommt als Heiliger oder Märtyrer auf die Welt und keinem wurde bereits in der Wiege das Kains-Zeichen des Mörders aufgedrückt. Alles ist eine Frage des Charakters und der historischen Umstände. Das erste Mal wurde ich im Konzentrationslager Sachsenhausen von einem französischen Kapo geschlagen. Der erste Leidensgenosse, der mit mir ein Stück Brot teilte, war ein deutscher Sozialdemokrat aus Köln. Er hieß Osske. Auf ihn komme ich später zurück.
Ich habe einmal geschrieben, dass »die Menschen von Natur aus schwach sind und sie deshalb die Gewalttätigkeit lieben«. Moczarski fand diese Ansicht richtig, und seine Meinung ist für mich maßgebend, denn kaum jemand hat so viel durchgemacht und dabei genügend innere Kraft besessen, um sich nicht der Gewalt zu beugen. Fast elf Jahre im Gefängnis, zweieinhalb davon in der Todeszelle, jeden Augenblick mit dem Erscheinen des Henkers rechnend: unbeugsam um seine persönliche Würde und die Ehre eines polnischen Soldaten kämpfend, überstand Moczarski alle Anfechtungen. Angeklagt und verurteilt wurde er unter dem Vorwurf der Kollaboration mit den Nazis, für Mord an polnischen Widerstandskämpfern, wegen Verrat an seinem Volk und Agententätigkeit für die Gestapo.
Die 49 Folterarten, denen Moczarski während der Untersuchungshaft unterworfen wurde, will ich hier nicht aufzählen. Vielleicht nur so viel, dass Ansengen der Fingernägel, Knüppelschläge bis zur Bewusstlosigkeit und Zerquetschen von Fingern und Zehen zu den Misshandlungen leichteren Grades zählten. Und wenn dieser Mann dreißig Monate auf die Vollstreckung seines Todesurteils wartete, um schließlich zu erfahren, dass die Strafe bereits zwei Jahre zuvor auf dem Gnadenweg in lebenslange Haft umgewandelt worden war, ist nicht dies das wirklich Entsetzliche. Am gespenstischsten war, dass alle, die am Schicksal Moczarskis beteiligt waren, vom Gefängniswärter bis zu den Richtern, genau wussten, dass dieser Mann unschuldig war. Sie wussten, dass Moczarski niemals ein Faschist, Verräter oder Gestapo-Agent, sondern ein mutiger Soldat des Untergrunds gewesen war, der während der Kriegs- und Besatzungszeit gegen die Nazis gekämpft hatte. Aber sie verlangten, dass er sich zu den erfundenen Verbrechen bekennen, die Strafe demütig annehmen und für die nicht begangenen Fehler büßen sollte. Sie verlangten, dass er sich von seiner aufrechten, tapferen Vergangenheit lossagen und sie nach einem Wahnsinnsdiktat mit Schmutz bewerfen sollte. Sie forderten, dass er seine Helfer nenne, jene »Faschisten, Verräter und Gestapo-Agenten«, die in Wirklichkeit Soldaten des polnischen Untergrunds gewesen waren und unter Einsatz ihres Lebens gegen den Feind gekämpft hatten. Sie wollten Moczarski dazu zwingen, sich selbst zu verleugnen, das Gute als etwas Böses zu bezeichnen, die Tugend als Verbrechen, die Heimatliebe als Verrat und den Mut als Niedertracht; sie verlangten, dass er den Teufel anbete. Aber sie wussten nicht, dass ihnen ein Mensch gegenüberstand, der bereit war, den schrecklichsten Tod zu sterben, aber unfähig war, gegen sein Gewissen zu handeln.
So besiegte er sie Tag für Tag, durch elf Jahre des Leidens und der Qual. Sie schrieben auf seine Stirn das Wort »Gestapo« und ließen ihn mit zwei Naziverbrechern in einer Zelle leben, erpressten ihn mit der Androhung schrecklichster Strafen, die seine Angehörigen treffen würden. Er brach nicht zusammen.
Moczarski sagte oft, dass Hitler im Grunde geradliniger gewesen sei als Stalin. Hitler war eine Kreatur von primitivem Hass. Während er Juden ermorden ließ, verkündete er, es handele sich um Läuse. Er erklärte, dass Slawen lediglich ein Sklavenstamm seien und behandelte sie entsprechend. Er tötete und erwartete nicht, dass man ihn liebte, ihm Recht gab, ihn menschlich und gerecht fand. Stalin dagegen ließ töten und verlangte von seinen Opfern Liebe und blinde Ergebenheit sowie die Bestätigung, dass er der größte Freund der Menschheit sei ...
X.
Ein Kritiker schrieb nach der Lektüre des Buches »Gespräche mit dem Henker«, ein »Treppenwitz der Geschichte« hätte bewirkt, dass Moczarski neun Monate gemeinsam mit Stroop, dem Henker von Warschau, in einer Zelle verbringen musste.
Hier geht es um keinen Witz, sondern um ein Verbrechen. Und nicht die Geschichte war schuld, denn weder Kanaillen noch Schergen schreiben die Geschichte eines Volkes. Die wirkliche Geschichte Polens schrieben mit ihrem Leben Kazimierz Moczarski und andere, die ihm ähnlich waren. Von Moczarski wird man eines Tages in den Schulbüchern lesen, er wird zu jenen gehören, denen Polen sein Selbstbewusstsein und seine geistige Unabhängigkeit verdankt, die generationenlang brutal vergewaltigt wurden und trotzdem im Gedächtnis der Menschen lebendig geblieben sind.
An die Namen derer, die Moczarski misshandelt haben, erinnert sich heute niemand mehr – sie verstauben in den Polizeiakten. Aber nicht nur sie tragen die Verantwortung für alles, was Moczarski angetan wurde.
Das Schicksal dieses Mannes beweist, dass es zwischen totalen Regimen keinen Unterschied gibt. Die Bedeutung des Buches »Gespräche mit dem Henker« beruht auf der Vielschichtigkeit der Themen und der Eindeutigkeit der moralischen Urteile, die es enthält.
In einer gemeinsamen Zelle, die sie mit einem Namenlosen namens Schielke teilen, fristen zwei Verurteilte ihr armseliges Dasein. Der eine ist ein Naziverbrecher, ein Mörder von Hunderttausenden unschuldiger Opfer, das Gestalt gewordene Beispiel für eine faschistische Einstellung zum Leben. Der andere ist das Opfer jener Henker und Mörder, die unbeeindruckt durch die Gefängnisgänge von Mokotów schlendern, von einer nur geringfügig andersgearteten Ideologie geprägt. Der SS-General Stroop steht beispielhaft für eine Mentalität, die im Dienst des Nazi-Terrors gezüchtet wurde, Moczarski wird von Handlangern des stalinistischen Terrors misshandelt. Doch Merkmale einer bestimmten Ideologie spielen hier keine Rolle – es zeigt sich nämlich, dass sowohl Methoden als auch Denkungsweisen einander stark ähneln.
Moczarski wiederholte mir gegenüber häufig, seine Gespräche mit Stroop seien nicht nur ein Versuch gewesen, dem furchtbaren Gefängnisdasein zu entfliehen. Sie dienten auch dem Erkennen der Realität, in der er sich befand. Während er die tiefsten Seelenregungen Stroops kennenlernte, versuchte er mittelbar, mehr über seine eigenen Peiniger zu erfahren. Und es gelang!
Der vermeintliche »Treppenwitz der Geschichte«, der schreckliche Zynismus wurde wohl eher zur göttlichen Rache der Wahrheit an der Verlogenheit, der Tugend an der Sünde, des Rechts am Verbrechen: Denn alles, was in der Vorstellung seiner Peiniger Moczarski entehren und vernichten sollte, erwies sich dank seines ungebrochenen Geistes als ein großer Enthüllungsprozess.
Moczarski war nicht in der Lage, die unmenschliche Denkweise der Männer, die ihn folterten, völlig zu erfassen. Kehrte er jedoch von den Verhören in die Zelle zurück, lagen wochen- und monatelange Gespräche mit einem Vertreter der gleichen Denkungsart vor ihm. Stroop erwies sich als das »Alter Ego« jener namenlosen, in undurchsichtiger Anonymität verharrenden Funktionäre und Handlanger der stalinistischen Diktatur, die manchmal in den Büchern Solschenizyns auftauchen. Denn sie unterschieden sich in nichts voneinander ...
Man könnte einwenden, dass es viele solcher Gestalten in unserer modernen Literatur gibt. Diese Ansicht ist falsch. Denn noch niemand hat sich je in einer ähnlichen Lage befunden. Sie schuf dieses in der Geschichte des Schrifttums wohl einmalige Buch.
Jene zwei Männer haben in der Zelle nicht nur miteinander geredet. Beide hofften auf Leben. Aber beide fürchteten, wussten, dass sie bald sterben würden. Jedes Wort von Stroop wurde zugleich zu einer Art Beichte, abgelegt von einem Mann, dem nur gelegentlich Ahnungen, Eingeständnisse von Schuld kamen, der aber eben darum sein Inneres offenlegte, so bedingungslos wie noch nie in seinem Leben. Das Bewusstsein, einem gemeinsamen Schicksal ausgeliefert zu sein, verstärkte die Offenheit seiner Bekenntnisse.
Der Zufall wollte es, dass Moczarski dem Tod durch den Strang entging. Hätte Stalin noch ein wenig länger gelebt, hätte sich nicht der Teufel im März 1953 seiner erinnert – dieses Buch wäre nie geschrieben worden.
Moczarski empfand für den SS-General keinerlei Sympathie. Für die ältere Generation unter uns, die die Kriegszeiten noch lebhaft in Erinnerung hat, klingt das selbstverständlich, alles andere schiene absurd, unbegreiflich.
Und doch ist alles nicht so einfach. 255 Tage und Nächte verbrachte Moczarski mit diesem Mann in einer Zelle, während beide mit dem Tod rechnen mussten. Wer so etwas nicht mitgemacht hat, weiß nichts von der gefühlsmäßigen Spannung einer solchen Situation.
XI.
Als die Zeitschrift »Odra« die »Gespräche mit dem Henker« veröffentlichte, wurde Moczarski von vielen gefragt, wie es möglich sei, dass er nach fast 25 Jahren die Gespräche so genau wiedergeben könne? Viele unterstellten dem Verfasser eine Neigung zum Fantasieren, zu unangemessener Rekonstruktion. Dieser Verdacht ist im Licht der Einzelheiten, die mir Moczarski erzählte, völlig unbegründet. Der Autor übertrug mir die moralische Pflicht, diese Frage richtigzustellen. Denn er selbst war nicht fähig, entsprechende Erklärungen abzugeben, was wohl nicht verwunderlich ist.
Moczarski unterstrich häufig, dass er zu jener Zeit kein gewöhnlicher Mensch gewesen sei. »Vielleicht war ich eher ein Tier«, meinte er. Ich bin da anderer Ansicht: Er war damals ein Stück über das gewöhnliche Menschsein hinausgewachsen.
Ein Mensch, der jahrelang auf seinen Tod wartet, lebt in anderen Dimensionen von Zeit und Raum. Um zu überleben und in seiner Dimension existieren zu können, schafft sich ein Eingeschlossener und Verurteilter eine andere Wirklichkeit. Wir kennen Ähnliches aus den Erzählungen vieler Häftlinge. Damit aber diese neue Wirklichkeit unabhängig von den Realitäten funktionieren konnte, bedurfte es einer großen inneren Stärke, über die sich der Gefangene wahrscheinlich überhaupt keine Rechenschaft gab.
Moczarski erkannte die sich der Zelle nähernden Aufseher an ihrem Geruch. Er hörte das Flüstern der Vernehmungsoffiziere, die sich bei geschlossenen Türen in einem Nebenzimmer unterhielten. Während seiner Berufungsverhandlung setzte er die Anwesenden in Erstaunen, als er auswendig Auszüge aus Akten zitierte, die fast tausend Seiten umfassten und die er nur einige Stunden im Gefängnis einsehen durfte. Er hatte sich viele, in die Hundert gehende Seiten eingeprägt. Natürlich büßte er in den folgenden Jahren diese erschreckende Begabung ein; seine Sinne, die nun nicht mehr einer Bewährung auf Leben und Tod ausgesetzt waren, kehrten zu ihrer normalen Trägheit zurück. In den »Gesprächen mit dem Henker« hat er nichts erfunden. Jedes Wort von Stroop, jede seiner Gesten, jeden Blick trug er behutsam in sich wie einen Schatz. Und auch das nach der Erinnerung Rekonstruierte, auch das später Verifizierte ist und hat die historische Wahrhaftigkeit des zuverlässigen Zeugen, der um objektive Wiedergabe bemüht ist.
Eines Tages sagte er mir ein wenig betroffen: »In mir steckt wohl irgendeine Krankheit. Jeden Satz von Stroop höre ich so deutlich, sogar die Betonung, als würde ich das alles vom Tonband abschreiben. Und ich sehe ihn vor mir, jede seiner Bewegungen, seinen Ausdruck, das Verziehen der Lippen, wie auf einer Filmleinwand ...«Ich glaubte ihm. Und ich bitte den Leser, ihm ebenfalls zu glauben. Dabei ist sein Buch weder eine historische Monografie noch ein Tatsachenroman. Es ist keine archivalische Dokumentation, sondern Dokument, historisch wahrhaftig auch dort, wo es in Details irrt und dort wo es Irrtümer der »handelnden Personen« wiedergibt oder wo sich im Nachhinein Perspektiven des Erlebten mit dem »Verarbeiteten« verbinden.
XII.
Mein deutscher Freund aus Sachsenhausen, der bereits erwähnte Osske, wiederholte häufig während unserer heimlichen Gespräche auf der Lagerlatrine, dass er mich um meine moralische Sicherheit und Unbefangenheit beneide. Denn ich sei ein Pole, der unter den Deutschen zu leiden habe, während seine eigenen Qualen um vieles größer seien – einmal als KZ-Häftling, zum anderen wegen der erniedrigenden Erfahrung, dass die Deutschen so tief gefallen waren. Er litt, weil seine Landsleute auf so furchtbare Weise die Ideale des Humanismus verraten hatten. Das Gebrüll und jeder Faustschlag eines SS-Mannes demütigten Osske als Deutschen und beleidigten sein Nationalbewusstsein. Damals, im Jahre 1945, war ich überzeugt, dass er Recht hatte, und Osske tat mir leid. Heute entdecke ich in seiner Haltung etwas Zweideutiges, das zwar durch die ehrliche Absicht moralisch gerechtfertigt, aber schwer zu akzeptieren war. Dieser kluge Mann dachte in Schablonen, die mir inzwischen fremd geworden sind. In Osske steckte trotz allem das Gefühl einer gewissen Gemeinsamkeit mit diesen Männern in SS-Uniform, die ihn jahrelang in den Gefängnissen und KZ-Lagern des Dritten Reiches misshandelt hatten. Osske fühlte sich als Deutscher, und dieses Deutschtum verband ihn auf eine verhängnisvolle Weise mit den Nazis.
Ich empfinde keinerlei Solidarität mit einem Schweinehund, nur weil er polnisch spricht, einen polnischen Namen trägt und sich für einen Polen hält. Ein anständiger Deutscher, Russe oder Engländer steht mir näher als ein Lump, der nur deshalb mein Bruder sein soll, weil er in meinem Land geboren wurde und meine Sprache spricht.
Diese Einsicht verdanke ich vor allem meiner Freundschaft mit Moczarski. Probleme, die Osske beschäftigt haben, kannte er nicht. Niemals litt er einzig aus dem Grund, weil es Polen waren, die ihm die größten Leiden zufügten. Er behandelte sie so, wie sie es verdienten, und er hielt sie für Kreaturen, die aus den finstersten Schlupfwinkeln dieser Erde hervorgekrochen waren.
Ein Pole zu sein war für ihn nicht gleichbedeutend mit Muttersprache, und schon gar nicht mit nationalistischem Phrasendreschen. Unter Polentum verstand er die Kulturtradition seines Volkes, das so viel gelitten hatte, um seine Eigenständigkeit zu bewahren.
XIII.
In jenem Frühling 1956, als Moczarski nach fast elf Jahren das Gefängnis verließ und über Osteuropa der milde Hauch des nachstalinistischen »Tauwetters« wehte, hatte der Rechenschaftsbericht Chruschtschows eine Lawine von Ereignissen in Bewegung gesetzt. Polen reckte vorsichtig seine schmerzenden Glieder, die Menschen lösten sich allmählich aus den Fesseln der Angst, die Presse schrieb vom Unrechtsregime der vergangenen Jahre. Sogar zu jener Zeit war es kein leichtes Unterfangen, als die Warschauer Rechtsanwälte Władysław Winawer und Frau Aniela Steinsberg, zwei mutige und hochanständige Menschen, den Kampf um die Rehabilitierung Kazimierz Moczarskis aufnahmen.
Aber die öffentliche Meinung erhob, zaghaft zuerst, dann immer lauter, ihre Stimme im Namen der jahrelang unterdrückten Gerechtigkeit. Tausende von Verschleppten kehrten aus den Lagern im Norden der Sowjetunion zurück, wurden aus den polnischen Gefängnissen freigelassen. Der berühmte »Oktober 1956« rückte näher, der die bisherige politische Führung stürzen und Władysław Gomułka an die Spitze der Macht bringen sollte. Aber auch dieser Mann erwies sich mit der Zeit als Enttäuschung, als eine neuerliche Fälschung im Namen des Totalitarismus.
Als im Dezember 1956 vor dem Wojewodschaftsgericht in Warschau der Rehabilitierungsprozess von Kazimierz Moczarski stattfand, war es die einzige öffentliche Gerichtsverhandlung, die in Polen gegen den Stalinismus geführt wurde. Wenn ich nicht irre, war es der einzige Prozess überhaupt, in dem der Stalinismus angeklagt worden ist.
Moczarski trat vor seine Richter als freier Mann, als ein Bürger, der seine vollständige Rehabilitierung fordert. Denn er war unter der fiktiven Anklage des Landesverrats und der Zusammenarbeit mit den Nazis verurteilt worden. Jetzt verlangte er einfach Gerechtigkeit.
Sie wurde ihm zumindest im moralischen Sinne zuteil: Seine langen Gefängnisjahre und die Torturen konnte niemand mehr wiedergutmachen ...
In der Begründung des Urteils vom 11. Dezember 1956 erklärte das Wojewodschaftsgericht der Volksrepublik Polen unter anderem:
»Das Wojewodschaftsgerichts erachtet es als seine Pflicht zu erklären, dass das nach neuerlicher Beweisaufnahme durchgefiihrte Berufungsverfahren im vorliegenden Fall nicht nur die Grundlosigkeit, Künstlichkeit und tendenziöse Ausrichtung der Anklage erwiesen hat, was bereits der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft der Volksrepublik Polen zum Ausdruck brachte, als er die Anklage fallen ließ; das Verfahren bewies außerdem, dass die Ehre und der Name der polnischen Untergrundarmee, die sich in ihrer überwältigenden Mehrheit auf keine Zusammenarbeit mit dem Feind eingelassen hatte und die Kazimierz Moczarski sowohl während seiner Tätigkeit in der Widerstandsbewegung als auch während der langjährigen Haftzeit mit achtunggebietender Hartnäckigkeit und Tapferkeit verteidigt hatte, während dieser Verhandlung voll wiederhergestellt worden sind.«
XIV.
Dieses Zitat aus dem im Namen der Volksrepublik Polen ergangenen Urteils wurde im Jahre 1972 von der staatlichen polnischen Zensur gestrichen. Ich hatte es in mein Vorwort zu Moczarskis Buch aufgenommen, das damals in der Zeitschrift »Odra« abgedruckt wurde.
So war im Jahre 1972 der politische Zensor in Polen wieder mächtiger als der unabhängige Richter, der im Namen des Volkes sein Urteil gesprochen hatte.
Jemand, der den Mechanismus des Systems nicht kennt, könnte fragen: Was bedeutet schon das Streichen einiger gedruckter Sätze im Vergleich zu den während der stalinistischen Zeit üblich gewesenen Todeszellen und Misshandlungen, dem Brechen von Knochen und Charakteren? Wir leben doch jetzt in einer ganz anderen Zeit, der Fortschritt ist so gewaltig, dass es kaum noch lohnt, sich mit Lappalien aufzuhalten ...
Kein vernünftiger Mensch bestreitet, dass die Veränderungen wirklich tiefgreifend sind. Schließlich lebte Moczarski nach 1956 viele Jahre ruhig und ohne materielle Sorgen, er konnte seine »Gespräche mit dem Henker« niederschreiben und drucken lassen, bis das Werk – leider erst nach seinem Tod – in Buchform erschien und den Lesern zugänglich gemacht wurde.
Wir leben also in Frieden und Sicherheit, in einer blühenden, heilen Welt, in der alle zufrieden sein sollen.
Wehe dem, der auch nur einen Hauch von Unzufriedenheit zu äußern wagt! Es stimmt, politische Urteile zählen heute zu Ausnahmen, die breit diskutiert werden und lebhafte Proteste hervorrufen. Etwas anderes gilt für eine auch nur vorübergehende Verhaftung, für Hausdurchsuchungen, die Beschlagnahme von Büchern, Manuskripten und von privater Korrespondenz. Oder auch für eine Entlassung oder ein Berufsverbot und behördliche Schikanen. Auch verleumderische Presseangriffe, auf die man nicht antworten kann, weil außer der staatlich kontrollierten keine andere Presse existiert. Es stimmt, im Vergleich zu den alten Methoden gibt es einen gewaltigen Fortschritt. In der Zeit des Stalinismus – hätte er länger gedauert – wäre Moczarski hingerichtet und seine Asche, wie die irgendeines Stroop, in alle Winde verstreut worden. Auch ich wäre wohl kaum noch am Leben, bestenfalls würde ich irgendwo dahinvegetieren.
Wir müssen Gott demütig danken, dass er seine Geschöpfe in die Ewigkeit abruft, auch wenn Er es manchmal sehr spät tut! Ich nehme an, Gott verspürte im Fall Stalins und Hitlers einen solchen Abscheu, dass er die Entscheidung so lange hinausschob, um beide nicht aus der Nähe betrachten zu müssen. Wir haben dafür einen gesalzenen Preis bezahlt ...
Doch zurück zum Thema. Zweifellos hat sich vieles verändert. Das verdanken wir vor allem der Zivilcourage von Hunderttausenden, denen ihre eigene Würde und ihre Freiheitsliebe mehr bedeuteten als Opportunismus oder unterwürfige Nachgiebigkeit. Wir verdanken es auch den Veränderungen in unserer Zivilisation, die in einem bestimmten Entwicklungsstadium der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens, der Selbstherrlichkeit staatlicher Behörden Einhalt gebieten.
Und doch ist bei weitem nicht alles ideal in dieser besten aller Welten! Schon hundert Jahre vor Hitler schrieb Heinrich Heine ahnungsvoll, dass »dort, wo Bücher verbrannt werden, man bald auch Menschen verbrennen wird«. Man kann nur eines hinzufügen: Dort, wo die Mächtigen das Recht mit Füßen treten, wo sie sich für das Maß aller Dinge halten und Urteile der eigenen Gerichte missachten, wo Scheinheiligkeit gleich Verlogenheit ist und Falschheit für Ehrlichkeit steht, wo der Staat den Bürger demütigen darf und dieser Bürger keinen Schutz vor der Selbstherrlichkeit des Apparats findet, wo selbstständiges Denken oft als Ausdruck der Feindseligkeit gegenüber dem System gilt und der Einzelne je nach dem Grad seiner Unterwürfigkeit gegenüber der gerade regierenden Gruppe eingestuft wird – dort kann es jederzeit zu Rechtlosigkeit und zu anderen Ausschreitungen eines totalitären Machtapparats kommen.
Bitte lesen sie aufmerksam die Worte Jürgen Stroops, dieses typischen Falls eines vom totalitären Denken beherrschten Geistes. Lesen Sie die »Gespräche mit dem Henker« und vergegenwärtigen Sie sich das Schicksal Kazimierz Moczarskis, eines Mannes, der sich nie aufgab, der bereit war zu sterben, um andere vor einem schmachvollen Dasein unter einem totalitären Regime zu bewahren.
I. Kapitel
Auge in Auge mit Stroop
2. März 1949. Abteilung XI des Warschauer Gefängnisses Mokotów. Eben brachte man mich in eine Zelle, in der schon zwei Männer sitzen. Kaum ist die Tür verriegelt, beginnen wir uns, wie bei Häftlingen üblich, vorsichtig zu »beriechen«. Innerhalb der Zellenordnung sind mir die beiden im Augenblick überlegen, denn ich wurde zu ihnen in ihre Zelle verlegt. Ich habe zwar gewisse Möglichkeiten: Um eine schützende Distanz zu schaffen, könnte ich »Salzsäule« oder »Mann vom Mond« spielen. Die beiden Männer wären nicht in der Lage, sich ähnlich zu verhalten, denn sie bilden eine wechselseitige Gemeinschaft.
»Sind Sie Pole?«, fragt der Ältere, mittelgroß, schlank, mit blau geäderten Händen, einem Kartoffelbauch und großen Zahnlücken. Er trägt eine feldgraue Jacke, Drillichhosen und Holzpantinen, das Hemd ist auf der Brust weit geöffnet.
»Ja. Und Sie? «
»Deutsche. Sogenannte Kriegsverbrecher.«
Ich richte mich notdürftig ein, stopfe meine wenigen Habseligkeiten in einen Winkel. Der Ältere hilft mir, ohne dass ich ihn dazu auffordere. Es herrscht angespanntes Schweigen. Also Deutsche, denke ich. Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich auf engstem Raum mit ihnen zusammen sein. An solche Nazis erinnere ich mich noch aus der Besatzungszeit so deutlich, als wäre es gestern gewesen. Eine schwierige Situation, aber in Mokotów wurden Gefangene häufig ohne Rücksicht auf ihre Nationalität in eine Zelle gesperrt. Von ihnen trennen mich Welten – die Last der Vergangenheit ebenso wie die Weltanschauung. Uns verbindet nur das Dasein als Zellengenossen. Kann das allein einen Abgrund überbrücken?
Meine chaotischen Gedankensprünge werden jäh unterbrochen, denn die Gewohnheit, stets auf der Hut zu sein, signalisiert mir: Warum drückt sich der andere Nazi so schweigsam in die Fensterecke? Ist er gefährlich, oder hat er Angst?
Beim Unterbringen meiner Sachen hilft mir Gustav Schielke1 aus Hannover, viele Jahre kleiner Beamter bei der Sittenpolizei. Während des Krieges SS-Untersturmfuhrer, Archivar beim Befehlshaber der Sipo und SD in Krakau, das heißt beim Führer der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Generalgouvernement.
»Schon verurteilt?«, frage ich ihn.
»Nein.«
»Lange im Knast?«
»In Polen 1 Jahr, 9 Monate, 27 Tage. Davor saß ich bei den Alliierten in Westdeutschland.«
Er zählt noch die Tage, malt wahrscheinlich Striche an die Zellenwand und hofft, später einmal seinen Enkeln vom polnischen Gefängnis erzählen zu können – denke ich.
Der andere, der mich etwas beunruhigt, ist hochgewachsen und wirkt auf den ersten Blick breitschultrig. Er steht mit dem Rücken zum Licht und verdeckt einen Teil des Fensters. Es ist schwierig, ihn zu beobachten. Ich kenne diese Methoden. Typischer Untersuchungsgefangenen-Komplex, aber er verhält sich richtig, stelle ich fest.
»Stroop«, stellt er sich endlich vor. »Mein Name ist Stroop, mit zwei ›oo‹. Vorname: Jürgen. Ich bin Generalleutnant oder divisiongénéral ... Enchanté, monsieur.« Er ist erregt, seine Ohren sind gerötet. Ich bin es wohl auch. Das Erscheinen eines unbekannten Häftlings und eine fremde Zelle können schon aufregend sein.
Kaum hatte ich meinen Namen genannt, als ein Kessel mit dem Mittagessen hineingeschoben wird. Essengeruch breitet sich aus. Die Kalfaktoren2, ebenfalls Deutsche, geben meinen Zellengenossen durch Zeichen zu verstehen, dass ich kein Spitzel bin. Sie kennen mich längst aus verschiedenen Begegnungen hier in Mokotów.
Stroop bekommt immer eine doppelte Portion zugeteilt. Er isst systematisch, mit Appetit. Das Essen verläuft schweigend. Ich bemühe mich, ganz entspannt zu kauen, um meine neuen Zellennachbarn nicht merken zu lassen, wie aufgewühlt ich bin.
Das also ist Stroop, der Vertraute Himmlers, SS- und Polizeiführer, Vorgänger des von uns hingerichteten Kutschera3, der Mann, der das Warschauer Ghetto liquidieren ließ? Er sitzt neben mir und verzehrt sein Mittagessen. Stroop ist etwa Mitte fünfzig. Auffallend sorgfältig gekleidet. Dunkelrote Windjacke, weißes Halstuch, kunstvoll unterm Kinn geknotet. Helle Hose. Dunkelbraune, leicht abgetragene, aber auf Hochglanz polierte Schuhe.
Schielke schaufelt das Essen in sich hinein. Er ist rasch fertig, summt vor sich hin: »In Hannover an der Leine haben Mädchen dicke Beine« und fragt wie nebenbei: »Sitzen Sie schon lange?« Ich antworte. Daraufhin schlägt er vor, mein Essgeschirr zu spülen. Ich muss sein Anerbieten ablehnen, denn diesen Gefallen nimmt man nur der Not gehorchend oder aus Freundschaft an. Stroop aß immer noch. Schließlich reichte er Schielke zwei Schüsseln zum Abwaschen. Dann lockerte er seine Hose und schloss sie mit einem Reserveknopf, den er sich »für alle Fälle«, je nach Bauchumfang, angenäht hatte.
Schielke säubert das Geschirr. Stroop sitzt, auf die Ellenbogen gestützt, das Gesicht in den Händen vergraben, am Fenstertisch. Zwischen den Fingern ragt seine fleischige Nase hervor. Die Haltung eines schmerzgebeugten Weisen.
Seine Denkerpose begann mich zu interessieren. Sie passte zu den Fotos und dem »Altar«, den sich Stroop auf dem Tischchen aufgebaut hat. Neben der Bibel lagen ein Päckchen Briefe aus der Bundesrepublik, einige Bücher, ein Heft, Bleistifte. Was mich am meisten verblüffte, war ein dreiteiliger Fotorahmen mit Aufnahmen von Stroops Familienangehörigen. Unter jedem Bild stand sorgfältig in gotischer Schrift: »unsere Mutter«, »unsere Tochter«, »unser Sohn« und »meine Frau«. In den Ecken des »Altars« kleine Andenken: die zarte Feder einer Blauracke und ein kleines, vertrocknetes Birkenblatt.
Stroops Nachdenklichkeit wirkt melancholisch, und ich frage ihn, worüber er sinniert. Ich nahm an, er würde antworten: »Das ist meine Privatangelegenheit«, was bedeutet hätte, dass er an seine Familie denkt und nicht gestört werden will. Aber Stroop entgegnete: »Ich habe vergessen, wie ein kleiner Vogel auf Polnisch heißt, mit dessen Namen man bei euch junge Frauen bezeichnet. Irgendwas mit schi ... schi ... schibka oder so ähnlich.«
»Wo haben Sie dieses Wort gehört?«
»Während eines Rundgangs, als Häftlinge aus den allgemeinen Untersuchungszellen eine weibliche Gefangene mit einem tollen Busen ansprachen, die in der Wäscherei arbeitet. Ich kann mir dieses Wort nicht merken, obwohl ich es jeden Tag wiederhole. Es klingt wie ›schibka, schtschirka‹ ...«
»Vielleicht riefen sie ›ścierka‹? Das ist aber kein Vogel.«
»Es war ganz sicher ein Vogel. Und bestimmt nicht ›schtscherka‹.«
»Da Sie auf einem Vogel bestehen, war es vielleicht ›sikorka‹?«
»Ja«, strahlte er auf, »schykorka, schykorka, die Meise. Dieses junge Ding aus der Wäscherei verdrehte den Hals wie eine Meise.«
»Wenn der General sich gestärkt hat«, röhrte Gustav Schielke, »wird er ganz geil nach so jungen Dingern. Die Zeiten sind vorbei, Herr General! Und außerdem, solange ich lebe, habe ich noch keine Meise mit Brüsten gesehen.«
Der General maß Schielke mit einem strengen Blick. Zum ersten Mal sah ich Stahl in den Augen Stroops aufblitzen.
In der Zelle befand sich ein einziges Bett, das tagsüber hochgeklappt und an der Wand festgemacht wurde (im Gefängnisjargon »Liegematte« genannt). Bisher hatte Stroop darauf geschlafen, während Schielke seinen Strohsack auf dem Boden ausbreitete. Gegen Abend mussten wir eine neue Schlafordnung aufstellen. Stroop wandte sich an mich: »Ich lege mich auf den Boden. Das Bett steht Ihnen zu, da Sie Angehöriger des hier herrschenden, also siegreichen Herrenvolkes sind.« Ich erstarrte. Stroop spielte keine Komödie, das war weder Höflichkeit noch Pose. Er hatte einfach seine Ansicht über die Art zwischenmenschlicher Beziehungen kundgetan. Die ihm seit Kindesbeinen eingetrichterten Eigenschaften, Anbetung der Macht und Unterwürfigkeit – das unvermeidliche Produkt blinden Gehorsams waren zum Vorschein gekommen.
Schielke pflichtete Stroop bei. Ich begründete meine Ablehnung mit der banalen Feststellung, dass während ihres Häftlingsdaseins alle Gefangenen gleich seien. Und bis zum letzten Tag meines Zellendaseins mit Stroop und Schielke schliefen wir alle drei auf dem Boden.
Kurz nach dem Meisen-Zusammenstoß mit Schielke bot mir Stroop an, seine Bücher durchzublättern. Er hatte mindestens 180 in der Zelle, die meisten aus der Gefängnisbibliothek. Alle in deutscher Sprache. Es waren wissenschaftliche Abhandlungen darunter, historische, geografische, ökonomische Werke, Schulbücher, Romane, Broschüren und sogar Propagandaschriften der NSDAP. Gierig griff ich nach allen Büchern – ein normaler Vorgang in einem Gefängnis. Anfangs blätterte ich die Texte, Abbildungen und Landkarten nur durch. Später las ich mich fest. Wir begannen zu diskutieren. Ich fraß Informationen über Deutschland in mich hinein und Kommentare der beiden Nazis zu verschiedenen, für einen Polen unverständlichen Vorgängen. Dabei vertiefte ich meine deutschen Sprachkenntnisse, lauschte den Berichten, Analysen und Meinungen und – was unvermeidlich war – mitunter auch persönlichsten Bekenntnissen.
Ich verfolgte aufmerksam die Erzählungen über deutsche Städte und Dörfer, über Berge, Täler und Wälder und erfuhr mehr über das Leben in den Städten und in einzelnen Familien. Ich nahm den Geruch der Küchen und Korridore wahr, der Esszimmer und Salons, der Kneipen und Gärten, der Feldschlachten und des Heimwehs. Ich, der ehemalige Soldat der polnischen Landesarmee4,5, begleitete Schritt für Schritt das Leben des Nationalsozialisten Stroop, folgte ihm und war gleichzeitig sein Gegner und sein Feind.
Jürgen Stroop. Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. Ehemaliger Angehöriger des Preußisch-Detmold’schen Infanterie-Regiments. Mitbegründer der NSDAP im früheren Fürstentum Lippe. Im Gebrüll der Hitler umjubelnden Massen marschierte er durch die Straßen Nürnbergs. Mit tatkräftiger Unterstützung der SS klettert er, trotz einer mittelmäßigen Ausbildung, die Ämterleiter hinauf. Er ist in Münster und Hamburg tätig, regiert mit harter Faust, brutal und oft mörderisch – in der Tschechoslowakei, in Polen, in der Ukraine und im Kaukasus, in Griechenland, im westlichen Deutschland, in Frankreich und in Luxemburg. Er liebt seine Gattin und auch andere Frauen, aber nur seine eigenen Kinder, spricht mit Politikern des Dritten Reiches, mit Himmler und den Spitzen der SS. Seine Autos heißen »Horch« und »Maybach«. Er reitet über die Felder des Teutoburger Waldes und der Ukraine, trägt ein Monokel und sonnt sich in der Würde eines Nazi-Generals. Und nie wird er von Hitler oder Himmler anders sprechen als von »Adolf Hitler« und »Heinrich Himmler«; immer nennt er ihre Vornamen, womit er seine Treue und Ergebenheit gegenüber diesen »großen deutschen Gestalten des zwanzigsten Jahrhunderts« zum Ausdruck bringt. Ich folgte Stroop auch ins Warschauer Ghetto, obwohl es mir manchmal schwerfiel, seinen Berichten über die »Großaktion« in jenen April-Tagen zuzuhören. Denn ich spürte noch den Brandgeruch meiner im Jahre 1943 bezwungenen und zerstörten Stadt.
Und ich begleitete ihn auch während des Fememordes an Generalfeldmarschall von Kluge im Jahre 1944 und war bei der Liquidierung der in Kriegsgefangenschaft geratenen amerikanischen Flieger im westlichen Rheinland dabei.
Wir sprachen über viele Dinge, vor allem in den letzten Wochen unseres gemeinsamen Zellenaufenthaltes. Stroop war kein Schwätzer, aber er neigte dazu, viel von sich zu reden und sich selbst zu loben. Es waren die typischen Gewohnheiten eines Amtsträgers, die sich da bemerkbar machten. Er genoss es, ein Publikum zu haben. Jetzt waren Schielke und ich seine einzigen Zuhörer. Dieser Umstand erlaubte es mir, viele glaubwürdige, wenn auch nur mündlich weitergegebene Einzelheiten zu erfahren.
Stroop beschrieb sein Leben nicht chronologisch. Manchmal diskutierten wir stundenlang über ein einziges Problem. Ein andermal sprangen wir von Thema zu Thema. Ich bemühte mich, aus all diesen Gesprächen ein möglichst systematisch gegliedertes Buch zusammenzustellen. Gustav Schielke beurteilte manche Tatsachen und Ereignisse anders als Stroop. Er war psychisch geradliniger. In ihm waren noch Reste eines sozialdemokratischen Bewusstseins lebendig, Erinnerungen an die Bindung an Gewerkschafts- und Arbeiterkreise in seiner Jugend. Die von Schielke meist spontan, kaum bewusst geäußerten Überzeugungen bildeten einen Gegensatz zu Stroops Einseitigkeit. Sie waren auch eine Art Kontrollorgan und eine Ergänzung der Bekenntnisse Stroops. Anfangs war unser Verhältnis in der Zelle von Vorsicht und leiser Verwunderung geprägt, die sich aus der Ungewöhnlichkeit der Situation ergaben; später folgte ein diplomatisches Vorgehen und das Reden »zwischen den Zeilen« und schließlich das offene Artikulieren von Meinungen und Informationen.
Waren es ehrliche Gespräche? In den meisten Fallen gewiss, besonders als wir uns schon besser kannten. Angesichts des Unabwendbaren werden die Bekenntnisse von Todgeweihten ehrlich und einfach. Aber es war eine passive Offenheit, die darauf beruhte, alles zu vermeiden, was zufällig zum »Verzinken« des Mitgefangenen führen konnte. Außerdem herrschte in der Zelle das ungeschriebene Gesetz, grundsätzlich alle besonders kritischen Themen zu meiden oder sie zumindest behutsam zu behandeln.
Meinen Lesern gegenüber muss ich betonen, dass ich mich stets um größte Ehrlichkeit bemühte, um dadurch die volle Wahrheit über Stroop und sein Leben zu erfahren. Der Schock des Augenblicks, als ich mich plötzlich den zwei Nazis gegenüberfand, war rasch dem Entschluss gewichen: Wenn ich schon mit Kriegsverbrechern Zusammenleben muss, dann will ich sie genau kennenlernen, will versuchen, ihr Leben und ihre Persönlichkeit bis zur letzten Faser aufzudecken. Sollte mir das gelingen, so wäre ich in der Lage, wenigstens bis zu einem gewissen Grade mir selbst die Frage zu beantworten, welcher historische, psychologische und soziologische Mechanismus einen Teil der Deutschen zu Massenmördern werden ließ, die das Dritte Reich beherrschten und ihre »Neue Ordnung« in Europa und in der Welt einzuführen gedachten.
Ich befand mich also während meines fast neun Monate dauernden Aufenthaltes in Stroops Zelle Auge in Auge mit einem Massenmörder. Unsere Beziehungen verliefen im Rahmen einer eigentümlichen Loyalität. Obwohl es mir anfangs schwerfiel, bemühte ich mich, in Stroop nur den Menschen zu sehen. Er hatte meine Haltung begriffen, obwohl ich immer wieder meine Ablehnung und Feindseligkeit gegenüber der Ideologie, der er diente, und den Handlungen, die er begangen hatte, nachdrücklich unterstrich. Stroop seinerseits versuchte nicht, einen Freund der Polen zu mimen und seine eigenen Taten zu verurteilen.
Diese gemeinsam verbrachte Zeit wurde zum Impuls und lieferte das Quellenmaterial für dieses Buch. Das Bild, das ich hier zeichne, ist gewiss nicht vollständig. Und es ist nicht frei von meinen eigenen Kommentaren, obwohl ich versucht habe, sie zu vermeiden.
Gebe ich den Sinn der Worte und der Verhaltensweisen von Stroop und Schielke wahrheitsgetreu wieder? Ich glaube schon. Umso mehr, als ich mir kurz nach Verlassen des Gefängnisses Aufzeichnungen gemacht habe und einige Aussagen Stroops in den Archiven und den mir zugänglichen historischen Dokumenten überprüfte. Nirgends fand ich einen Hinweis, dass Stroop in unseren Gesprächen die Unwahrheit gesagt oder Schönfärberei betrieben hätte.
Bestimmte Teile der »Gespräche mit dem Henker« könnten zu Missverständnissen führen. Sollte dies der Fall sein, so ließen sie sich meiner Meinung nach nur damit erklären, dass es dem Leser unmöglich ist, seine Erfahrungen und seinen Wissensstand mit den hier beschriebenen Tatsachen gleichzusetzen; oder mit meiner subjektiven Unfähigkeit, diesen Bericht niederzuschreiben. Ich betone: Bericht; denn im Falle dieses Buches scheint mir jegliche literarische Fiktion unpassend.
Noch eine Anmerkung zu den Dialogen, die in einigen Kapiteln der »Gespräche mit dem Henker« vorkommen. Möglich, dass es zu viele sind. Aber mein 2556 Tage währendes Leben in dem Dreieck »Stroop, Schielke und ich« (nur für kurze Zeit war ein vierter Mitgefangener dabei) setzte sich aus Dialogen zusammen, jener Grundform sprachlicher Kontakte in kleinen Zellen. Warum sollte ich mich dieser Form nicht bedienen, da es um die Wahrheit geht?
II. Kapitel
Zu Füssen von Bismarcks Cherusker
Der SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Stroop, bekannt als Jürgen, trug bis zu seinem 46. Lebensjahr den Vornamen Joseph, den er gemäß der Familientradition von seiner Mutter Katharina, geb. Welther, und dem Vater Konrad Stroop, einem Polizeichef im Fürstentum Lippe-Detmold, erhalten hatte. Josephs Eltern waren katholisch. Der Vater trug sein Glaubensbekenntnis kaum zur Schau, die Mutter dagegen war eine bigotte Frömmlerin, wie aus den Erzählungen Stroops in der Zelle hervorging.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























