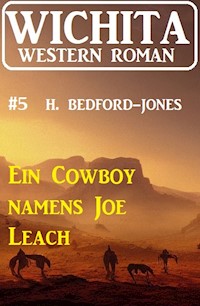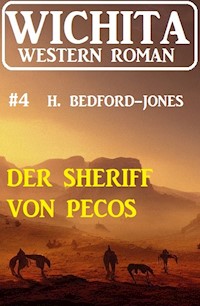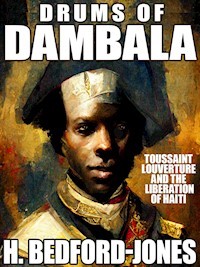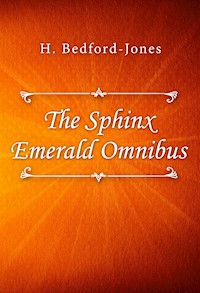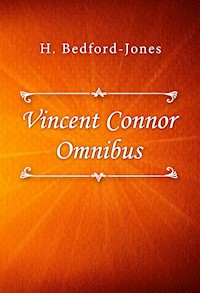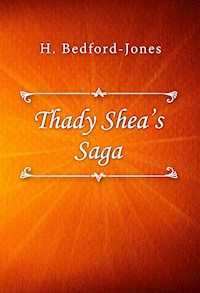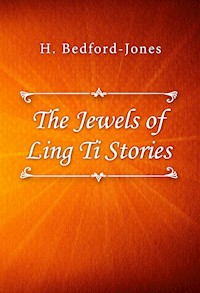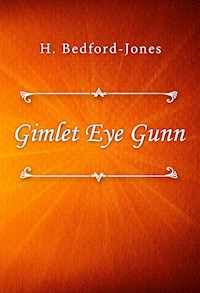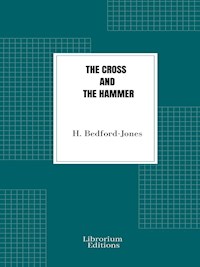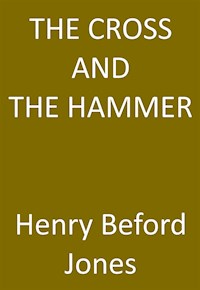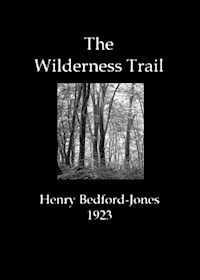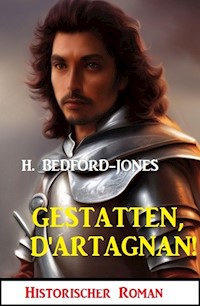
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
von H. Bedford-Jones (Übersetzung Manfred Plattner) Eine Fortsetzung der "Drei Musketiere" von Alexandre Dumas! Aramis, Porthos und Athos - die Namen der drei Musketiere kennt jeder. Und natürlich den von D'Artagnan, dem Mann aus der Gascogne. Das Schicksal D'Artagnans steht im Mittelpunkt dieses historischen Romans. Wie ging es mit ihm nach den Ereignissen aus den "Drei Musketieren" weiter? D'Artagnan ist nun Musketier und bekleidet den Rang eines Leutnants. Im Auftrag der Königin erfüllt er einen Auftrag. Da findet er einen Sterbenden. Dessen rätselhafte letzte Worte und das noch rätselhaftere Dokument, das er bei ihm findet, ziehen D'Artagnan in einen wahren Strudel an aberwitzigen Ereignissen hinein. Intrigen und Verschwörungen des französischen Hofes werden ihm zum Schicksal, das Mysterium der Herkunft eines königlichen Kindes wird offenbar und d'Artagnan muss sich schon bald nach Art eines Musketiers seiner Haut wehren… Aber wozu hat man alte Freunde, wenn man sie braucht? Ein farbiges Historienabenteuer!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. Bedford-Jones
Gestatten, D‘Artagnan! Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Gestatten, D‘Artagnan! Historischer Roman
Copyright
VORWORT
I. - EINFÜHRUNG EINER KÖNIGIN, EINES SOLDATEN UND EINES SCHURKEN
II. - DER BEWEIS, DASS WEDER KÖNIG NOCH MINISTER IN FRANKREICH REGIERTEN
III. - ERWÄHNE DEN TEUFEL, UND ER ERSCHEINT
IV. - EIN MARSCHALL KOMMT AN, EIN LEUTNANT GEHT WEG
V. - VIER BRIEFE WERDEN VERSCHICKT, EINER KOMMT AN
VI. - IN DEM ATHOS VORHERSAGEN MACHT
VII. - WUNDER SIND MANCHMAL UNERWÜNSCHT
VIII. - IN DEM SICH EIN GENTLEMAN ALS GUTER HANDWERKER ERWEIST
IX. - EIN NACKTER MANN HAT KEINE WAHL
X. - DAS AUSSERGEWÖHNLICHE ABENTEUER DES COMTE DE LA FÈRE
XI. - DAS NOCH AUSSERGEWÖHNLICHERE ABENTEUER VON M. DU VALLON
XII. - IN DEM D'ARTAGNAN ZWEI DINGE FÜR ANDERE UND EINES FÜR SICH SELBST VOLLBRINGT
XIII. - EIN MITTEL ZUR AUFNAHME IN DEN ORDEN DES HEILIGEN GEISTES
XIV. - STATT EINES VATERS ERSCHEINEN ZWEI
XV. - ZWEI REISEN AB, DREI BLEIBEN
XVI. - DIE ERSTAUNLICHE WIRKUNG EINES TRITTES AUF EINEN TOTEN MANN
EPILOG
Gestatten, D‘Artagnan! Historischer Roman
von H. Bedford-Jones
(Übersetzung Manfred Plattner)
Eine Fortsetzung der „Drei Musketiere“ von Alexandre Dumas!
Aramis, Porthos und Athos - die Namen der drei Musketiere kennt jeder. Und natürlich den von D’Artagnan, dem Mann aus der Gascogne.
Das Schicksal D’Artagnans steht im Mittelpunkt dieses historischen Romans. Wie ging es mit ihm nach den Ereignissen aus den “Drei Musketieren” weiter?
D’Artagnan ist nun Musketier und bekleidet den Rang eines Leutnants. Im Auftrag der Königin erfüllt er einen Auftrag. Da findet er einen Sterbenden. Dessen rätselhafte letzte Worte und das noch rätselhaftere Dokument, das er bei ihm findet, ziehen D’Artagnan in einen wahren Strudel an aberwitzigen Ereignissen hinein. Intrigen und Verschwörungen des französischen Hofes werden ihm zum Schicksal, das Mysterium der Herkunft eines königlichen Kindes wird offenbar und d’Artagnan muss sich schon bald nach Art eines Musketiers seiner Haut wehren…
Aber wozu hat man alte Freunde, wenn man sie braucht?
Ein farbiges Historienabenteuer!
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER: A.PANADERO
ÜBERSETZUNG MANFRED PLATTNER
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
VORWORT
Diese Geschichte ergänzt und übernimmt unverändert ein fragmentarisches Manuskript, dessen Handschrift als die von Alexandre Dumas identifiziert und als solche von Victor Lemasle, dem bekannten Pariser Experten, beglaubigt wurde. Soweit bekannt, ist es bisher unveröffentlicht geblieben.
Diesem Manuskript kann keine romantische Geschichte beigefügt werden, obwohl man versucht ist, einen fantastischen und plausiblen Prolog nach der Art von Rider Haggard zu weben. Das Thounenin-Testament, dessen Existenz in einer französischen Sammlung alter Dokumente den Autor möglicherweise auf die Geschichte aufmerksam gemacht hat, wurde sichergestellt und befindet sich im Besitz des Verlags. Dieses Blatt aus altem Pergament, das mit dem lothringischen Wappen versehen und von Leonard, dem Erbgroßtabellion der Provinz, unterzeichnet ist, ist an sich schon eine Kuriosität.
Indem der Autor hier eine vollständige Geschichte präsentiert, hat er keine Entschuldigung anzubieten. Aus dem Leben oder den literarischen Hinterlassenschaften von Dumas kann man nichts über diese Geschichte erfahren. Das Kind, um das es geht, ist der Vicomte de Bragelonne, der Held der späteren Romane der Reihe, dessen Abstammung Dumas in "Zwanzig Jahre danach" sehr deutlich darlegt. Der Verleger, dem das betreffende Manuskript gehört, ist natürlich genau darüber informiert, welcher Teil des Romans aus der Feder von Dumas stammt und welcher aus der Schreibmaschine von
-H. Bedford-Jones. Ann Arbor, 1. April 1928
I. - EINFÜHRUNG EINER KÖNIGIN, EINES SOLDATEN UND EINES SCHURKEN
Am zweiten Donnerstag im Juli 1630 war die alte Stadt Lyon zur zweiten Hauptstadt Frankreichs geworden. Ludwig XIII. und Kardinal de Richelieu, die mit der Armee in Savoyen gewesen waren, waren nach Grenoble zurückgekehrt; der Hof und die beiden Königinnen waren nach Lyon gekommen. Paris war leer wie ein Grab, und zwischen Lyon und Grenoble pendelten alle Hofgeschäfte, denn Marie de Medici, die Mutter der Königin, fungierte als Regentin, während Ludwig XIII. auf Feldzug war.
An der Südseite des Place des Terreaux, mit Blick auf die Saone zur Linken und die Rhone zur Rechten, stand das große Kloster der Benediktinerinnen. In diesem gewaltigen Gebäude, von dem heute nur noch das Verzeichnis erhalten ist, ertönte lautes Stimmengewirr, und es glänzte mit fröhlichen Kostümen und Waffen. Musketiere bewachten die hohen Tore, Kutschen donnerten im gepflasterten Hof, und am Flussufer unterhalb der schönen grünen Gärten warteten vergoldete Kähne; in Wahrheit residierten in diesem Moment zwei Königinnen von Frankreich in seinen Mauern.
In einem oberen Zimmer, neben einem winzigen Feuer, das in der Herdwand brannte, um die Morgenkühle zu vertreiben, saß eine Frau, die in einiger Aufregung einen Brief las. Trotz des Wandteppichs, der die Wände schmückte, und der hübschen Vorhänge am Bett strahlte der Raum eine Strenge und Schlichtheit aus, die von der klösterlichen Umgebung kündete.
Die Frau, die in diesem Zimmer saß, war etwa dreißig Jahre alt, also auf dem Höhepunkt ihrer weiblichen Vollkommenheit; die samtige Weichheit ihrer Haut, ihr gepudertes kastanienbraunes Haar und ihre schönen Hände ließen sie viel jünger erscheinen. In ihren Zügen mischte sich Stolz mit einer sanften Traurigkeit; eine gewisse erhabene Majestät in ihrer Miene wurde durch Freundlichkeit und Sanftheit gemildert. Ihre Augen leuchteten hell, doch jetzt, als sie die beunruhigenden Sätze dieses Briefes las, sammelte sich in ihren flüssigen Tiefen ein trübes Phantom des Schreckens:
Auch wenn es mich schmerzt, Euch zu beunruhigen, so müsst Ihr doch auf der Hut sein. Da ich weiß, dass dies direkt an Deine Hand geht, schreibe ich es ohne Umschweife und vertraue darauf, dass Du es sofort vernichten wirst.
Im Jahre 1624, also vor sechs Jahren, war ein gewisser François Thounenin Pfarrer in Dompt; er hat dort sein Testament gemacht. Im folgenden Jahr wurde er durch den Einfluss meiner Familie, mit der er verwandt war, nach Aubain in der Nähe von Versailles versetzt. Vor zwei Jahren starb er in demselben Dorf Aubain. Bevor er starb, machte er bei einem Besuch in Dompt einen Zusatz zu seinem Testament, der in das in Nancy hinterlegte Originaldokument aufgenommen wurde. Dieser Zusatz, der in der Angst vor dem Tod gemacht wurde, betraf ein bestimmtes Kind. Wir wussten natürlich nichts von diesem Kodizil. Thounenin starb bald nach seiner Abfassung, und als wir davon erfuhren, kümmerten wir uns um das Kind.
Dieses Testament wurde aus den Archiven entwendet. Die Tatsache wurde sofort bekannt, die Verfolgung wurde aufgenommen, und ich habe allen Grund zu glauben, dass das Dokument wiedergefunden und vernichtet werden wird. Es wäre unmöglich, dass es Sie betrifft; dennoch fürchte ich, mein lieber Freund, dass es Sie betreffen könnte! Ich werde genau beobachtet, meine Freunde sind verdächtig, es ist schwierig für mich, etwas zu tun.
Wenn möglich, schickt mir einen Boten, dem Ihr vertrauen könnt. Ich habe vielleicht keine andere Möglichkeit, Ihnen aus sicherer Hand zu schreiben, doch ist es unbedingt notwendig, dass Sie über Gefahren oder Sicherheit informiert werden. Adieu! Zerstöre dies.
Marie.
Die Frau, die diesen Brief schrieb, war Marie de Rohan, Herzogin von Chevreuse, die fähigste und entschlossenste Feindin Richelieus. Die Frau, die ihn las, war Anna von Österreich, Königin von Frankreich, das schönste und hilfloseste Opfer Richelieus. Nachdem sie den Brief gelesen hatte, ließ die Königin ihn in die Flammen des Kamins fallen; in einem weiteren Augenblick war er zu schwarzer Asche geworden, die sich im Luftzug nach oben erhob. Den Kopf auf die Hand stützend, verfiel die Königin in aufgewühlte Träumerei.
"Gütiger Gott, was kann das bedeuten - worum geht es - was werden sie als Nächstes gegen mich oder meine Freunde versuchen?", murmelte Anna von Österreich. Ihre schönen Augen waren von Tränen überströmt. "Und was kann ich tun - wen kann ich schicken - welcher Person kann ich vertrauen, wenn ich niemanden privat sehen darf, außer mit ausdrücklicher Erlaubnis?"
In diesem Augenblick wurde sie durch ein Klopfen an der Tür geweckt, was sie dazu veranlasste, jede Spur von Rührung zu beseitigen. In den Raum kam Dona Estafania, die einzige ihrer spanischen Dienerinnen, die noch an ihrer Seite war. Sie knickste vor der Königin in der Tür.
"Eure Majestät, der Kurier ist hier, um die Depeschen abzuholen. Madame, die Königinmutter, bittet darum, dass, wenn die Euren fertig sind, sie sofort abgeschickt werden."
"Sie liegen auf meinem Sekretär", sagte die Königin. Aus der förmlichen Anrede erahnend, dass der Bote wartete, fügte sie hinzu: "Dieser Kurier - ist er zur Stelle?"
"Ja, Madame", sagte Dona Estafania. "Er ist M. d'Artagnan, ein Gentleman der Musketiere..."
"Ah!", murmelte die Königin. "Warte..."
Bei der Erwähnung dieses Namens stieg eine rasche Blässe in ihre Wangen und verschwand dann in einem satten Rot, das von ihrem Rouge halb verdeckt wurde. Vielleicht erinnerte sie sich an diesen Namen, vielleicht kamen ihr in diesem Moment andere Tage in den Sinn, vielleicht durchbohrte sie die Erinnerung an den toten Buckingham.
"Ist er allein?", fragte sie schnell und impulsiv.
"Ja, Madame."
"Bitten Sie ihn, einzutreten. Nehmen Sie die Briefe. Schließen Sie die Tür. Sie können bleiben."
Im nächsten Augenblick kniete d'Artagnan, gestiefelt und gespornt, über der Hand der Königin und berührte sie mit seinen Lippen. Lächelnd blickte sie in sein eifriges Gesicht, das vor Hingabe strotzte.
"D'Artagnan - du reist nach Grenoble?
"Mit Gesandtschaften für Seine Majestät, Madame."
"Meine sind fertig - geben Sie sie mir, Dona Estafania, wenn Sie möchten."
Sie nahm die versiegelten Briefe von ihrer Herrin und reichte sie d'Artagnan, der sich verbeugte und sie in seine Tasche steckte.
"Monsieur", sagte die Königin mit etwas unsicherer Stimme, "würden Sie mir dienen?"
D'Artagnan sah sie erstaunt an.
"Mit meinem Leben, Madame", rief er eifrig aus.
"Ich glaube Ihnen", sagte sie. "Ich glaube sogar, dass ich Grund habe, Ihnen zu glauben. Man wirft mir vor, viele Dinge zu vergessen, M. d'Artagnan - aber es gibt viele Dinge, die ich nur zu vergessen scheine." Erneut trat eine leichte Blässe in ihr Gesicht. "Herr de Bassompierre hat offen erklärt, dass er dem König, seinem Herrn, dient - und er hält es für die Pflicht eines Gentleman, diesen Dienst als höherwertig anzuerkennen als jeden anderen."
D'Artagnan verbeugte sich, und seine Augen blitzten ein wenig.
"Madame", antwortete er lebhaft, "Gott sei Dank bin ich M. d'Artagnan und nicht M. de Bassompierre! Ein Marschall von Frankreich dient dem König. Ein einfacher Gentleman dient einer Dame. Wenn Eure Majestät auch nur das geringste Bedürfnis nach einem Dienst hat, dann schenkt ihn mir, ich flehe Euch an! Es ist das größte Glück meines Lebens, Euch meinen Dienst zu Füßen zu legen, und Ihr seid mir wichtiger als Gott selbst!"
In den Augen des jungen Mannes leuchtete die Wahrheit, in seiner Stimme klang Aufrichtigkeit.
"Ah, M. d'Artagnan!", rief die Königin leise aus. "Wenn Sie doch nur an der Stelle von M. de Bassompierre wären!"
"Dann habe ich Pech gehabt, Madame, denn er ist bei der Armee und nicht hier."
Die Königin fing eine warnende Geste von Dona Estafania auf. Die Zeit war knapp.
"Gut." Sie nahm einen Ring von ihrem Finger und streckte ihn aus. "Bring ihn nach Dampierre, gib ihn Madame de Chevreuse in die Hand und sag ihr, dass ich dich geschickt habe. Das ist alles. Sie wird dir eine mündliche Nachricht für mich geben, denke ich. Gehen Sie, wenn Sie können, und kommen Sie zurück, wenn Sie können. Ich bin nicht in der Lage, dir zu helfen - wenn ich es versuchte, würdest du in Verdacht geraten -"
D'Artagnan ging in die Knie, küsste die Finger, die sie ihm reichte, und erhob sich.
"Madame", sagte er schlicht, "mein Leben gehört Ihnen, meine Ehre gehört Ihnen, meine Hingabe gehört Ihnen! Für das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, danke ich Ihnen."
Im nächsten Moment war er verschwunden. Die Königin entspannte sich in ihrem Stuhl, zitterte ein wenig und sah ihre einzige treue Frau mit ängstlichen Augen an.
"Ah!", murmelte sie. "Ich habe zu impulsiv gehandelt, vielleicht habe ich falsch gehandelt..."
"Sie haben nicht Unrecht getan, wenn Sie diesem jungen Mann vertrauen, Madame", sagte Dona Estafania. "Seine Uniform spricht für seinen Mut, sein Gesicht für seine Hingabe. Seien Sie unbesorgt. Er wird nach Dampierre gehen."
Die Königin neigte ihr Haupt.
D'Artagnan, dessen Pferd im Hof gesattelt wartete, hatte keine Zeit, Athos zu sehen, der sich im Quartier der Musketiere befand. Die Briefe von Anna von Österreich und Marie de Medici, der Königinmutter, waren von äußerster Eile und duldeten keinen Aufschub - ihre Wichtigkeit konnte man daran ermessen, dass sie einem Offizier der Garde und nicht dem Postkurier anvertraut wurden. D'Artagnan hatte also keine andere Wahl, als nach Grenoble zu reiten, wo der König und der Kardinal Halt machten. Es war bereits nach Mittag; er musste Grenoble vor der nächsten Mitternacht erreichen.
In fünf Minuten verließ er das Kloster an der Place des Terreaux, in zehn Minuten war er vor den Toren Lyons.
Während er ritt, schien es ihm, dass die wenigen Augenblicke im Gemach der Königin ein Traum gewesen sein mussten - aber nein! Er trug einen Ring, um zu beweisen, dass sie echt waren, und schaute ihn an. Der Ring bestand aus einem großen Saphir, der von Brillanten umgeben war; offensichtlich war es kein Ring, den ein Kavalier tragen sollte. Unter seinem Hemd trug d'Artagnan ein Skapulier, das ihm seine Mutter auf dem Sterbebett anvertraut hatte; während er ritt, löste er die Kette dieses Skapuliers, fädelte den Ring auf und legte ihn wieder an. Wie er gesagt hatte, kam der Dienst an der Königin tatsächlich dem Dienst an Gott gleich.
"Nun, mir steht Urlaub zu - ich kann ihn beantragen, Athos mitnehmen und nach Dampierre aufbrechen", dachte er mit Eifer. "Wie sich die Dinge entwickeln, was? Ausgezeichnet! Und wenn ich daran denke, dass ich sie gesehen habe, dass ich zweimal ihre Hand geküsst habe, dass ich ihr in die Augen geschaut habe - wenn ich daran denke, dass sie sich doch noch an mich erinnert hat! Dass sie mich nicht vergessen hat! Ach, verdammter Kardinal, der du bist, um diesen Engel vom Himmel zu verfolgen!"
Er ritt weiter, blind und taub für alles um ihn herum, verloren in einer Ekstase glückseliger Träumerei.
Frankreich befand sich im Krieg mit dem Reich - mit Spanien, Italien, Savoyen, mit allen Ländern, die das Reich der Habsburger bildeten. Richelieu und der König, die zusammen mit der Armee ganz Savoyen erobert hatten, waren zurückgekehrt; die beiden Königinnen hatten den Hof nach Lyon gebracht, und Ludwig XIII. bat seine Mutter, nach Grenoble zu kommen, in der Hoffnung, so die bittere Feindschaft zwischen ihr und Richelieu zu kitten. Marie Medici weigert sich, und diese Weigerung wird von d'Artagnan nach Grenoble getragen.
Da er nicht auf seinen eigenen Pferden ritt, wechselte er an jeder Poststation die Pferde und gab sich die Sporen; wegen des Regens waren die Straßen stellenweise fast unpassierbar, und trotz all seiner Bemühungen konnte d'Artagnan nicht sehr schnell vorankommen. Sein Trost war, dass ein anderer an seiner Stelle überhaupt nicht schneller geworden wäre.
Als es am nächsten Tag dunkel wurde, war er noch sechs Meilen von Grenoble entfernt, hatte an der letzten Station kein neues Pferd bekommen und war verzweifelt.
"Dann stirb eben", murmelte er, als er einen langen Anstieg vor sich sah, und setzte seine Sporen ein. "Stirb, wenn du musst, aber erreiche Grenoble vor Mitternacht!"
Dünnes, fantastisches Mondlicht berührte und schimmerte auf dem dunklen Fluss Lizère zur Rechten, füllte die Bäume zur Linken mit seltsamen Schatten und brach sich klar und weiß auf dem scharfen Staub der Höhe vor uns. Die Straße neigte sich hier nach oben und brach dann durch eine lange, abfallende Schlucht ab, die von dunklen Baummassen flankiert wurde.
Am Scheitelpunkt der Anhöhe zog d'Artagnan die Zügel an; im nächsten Augenblick kam ein Schrei des Entsetzens über seine Lippen. Das bebende Keuchen des Pferdes und das schreckliche Zittern des Tieres verrieten ihm die Wahrheit: Das arme Tier lag im Sterben.
Plötzlich ertönte der scharfe Knall einer Pistolenkugel aus der Dunkelheit vor ihnen. Es folgten das noch lautere Dröhnen einer Arkebuse und der laute Schrei eines Mannes, der Todesqualen erlitt.
Der Kavalier griff nach einer Pistole und hätte die Zügel angezogen, aber das sterbende Pferd stürzte vorwärts, mit dem Gebiss zwischen den Zähnen, pfeifendem Atem, donnernden Hufen den Abhang hinunter und hallten von den Bäumen wider. Scharfe Alarmrufe ertönten vor ihnen, Männer riefen einander zu, dann kam das Getrappel der eilig davonreitenden Reiter.
"Räuber, pardieu!", murmelte d'Artagnan und blickte nach vorn. "Und sie müssen jemanden kurz vor mir erwischt haben..."
Sein Pferd zitterte, stieß einen seltsamen und furchtbaren Schrei aus und blieb dann abrupt stehen, mit weit gespreizten Beinen, mit dem Kopf auf der Straße, am ganzen Körper zitternd. Das arme Tier lag im Sterben.
D'Artagnan stieg ab. Er erkannte, dass seine Annäherung die Räuber von ihrem Opfer abgeschreckt hatte. Vor ihm, im offenen Mondlicht, war die Gestalt eines Mannes ausgestreckt, der noch immer mit einer Hand die Zügel seines Pferdes festhielt und über ihm stand. Das Pferd wandte den Kopf und blickte fragend auf den sich nähernden d'Artagnan.
Der Mann, der am Boden lag, war bewusstlos. D'Artagnan eilt zu ihm, nimmt ihm die Zügel aus der Hand und hebt den Kopf. Der unglückliche Reisende war durch den Körper geschossen worden, seine Kleidung war blutdurchtränkt und er lag im Sterben. Das Mondlicht brachte die Einzelheiten seines Gesichts zum Vorschein, und sein Retter konnte eine Geste des Abscheus nicht unterdrücken; dieses Gesicht war brutal, verräterisch, mit schweren schwarzen Brauen, die sich über den Augen trafen.
"Ein Lakai in den Kleidern seines Herrn", murmelte d'Artagnan. "Oder ein Schurke..."
Als ob der Klang menschlicher Sprache in sein Gehirn eingedrungen wäre, öffnete der Sterbende seine Augen und starrte leer nach oben. Seine Lippen bewegten sich zu schwachen Worten.
"Ich habe alles entdeckt - alles! Bassompierre-du Vallon-dieser falsche Priester d'Herblay-die Beweise! Das Dokument wurde zur Sicherheit nach London geschickt, es wird Paris in einer Woche erreichen, wir haben sie alle! Und vor allem sie - sie selbst -"
Die Stimme versagte und erstarb. Bei diesen Namen erschrak d'Artagnan heftig. Sein Gesicht veränderte sich. Man hätte sagen können, dass plötzlicher Schrecken in seine Seele eingedrungen war.
"Du Vallon-Porthos!", murmelte er. "Und d'Herblay-Aramis! Ah, ah - was ist das denn? Ist das möglich? Träume ich?
Abrupt klammerte sich der Sterbende an seinen Ärmel, versuchte, sich aufzurichten. Jetzt ertönte seine Stimme in gequälten Tönen, klar und laut mit dem unverkennbaren Akzent des Todes.
"Père Joseph!", rief er aus. "Ich kann alles melden - Betstein ist der Vormund des Kindes! Eine falsche Geburtsurkunde wurde von dem Priester Thounenin gefälscht - das Kind ist in der Benediktinerabtei St. Saforin. Der Prior kennt den Ring - ich habe die Kopie machen lassen! Ich habe einen Brief von d'Herblay-er wurde verwundet, du Vallon wurde getötet-er hat Papiere mitgenommen-seine Eminenz muss es wissen-schickt Montforge nach Paris-nach Paris-"
Der Mann hustete fürchterlich, stöhnte, dann entspannte er sich von dem Spasmus. Er kam vollkommen zu sich. Er starrte mit wilden Augen auf das Gesicht über ihm.
"Wo bin ich?", murmelte er. "Wer sind Sie?"
"Ich bin M. d'Artagnan, Leutnant von..."
"Ach, Jesus", stöhnte der Mann und zitterte, als der Tod seine Seele zerriss.
D'Artagnan erhob sich. In der einen Hand hielt er einen schlichten goldenen Siegelring, in den ein ihm unbekanntes Zeichen eingraviert war. In der anderen Hand hielt er zwei Briefe und ein kleines Päckchen mit Papieren, die stark versiegelt waren. Er betrachtete das Siegel im Mondlicht; es war das Siegel, das Aramis gewöhnlich benutzt hatte.
Aramis-Porthos! Verwirrt, benommen, an seinen eigenen Sinnen zweifelnd, betrachtete d'Artagnan die beiden Briefe. Den einen konnte er nicht lesen, aber er erkannte die winzige, perfekte, schöne Schrift von Aramis. Der andere war ein schweres Gekritzel, dessen Worte im Mondlicht deutlich genug hervortraten; die kurze Botschaft nahm ein ganzes Blatt Papier ein, so schwarz und schwanger war die Schrift:
M. l'Abbé d'Herblay:
Schreib mir nicht mehr. Sieh mich nicht mehr. Denke nicht mehr an mich. Für dich bin ich für immer tot.
Marie Michon.
"Was zum Teufel!", rief d'Artagnan aus. "Marie Michon - das ist also die Geliebte von Aramis! Chevreuse, nicht weniger. Oh, Unhold, nimm alles, was ich hier aufgedeckt habe!"
Er wurde totenbleich, als er sich daran erinnerte, was der Sterbende gesagt hatte. Porthos tot, Aramis verwundet! Athos hatte erst vor einem Monat einen Brief von Aramis erhalten; Aramis war damals aus unbekannten Gründen auf einer Reise nach Lothringen. Porthos war aus dem Dienst ausgeschieden, hatte geheiratet und hielt sich irgendwo in der Provinz auf.
Mit einer raschen Bewegung zerriss d'Artagnan den Brief von Marie Michon in winzige Stücke und warf sie in den Wind. Das Päckchen verstaute er sorgfältig - er musste dieses heilige Päckchen, das noch unter dem Siegel von Aramis stand, vernichten. Den ersten Brief studierte er noch einmal, konnte ihn aber im fahlen Mondlicht nicht lesen, und steckte ihn ebenfalls ein. Den Ring steckte er sich an den Finger.
"Einzigartig!", dachte er aufgeregt. "Welches Geheimnis hat dieser elende Spion ins Grab getragen? Bassompierre, der größte Edelmann Frankreichs, Liebhaber von tausend Frauen - mein armer, dummer, ehrlicher Porthos - mein listiger, gewitzter, intriganter Aramis? Und sie - sie selbst - was hat der Schurke mit diesen Worten gemeint?"
Eine schreckliche Vermutung schoss ihm durch den Kopf. Der Tote war offensichtlich einer der Spione des schweigsamen Kapuziners, der Richelieus Sekretär war, der sein Spionagesystem organisiert hatte und ohne dessen Rat Richelieu selten handelte - seine Graue Eminenz, Père Joseph le Clerc, Sieur du Tremblay.
"Sie selbst!" D'Artagnan wiederholte die Worte, als sei er von ihrer Bedeutung verblüfft. "Über allen - sie selbst!" Sein Tonfall, mehr noch als seine Worte - was hatte er denn entdeckt? Auf welche Frau bezog er sich? Wer ist das Kind? Wer ist Betstein?" Er strich sich mit der Hand über die Stirn; sie wurde nass von kaltem Schweiß. "Nun, wenigstens hat er die Wahrheit gesagt - er hat jetzt alles im Leben und im Tod selbst entdeckt!"
Er drehte sich um, schaute sich um und ging zu seinem eigenen Pferd. Das arme Tier stand genauso da, die Füße weit gespreizt, den Kopf gesenkt, im Sterben liegend. D'Artagnan nahm aus den Satteltaschen die Depeschen, die er bei sich trug, steckte eine der Pistolen durch seine Schärpe und ging dann zum Pferd des toten Spions.
"Ein ausgezeichnetes Tier!", bemerkte er. "Offensichtlich handelt es sich um eine der Fügung der Vorsehung, von der die Geistlichen so oft sprechen. Der Schlingel ist genau in dem Augenblick unter andere Schurken gefallen, als mein Pferd den Geist aufgab; er hat mir freundlicherweise seine Meinung gesagt und sich auf den Weg zur größten aller Entdeckungen gemacht. Ich steige in seine Steigbügel - und meine Briefe erreichen den König doch noch vor Mitternacht! Die Vorsehung ist Ludwig XIII. heute Abend eindeutig gnädiger gesinnt als seinem Kriegsminister, dem liebenswürdigen Richelieu!"
D'Artagnan stieg auf. Aber da er sich auf dem Sitz einer viel größeren Person befand, musste er die Steigbügel anpassen.
"Nun", sagte er nachdenklich, während er an den Ledern arbeitete, "wenn der gute Athos an meiner Stelle wäre, würde er es vielleicht für seine Pflicht halten, seiner grauen Eminenz eine Nachricht von all dem zu überbringen - hm! Es wäre zweifellos sehr höflich von mir - aber was zum Teufel kann in diesem Brief von Aramis stehen? Es sieht unserem klugen Aramis nicht ähnlich, seinen Hals einem Brief anzuvertrauen! Warum ist der Name von Porthos mit dem von Bassompierre verbunden? Wer ist Betstein, und wessen Kind bewacht er zusammen mit einem Benediktinerprior? Zweifellos könnte M. de Richelieu all diese Fragen beantworten, aber ich ziehe es vor, woanders zu suchen."
Wieder kamen ihm diese bedeutungsvollen Worte in den Sinn: "Über ihnen allen, sie - sie selbst!" Es war, als würde er von der höchsten aller Frauen sprechen - aber nein, das wäre ein zu großes Wagnis! Außerdem gab es zwei Königinnen in Frankreich. Wahrscheinlich handelte es sich eher um eine Intrige von Bassompierre. Der Marschall hatte gerade einen skandalösen dreijährigen Prozess vor dem Hohen Gericht von Rouen hinter sich, und seine Intrigen mit großen Damen hatten zu mehr als einem Zuneigungsversprechen geführt. Bei diesem Gedanken hellte sich d'Artagnan auf.
"Vivadiou! Ich mache aus wenig viel." Er blickte auf den toten Mann hinunter, bekreuzigte sich und nahm seufzend die Zügel in die Hand. "Hättest du nur ein paar Worte mehr gesagt, mein guter Schlingel! Aber ich danke dir - dein Geheimnis ist bei mir sicher. Hinfort, nach Grenoble!"
Und als er sich die Sporen gab, war er in einem Wirbel aus mondbeschienenem Staub verschwunden.
II. - DER BEWEIS, DASS WEDER KÖNIG NOCH MINISTER IN FRANKREICH REGIERTEN
Im Sommer 1630 herrschte in ganz Frankreich Krieg, Verrat und Unruhen.
Gewiss, La Rochelle war gefallen, die Protestanten waren niedergeschlagen, England hatte sich gefügt - das war gestern. Heute führte Richelieu die Armee in Savoyen zu Siegen gegen das Kaiserreich; doch er stand am Abgrund, und in seinem Rücken sammelten sich alle Winde Frankreichs, um ihn über den Abgrund zu blasen.
Er war gerade dabei, diese Tatsache zu entdecken, da er gerade erfuhr, dass die tödlichsten Feinde Frankreichs innerhalb seiner Grenzen lagen.
Ludwig XIII., Sohn von Heinrich von Navarra, war nomineller Herrscher Frankreichs. Marie de Medici, die Witwe Heinrichs von Navarra, konnte nicht vergessen, dass ihr Mann Frankreich tatsächlich regiert hatte. Armand du Plessis, der virtuelle Herrscher Frankreichs, beabsichtigte, dass Frankreich Europa regieren sollte. Dies waren drei Seiten eines Dreiecks - extrem ungleiche Seiten.
Ludwig war ein grausamer, eifersüchtiger König, der darauf aus war, der Nachwelt als "der Gerechte" bekannt zu werden. Er fürchtete die persönliche Macht von Richelieu, vertraute auf die Staatskunst von Richelieu, dem Kardinal, und zögerte nicht, seine Armeen in die Hände von Richelieu, dem Minister, zu legen. Der König fürchtete seine Mutter, verabscheute seinen Bruder, den Duc d'Orléans, misstraute den großen Adligen um ihn herum und war klug genug, die Verantwortung auf würdigere Schultern zu legen. Und auch die Königinmutter hasste Richelieu wütend und rachsüchtig. Sie hasste ihn dafür, dass er sie entmachtet und ihren Einfluss auf den König zerstört hatte; sie hasste ihn dafür, dass er den Krieg in ihr geliebtes Italien getragen hatte; sie hasste ihn, weil er gut machte, was sie so schlecht gemacht hatte; sie hasste ihn, weil er Richelieu war und sie Marie de Medici. Und vor allem konnte sie nicht vergessen, dass sie selbst es war, die ihn aus der Dunkelheit geholt hatte. So sammelte sich um die Königinmutter der ganze schwärende Groll der Feindschaft, unterstützt von den Fürsten des Blutes und den Adligen Frankreichs.
Richelieu, auf der dritten Seite, beginnt seine Unsicherheit zu erkennen. Er hatte die Königinmutter unterworfen, die Königin, Anna von Österreich, gedemütigt, die Vendômes zerschlagen, die Hugenotten ausgerottet und Chevreuse ins Exil getrieben. Er war der Sieger, aber er war nicht der Herr. Der Sturm des Neides, des Hasses und der Bosheit war gebremst, aber insgeheim sammelte er sich gegen ihn.
Die einzige Stärke Richelieus war, dass niemand seine Stärke erahnte. Die Fürsten besaßen Ländereien, Reichtum und Rang, die großen Adligen schlechte Machtpositionen, der Duc d'Orléans, der Thronfolger, hatte Immunität, Richelieu hatte nur einen Mann, einen einfachen Kapuzinermönch. Es ist bezeichnend, dass dieser Père Joseph vertraulicher Sekretär des Kardinals war, während sein Bruder, Charles du Tremblay, die Bastille kommandierte.
Dieser Mönch war der einzige Mann in Frankreich, der nichts wollte, der alles ablehnte, dem man weder eine Belohnung noch einen Platz geben konnte, weil er nichts akzeptierte. Er diente Richelieu; das war seine einzige Ehre, seine Würde und sein Ehrgeiz. Nichts wurde in Frankreich ohne seine Zustimmung unternommen, und alles, was er riet, wurde in die Tat umgesetzt. Der Minister verließ sich auf die Diplomatie des Bruders, der Kardinal auf die Klugheit des Bruders, der General auf die Menschen- und Heereskenntnis des Bruders, der Kardinal in der roten Robe auf den Bruder in der grauen Robe.
In den Quartieren, die Richelieu in Grenoble bewohnte, waren die beiden Männer allein. Dieser Père Joseph, der die Belagerung von La Rochelle veranlasst hatte, der einen Kommentar zu Machiavelli geschrieben hatte und der die Stütze seines Herrn war, war groß, gut gebaut und von Pocken gezeichnet. Einst war sein Haar feuerrot gewesen; als er erfuhr, dass der König eine Abneigung gegen diese Farbe hatte, wurde er vor seinem dreißigsten Lebensjahr weiß. Seine Augen waren klein, leuchtend und mit verborgenem Feuer gefüllt.
Richelieu, von weitaus imposanterer Erscheinung, befand sich zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Kräfte. Er war gutaussehend und wusste den Wert dieser Eigenschaft voll zu schätzen; er war stolz und benutzte seinen Stolz als Maske, wenn es nötig war; vor allem war er klug - und seine Klugheit wurde am besten dadurch bewiesen, dass seine Beziehungen zu seinem Sekretär nie zweideutig, nie angespannt, nie für Missverständnisse auf beiden Seiten offen waren. Gerade jetzt waren seine aristokratischen Züge nachdenklich; der durchdringende Blick, den er auf Père Joseph richtete, war beunruhigt und sogar melancholisch.
"Mein Freund und Vater", sagte er, "ich glaube, die Lage ist zu bedrohlich, als dass ich mich von Paris fernhalten könnte. Die Königin hat keinen Thronfolger vorgesehen, die Intrigen wuchern, der König besteht darauf, in die Armee einzutreten. Ich werde mich auf meine Krankheit berufen, das Kommando an Créquy oder Bassompierre übergeben und in die Hauptstadt zurückkehren."
Père Joseph war an diese plötzlichen Entscheidungen gewöhnt.
"Ausgezeichnet, Monsignore, ausgezeichnet", erwiderte er mit seiner trockenen, phlegmatischen Stimme. "Der Beichtvater des Königs schreibt, dass Sie diese Maßnahme ergreifen sollten. Es wäre das Beste, was Sie tun könnten. Leider würde es die Interessen Frankreichs nicht besonders fördern."
"Verlangen die Interessen Frankreichs also, dass ich aus dem Ministerium abgesetzt werde?"
Père Joseph, der an einem Sekretär geschrieben hatte, schob die Papiere von sich weg, faltete seine schlanken, kräftigen Hände auf dem Schreibtisch und betrachtete den Kardinal.
"Eure Eminenz war vielleicht zu sehr mit dem Feld beschäftigt", sagte er sanft, "um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Habe ich Eure Erlaubnis, sie zu erläutern?
"Fahren Sie fort, Prediger!" Lächelnd ließ sich Richelieu auf seinem Stuhl nieder.
"Dann überlegen Sie." Die Stimme des Kapuziners kam wie von einer Maschine, emotionslos, gleichmäßig, unnachgiebig. "Mit dem Krieg gegen das Haus Österreich, den wir jetzt führen, haben Eure Eminenz die Fäden der Politik wieder aufgenommen, die mit dem Tod Heinrichs IV. verloren gegangen sind; sehr gut! Ich persönlich bin der Meinung, dass das Wohl Frankreichs es erfordert, dass Sie Ihre derzeitige Position beibehalten. Von dieser Basis aus argumentiere ich."
Richelieu neigte leicht den Kopf, als wolle er signalisieren, dass diese Basis für ihn völlig akzeptabel sei. Der Kapuziner fuhr fort.
"Diejenigen, die Euch absetzen wollen - die beiden Königinnen und einige große Häuser - sind erbittertere Feinde Frankreichs als seine äußeren Feinde; denn wie der Duc de Rohan stellen sie persönliche Angelegenheiten über das Wohl ihres Landes. Es ist klar, Monseigneur, dass Frankreich nicht länger ein gegen sich selbst gespaltenes Haus sein darf."
"Also…."
"Mit Euer Eminenz an der Spitze der Armee wäre ein ernsthafter Rückschlag das Signal für sie, zuzuschlagen."
"Zugegeben", sagte Richelieu, "wenn die Gefahr eines solchen Umschwungs bestünde".
"Innerhalb von zwei Monaten wird es geschehen".
Der Kardinal warf seinem Sekretär einen verblüfften Blick zu.
"Casale wird von den kaiserlichen Truppen belagert", fuhr Père Joseph fort. "Unser Entsatzheer ist unzureichend; die Stadt muss unbedingt eingenommen werden. Das wäre ein schwerer Schlag für Frankreich und ein noch schwererer Schlag für Eure Eminenz. Mir ist eine gewisse Politik in den Sinn gekommen", und er berührte seinen Stapel Papiere, "zu diesem Zweck habe ich einen Plan ausgearbeitet, den ich Ihnen zur Genehmigung vorlege."
"Sagen Sie es mir", sagte Richelieu. "Das Ohr ist weniger anfällig für Täuschungen als das Auge."
"Nun gut. Erstens findet im nächsten Monat etwas statt, was alle in Frankreich vergessen haben. Der Reichstag wird in Regensburg tagen."
"Das weiß ich", und Richelieu runzelte leicht die Stirn. "Was ist damit?
"Laut Gesetz ist es dem Kaiser strengstens untersagt, ohne Zustimmung des Landtages Frieden zu schließen.
"Frieden? Wer hat davon gesprochen, Frieden zu schließen?", rief Richelieu.
"Ich vertraue darauf, dass Eure Eminenz ihn für erwägenswert hält. Ich habe allen Grund zu glauben, daß der Kaiser einen sofortigen Frieden mit Frankreich höchst annehmbar finden würde - wenn die Angelegenheit in Regensburg richtig dargestellt würde. Alles hängt von der Vorlage ab."
"Das würde es", sagte Richelieu trocken. "Der Landtag würde sich weigern."
"Verzeihung - der Reichstag könnte dazu gebracht werden, zuzustimmen", sagte Père Joseph. "Andererseits finde ich, dass Gustavus Adolphus, der tödlichste Feind Österreichs..."
Richelieu begann. "Der Erzketzer! Der Erzfeind der heiligen Kirche!"
"Und der Erzgeneral von ganz Europa", fügte der Kapuziner hinzu. "Er könnte einen Bündnisvertrag mit Frankreich begrüßen, vorausgesetzt, er würde richtig präsentiert - wie zuvor. Mit anderen Worten: Frankreich schließt einerseits Frieden mit dem Haus Österreich und andererseits ein Bündnis mit dem erbittertsten Feind des Hauses Österreich."
"Und gewinnt was?", fragte Richelieu. Er wusste sehr wohl, dass die vier Sekretäre von Père Joseph in engem Kontakt mit den gesamten politischen und religiösen Angelegenheiten nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt standen.
"Es ist Zeit, ihre inneren Angelegenheiten zu ordnen, Monseigneur. Ein demütigender Rückschlag auf dem Feld wird vermieden. Am Ende des Sommers ist der Minister wieder in Paris - zum Wohle Frankreichs nicht zu früh. Seine Majestät besteht darauf, bei der Armee zu sein. Die Armee ist notorisch ungesund, selbst jetzt wird sie durch Fieber und Krankheiten dezimiert."
"Ah!" Richelieus Augenbrauen zogen sich zusammen. "Ah! Wenn der König sterben sollte..."
"Gott bewahre!", rief der Kapuziner fromm aus. "Wenn der König stirbt, dann wird sein Bruder Frankreich regieren."
Richelieu starrte ihn mit einem seltsamen Blick an. Der Duc d'Orléans auf dem Thron, das bedeutete der Kardinal de Richelieu in der Bastille.
"Und all diese Möglichkeiten", sagte der Minister langsam, "könnten abgewendet werden..."
"Indem wir die Sitzung des Landtages in Regensburg aufmerksam verfolgen."
"Der König würde niemals zustimmen."
"Lassen Sie Seine Majestät den siegreichen Feldzug in Savoyen kommandieren, und er wird allem zustimmen. Außerdem wird uns der Einfluss der Königin Anna von Österreich hier zu Hilfe kommen."
Richelieu blieb eine Zeit lang nachdenklich. Er begann, den Wert dieses Rates zu erkennen, obwohl er wusste, dass jeder Vertrag mit Österreich in seinen Bedingungen unangenehm sein musste. Ein Frieden mit dem Kaiser würde einen äußeren Frieden für Frankreich bedeuten.
"Ein solcher Frieden kann nicht von Dauer sein", murmelte er.
"Monseigneur, wir bitten nur darum, dass es bis zum Frühling hält."
"Stimmt."
"Außerdem würde niemand in Frankreich daran glauben, dass der Frieden erreicht werden könnte. Und er könnte nur durch den richtigen Mann erreicht werden."
"Wieder wahr. Wir haben den richtigen Mann - Bassompierre. Er hat als Botschafter in Spanien und England gedient", murmelte der Kardinal nachdenklich. "Er ist wohlhabend, beliebt, von höchstem Niveau. Er wird von allen Seiten geliebt..."
"Sehr geliebt", korrigierte der andere trocken, und Richelieu lächelte. Bassompierre war mehr als einmal der Rivale Heinrichs IV. gewesen; und wenn die Duchesse de Chevreuse Prinzen verführt hatte, so hatte Bassompierre Königinnen verführt.
"Es stimmt, Bassompierre ist der Königinmutter zugetan", sagte Richelieu langsam. "Und..."
"Er ist der zweite Hauptmann in Frankreich, Eure Eminenz ist der erste."
"Aber er ist nicht ehrgeizig. Er würde diese Aufgabe mit Bravour erfüllen."
"Höchst bewundernswert, Monseigneur, da er heimlich mit der Princesse de Conti verheiratet ist."
"Was!"
Richelieu erhob sich von seinem Stuhl und starrte Père Joseph mit ungläubigen Augen an.
"Die Schwester von Guise? Unmöglich! Heimlich verheiratet?"
"An die Prinzessin, die ihm vor einigen Jahren einen Sohn gebar."
Der Minister ließ sich wieder in seinen Sessel sinken und schnappte fast nach Luft, als er die Kluft sah, die sich vor ihm auftat. Bassompierre, Marschall von Frankreich, der über die Herzogtümer lachte und sich damit begnügte, Generaloberst der Schweizergarde zu sein, der sich damit begnügte, der größte Spieler, Liebhaber und Verschwender in Frankreich zu sein - wenn dieser Mann nicht mehr zufrieden war, dann Vorsicht!
Der Marschall de Bassompierre, Liebling des Königs, den beiden Königinnen treu ergeben und mit dem vollen Vertrauen Richelieus ausgestattet, war der erste und mächtigste Herr Frankreichs, der sich nie von Intrigen und Komplotten fernhielt. Nun, da er heimlich mit der Schwester des Duc de Guise verheiratet ist, ändert sich alles. Er war sofort verdächtig. Die Prinzen hatten ihn auf ihre Seite gezogen.
Bassompierre", fuhr Père Joseph fort, "hat in seinem Haus sechs Schatullen mit Briefen, und die Schlüssel zu diesen Schatullen verlassen ihn nie. Das, Monseigneur, ist bezeichnend. Er ist ein gebürtiger Lothringer. Sein Einfluss ist außergewöhnlich. Gewiss, er war nie ehrgeizig und wurde daher nie gefürchtet. Aber jetzt..."
"Aber jetzt!" Der rote Minister richtete sich auf. "Ich verstehe. Wer kann denn nach Regensburg gehen? Wer besitzt den Scharfsinn, die deutschen Fürsten zu täuschen, mit ihnen zu spielen, sie um den Finger zu wickeln?"
"Das muss Eure Eminenz entscheiden, wenn der Vorschlag Ihre Zustimmung findet."
Richelieu warf ihm einen scharfen Blick zu. "Frieden ist ein Gebot?"
"Um jeden Preis, Monseigneur."
"Nun gut. Ihr sollt gehen."
Père Joseph zeigte sich sehr überrascht. "Monseigneur, Sie scherzen! In meinem einfachen Gewand unter Fürsten, Kurfürsten, Botschaftern, illustren Männern aufzutreten? Nein, nein! Ich bin ein zu bescheidener Mensch für eine solche Aufgabe.
Es war bezeichnend für Richelieu, dass er diesen Mann bis zum Ende anhörte, seinen Rat und sein Urteil abwog, seine Feststellungen akzeptierte - und dann seine eigene Autorität und sein eigenes Denken an den Tag legte.
Die Enthüllung der Heirat Bassompierres mit der Princesse de Conti hatte ihn aufgeschreckt, beunruhigt, wachgerüttelt. Dass Bassompierre ihr Geliebter gewesen war, dass sie ihm einen Sohn geboren hatte, bedeutete nichts; dass er nun mit dem Haus Guise verbündet war, bedeutete alles. Blitzartig erkannte Richelieu, wie dringend die Gefahr war, die ihn umgab.
Alles andere muss aufgegeben werden; er muss seine Staatskunst beiseite legen und alles daran setzen, der Bedrohung von innen zu begegnen.
Er wusste nur zu gut, dass der Gesandte in Regensburg ein hervorragender Gaukler sein musste, sonst war alles verloren. Die deutschen Fürsten, die davon träumten, Frankreich zu zermalmen, würden nicht bereitwillig einwilligen; Ludwig XIII. Richelieu konnte die Sache zu Hause regeln - aber der Mann, der sie in Regensburg regelte, musste ein anderer Richelieu im Ausland sein.
"Genug!", rief er aus. "Mein Freund, du gehst nach Ratisbon. Bulart de Léon, jetzt Botschafter in der Schweiz, wird als Gesandter gehen; du wirst mit ihm verbunden sein, und die Arbeit wird in deine Hände gelegt werden. Lass Bulart de Léon unter den Fürsten glänzen - lass den schriftlichen Vertrag aus deiner Feder und deinem Gehirn kommen. Du bist der richtige Mann."
"Wie Eure Exzellenz es wünscht", sagte der Kapuziner demütig.
Seine Augen glühten bei dem Gedanken an die Intrige, die in Regensburg zwischen seinen Händen ablaufen sollte. Dieser Mann, der das Herz und die Gedanken der Menschen um ihn herum lesen konnte, hätte sich nichts Größeres wünschen können, als alle Fürsten Deutschlands hinters Licht führen zu können.
"Und der Vertrag mit Gustavus Adolphus?"