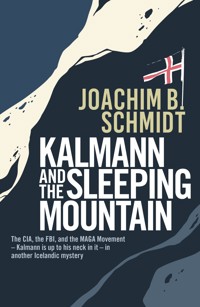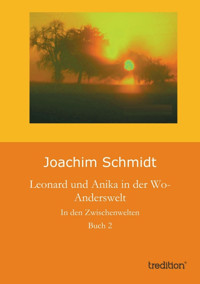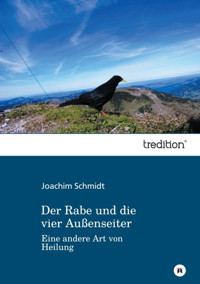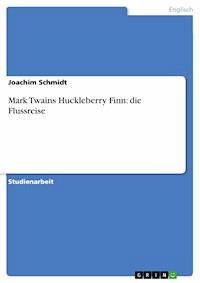2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine spannende Liebesgeschichte zwischen Heute und Gestern
Das E-Book Gestern-Heute-Morgen wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Unterhaltung, Liebesroman, Historischer Roman
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Joachim Schmidt
Gestern-Heute-Morgen
Teil 1
Und dann eines Tages….
Eine verzwickte Liebesgeschichte zur Zeit des Ulmer Münsterbaues
Ein „book for all“
© 2020 (erste Auflage)
© Umschlaggestaltung,: Joachim Schmidt Lektorin: Christina Biber-Hörger
Verlag&Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44 22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-20100-2
(Paperback)
978-3-347-20101-9
(Hardcover)
978-3-347-20102-6
(e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Joachim Schmidt
Autor mehrerer BücherGrenzgänger zwischen Diesseits und Jenseits
Bisher erschienen:
- Hinter den Tapeten
- Zeitfallen
- Leonard in der Wo-Anderswelt
- Leonard und Anika in der Wo-Anderswelt
- Der Rabe und die vier Außenseiter
- Der Kelch
- Das Schicksalsrad
- Die Gezeitenfrau
- Der Mann im Baum
- Der Steinmetz und die Tochter des Bürgermeisters
Leben-Liebe
Von uns Menschen wird das Leben meist mit Bewegung gleichgesetzt. Alles, was sich im sichtbaren und unsichtbaren, also im makro- und mikrokosmischen Bereich bewegt, verkörpert Leben. Eine sich ständig bewegende Ursuppe mit darin mehr oder weniger aufgelöster Materie.
Aber wer oder was steckt hinter dieser Bewegung? Hinter der bewegten Materie, hinter ihrer Ordnung, den sogenannten Naturgesetzen? Wo sitzt der Motor, der intelligente, schöpferische Antrieb? Die Kraft ohne Form und Namen, die alles von ihr selbst Erschaffene wieder aufzulösen und zu verändern weiß? Eine Kraft, die immer mit allem verbunden ist, ja sogar verbunden sein muss, denn ohne sie gäbe es diese Art von lebender Materie nicht. Ohne sie keine Verbindung, kein Miteinander, nur ein Nichts. Ein in sich ruhendes Etwas, das alle Möglichkeiten in sich birgt, ohne sie zum Leben zu erwecken.
Vielleicht lassen sich unter diesem Aspekt das Leben oder auch die vielen aufeinander folgenden Leben, bekannt als Inkarnationen, besser erklären. Diese vielen Leben entsprächen dann in Wirklichkeit nur einem einzigen Leben. Einem unendlich bewegten, kreativen Ablauf ohne Stillstand.
Liebe - Illusion oder Wahrheit?
Vielleicht aber ist dieses Leben durch ein menschliches Gehirn überhaupt nicht erklärbar und alles Gedachte entspricht nur einer beschränkten Vielfalt menschlichen Denkens. Mehr die Vorstellung eines Traumes, denn Materieentspricht in Wirklichkeit nichts anderem als gebündelter, Energie, angetrieben durch ????? die Liebe?
Gestern-Heute-Morgen
Teil 1
In Ulm samstags einen kostenlosen Parkplatz zu finden, ist so gut wie unmöglich und sehr nervig, selbst für Eingeweihte, die es an bewährten Plätzen probieren. Man muss dafür ein schönes Stück des Weges mit einkalkulieren. Wird aber dafür entlang der Donau und auf der alten Stadtmauer mit Blick zum Fischerviertel und dem dahinter hoch aufragenden Ulmer Münster reichlich belohnt.
Dieser Blick faszinierte mich immer wieder aufs Neue und öffnete mir ein angenehmes, wohliges „Zu-Hause-Gefühl“. Ich machte mir nie große Gedanken darüber, warum ich so empfand. Es war einfach so. Irgendwie schien es da eine Verbundenheit mit diesem längst vergangenen Ulm oder einer ähnlichen Stadt mit mittelalterlichem Charakterbild zu geben.
Wenn ich heute zurückblicke, verstehe ich dieses Vertrautheitsgefühl von damals viel besser. Ab einem bestimmten Punkt auf der Mauer fühlte es sich immer irgendwie besonders geheimnisvoll an, als ob ich an einem Tor vorbeiliefe, hinter welchem sich unglaubliche Erinnerungen verbargen.
Das einzig Unangenehme dieses Spazierganges, sowie aller anderen Wege, die ich während meines Lebens zu gehen hatte, waren die wieder und wieder auftauchenden Schmerzen in der rechten Schulter und in meinem linken Bein. Trotz mehrerer Untersuchungen konnten sie nichts zugeordnet werden. Deshalb wollte ich auch mit niemand mehr darüber reden. Jeder dachte gleich, ich sei ein Simulant bzw. alles hätte einen psychischen Hintergrund.
Und dann - an einem Samstagmorgen, bei herrlichem Sonnenschein - die Donau glitt, wie so oft nur leichte Wellen schlagend, in Richtung Schwarzes Meer, genau in diesem Augenblick, als die Turmuhr über dem alten Schwörgebäude neun Mal schlug, machte dieses besondere Gefühl einer völlig veränderten Realität Platz. Was war geschehen?
Verwirrt starrte ich auf herumrennende Männer, die mit langen Spießen, alten Hinterladern, Pfeil und Bogen, Armbrüsten und großen Steinen bewaffnet, um mich herum auf der Mauer Stellung einzunehmen schienen. Ich wandte mich dem Geschrei zu, das rechts von der Donau her mein Trommelfell strapazierte. Erst danach begann sich mein Gehirn mit dieser neuen Wirklichkeit auseinandersetzen zu wollen.
Was ich da sah, hatte nichts mit dem alljährlich wiederkehrenden Ulmer Stadtfest, dem „Nabada“ oder dem „Fischerstechen“ zu tun. Nein, diese ganze Szenerie schien blutiger Ernst! Gewehre krachten von der anderen Uferseite herüber und setzten die Soldaten auf der Stadtmauer unter Dauerbeschuss. Viele Boote und Flöße versuchten mit heftigen Ruderschlägen, ohne dabei von den Steinschleudern der Stadtwehr getroffen werden zu wollen, schnellstmöglich den Fluss zu überqueren. Überall kommandierte, schrie, tobte und schnaufte es aufgebracht.
Panik wollte in mir aufsteigen, als mir, Gott sei Dank, ein nicht ganz unbekanntes Gesicht zurief: „Ed glotza, beweg da Arsch, komm mit, da Offizier will, dass ma dort vorne Platz einehmad ond verteidigad.“ (nicht schauen, beweg Dein Hinterteil, der Offizier möchte, dass wir dort vorne Platz einnehmen und verteidigen).
Wenig später, kurz bevor meine Gedanken völlig chaotisierten, meldete mir mein Erinnerungsdepot, dass sich der Kerl Heiner nannte und ich ihn schon lange als einen guten Freund zu schätzen wusste.
Mich auf dieses Geschehen einzulassen, in diesen komisch aussehenden Klamotten zu bewegen und gleichzeitig zwei Eimer mit heißem Wasser zu tragen, hinderten meine sonst so viel gerühmte Spontanität, schnell zu reagieren.
„Einfach mitmachen, später nachdenken“, befahl mir eine innere Gewissheit, die damit ganz bestimmt eine schlimme Erfahrung mit meiner Psyche verhindern wollte.
Während ich agierte, und gleichzeitig meinen Kumpel nachzuahmen versuchte, legte sich ein neuer, bzw. alter Bewusstseinsschleier über mich. Ich wusste mit einem Mal, wer ich hier war, welche Aufgabe ich zugeordnet bekommen hatte und was im Augenblick vor sich ging.
Kaiser Karl der IV. selbst wollte endlich der freien Reichstadt Ulm persönlich zeigen, wer, was, wem zu sagen hatte und vor allen Dingen, wer über den Reichtum Ulms bestimmen sollte. Die Bevölkerung war schon lange über Predigten und andere Anlässe aufgeklärt worden und deshalb hatte Ulm nicht vor, sich vor ihm zu beugen. Die Obersten der Stadt wollten, ganz egal, wie das Gefecht ausgehen würde, dem Kaiser die Stirn bieten. Acht Städte bildeten seit Jahren den Schwäbischen Städtebund, den Ulm als reichste und ansehnlichste Stadt anführte. Um keine außergewöhnlichen Steuern bezahlen, noch Verpfändungen hinnehmen zu müssen, hatten sie sich gegenseitig Rechte und Freiheiten geschworen.
Zu all dem, hatte der jüdische Banker Jäcklin, der dem Kaiser durch seine Staatszugehörigkeit eh ein Dorn im Auge war, der Stadt auch noch Geld für ihre Wehr bereit gestellt. Das machte den Kaiser so wütend, dass er kurzerhand mehrere städtische Gebiete verwüstete. Die Stadt sah dabei nicht zu, sondern griff sich dafür ihrerseits einige Besitztümer des Adels. Dies brachte Karl den IV. noch mehr auf die Palme. Er sah sich deshalb genötigt ein Söldnerheer zu rekrutieren und zum Angriff auf Ulm zu blasen. Augenblicklich erlebte ich also, wie sich die Stadt dem Kaiser widersetzte.
„Achtung!“ schrie Heiner, „zwei Leitern! Links von uns.“ Automatisch schnappten wir uns zwei für diese Zwecke bereitliegende Stangen, warteten bis die Kerle fast über die Mauer blickten. Dann stießen wir sie mit Anlauf so weit von der Mauer ab, bis ihre Körper, von der Schwerkraft gezogen, rückwärts nach unten auf den knappen Wiesenrain der Donau aufschlugen und von dort nicht mehr aufstanden. Heiner und ich tauschten mit geschwellter Brust kurz Blicke aus, wie es nur befreundete, erfolgreiche Kämpfer fertigbringen konnten. Ich verteilte meine zwei Eimer mit heißem Wasser über Männer, die sich unten an der Mauer zu schaffen machten, um neue Leitern zu positionieren. Sie schrien laut auf, sprangen zur Donau und tauchten ihre verbrannten Hände sowie ihr Gesicht ins Wasser. Jetzt bekamen wir Nachschub von älteren Ulmern, die wegen ihres fortgeschrittenen Alters nur indirekt ins Kampfgeschehen einzugreifen brauchten. Sie transportierten Steine, brennende Hölzer, legten Pfeile und Bogen vor uns ab und halfen, die bereits angelegten Leitern von der Mauer zu stemmen.
Dann übernahm die hinter uns auftauchende Stadtwehr mit ihren Hinterladern unsere Stellung. Sobald ein Kaisertreuer über die Mauer klettern wollte, stießen sie mit ihren aufgesetzten Kurzschwertern zu oder erschossen ihn aus nächster Nähe.
Ulm hatte das vom Judenbanker Jäcklin erhaltene Geld gut in Hinterladern und Munition angelegt. Sobald abgedrückt worden war, erhielt ein Nachlader das leergeschossene Gewehr. Dieser übergab im Tausch ein bereits wieder neu aufgeladenes. Wenn es eilte, schoss auch der Nachlader aus vollem Rohr.
Die zwei Kanonen, die der Kaiser am anderen Ufer stationiert hatte, nützten ihm augenblicklich wenig, denn sie hätten ihre eigenen Mannen getötet. Ein großer strategischer Fehler. Ein Missverständnis der kaiserlichen Offiziere half den Ulmern die erste Angriffswelle abzuwehren. Ein junger Anführer konnte es anscheinend nicht erwarten, bis die Kanonen auf einem festen, zugewiesenen Platz standen. Er setzte die Fußsoldaten viel zu früh in Marsch bzw. in die Boote.
Als zum Rückzug geblasen wurde, lagen bereits viele Tote und Verletzte vor der Mauer, die einige Bürger der Stadt voller Wut von oben herab bespuckten. Andere Ulmer grölten und verhöhnten den Kaiser. „Nicht mit uns!“, schrien sie, „stiehl Dein Gold und Geld woanders!“
Inzwischen wusste ich ganz genau, wo und wer ich war. Ich steckte in der Zeit eines anderen Jahrhunderts fest. Es handelte sich um das Ende des 14.Jahrhunderts. Warum ich mich gerade hier befand? Das hoffte ich, würde mir die Zukunft verraten.
Die Nacht brach an und wir, wie auch der Feind, versorgten eine nicht geringe Anzahl von Verwundeten, die sich jedoch auf unserer Seite in Grenzen hielt. „Morgen früh setzt der Kaiser bestimmt zuerst seine zwei Kanonen ein, die unsere Mauer durchbrechen werden“, ereiferte sich einer unserer jungen Männer besserwisserisch. Viele stimmten ihm nickend zu. „Komm Heiner, lass uns zu den Offizieren gehen, ich habe eine Idee“, riet ich meinem Freund.
Ich war 23 oder 24 Jahre alt, so genau wusste das meine Mutter nicht mehr und es gab noch eine drei Jahre jüngere Schwester, die vermutlich den gleichen Vater hatte. Er war vor wenigen Jahren an der Ruhr gestorben.
Ich hatte seine Töpferei übernommen und verkaufte, zusammen mit meiner Schwester, die Waren auf dem Markt. Auf diese Weise konnte sich unsere kleine Familie gut über Wasser halten.
„Was für eine Idee? Der lacht Dich doch bloß aus“, entgegnete mein Freund. Heiner baute Flachs an, unterhielt eine Weberei und trieb in vielen anderen Städten eifrigen Handel, mit dem bekannten Ulmer Barchent-Tuch. Wir kannten uns schon als kleine Jungs, hatten so manche Streiche ausgeheckt und halfen uns immer wieder, wenn wir in schwierigen Situationen steckten.
„Was habt ihr vorzubringen?“ „Es ist ganz einfach, Herr Offizier“, entgegnete ich. „Wir müssen nur das Kanonenpulver nass machen.“ „Ach ja! Nur das Pulver nass machen! Dann schwimm mal rüber zum Kaiser und sag ihm, Du möchtest sein Pulver nass machen, damit er seine Kanonen nicht mehr gebrauchen kann, Du Einfaltspinsel!“
„Nein, nicht nur nass machen, sondern das Pulver mit nassem Mehl verkleistern! Ich kenne mich dort drüben aus und weiß, wo sie die Kanonen befestigt haben. Da gibt es einen festen, lehmhaltigen Boden. Da stehen bestimmt auch ihre Fuhrwerke mit den Kugeln und dem Pulver drauf. Heiner wird mir helfen. Das Ganze muss natürlich heute Nacht passieren, wo man uns im Fluss nicht sehen kann.“ Sein Blick verriet, dass er jetzt diese Idee etwas positiver einschätzte. „Gut, ich werde Deinen Vorschlag dem 1. Offizier und dem Bürgermeister weiterleiten, dann werden wir sehen.“ Die Glocke im Turm schlug neun Mal, als man uns ausrichten ließ, dass wir es versuchen sollten.
Heiner und ich hatten schon alles genauestens durchgeplant, wo wir ins Wasser gleiten mussten und wo wir es unter Berücksichtigung der Strömung wieder verlassen würden. Bei den Kanonen saßen vermutlich nur zwei Wachen. Jeder bestimmt mit einem Schwert bewaffnet. Dies betrachteten wir nicht als großes Hindernis. Ein anderes, wichtigeres Problem musste vorher noch geklärt werden. Wie konnten wir trockenes Mehl mit uns über das Wasser nehmen? Wir wollten es zuerst unter das Pulver mischen und anschließend befeuchten. Das Mehl und das Wasser würden sich bis zum Morgen so verklumpen, dass es nicht mehr zu gebrauchen sein würde. Dies war meine Idee.
„Eine Plastiktüte“, dachte ich, „ja wenn….“
Mein geistiger Ausflug in die Zukunft brachte mich nicht weiter, doch dann kam der zündende Einfall. „Eine Schweinsblase müsste es auch tun.“ Heiner und ich liefen sogleich zum Metzgerturm, dem Durchlass zur Donau, der heute natürlich durch das Eisengatter verschlossen ist. Die Schlachthäuser der Metzger befanden sich nahe dem Wasser. Sie hatten es von dort aus nicht weit, ihre Abfälle in den Fluss zu kippen. Trotzdem stank es in der Gegend immer sehr stark nach altem, verfaultem Fleisch, nach Blut und nach frisch Geschlachtetem.
„Ja, die sind dicht genug, hab noch zwei herumliegen, über die anderen sind die Köder hergefallen. Hoffe, euer Vorhaben gelingt und ihr könnt der Stadt helfen, ihre Freiheit zu bewahren. Lasst euch nicht schnappen, die ersäufen euch sonst wie junge Hunde in der Donau“, dabei lachte er gequält, viel Schlechtes ahnend.
„Heiner, ich hoffe, dass die Menge an Mehl ausreicht. Wir müssen jetzt nur noch die Blase mit Lederriemen dicht verschließen und Erkundigungen einziehen, wie weit der Kaiser die Stadt umschlossen hält.“
Ein Wachmann beriet uns: „Der Norden ist nur von ein paar kleineren Trupps bewacht. Die lassen niemanden raus, damit keiner bei unseren verbündeten Städten um Hilfe ersuchen kann. Passt auf, genau unter uns befindet sich in der Mauer, von einem Busch verdeckt, ein kleines Loch. Ich zeig es euch und sagt es niemand weiter, sonst….“ Die horizontale Handbewegung vor seinem Hals gab uns genügend Auskunft.
„Wenn ihr durch das Loch gekrochen seid, könnt ihr die paar Meter unentdeckt zur Donau robben und von dort aus rüber schwimmen. Die Strömung ist nicht so stark. Ich werde euch von oben beobachten. Solltet ihr entdeckt werden, pfeife ich drei Mal kurz durch die Finger.“ Er pfiff drei Mal scharf. „So etwa, das müsstet ihr auch im Wasser hören, dann schwimmt ihr sofort zurück. Wartet hier noch einen Augenblick“, er verschwand in der Dunkelheit.
„Ich habe extra etwas Luft in die Blase gepustet, damit sie von allein schwimmt.“ „He, Du Angeber, woher weißt Du das?“ „Ach, das weiß doch jeder!“ antwortete ich lässig. „Wenn ein Boot kippt, hält es sich doch auch über Wasser, solange noch Luft drunter ist. Komm, lass uns keine Zeit vergeuden.“
Inzwischen schlug die Turmuhr des Rathauses elf Uhr. Höchste Zeit, uns auf den Weg machen. Der Stadtwächter erschien und führte uns zu jener Stelle an der Mauer, wo wir tatsächlich hinter dem Gestrüpp einen kleinen, mit Backsteinen verdeckten Durchschlupf vorfanden. „So, jetzt viel Glück, aber wartet noch, bis ich auf der Mauer stehe.“
Als er uns von oben ein Zeichen gab, wussten wir, die Luft war rein, und wir konnten annehmen, dass sich jetzt direkt vor der Mauer niemand befinden würde. Wir schoben uns, zusammen mit der mehlgefüllten Blase voraus, durch das enge Loch.
Auf der anderen Seite des Flusses sahen wir große Feuer, um die sich Soldaten versammelt hielten. Sie verbanden gegenseitig ihre Wunden und schimpften lautstark auf uns Ulmer. „Wartet ab! Morgen pusten wir euch samt eurer Mauer weg!“ Dann sangen sie, um sich gegenseitig Mut zu machen. Aber das Gejammer und Gestöhne vieler Verletzter war trotzdem nicht zu überhören. Unsere eigene Wehr zählte nur drei Tote, einige Schwer- und ein paar Leichtverletzte. Das ging noch.
Die Feuer an der Donau erhellten das Wasser etwas, deshalb hielten wir nach einem im Wasser schwimmenden Baumstamm oder einem Gestrüpp Ausschau. Und da trieb auch schon etwas heran. Äste, in sich verkeilt, allerdings etwas entfernt, mehr in der Mitte des Flusses treibend. Wir durften nicht viel überlegen, die Gelegenheit war nicht ideal, aber immerhin ein möglicher Schutz. Nur mit einer dunklen, wollenen Unterhose und einem leichten Hemd bekleidet, glitten wir in das kühle Wasser. Mehr hätte uns beim Schwimmen behindert.
Leise schwammen wir, die Blase vor uns her schiebend, zur Mitte des Flusses. Das Gewicht des Mehls zog sie tatsächlich fast unter die Oberfläche. „Gib mir Deine Hand Georg, ich hab einen Ast.“ Heiner zog mich unter das Geäst und wir versuchten sogleich die Richtung des Gestrüpps zu beeinflussen. Dann eine laute Stimme: „He, Leute, dort schwimmt was im Fluss!“ Sofort duckten wir uns unter die Äste, als auch schon der erste Schuss in das Holz schlug. „Das ist nur Treibgut, Du Esel, vergeude Deine Kugeln nicht!“, hörten wir einen Offizier rufen und dann folgte höhnisches Gelächter. Das Zittern unserer Körper, natürlich nur durch die Kälte bedingt, ließ sich niemand von uns beiden anmerken. „Die Äste werden nicht ganz zum Ufer treiben, lass uns den Rest schwimmen“, flüsterte Heiner. „Ja, dort hinüber, da ist kein Feuer und vermutlich auch keine Wache, wir sind bereits an den Kanonen vorbei“, antwortete ich.
Am Ufer verbarg zwar die Dunkelheit unser Zittern, aber ab und zu vernahm ich jetzt das Klappern unserer Zähne. Und in der Tat, es war lausig kalt und irgendwie vermischte sich diese Kälte mit einer unterschwelligen Angst. Vorsichtig, fast die gesamte Aufmerksamkeit auf unsere Ohren gerichtet, schlichen wir langsam am Ufer zurück in Richtung Lagerfeuer. Das laute Schnarchen eines Wachpostens verriet uns seine Stellung. Er schien sich sicher zu fühlen, aber bestimmt hatte er auch einen anstrengenden Kampf ausgefochten und schließlich musste er am nächsten Tag wieder bei Kräften sein. „Schau, wie süß er seine Kanonen bewacht“, beinahe hätten wir laut aufgelacht. „Georg, lass uns nach oben schleichen, bestimmt stehen da die Fuhrwerke mit den Kugeln und dem Pulver drauf.“ „Ich glaube ich kann es schon sehen“, flüsterte ich.
Natürlich hatten wir keinen Hinterlader bei uns, aber auch der Umgang mit dem eingezwängten Messer am Ledergürtel war uns nicht fremd, wir wussten damit gut umzugehen. Der Soldat schlief immer noch tief, weshalb wir uns um ihn zunächst nicht zu sorgen brauchten. Das Lagerfeuer kam näher und näher. Noch befanden wir uns außerhalb des Lichtscheins, dann sahen wir deutlich die Umrisse eines Fuhrwerkes. Es stand zentral, nur wenig entfernt hinter den Kanonen und war schnell erreichbar. „Kriechen wir seitlich hoch“, flüsterte ich. „Klar, dort bekommen wir, was wir suchen.“
Langsam näherten wir uns dem Wagen, als es plötzlich in der Nähe wieherte. „Verdammt, die Pferde haben uns gewittert.“ Schnell überprüften wir die Windrichtung, indem wir einen Finger im Mund befeuchteten und ihn dann in die Luft hielten. Der Wind war nur schwach zu spüren, doch wir wussten, dass er von Osten kam, wir konnten ihn an der kühlen Seite unseres Fingers spüren. Die Pferde mussten also entgegen dieser Richtung stehen. Zwar hinter dem Fuhrwerk, nur das Problem war jetzt, sie konnten uns trotzdem wittern.
„He, schau mal nach Deinen Pferden, da stimmt was nicht.“ „Ach, was soll da schon los sein, wahrscheinlich ein Fuchs oder anderes Getier, das unser Essen gerochen hat.“ Wir atmeten auf, bewegten uns nun noch langsamer und tief geduckt.
Gott sei Dank, die Pferde hatten sich beruhigt. „Ich geh doch mal schauen“, hörten wir eine Stimme und außerdem muss ich pinkeln.“ Wir konnten uns gerade noch unter den Wagen rollen, als sich die Schritte näherten, neben uns zum Stehen kamen und wir dann ein Geplätscher und Gestöhne hörten. „Da war`s höchste Zeit!“ „Bist halt auch nicht mehr der Jüngste!“, kam als Antwort. „Ja, ja macht euch nur lustig, ihr werdet auch nicht jünger!“ Wieder Gelächter. Die Schritte entfernten sich. „Jetzt Heiner, knöpfen wir die Schweinsblase auf, dann auf den Wagen damit.“ „Georg, klettere Du rauf, einer genügt zum Pulver suchen, sonst quietscht vielleicht die Karre. Ich reich Dir dann die Blase.“ „Gut, ich steige hoch.“
Fast in Zeitlupe stemmte ich mich hoch und zum Glück gab das Gefährt keine Geräusche von sich. Fast kriechend, damit die Soldaten keinen Schatten von mir wahrnehmen konnten, machte ich mich auf die Suche. Nicht lange, dann fand ich das Pulverfässchen. Ich löste den Deckel und flüsterte vor mich hin: “Das stinkt nach Schwefel, gib mir jetzt die Schweinsblase hoch.“ Es war mehr ein Tasten als ein Sehen, doch es gelang. Ich kippte das Mehl aus der Blase in das Fässchen, reichte sie Heiner zurück und schickte ihn zur Donau, um sie mit Wasser zu füllen. Das dauerte, denn, um nicht entdeckt zu werden, musste er fast den ganzen Weg wieder zurückschleichen. Dann landete auch das Wasser im Fässchen, das ich nun mit beiden Händen so lange durchmischte, bis es sich total mit dem Pulver verbunden hatte. „So, erledigt, wir können zurück! Mit dem Pulver schießt keiner mehr. Jetzt heißt es schnell hinüber schwimmen, mir ist es arschkalt.“
Der Rückweg über das Wasser war kein großes Problem gewesen. Immer wieder schwammen Äste vorbei, bis wir uns dann entschlossen, uns an einen Baumstamm zu hängen.
Auf der Ulmer Seite angekommen, tasteten wir uns wieder der Mauer entlang bis zum Durchschlupf. Wir pochten an die Backsteine, die daraufhin sofort weggeräumt wurden. Man empfing uns voller Freude und als wir dem Offizier Bericht erstatteten, jubelten alle, die neugierig um uns herumstanden. Meine Schwester Resa, die hier ängstlich auf mich gewartet hatte, hängte sich freudestrahlend bei mir ein und wir liefen nun beide zu unserem kleinen Häuschen an der Blau, welches unser Vater zusammen mit Freunden vor Jahren errichtet hatte.
Meine Mutter umarmte mich und schluchzte vor Erleichterung und Freude. „Gott sei gelobt, Junge, mutig bist Du, ganz wie Dein Vater.“
Erst als ich im Bett lag, überfiel mich wieder die Erinnerung an mein anderes Leben.
„Wie kann das passieren? Ein Zeitsprung zurück in die Vergangenheit? Meine Gefühle müssen dies ermöglicht haben. Aber mein Körper, den ich nun im Mittelalter besitze? Ist er echt? Habe ich gleichzeitig noch einen anderen in der Zukunft? Ist alles nur ein Traum? Können verschiedene Leben parallel ablaufen? Das ist theoretisch nur möglich, wenn es keine Vergangenheit und keine Zukunft, also auch keine Zeit gibt, ist dies denkbar? Alles geschieht dann in der Gegenwart, im Jetzt.“ So logisch diese Erklärung auch scheint, so unvorstellbar kommt sie mir als Betrachter vor.
Im Augenblick war alles zu viel für mich, einfach unvorstellbar das Ganze. Die Zeit eine Illusion?
Meine Schwester kuschelte sich zu mir ins Bett. „Ich bin so froh, dass Dir nichts passiert ist“, waren ihre letzten Worte bevor ihr die Augen zufielen. „Vielleicht wache ich ja wieder in meinem alten, modernen Leben auf“, dachte ich noch. Aber darauf konnte ich noch lange warten.
„Für Resa bin ich ihr Bruder Georg, nicht erst seit meinem Sprung ins Mittelalter, nein, ich war schon immer ihr Bruder.“
*
Schüsse und Kampfgeschrei weckten uns. Ich sprang in meine Klamotten, rannte ohne etwas zu essen wieder auf meine Station. Was war geschehen? Hatten die Feinde schon bemerkt, was ihnen widerfahren war? In der Tat konnte ich von der Mauer aus sehen, dass einige Männer um ihre Kanonen herumstanden und laut brüllten. Einige schossen mit ihren Gewehren vor Wut in die Luft. Immer wieder schauten sie zu uns, hoben ihre Fäuste und schrien unflätige Worte. Heiner schlug mir auf die Schulter. Ein Schmerz, gemeinsam mit einer Erinnerung durchzuckte mich.
„Na, wie haben wir das gemacht? Bestimmt sind wir jetzt Helden und die Maid werden sich um uns reißen.“ Wir freuten uns wie Kinder. Dann hörte man Kommandos und das Heer mitsamt seinen Verletzten und Toten, die sie auf Fuhrwerken aufgestapelt liegen hatten, sammelte sich auf der anderen Uferseite. Eine Trompete unsererseits ertönte, denn wir dachten, der Kaiser würde einen neuen Angriff starten. Alle eilten wieder zu ihren Posten und nahmen Stellung ein. Aber wie groß war die Freude, wir trauten kaum unseren Augen. Der Kaiser gab sich geschlagen und rückte ab. „Sieg! Sieg!“ schrien die Unseren und lagen sich in den Armen. „Hoffentlich kehren sie heute Nacht nicht mit einem neuen Fässchen Pulver zurück“, gab ich zu bedenken.
Bald darauf wurden Heiner und ich zu einem Empfang im Rathaus eingeladen. Der Bürgermeister Kraft bedankte sich persönlich im Namen der Stadt bei uns. „Das war eine brillante und wirklich gut durchgeführte Idee. Wenn nur alle meine Offiziere so auf Zack wären. Hättet ihr nicht Lust, in unserer Wehr zu dienen?“ Beinahe gleichzeitig schüttelten wir die Köpfe. „Na gut, ihr wollt sicher eure Tätigkeit nicht vernachlässigen, mit diesen zwei goldenen Dukaten möchte ich euch im Namen der Stadt meinen Dank ausdrücken und solltet ihr einmal in Not sein, so werde ich euch gerne zur Seite stehen. Feiert schön mit den Soldaten und den Maid, ich denke, heute wird es auf unserem Marktplatz noch laut werden.“ Er lachte herzlich und streckte uns auch schon wieder seine kräftige Hand entgegen.
„Heiner! Jeder eine Goldmünze,“ „und was für eine, Georg, ich weiß schon, was ich damit anfange!“ „Ich vermutlich auch. Ein neuer, größerer Brennofen muss her.“
Es folgte in der Tat eine lange Nacht vor dem Rathaus. Überall trug man Brennholz zusammen, das von einer Vielzahl kleiner Feuer verspeist wurde. Marktstände nahmen immer mehr Platz für sich in Anspruch und viele Händler sorgten für Speise und Trank. Gaukler, Spielleute und Hübschlerinnen unterhielten die Stadtleute, von denen jetzt immer mehr in schöner Kleidung und hastig gerichtetem Haar zum Tanz herbei geeilt kamen. Alle wollten mitfeiern und viele bedankten sich bei Heiner und mir. Jeder wusste, wie lange eine Stadtbelagerung hätte dauern können und wie viele Opfer sie gekostet hätte. Wir wurden an jedem Feuer willkommen geheißen und mussten unsere Geschichte erzählen. Immer wieder hielt man uns einen Bier- oder Weinkrug mit den Worten vor die Augen: „Hier trinkt, das habt ihr reichlich verdient. Ihr habt viel Schaden verhindert“, oder wir hörten: „Wer weiß, wie viele Leben ihr gerettet habt.“ Ich wollte und konnte die Krüge nicht immer abwehren, denn mein Kopf, der gewöhnlich nicht sehr viel vertrug, fühlte sich bereits trunken an. Mein Blick machte die Runde, mehr und mehr schaute ich mich nach Weibsbildern um.
Eine Hübschlerin kam geradewegs auf mich zu, sie hatte wohl meine innere Unruhe und mein Verlangen beobachtet. Auch war ihr sicher nicht entgangen, dass uns der Bürgermeister belohnt hatte. „Na, mein Lieber, ein Spaziergang zur Donau würde uns wohl ganz gut tun.“ Alle lachten und Heiner, der sich sofort einmischte, antwortete, bevor meine etwas schwer gewordene Zunge auch ein Wort bilden konnte: „Da hast Du vollkommen Recht, nimm ihn mit, sonst dreht er morgen nur unrunde Töpfe.“ Wieder ertönte beifälliges Gelächter, bis auf eine hübsche Maid, die mir erst an diesem Abend zum ersten Mal aufgefallen war. Sie trug langes, lockiges Haar und auf ihrem Gewand deuteten sich Rundungen an, wie ich sie liebte.
Trotz allem ließ ich mich von der Hübschlerin mitziehen, mein innerer Widerstand war schon lange gebrochen und ich muss gestehen, sie verstand ihr Handwerk. Nachdem ich ihr einen Heller überreicht hatte, brachte sie mich sogar nach Hause und flüsterte mir ins Ohr: „Ein hübscher Bursche bist Du, aber ich mag mich nicht binden.“ Lachend huschte sie fort.
Meine Schwester, die noch wach lag, meinen Zustand bemerkt und vermutlich alles mitbekommen hatte, gab meinem Ohr deutlich zu verstehen: „Geh zuerst zum Wasser, Georg, Du stinkst.“
„Es ist schon merkwürdig, wie schnell ich mich in dieses neue/alte Stadtleben einfügen kann“, dachte ich. „Ich vermisse nicht die verlorengegangene Schnelllebigkeit. Weder die Züge und Busse, noch mein Auto oder Fahrrad, ganz im Gegenteil, ich finde es schön, dass das Persönliche zwischen den Menschen im Vordergrund steht. Viele denken zwar einfach aber irgendwie bewegt es mein Innenleben mehr als das oberflächliche Geschwafel aus meiner Zeit. Nun ja, bedenkt man, wie wenig Menschen hier die Mittel und Möglichkeiten besitzen, Lesen und Schreiben zu lernen, dann kann man das verstehen.“
Sobald unbekannte Händler die Stadttore durchfuhren, begleitete sie eine Menschenschar. Zunächst die Kinder, dann die Erwerbslosen. Jeder wollte das Neueste von ihnen wissen. das sie sofort zum Weitererzählen mit nach Hause trugen Und waren die Händler nicht zu müde, um die vielen Fragen der Jungen und Alten zu beantworten, dann konnte man schon einiges an Interessantem in Erfahrung bringen. Der Handel hatte das Wissen und die Neugier über das eigene begrenzte Denken hinaus weit geöffnet. Man wusste auch ohne Zeitung und Fernsehen, dass man in anderen Städten wie Augsburg, Köln und Wien ebenso an großen Kirchenbauten arbeitete. Aber um wirklich spannende Geschichten über Länder und Städte zu erfahren, die hinter den Alpen lagen, wie Italien, Venedig oder Rom, dann musste man sich des Abends nur ins Zunfthaus an der Donau begeben. Dort trafen sich allabendlich die fahrenden Händler und Bootsleute. Sie erzählten und prahlten dabei in angeheitertem Zustand nicht selten über ihre Erlebnisse aus den Ländern, die sie besucht hatten. Von Kriegen, denen sie gerade noch entronnen waren und von gefährlichen Fahrwegen, wo oft Wegelagerer ihr Unwesen trieben. Fast immer wurde dabei übertrieben, aber ein Körnchen Wahrheit steckte in jeder Geschichte. Ich fragte oft nach den Glasurrezepten von Töpfern in anderen Städten und Gegenden, doch dieses Wissen langweilte und deshalb wusste auch kein Händler darüber Bescheid. Sie konnten zwar von schönen Töpfen und Statuen berichten, nur wer von den Händlern interessierte sich schon für ihre äußere Gestaltung?
Mein Vater hatte, als er noch lebte, stets so viel mit seinen Töpferwaren verdient, dass wir Kinder meist an einem reichlich gedeckten Tisch saßen, kaum geflickte Kleider und Hosen tragen mussten und uns im Kloster das Rechnen, Lesen und Schreiben beigebracht werden konnte. Er dachte dauernd voraus und war deshalb sehr darauf bedacht, dass ich einmal das Töpfergeschäft fortführen konnte.
Nach seinem Ableben übernahm ich dankbar die Töpferei, insgeheim aber wollte ich mehr. Ein starkes Verlangen nach Reisen in ferne Länder brachte mich auf den Gedanken, mich vielleicht doch einmal einem fahrenden Händler anzuschließen. Noch traute ich mich nicht, denn wer würde sich um meine Mutter und meine Schwester kümmern? Auch trieb sich viel Gesindel in den Wäldern herum. Sie überfielen oft die Kauf- und Handelsleute und schon manch einer kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Deshalb zögerte auch ich. Mein Leben in so jungen Jahren dieser Gefahr auszusetzen, ließ mich umsichtig bleiben. Trotz allem, ich musste bald handeln.
„Von was sollen dann Mutter und ich leben, wenn Du weg bist? Bitte, tu uns das nicht an, Georg“, flehte meine Schwester, sobald ich auch nur das Geringste von meiner Sehnsucht preisgab. Aber da hatte Resa natürlich Recht. Meine Schwester und ich liebten unsere Mutter. Wir drei gehörten einfach zusammen.
Doch dann ereignete sich etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte. Eines Tages erhielt ich tatsächlich über einen Händler eine Nachricht.
„Du bist doch Georg der Töpfer, der sich im Zunfthaus hin und wieder nach dem Glasurhandwerk für Töpfer erkundigt.“ „Ja, der bin ich.“ „Ich hatte Gelegenheit, einen Töpfermeister im Norden zu befragen. Zunächst winkte der nur ab, dann gab er schließlich doch etwas preis, indem er mich flüsternd wissen ließ: „Das sei ein großes Gebiet, um es wirklich kennenzulernen, sollte man am besten nach Italien reisen, dort gäbe es große Töpfereien, die all das Fachwissen hätten. Man bräuchte, wenn man absolut dichte Töpfe herstellen wollte, Brennöfen mit sehr hohen Temperaturen, die Steine und Asche zum Schmelzen brächten.“ „Was, Steine und Asche? Das ist ja ein Ding.“ „Die Steine müssten ganz fein zu Staub zerstampft werden und dem Ofen sollte zusätzlich Luft zugeführt werden, dass er diese hohen Temperaturen erreichen kann. Man müsste ihn aber vorher gut abdichten. Ach ja, und dem Steinstaub muss man oft noch ein Pulver zugeben, damit es besser ausschmilzt.“ „Was für ein Pulver?“ „Keine Ahnung.“ „Ah, er meinte wahrscheinlich ein Mittel, das das Gesteinsmehl zum Fließen bringt.“
Mehr konnte ich nicht aus ihm herausquetschen, außer vielleicht noch dem Einen. Man müsse viel experimentieren, da jedes Gestein einen anderen Schmelzpunkt und eine andere Farbgebung hätte.“
Da sagte er mir allerdings nichts Neues. Glasurprobenversuche fanden in meinem Ofen zusätzlich bei jedem Brand statt. Doch dieses Gespräch hatte meine Neugier neu entfacht. „Ach, das hätte ich beinahe vergessen, da war noch etwas“, er drehte sich im Gehen noch einmal um. „Du darfst auf keinen Fall Blei in den Glasuren von Trinkbechern verwenden, da es giftig für den Menschen ist. Es lässt die Haare ausfallen und schadet dem Körper. Also halte es von Trink- und Essgefäßen fern aber das weißt Du bestimmt.“ „Ja das ist mir bekannt.“ „Nützt Dir das andere etwas?“ „Na klar“, bedankte ich mich und schenkte ihm einen Topf aus meinem Sortiment. „Oh, danke, wenn das so ist, werde ich noch weitere Erkundigungen für Dich einholen.“ „Das käme mir sehr gelegen, melde Dich einfach wieder, danke Dir.“ Ich verabschiedete mich herzlich.
„Resa, Du musst ab sofort das Töpferhandwerk erlernen! Ich werde bald auf Reisen gehen. Es ist wichtig, Neues in mein Töpferhandwerk zu bringen.“ „Oh nein“, stöhnte sie, „Du weißt doch, „dass ich das nicht kann. Ich hab es doch schon oft versucht.“ „Versuchen reicht nicht, morgen beginnen wir mit dem Zentrieren.“ Resa schaute mich flehend an, aber es half ihr nichts, trotz großer Schwesterliebe blieb ich standhaft. Nur auf diese Weise würde ich mein Vorhaben durchführen können.
Ab und zu vermischten sich noch Bilder aus meiner modernen Zukunft, aber sie verblassten immer mehr.
„Gut, ich kann mich noch an eine damalige Hobbytöpferei erinnern, wahrscheinlich bildet meine mittelalterliche Arbeit den Zugang zu ihr. Alles scheint jedoch schon so weit entfernt. Wieso soll ich mir also darüber Gedanken machen? Wichtigeres steht an.“
Meine spezielle Neugierde über unbekannte Glasurrezepte hing einerseits sicherlich mit dem Wunsch zusammen, andere Länder besuchen zu wollen. Anderseits aber wollte ich auch das ewige Problem mit dem absoluten Abdichten von Gefäßen in den Griff bekommen.
Der gebrannte Ton hielt Flüssigkeiten nicht wirklich. Das einzige was einigermaßen half, war Mehl zu einem dünnen Brei aufzuschwemmen, das Gefäß damit auszuschwenken und danach ordentlich in der Sonne trocknen zu lassen.
Wie mein Vater arbeitete auch ich ganz allein. Nach einer Prüfung durch einen Zunftmeister, bekam er auf einer Papierrolle die Bezeichnung Töpfermeister ausgehändigt. Ich selbst verstand das Handwerk zwar ebenso gut wie er, war allerdings noch zu jung, um den Titel zu erwerben. Vielleicht würde es mir endlich in einer anderen Arbeitsstätte, einer Großtöpferei gelingen. Unsere Zunft wurde schon seit langem von keinem Töpfermeister vertreten.
„Resa, hast Du Zeit? Ich muss Dir noch zeigen, wo ich den Lehm her bekomme und wie ich ihn zu einem brauchbaren Ton aufarbeite.“ „Aber das hat mir doch Vater schon beigebracht!“ „Gut, dann zeig mir jetzt, ob Du es verstanden hast. Komm, wir holen zwei Jutesäcke.“
„Wo würdest Du ihn suchen?“ „Natürlich irgendwo am Ufer der Donau oder an einem kleinen Bach, wo er sich an einer Krümmung abgelagert hat.“ „Das ist richtig, lass uns eine noch unbekannte Stelle im Wald an der Blau suchen!“
Wir fanden einen Ort, wo sich eine dicke Lehmschicht abgesetzt hatte und sogar recht rein von anderem Gestein zu sein schien. Für den Fall, dass der Lehm zu speckig sein würde, nahmen wir auch feinen angeschwemmten Sand mit, um den Lehm damit durchzumischen und ihn zu magern. „Durch Untermischen von feinem Sand reißt der Tonscherben nicht so schnell, bitte merke Dir das.“ Sie schaute mich nicht begeistert an. „Du weißt, dass mich das nicht wirklich interessiert, ich verkaufe lieber die Ware auf dem Markt. Das ist lustiger, man kann sich mit den Leuten unterhalten und muss nicht mit Kreuzschmerzen an der Drehbank sitzen.“ „Resa, lass es uns probieren, ich möchte nicht als Geselle mein Leben in Ulm versauern. Außerdem muss ich auch mal eine andere Luft schnuppern. Ich versprech Dir, nach der Erlangung meines Meisterbriefes komm ich sofort wieder hier her.“ „Ach, aber ich soll hier versauern!“ „Du bist noch jung und hast noch Zeit.“ „Und dann soll ich heiraten, wie die meisten Maid. Kinder kriegen und am Herd stehen, Georg.“ „Was weiß ich Resa, Du bist schließlich eine Frau.“ „Hallo, Georg, wie viele Frauen verdienen sich hier in Ulm völlig selbständig ihr eigenes Brot?“ „Hast ja Recht, aber ich brauche unbedingt den Meisterbrief.“
Am nächsten Tag machte ich Resa mit Übungen vertraut, die der Kräftigung für Hände und Arme dienten und die sie morgens und abends durchführen sollte. „Dann gelingt das Zentrieren besser. Dazu brauchst Du viel Kraft“, riet ich ihr. Doch das sonst so hübsche Lächeln wollte einfach nicht über ihre Lippen huschen. „Wird wohl nichts“, dachte ich schon ein wenig enttäuscht.
Heiner schaute vorbei, überblickte die Lage und schüttelte sofort den Kopf. „Warum muss Resa das Töpfern erlernen? Sie heiratet doch eh bald einen Kerl mit viel Geld, wie mich.“ Resa und ich sahen ihn erstaunt an, dann erkannten wir an seinen lustig zusammen gekniffenen Augenfalten, dass er es nicht wirklich so meinte und wir lachten alle drei.
„Ja, ja, Sprücheklopfer, Du wolltest bestimmt keine wie mich, oder?“ „Wer weiß, vielleicht, wenn ich genug Geld mit dem Tuchhandel verdient habe. Eine hübsche Braut gäbest Du sicher ab.“ „Jetzt aber genug mit dem Bauchgepinsle, Resa wird ja schon ganz verlegen.“ Resa drehte sich schnell um und verschwand im Haus. Niemand sollte die Röte sehen, die an ihrem Hals bis ins Gesicht hochstieg.
„Sag mal, Heiner, Du kommst doch mit Deinem Tuch bis nach Norden an den Rhein, dort gibt es ganz bestimmt auch größere Töpfereien? Denkst Du, ich könnte Dich dabei einmal begleiten?“ „Na klar, Du Spaßvogel, bist doch mein bester Freund. Musst Dir nur eine Armbrust oder einen Hinterlader zulegen. Es ist nie ungefährlich.“ „Mit dem Bogen verstehe ich ganz gut umzugehen. Wann fährst Du denn wieder?“ „Denke im Frühjahr, bis dahin haben wir unsere Flachsernte aus dem letzten Jahr zu Garn verarbeitet.“ „Gut, vielleicht bin ich bis dahin auch mit Resa soweit.“
„Mutter, ich möchte im Frühjahr mit Heiner in den Norden, um mir neue Ideen im Töpfern und Glasieren anzueignen und vielleicht sogar den Meisterbrief zu erwerben, was meinst Du dazu? Besitzen wir so viel Rücklagen?“ „Ja weiß ich´s denn?“ „Du solltest es doch wissen, das Geld verwaltest ja schließlich Du.“
„Muss mal nachschauen, vielleicht reicht das Zurückgelegte für ein paar Wochen. Du müsstest schon noch einen weiteren Vorrat an Töpfen, Bechern u.a. Dingen anlegen. Doch sollte Dir etwas passieren, dann weiß ich auch nicht. Was soll dann aus Resa und mir werden?“
Da war es wieder, das schlechte Gewissen. Es zieht sich wohl durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende. Eine menschliche Eigenschaft, die wohl die Gemeinschaft schützen soll und gleichzeitig den Fortschritt hemmt.
„Ich werde schauen, was sich machen lässt, Mutter, sorge Dich nicht.“
Am nächsten Tag feierten Kirche und Stadträte die Grundsteinlegung einer neuen Kirche. Die alte Pfarrkirche lag außerhalb der Stadt und deshalb ein gefundenes Fressen für Diebe und Gesindel. Sie sollte nun innerhalb der Stadtmauer neu errichtet werden. Da es eine Eigenschaft bzw. ein Privileg für alle Kaiser zu sein schien, sich immer neuen Besitz während ihrer Amtszeit anzueignen, war es kein Wunder, dass sich auch Karls gierige Augen wieder einmal auf Ulm richteten. Er versuchte über zusätzliche Abgaben seinen Staatssäckel aufzufüllen. Kriege kosteten schließlich Geld, viel Geld.
Doch die schlauen Ulmer Stadträte hatten im Voraus alles Wertvolle der alten Kirche in die Stadt bringen lassen und teilten dem Kaiser mit, dass sie sich als eine eigenständige Reichsstadt nicht für besondere Abgaben verpflichtet fühlten. Sie müssten sich schließlich bei Angriffen von außen immer mit einer eigenen Wehr selbst verteidigen.
Ich gesellte mich zu den Schaulustigen. Viel Spenden seien nötig und die Steine der alten Pfarrkirche müsste man für den Bau mitverwenden, soviel hatte ich verstanden. Ich selbst hielt nicht viel vom kirchlichen Zauber. Das Ganze erschien mir zu fanatisch, zu viel mit den Worten: „Haben wollen“, besetzt. Außer dem nicht wirklich beweisbaren Glauben, mit dem so oft Schindluder getrieben wurde, gab es absolut keine Begründungen für die unersättliche Gier des Klerus. Selbst die Reden aus der Bibel, wo immer das Geben als Gott gewollte gute Tat im Vordergrund allen menschlichen Verhaltens stehen sollte, beeinflussten meine Einstellung nicht, denn die Bibel ließ sich immer so auslegen, wie sie gerade jemandem dienlich erschien. Trotz allem verstand ich, dass für viele Menschen, besonders im Alter und bei Erkrankungen, der Glauben Halt und Trost verlieh. Das war sogar mir schon in meinen jungen Jahren einsichtig.
Nun gut, dass es da mehr geben musste, hielt ich für denkbar, schließlich sah ich in der Existenz von uns Menschen genug Beweis.
Ich bedauerte sehr, dass die Sammlungsfrauen dem Kirchenbau aus der Stadtmitte weichen mussten. Sie verkörperten eine gute und allzeit wohltätige Sache. Zum Glück erhielten sie einige Zeit später von der Stadt eine gute Abfindung und als Wohnsitz ein neues Gebäude an der Neuen Straße.
„Wie lange wird es dauern, bis die Kirche steht?“ fragte ich einen Mönch, der in meiner Nähe stand. Dieser lachte: „Für die alte Pfarrkirche benötigten die Erbauer zwanzig Jahre bis sie endlich fertig stand. Diese neue Kirche soll aber dreimal so groß werden. Also, wenn Dir das Rechnen nicht fremd ist“, er unterbrach sich, schaute mich an und lächelte etwas überheblich. „Dann wird es wohl sechzig Jahre dauern und wir beide werden die Fertigstellung nicht miterleben“, antwortete ich schnell. Jetzt blickte mich der Mönch erstaunt an. „Ja, da dürftest Du Recht behalten.“ Dann wandte er sich schnell ab.
Schon die Ausgrabungen der Grundfeste dauerten zwei Jahre. Viele Fuhrwerke wurden benötigt, die Tag für Tag den ausgehobenen Boden für die neue Kirche wegfuhren und danach die Steine der abgetragenen alten Pfarrkirche in die Stadt transportierten. Sie würden auf jeden Fall wiederverwendet werden.
Nach jeder Predigt hörte man die Klingelbeutel, wie sie weitergereicht wurden. Man rief jetzt vermehrt zu Freisprechungen von Sünden auf, natürlich nur gegen ein ordentliches Bußgeld. Außerdem verkaufte man im Voraus Altäre für gut betuchte Patrizier, die mit der Inschrift seiner Spender versehen würden. Das dafür erhaltene Geld fand natürlich den gleichen Weg in den Bau der Kirche sowie in den Unterhalt des Klerus.
Zufällig schnappte ich ein paar Fetzen des Gesprächs zwischen Baumeister Parler und dem Bürgermeister Kraft auf. „Den höchsten Kirchturm des ganzen Landes, ja der ganzen Welt soll unsere Kirche erhalten, dafür werden ich und meine Nachkommen sorgen. Unsere schöne Stadt hat es sich verdient.“ Auch die anwesenden Stadträte nickten bei-fällig. „So ein Blödsinn“, dachte ich, „der ganzen Welt, was weiß der Bürgermeister schon von der ganzen Welt?“
Und dann tauchte ihr liebreizendes Gesicht plötzlich zwischen den Anwesenden wieder auf. Meine Augen trafen die ihren. Schnell blickte sie zu Boden. „Also hat auch sie mich wahrgenommen. „Wieso ist sie mir in Ulm noch nie aufgefallen?“, dachte ich.
„Sie ähnelt einer jungen Frau aus der Neuzeit, die ich sehr gut kenne“, antwortet eine innere Gewissheit.
„So, wie sie gekleidet ist, stammt sie sicher aus gutem Hause.“ Eine ebenfalls junge Frau, mit der sie sich angeregt unterhielt, wohl eine Freundin, stand ihr gegenüber. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie sie beide ab und zu in meine Richtung blickten. „Sie sprechen über mich, das kann etwas bedeuten.“ Wie als Antwort, begann mein Herz zu klopfen.
Ulm ließ sich nicht nachsagen, es sei eine armselige Stadt. Ganz im Gegenteil, überall wusste man um das „gut betuchte“ Ulm. Auch was die Sauberkeit in Ulm anbelangte, sorgte außerhalb der Stadt für großes Ansehen. Die ganzen Kloaken der Stadt wurden unterirdisch entsorgt. Selbst die Wasserversorgung war einmalig. Viele Brunnen förderten sauberes Wasser ins Innere und so mancher Patrizier ließ sich einen Abzweig für das eigene Anwesen ausheben. Auch den Armen und Bettlern gewährte man Schutz. Mit Hilfe von einem an der Kleidung befestigten „Heiligen Blechle“, das ihnen die Stadt verlieh, durften sie in der Öffentlichkeit betteln.
Was das Bauen der Kirche anbelangte, hätte ich bestimmt mithelfen können. Mein Vater bildete mich nicht nur zum Töpfer aus, ich hatte auch an unserem Hausbau viel mitarbeiten dürfen und verstand dadurch einiges. Doch ein innerer Widerstand ließ mich von dieser ganzen Glaubensgeschichte Abstand halten.
„Wenigstens beerdigt man jetzt, wo in der Stadt durch den Neubau der Kirche der Platz für Gräber immer knapper geworden war, die Verstorbenen außerhalb der Mauer“, dachte ich. Ein kleines, notwendiges Zugeständnis der Kirche.
„Mutter!“ „Ich hänge gerade die Wäsche auf!“ „Was hältst Du davon, wenn ich unser Dach mit Tonplatten bestücken würde, dann werden bei Regen und Schnee die Decken in den Zimmern nicht mehr feucht?“ „Junge!“ antwortete sie. „Das ist doch viel zu langwierig. Du müsstest viel zu oft den Brennofen aufheizen. Wo willst Du denn das ganze Brennholz her bekommen, das kostet doch alles viel zu viel!“ „Lass mich nur machen, ich hab da so eine Idee.“
Resa half mir beim Sammeln von angeschwemmtem Holz aus der Donau. „Das wird mir eine Zeit lang reichen. Resa, könntest Du Heiner für den Transport des Holzes nach einem seiner Fuhrwerke und einem Pferd fragen?“ „Klar, mach ich gerne.“
Meine Mutter kannte sich mit meiner Arbeit nicht so gut aus. Der kleine, selbstgefertigte Brennofen verbrauchte nicht so viel Brennmaterial, wie sie dachte, außerdem besaß ich vom Köhler noch genügend Holzkohle. Mein Vater hatte unseren Ofen mit Absicht kleiner gehalten, als dies sonst bei Brennöfen üblich war. Er besaß anderen Öfen gegenüber den Vorteil, öfter mit unterschiedlichen Materialen bestückt werden zu können und gleichzeitig brauchte ich nicht zu lange auf seine Abkühlung warten.
Mit den Dach-Tonplatten wollte ich gleichzeitig Versuche mit unterschiedlich hohen Temperaturen durchführen, um beobachten zu können, wie sich der Ton dabei in seinen Eigenschaften veränderte. Ein Problem stellte noch die stärkere Zuführung von Luft und die perfekte Abdichtung des Ofens dar, denn ich benötigte wirklich sehr hohe Temperaturen. Ich erkundigte mich beim Schmied, der ja schließlich Hufeisen zum Glühen bringen musste.
„Da benötigst Du einen besonderen Blasebalg, der die Luft von unten in Deinen Ofen bläst. Wird aber nicht einfach werden, denn den musst Du durch andauerndes Drauftreten bedienen, weil er fortwährend viel Luft erzeugen muss. Du kannst ihn ja nach dem Vorbild meines Handblasebalgs anfertigen. Er muss halt groß genug sein, damit Du ihn mit dem Fuß bedienen kannst. Ich kann es Dir gerne zeigen.“
Nun musste ich mir nur noch über die Form der Tonplatten sowie über ihre Herstellung Gedanken machen. Sie sollten so ausgearbeitet sein, dass falls es regnen würde, sich das Wasser nicht unter ihnen aufstaute, sondern schnell ablaufen konnte. Aber da hielt ich durch meine Erinnerung an die Neuzeit Unterstützung. Ich bewunderte oft während meiner südländischen Urlaube die Dachplatten der Häuser. Sie besaßen eine halbrunde, leicht konisch zulaufende Form. Mit Hilfe vorgefertigter Holzmodel, ließen sie sich bestimmt leicht und schnell herstellen. Und schon strömten wieder neue Gedanken ein, die meinen derzeitigen Aufenthalt im Mittelalter zu rechtfertigen versuchten.
Wie konnte dieser Zeitsprung überhaupt geschehen? Ich vertrat hier ein Leben, das mir eigentlich hätte fremd sein müssen. Doch lebte ich es mit einer Selbstverständlichkeit, als ob ich nie etwas anderes getan hätte. Der Augenblick des Glockenschlages, bei dem mein mittelalterliches Leben in Erscheinung trat, suchte wieder einmal nach einer Erklärung. Doch empfand ich ihn in eine weite Entfernung gerückt. Wie hinter einem undurchsichtigen Nebel der Vergessenheit. Der Drang wieder zurückzuwollen, bestand nicht wirklich. In manchen Situationen jedoch, besonders bei Problemen, die einer technischen Lösung aus der Neuzeit bedurft hätten, ertappte ich mich, wie ich versuchte, Erkenntnisse aus der modernen Zeit wachzurufen, öfter dachte ich dann: „Wenn ich nur eine Bohrmaschine oder eine richtige Säge hätte“ oder „alles ginge mit einer Kettensäge wesentlich schneller und präziser“, und so fort.
Hatte ich mich in zwei Persönlichkeiten aufgespalten, eine, die in der Neuzeit lebte und die andere im Mittelalter? Zwei Körper an zwei zeitlich verschiedenen Orten, wie sollte das möglich sein? „Ein geistiges Rätsel, vorerst nicht zu lösen“, riet mir mein Gehirn. „Abwarten, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit.“ Ich musste mich auf das Hier und Jetzt voll und ganz einlassen, sonst, so vermutete ich, würde alles im Chaos enden.
Resa konnte oder wollte sich tatsächlich nicht zu einer Töpferin ausbilden lassen. Sie stellte sich so tollpatschig an, dass mir die Lust verging, mit ihr weiter zu üben. Erst als ich nach einem jungen, willigen und talentierten Burschen Ausschau hielt und auch einen gefunden hatte, stieg bei ihr das Interesse.
Eines Tages stand der Pfarrer vor der Haustüre. Meine Mutter bat ihn umgehend ins Haus. „Herr Pfarrer, was kann ich für Euch tun?“ „Ein von Gott gewollter Gedanke schickt mich und ich weiß, dass Du und Deine Tochter sehr gläubige und treue Kirchengängerinnen seid. Nun ja, Euer Sohn ist ja immer viel bei der Arbeit, das Töpfern, eine aufwändige Tätigkeit, da bleibt oft nicht die Zeit, sich der Ansprache des Herrn hinzugeben.“
Ich hatte im Nebenzimmer gelauscht und mir missfiel seine Redensart, diese einschleichende Art von Schuldzuweisung. Was sollte diese Schlüpfrigkeit? Ich wusste wieso das Blut in meinem Kopf plötzlich zu pochen anfing. „Kommt doch herein, ich hole etwas Wein und Brot, dann können wir Euer Anliegen besprechen.“ Der Pfarrer nickte. Spürbar dankbar, betrat er, bedächtigen Schrittes mit gefalteten Händen unsere Stube. Er begab sich sogleich an den Tisch und begrüßte mich, als wäre ich die größte Nebensache der Welt, dann meinte er: „Nicht, dass ich mich beklagen wollte, Georg, versteh mich nicht falsch. Ich schätze Deine anstrengende Tätigkeit sehr und ein Kirchgang, bei Deinem Mangel an Zeit, kostet sicher viel Überwindung. Trotzdem möchte ich Dich, im Namen unseres Vaters und seiner Kirche, um einen Gefallen bitten, der Deine Versäumnisse sicher ins rechte Lot rücken könnte.“ „Immer zu Euren Diensten, Herr Pfarrer. Was kann ich einfacher, so oft unvernünftiger Mensch, für Euch tun?“ Meine Mutter stellte Brot, Käse und einen Krug mit Wein auf den Tisch. Seine Augen stimmten willig ein. „Ein schöner Krug, der Henkel, der Ausguss, alles sehr stimmig. Sicher stammt er aus Deiner Werkstatt.“ Ich nickte, das Gesäusel ging mir auf den Geist. „Du weißt doch bestimmt um die Unterbringung in unserem Franziskaner-Orden.“ Ich nickte wieder. „Dort ist während eines Umbaus ein Missgeschick passiert, wobei viel unseres Geschirrs, Teller, Becher, Krüge und Schalen kaputt oder angeschlagen wurden.“ „Oh, das tut mir leid“, brachte ich nur mühsam über die Lippen, wohl wissend, was bevorstand. „Ja, und nun meine Bitte. Wäre es möglich von Dir neues Geschirr zu erhalten, natürlich gegen eine entsprechende Vergütung?“ Ich wusste um die Vergütungen seitens der Kirche. „Ein Almosen, nicht mehr“, dachte ich. „Natürlich geht das, Herr Pfarrer, wenn es nicht gleich morgen sein muss. Der ganze Herstellungsablauf, die Trocknung und dann das Brennen dauern. Könntet Ihr mir vielleicht in den nächsten Tagen eine Aufstellung zukommen lassen?“ „Selbstverständlich habe ich daran gedacht und vorgesorgt.“ Er zog ein Papier aus seinem Wams und überreichte es mir. Ich überflog es. Vor Schreck brachte ich kein Wort mehr über die Lippen. Meine Mutter, die mich die ganze Zeit beobachtete, erkannte die Lage sofort und lenkte den Pfarrer ab, indem sie für mich antwortete. „Für das Gemeinwohl der Mönche, Herr Pfarrer, wie könnte da mein Sohn ablehnen.“ Der Pfarrer, der jetzt immer öfter und reichhaltiger sich am Brot und Käse bediente und den Becher durch seinen hastigen Griff beinahe zum Überschwappen brachte, strahlte. Mit vollen Backen brunstete er: „Das freut mich und unseren Orden sehr. Wir werden uns nicht lumpen lassen.“
Das hatte noch gefehlt, ausgerechnet jetzt, wo mir die Arbeit eh bis zum Halse stand.
Der Pfarrer ließ nichts übrig. „Wahrscheinlich stammt sein Bäuchlein von derartigen Botengängen“, dachte ich missgünstig, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu empfinden.
Nachdem er sich bedankt und verabschiedet hatte, verschwand er wie ein Schatten in der Dunkelheit. Endlich konnte ich Reiner, dem Neuling, die Arbeit an den Dachplatten anvertrauen. Auch Resa war plötzlich ganz angetan und half mit. Ich bemerkte, wie die beiden keine gewöhnlichen Blicke tauschten.
Meine vorgefertigten Schablonen vereinfachten die Fertigung der Dachplatten. Man musste den Ton nur mit den Händen zu Würsten formen. Alle gleich lang, gleich dick und sie dann mit einem Rundholz flach zu einem Rechteck ausrollen. Die Platten legte man danach über die konisch zulaufenden, halbrunden Holzmodelle und ließ sie dort antrocknen. Während des Trocknens lösten sie sich von alleine vom Holz. Würde man nun diese schalenförmigen Platten abwechselnd seitlich ineinander legen, so konnte man sicher sein, dass mit diesem System und wenn es noch so stürmte, kein Wasser unter den Platten ins Haus gelangen würde.
Meine zwei Mithelfer gaben sich bei der Beschaffung des richtigen Tones viel Mühe. Sie kamen sich dabei immer näher und zu meiner Freude erwuchs daraus eine gute Freundschaft. Während sich bei den beiden immer mehr Dachplatten anhäuften, arbeitete ich langsam den Auftrag des Pfarrers ab. Ich begann mit dem Drehen einfacher Trinkbecher. Dies war gleichzeitig eine gute Gelegenheit den jungen Buschen auf der Töpferscheibe einzuweisen. Er war eifrig dabei, stellte sich gut beim Zentrieren des Tones an und half mir oft über die Zeit hinaus. Für das ganz exakte Zentrieren würde er noch längere Zeit benötigen. Das Hochziehen der Wände dagegen beherrschte er erstaunlicher Weise rasch. Nur das gleichzeitige Bedienen des Schwungrades, das dauernd mit den Füßen gedreht werden musste, machte ihm etwas zu schaffen. Mal lief es zu schnell, mal zu langsam, was natürlich wiederum das gleichmäßige Hochziehen der Wandung beeinflusste. Das Zusammenspiel von Händen und Füßen musste erfühlt werden. Doch alles in allem freute ich mich über seine Fortschritte und lobte ihn. Ich baute mit ihm zusammen eine zusätzliche Töpferscheibe und wuchtete das Schwungrad mit besonders großen Steinen so exakt aus, dass er hier wesentlich besser die Geschwindigkeit halten konnte. Sie lief so gut, dass ich für Resa noch eine weitere Töpferscheibe anfertigte. Durch das intensive Arbeiten des Auszubildenden angespornt, kam auch sie jetzt auf den Geschmack.