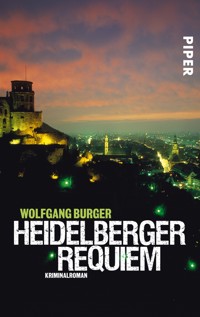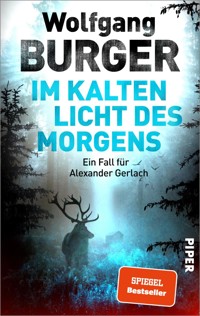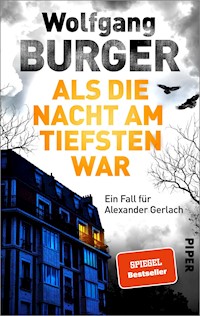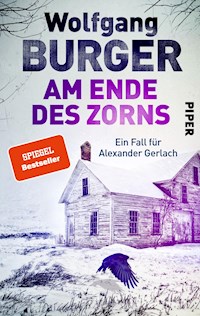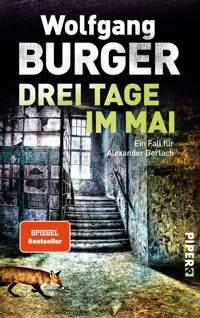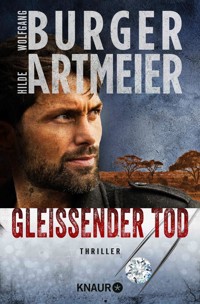
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marc-van-Heese-Thriller
- Sprache: Deutsch
Ein rasanter Thriller über Korruption in Afrika und dunkle Machenschaften vom Bestseller-Autor Wolfgang Burger und seiner Frau Hilde Artmeier Ein Konvoi mit wertvoller Fracht gerät in Nigeria in einen Hinterhalt – ein Fahrer stirbt, zwei Männer verschwinden. In einem Flugzeug von Lagos nach Frankfurt sitzt ein Passagier – er ist verletzt und offenkundig auf der Flucht. Von seiner Sitznachbarin, einer ebenso schönen wie redseligen Rothaarigen, ist er zunächst nur genervt. Als sie in Deutschland jedoch immer wieder seinen Weg kreuzt, steigen Zweifel in ihm auf: Welche Rolle spielt Linda wirklich – gehört sie in Wahrheit zu seinen Verfolgern? Eine atemlose Jagd quer durch Europa beginnt, bei der am Ende niemand gewinnen kann. Ein spannender Thriller mit internationalem Setting, bei dem die Fetzen fliegen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wolfgang Burger / Hilde Artmeier
Gleißender Tod
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Mann ist auf der Flucht. Offenbar wird er gejagt – und das nicht nur von einer Seite. Als er im Flugzeug von Lagos nach Deutschland die zwielichtige Belinda Marie kennenlernt, ist er zunächst nur genervt von der ebenso schönen wie redseligen Rothaarigen. Doch welche Rolle spielt sie wirklich – gehört sie in Wahrheit zu seinen Verfolgern?
Für die beiden beginnt eine Jagd auf Leben und Tod, die mehr als einmal zu dramatischen Situationen führt.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Teil
Lagos, Nigeria – Sonntag, 6. September
Flug LH 569 von Lagos, Nigeria, nach Frankfurt am Main – zur selben Zeit
Lagos
Flug LH 569
Lagos
Flug LH 569
Frankfurt am Main
Lagos
Frankfurt am Main
Lagos
Frankfurt am Main
Lagos
Frankfurt am Main
Lagos
Göttingen – Montag, 7. September
Lagos
Göttingen
Lagos
Göttingen
Lagos
Göttingen
Lagos
Göttingen
Lagos
Göttingen
Köln
Göttingen
Köln
Göttingen
Köln
Göttingen
Köln
Lagos
Köln
Lagos
Köln
2. Teil
Göttingen
Lagos
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland – Dienstag, 8. September
Lagos
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland
Lagos – Mittwoch, 9. September
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland
Lagos – Donnerstag, 10. September
Im Münsterland
Lagos
Im Münsterland
3. Teil
Im Münsterland
Lagos, Banana Island
Im Münsterland
Lagos
In der Nähe der holländischen Grenze
Lagos
Arnheim
Lagos
Arnheim
Lagos
Arnheim
Lagos – Freitag, 11. September
Arnheim
Lagos
Arnheim
Paris
Lagos
Rotterdam
Lagos
Rotterdam
Rotterdam – Samstag, 12. September
Paris
Im Zug nach Antwerpen
Lagos
Antwerpen
Lagos
Antwerpen
Lagos
Antwerpen
Lagos
Antwerpen
Im Münsterland – einige Tage später
Danksagung
Für unsere Kinder Amelie, Charlotte, Johanna, Marlene und Sebastian
1. Teil
Lagos, Nigeria – Sonntag, 6. September
Drei Tage! Drei verfluchte Tage sind seit dem Überfall vergangen, dachte Steven Huntington zähneknirschend, und der zerschossene Range Rover stand immer noch am Rand des Expressway 1 von Lagos nach Ibadan. Fast die Hälfte der verlorenen Zeit hatte es gedauert, um in diesem von allen guten Geistern verlassenen Land einen Abschleppwagen zu organisieren, der jetzt mit qualmendem Auspuff und aufgeregt zuckenden gelben Lichtern neben ihm stand.
Nun aber sollte der Rover beziehungsweise das, was noch von ihm übrig war, endlich auf das umzäunte und bewachte Gelände der Firma geschafft werden. Der Ort des Überfalls befand sich nur etwa zwei Kilometer nordöstlich der Kreuzung des E 1 mit der A 1. Nicht weit von dem Punkt, wo die vierspurige und miserabel instand gehaltene Autobahn begann, sich durch den Wald zu kämpfen. Durch diesen so irrwitzig schnell wachsenden Urwald, der unablässig und mit gieriger Verbissenheit versuchte, von dem ihm so mühsam entrungenen Terrain wieder Besitz zu ergreifen.
Der Rover war dunkelblau, stand quer zur Fahrtrichtung und mit der Vorderachse in einem Wassergraben, der die Fahrbahn vom Dickicht trennte. Auf der durchlöcherten Fahrertür war in goldenen Buchstaben der Name der Firma zu lesen: Euro Mining SA, Lagos, Nigeria. Es stank nicht nur nach den Dieselabgasen des rostigen Abschleppwagens, sondern auch nach denen der schweren Lkws, die unentwegt an Huntington vorbeidonnerten und seine Hosenbeine zum Flattern brachten. Es stank nach Fäulnis, nach sumpfigem Morast und Verwesung, als würde irgendwo in der Nähe ein totes Tier liegen. Oder die Leiche eines Menschen. Auf der Betonpiste des Expressway dampften noch große Pfützen vom letzten Regenguss, der vor einer halben Stunde so plötzlich geendet hatte, wie er losgebrochen war. Inzwischen brannte längst wieder diese unbarmherzige Sonne vom grellweißen Himmel herab.
6. September. Sonntag. Noch immer war Regenzeit. Nach deren Ende würde es jedoch keineswegs besser werden, sondern nur anders. Dann begann der Harmattan, dieser wüstentrockene, sandgesättigte Nordwind aus der Sahara, der einem die Poren, die Lungen und die Nerven verklebte und die Menschen wahnsinnig machte, wenn sie es nicht ohnehin schon waren.
Trotz der mörderischen Hitze und atemberaubenden Luftfeuchtigkeit trug Huntington einen seiner edlen Anzüge aus Kammgarnwolle, die er sich regelmäßig von Anderson & Sheppard schicken ließ, seinem Schneider in der Londoner Savile Row, dem er nun schon seit bald zwanzig Jahren die Treue hielt. Nur selten hatte eines der dort notierten Körpermaße geändert werden müssen. Trotz seiner einundvierzig Jahre war der in Liverpool geborene Engländer immer noch schlank und durchtrainiert. Trotz der menschenunwürdigen Umgebung, in der er seit Jahren lebte, ging er niemals unrasiert oder nachlässig gekleidet aus dem Haus. Und ohne sich zuvor zwei Tropfen Oud & Bergamot von Jo Malone an den Hals getupft zu haben.
Das räderlose Heck des Rover ragte albern in die Luft. Und der Wagen sah tatsächlich noch deprimierender aus als gestern Vormittag, als Huntington ihn zum ersten Mal besichtigt hatte. Auch gestern war er schon von Schüssen durchsiebt, der Innenraum voller Blut, ansonsten jedoch noch weitgehend komplett gewesen. Jetzt fehlten nicht nur Scheinwerfer und Rücklichter, sondern auch die Spiegel, Scheibenwischer, alle vier Räder, sogar die Motorhaube, einfach alles, was sich ohne größere Mühe demontieren und auf dem schwarzen Ersatzteilmarkt des Molochs Lagos zu Geld machen ließ.
Was ebenfalls fehlte, waren die beiden Schwarzen, die das Fahrzeug bewachen sollten, bis Huntington eine Transportmöglichkeit organisiert hatte. Vermutlich hatten die Schlitzohren sich ausgerechnet, dass sich mit dem Verhökern der Fahrzeugteile erheblich mehr verdienen ließ als die zwanzig Dollar, die er ihnen pro Tag und Nase versprochen hatte.
Der andere Rover, die Vorhut des kleinen Konvois, in welchem die vier Securitymänner gesessen hatten, war seit der Schießerei spurlos verschwunden. In dem Wagen, vor dessen kläglichen Resten er jetzt stand, hatten Benoît Ducasse und Marc van Heese gesessen sowie ihr einheimischer Fahrer Henry. Nicht nur der Fahrersitz, auch die Rückbank war blutgetränkt.
Die vier mit G3-Gewehren von Heckler & Koch bewaffneten Beschützer, auch sie Schwarze, hatten es wahrscheinlich vorgezogen zu türmen, als die Knallerei losging. Benoît selbst, einer von Huntingtons Untergebenen, hatte die vier Halunken angeheuert. Für zwei Tage. Einen Tag Hinfahrt, Übernachtung in Shagamu, am zweiten Tag Rückfahrt ohne die kostbare Fracht. Aber dann war die Fahrt nach kaum mehr als einer Stunde schon zu Ende gewesen.
Auch die Leiche des Fahrers Henry, die gestern noch im Wagen gelegen hatte, war inzwischen verschwunden, vermutlich von seiner Verwandtschaft fortgebracht, um sie entsprechend Gott weiß welchem Vodun-Ritus zu bestatten. Und selbstverständlich war auch der Aktenkoffer aus hellem Kalbsleder nicht mehr da, dessen Inhalt den Anlass dieser so rasch wie katastrophal geendeten Fahrt bildete. Am linken der beiden Plätze, auf denen Huntingtons Kollegen Benoît und Marc gesessen hatten, war deutlich mehr Blut zu sehen als am rechten. Wer wo gesessen hatte, war Huntington nicht bekannt.
»Fuck me sideways!«, fluchte er ganz entgegen seinen britischen Gewohnheiten lauthals und trat mit Schwung gegen den linken hinteren Kotflügel des schweren Wagens.
Jedem der wenigen Menschen, die davon wussten, war klar gewesen, dass der Transport so wertvoller Fracht per Auto durch den nigerianischen Busch nicht ungefährlich war. Deshalb ja auch die vier sogenannten Beschützer im ersten Rover. Überall am Expressway lauerten Wegelagerer, Gelegenheitsganoven, die auf ihre Chance hofften, auf den großen Fang, der in diesem Fall ja nun leider geglückt war.
Je weiter man nach Osten fuhr, tiefer in den Busch hinein, desto schlimmer wurde es. Dies war der Grund für eine eiserne Regel, an die sich jeder Trucker hielt, der auf dem Expressway unterwegs war und an seinem Leben hing: Niemals anhalten! Gleichgültig, ob eine Ziegenherde sich auf der Straße tummelte oder spielende Kinder oder zehn um Liebe bettelnde nackte Frauen – niemals, niemals auf offener Strecke anhalten.
»What a bloody fucking shit!«, fluchte er wieder. Dieses Mal trat er jedoch nicht gegen den Kotflügel, da sein rechter Fuß noch vom ersten Mal schmerzte.
Nach einem Blick auf seine Armbanduhr von Maurice Lacroix gab er dem Fahrer des schrottreifen Abschleppwagens, der die ganze Zeit neben ihm gestanden und seinen Wutausbruch interessiert beobachtet hatte, seine Anweisungen. Er zeigte dem nur gebrochen Englisch sprechenden Halbidioten die Stelle, an der er das Zugseil befestigen konnte. Halb vier war schon vorbei. Zeit, endlich wieder in seinen geliebten und gut klimatisierten Jaguar XJ 12 zu steigen und in die Stadt zurückzukehren. Der nächste schwer beladene Sattelschlepper donnerte fast auf Tuchfühlung an Huntington vorbei in Richtung Zentralnigeria, und in diesem Moment begann die Schießerei.
Ohne eine Sekunde nachzudenken oder auf seinen teuren Anzug zu achten, warf er sich auf die staubige Straße, zückte im Fallen seine Walther PPK, entsicherte sie, während er sich unter das Heck des zerstörten Wagens rollte, in dem vielleicht vor drei Tagen zwei seiner Kollegen gestorben waren. Dummerweise hatte er keinen Schimmer, woher die Schüsse gekommen waren, wer sie abgegeben haben könnte, wohin er zielen sollte. Was er wusste, weil es offensichtlich war: Den Fahrer des Abschleppwagens hatte es erwischt. Der lag wenige Schritte von ihm entfernt am Boden und regte sich nicht mehr.
Ein Diesel brüllte auf.
Flug LH 569 von Lagos, Nigeria, nach Frankfurt am Main – zur selben Zeit
Festhalten! … Der Wagen bockt und springt, rumpelt … Wir kommen von der Straße ab … Blech kracht, Kugeln pfeifen, Glas splittert, autsch, verdammt! … Henry!
Aber nein, ich sitze nicht im Range Rover, wird mir im Moment des Aufwachens klar. Kein Mensch schießt auf mich.
Ich sitze in der First Class einer A340, die offenbar soeben in ein Luftloch gesackt ist. Muss wohl ein wenig eingenickt sein und …
Und wer zur Hölle ist die Vogelscheuche neben mir?
»Jessas Maria!«, sagt sie mit heller Stimme und strahlt mich aus klaren graublauen Augen an. »Ganz schön holprig, die Luft heut, gell?«
Viertel vor fünf. Als wir um halb zwei vom Murtala Muhammed Airport in Lagos abgehoben haben, war der Gangplatz neben mir noch leer. Ich muss ziemlich lange geschlafen haben. Kein Wunder nach den anstrengenden Tagen.
»Wanzl«, sagt sie und hält mir ihre schmale Rechte hin. Sie hat langes hexenrotes, leicht gewelltes Haar und ein blasses, sommersprossiges Gesicht mit Sonnenbrand auf der etwas zu langen Nase. »Linda Wanzl. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht erschreckt.«
Ein Blick aus dem Fenster: über mir dieser immer wieder unfassbar tiefblaue Himmel. Glücklicherweise sitze ich auf der Schattenseite. Unsinn, natürlich nicht glücklicherweise. Ich sitze immer auf der Schattenseite. Schließlich weiß man ja vorher, in welche Richtung der Flieger fliegt. Zehn Kilometer unter mir ist nichts als Sand. Gelber, manchmal grauer, manchmal rötlicher Sand, so weit das Auge reicht. Diese elende Sahara, die mit ihrer Thermik gerade ein wenig den Flieger durchschüttelt.
»Sie sind nicht gerade der große Kommunikator, was?«, fragt Linda Wanzl und zieht ihre Hand wieder ein. Aber sie lächelt standhaft weiter. Sie riecht ein wenig säuerlich, fast, als hätte sie … Nun ja. Und ich hatte mich so gefreut, einen leeren Sitz neben mir zu haben. Am besten, ich versuche, noch eine Runde zu schlafen, bevor wir in Frankfurt landen.
Der Typ neben mir, der mich anstarrt, als wäre ich ein ekliges Insekt, schläft fast sofort wieder ein. Beneidenswert, wenn man in jeder Lebenslage schlafen kann.
Immerhin habe ich so Gelegenheit, meine Klamotten wieder auf Vordermann zu bringen. Am liebsten würde ich ja in etwas Sauberes schlüpfen, aber da komme ich jetzt natürlich nicht ran. Außerdem sieht man schon kaum mehr was von den hässlichen Flecken. Wäre wirklich schade gewesen um die prächtig bunte und mit afrikanischen Motiven bestickte Tunika aus reiner Wildseide, die ich diesem schlitzohrigen Händler auf dem überfüllten Basar mitten in Lagos abgekauft habe. Nach stundenlangem Feilschen habe ich immer noch ein Schweinegeld für den Fummel bezahlt. Aber ich wollte schließlich nicht dafür verantwortlich sein, dass seine vielen Kinder Hunger leiden müssen. Lang und breit hat er mir erklärt, es bringe Unglück, die genaue Anzahl seiner Kinder zu nennen. Was für ein Land …
Feiner Platz, hier in der Bonzenklasse. Jede Menge Beinfreiheit, Essen auf Tellern und nicht in der Plastikschale, und sogar Rotwein gibt es dazu. Ein wenig Gerechtigkeit nach diesen beschissenen Tagen in dieser entsetzlichen Stadt, in die ich nie wieder einen Fuß setzen werde.
Leider sitze ich nun ausgerechnet neben dem maulfaulsten und verpenntesten Mann im ganzen Flieger. Aber solche Typen, die nur auf Show machen, kann ich sowieso nicht ausstehen. Er hat Geld, und zwar nicht zu knapp, und jeder soll es sehen. Der hellgraue Anzug ist nicht von der Stange, ich tippe auf ein französisches Designerlabel. Ob das Steinchen, das da an seinem Ohrläppchen glitzert, ein echter Brilli ist?
Doch obwohl er ein Angeber ist, irgendwas hat er an sich …
Ich lehne mich zur Seite und atme seinen Geruch ein. Er riecht nach Zigarettenrauch, doch darunter erahne ich etwas von seinem Eau de Toilette. Ein erdiges, vermutlich schweineteures Männerparfüm, mit einer Note von Amber. Das mausgraue Hemd passt absolut nicht zu seinem restlichen Outfit. Viel zu blass, viel zu sehr Ton in Ton. Er hat keinen Mut zu Farben. Dabei würde ein knalliges Rot oder sattes Lila wunderbar zu seinen blonden Haaren passen. Ob er im Bett auch so fad ist?
Was denkst du denn schon wieder, Lindalein?
Ein Blick aus dem Fenster. Alles, was ich sehe, ist dieser endlos blaue Himmel. Der Typ versperrt mir die Sicht auf das sandige, trostlose Land dort unten. Mit jedem Kilometer mehr zwischen mir und dem Chaos in Lagos geht es mir besser. Vermutlich ist der Rest von Nigeria ja wirklich so ursprünglich und betörend schön, wie mein Reiseführer behauptet. Aber Lagos ist definitiv zu heiß, zu feucht, zu laut und viel zu überfüllt, sobald man auch nur einen Schritt über die Schwelle des Hotels setzt. Und jeder zieht einem das Geld aus der Tasche, wo er nur kann. Jeder.
Noch einmal atme ich den erdig rauchigen Duft meines tief schlafenden Sitznachbarn ein, lehne mich dann in meinen Sessel zurück, höre ihn leise schnarchen und denke an Vivian. Nein, an die will ich ebenfalls nicht denken. Und an George erst recht nicht. Auch die Probleme, die zu Hause auf mich warten, blende ich erst mal komplett aus. Die kommen noch früh genug …
Ich zwinge mich, an etwas Schönes zu denken. Das Klappern von Pferdehufen, der Rausch der Geschwindigkeit, wenn ich im Galopp über saftig grüne Wiesen jage, Sonne auf meiner Haut. Männerlachen, laszive Blicke, Sekt, der prickelnd durch die Kehle perlt, Berührungen, heiß und erregend. Ohne es zu wollen, höre ich Georges schnellen Atem, fühle ihn schon wieder auf mir, lausche seinen Versprechungen, die so verführerisch und betrügerisch sind wie sein fremdes, heißes Land, sehe ihn in dieser innigen Umarmung, in der sich ihre Leiber aneinanderpressen …
Schnitt!
Aus!
Weg mit den verdammten Erinnerungen!
Schnitt, ein für alle Mal.
Wieder male ich mir aus, was ich den beiden antun werde, wenn es an der Zeit ist. Für George wäre ein Schuss in den Kopf genau das Richtige. Schnell, sauber und begleitet von einem eiskalten Blick in seine herrlich dunklen Augen. Für Vivian lasse ich mir etwas einfallen, das länger dauert. Das richtig wehtut. Sie muss weinen, schreien, leiden, mich um Gnade anflehen, bis zum Schluss. Mir schwebt so etwas wie ein elektrischer Stuhl mit verstellbarer Stromstärke vor. Aber vielleicht fällt mir ja noch was Gemeineres ein.
Lagos
»Bien sûr je vais t’informer tout de suite, dès que Steven me rappellera, Maurice.« Eileen Sanders lächelte ihren Chef an und sah ihm wie üblich eine Spur zu lange in die Augen. »Natürlich sage ich dir sofort Bescheid, sobald Steven anruft.«
Leise schloss sie die Tür zu Maurice de Wevers Büro im zwölften Stock eines modernen Bürogebäudes am Ahmadu Bello Way. Ihr Sekretärinnenlächeln mit der wohldosierten Portion Erotik verschwand wie ausgeknipst. Sie war genauso nervös wie Maurice, aber im Gegensatz zu ihm zeigte sie es nicht.
Steven hätte sich schon längst melden sollen, entweder bei Maurice oder bei ihr. Vor über drei Stunden war er aufgebrochen, um den zerschossenen Range Rover bergen zu lassen, und als Securitychef der Euro Mining war es seine Pflicht, den Geschäftsführer über den Stand der Dinge auf dem Laufenden zu halten. Und auf Steven war normalerweise Verlass. Natürlich dauerte hier in Lagos alles länger als sonst irgendwo auf der Welt, und vielleicht hatte er momentan auch nur keinen Handyempfang. Dennoch wurde auch sie allmählich unruhig, weil Steven sich immer noch nicht gemeldet hatte. Wenn jemand Nachricht von Marc oder Benoît hatte, dann er.
Seufzend setzte Eileen sich an ihren Schreibtisch, schlug die makellosen Beine übereinander und sah hinunter auf das Meer. Noch bevor sie ins Flugzeug steigen würde – dummerweise wusste sie noch immer nicht, wann –, würde sie diesen Blick schon vermissen. Der Ahmadu Bello Way trennte Victoria Island vom Atlantik, und hier oben war die Aussicht einfach bombastisch. In den sieben Jahren, die Eileen, eine gebürtige Amerikanerin, nun schon für den aus Belgien stammenden Maurice de Wever arbeitete, hatte sie den spektakulären Ausblick jeden Tag aufs Neue genossen.
Jetzt, um diese Uhrzeit, war das Meer nicht blau, sondern glitzerte so silbern wie ein Funkenregen bei einem Feuerwerk. Das Blau des Himmels lag hinter einem zarten Dunstschleier verborgen, alles irisierte und flimmerte wie der Wassernebel eines Springbrunnens an einem windigen Sommermorgen. Am Horizont zogen riesige Öltanker vorbei, Containerschiffe und die luxuriösen schneeweißen Jachten der Superreichen, die in Lagos noch um einiges größer waren als irgendwo sonst in der Welt. Auch auf ihnen lag dieses magische Licht. Näher am Strand jagten und sprangen schlanke Motorboote über die Wellen und ließen die Gischt aufspritzen. Die alten Fischerboote hingegen tuckerten mit eingezogenen Netzen verträumt in Richtung Hafen, auch sie eingebettet in diesen überirdisch glänzenden Schimmer.
Eileen befingerte ihr Nasenpiercing, einen in Weißgold gefassten winzigen Diamanten, der ebenso funkelte wie die Pracht dort draußen, und trank nachdenklich einen Schluck ihres inzwischen kalt gewordenen Tees. Automatisch füllte sie aus der Thermoskanne heißen Tee nach, gab drei Stück Kandiszucker dazu und rührte um.
Seit Marc und Benoît verschwunden waren, ging hier alles drunter und drüber. Alle paar Minuten stand einer der knapp fünfundzwanzig Mitarbeiter in ihrer Tür, die sich in den drei Stockwerken unter der Chefetage um die Lieferzeiten von Planierraupen und Baggern, um Ersatzteilbestellungen, Preiskalkulationen oder logistische Planungen kümmerten. Als rechte Hand des Chefs war sie für alle Kollegen – die meisten stammten ebenfalls aus den Staaten oder aus Europa – die erste Ansprechpartnerin, wenn es brannte. Und im Moment brannte es so lichterloh wie noch nie.
Erst die überraschende Entlassung von Frieder Waaghausen, einem aus Deutschland stammenden Techniker, die Maurice nicht einmal ihr erklärt hatte. Dann der Überfall auf den Rover mit dem Ergebnis, dass Henry tot und Marc und Benoît unauffindbar waren. Die meisten der Kollegen fragten nicht direkt nach Neuigkeiten zu dem Vorfall, sondern schoben irgendein organisatorisches Problemchen vor. Doch Eileen sah jedem sofort an, was ihm wirklich auf dem Herzen lag. Nach einem zuversichtlichen Lächeln und ein paar unverbindlichen Worten trollte er oder sie sich zum Glück bald wieder.
Eileens Chef hingegen war nicht so leicht abzuspeisen. Es kostete sie einen ungeheuren Kraftaufwand, Maurice den Rücken zu stärken. Natürlich war genau das ihr Job, und selbstverständlich stand für ihn viel auf dem Spiel, wenn nicht sogar alles. In Brüssel, wo sich der Firmensitz der Euro Mining befand, wartete man nur darauf, dass er Schwäche zeigte, den Anforderungen nicht mehr gewachsen war. Niemand wusste das besser als sie. Aber verschwendete er auch nur einen Gedanken daran, wie es in ihr aussah?
Die Nachricht von dem Überfall hatte sie mehr getroffen, als sie es je für möglich gehalten hätte. Benoîts Schicksal ging ihr nicht allzu nahe. Sie hatte die eine oder andere aufregende Stunde mit ihm verbracht, zugegeben. Ansonsten aber verband sie nichts.
Bei Marc hingegen lag die Sache anders. Aber bei ihm war ja von Anfang an alles anders gewesen als bei den sonstigen und weiß Gott nicht wenigen Männern in ihrem Leben.
Man hatte Blut im Rover gefunden, viel Blut. Vielleicht waren die beiden entführt worden, wie so manche Mitarbeiter ausländischer Firmen, die dann anschließend um aberwitzige Summen erpresst wurden. Von Gelegenheitsganoven, Kriminellen, Stammesvätern auf der Suche nach neuen Einkunftsquellen für ihren Clan oder gerade beschäftigungslose Warlords, von denen es Unzählige in Nigeria gab. Auch die Euro Mining hatte es schon getroffen.
Sie mochte gar nicht daran denken, was sie Marc antaten, was er jetzt vielleicht zu erleiden hatte. Ob sie ihn in einen der stinkenden Slums gebracht hatten, in die sie als Weiße selbst in Begleitung nie einen Fuß setzen würde? Oder im Gegenteil raus aus Lagos, so tief in den Busch, dass niemand ihn je finden würde?
Vielleicht war er auch längst tot. Obwohl sie in den vergangenen zwei Tagen diese Möglichkeit oft in Betracht gezogen hatte, versetzte ihr der Gedanke wieder einen schmerzlichen Stich. Andererseits wäre es vielleicht sogar die beste Lösung. Dann müsste sie sich nicht mehr unentwegt fragen, ob ihre Entscheidung, sich nach so langer Zeit von ihm zu trennen, wirklich die richtige gewesen war.
Steven Huntington ging in verhaltener Eile auf den Mann in goldbetresster Prachtuniform zu, dessen Miene keinen Zweifel daran ließ, dass er es nicht gewohnt war, auf seine Gesprächspartner zu warten.
»Mr Asare, I’m so sorry.« Mit einer tiefen Verbeugung begrüßte er den beleibten Schwarzen. »Sie wissen ja selbst, wie die Verkehrsverhältnisse manchmal sind hier in Ihrer wundervollen Stadt. Und leider musste ich noch rasch jemanden ins Krankenhaus fahren, einen Landsmann von Ihnen. Er wurde angeschossen. Es tut mir wirklich sehr leid.«
Inspector General of Police Olufunlola Solomon Asare ergriff mit unbewegter Miene und ohne sich zu erheben, die dargebotene Hand des jetzt wieder tadellos gekleideten Engländers und drückte kräftig zu. Huntington verzog keine Miene und setzte sich dem Mann gegenüber an den edel gedeckten Tisch. Asares afrikanischer Vorname Olufunlola bedeutete »Gott hat mir Wohlstand geschenkt«. Was in diesem Fall ein selten schlechter Witz war. Nicht, dass der Kerl es nicht innerhalb weniger Jahre zu beträchtlichem Reichtum gebracht hätte. Aber sein Geld und seine Villen waren mit Sicherheit nicht vom Himmel gefallen.
Huntington hatte einen Zweiertisch an der Fensterfront reserviert, sodass sie ungestört und vor allem unbelauscht sprechen konnten. Vor dem Gespräch war er noch kurz in seinem Apartment gewesen, um zu duschen und sich umzuziehen.
»Ich hoffe, das Essen hier im Federal Palace ist so gut, wie man überall behauptet«, brummte der hohe Polizeioffizier verstimmt, spitzte kurz die Lippen, als wollte er jemanden küssen, und entledigte sich im Sitzen der Uniformjacke. Eine feuchte Wolke seines penetranten Deodorants wehte zu Huntington herüber.
»Wie ich diese Aussicht auf die Lagune liebe!«, behauptete der Engländer mit gut gespielter Begeisterung. »Herrlich, nicht wahr? Quite honestly, I do love it.«
Lagos, angeblich die Stadt mit dem höchsten Champagnerverbrauch der Erde, zu fünf Prozent Größenwahn und zum größten Teil ein stinkendes Dreckloch voller Schlamm und Elend, Armut, ekliger Krankheiten, Prostitution und Kriminalität.
Asare gönnte der Aussicht keinen Blick, sondern musterte seinen Gesprächspartner mit kühler, undurchdringlicher Miene. Ein hagerer Ober näherte sich mit leichten Schritten und devotem Lächeln, reichte den offenkundig wichtigen Gästen in dunkles Leder gebundene Speisekarten, wartete, bis die Herren gewählt hatten, nahm immerfort dienernd die Bestellungen entgegen – Entrecôte für Mr Huntington, Filet Mignon für den Polizeioffizier, dazu eine Flasche Chardonnay, Jahrgang 2009 aus der Champagne – und entschwebte.
»Sie hatten es sehr eilig, mich zu treffen«, murmelte Asare, dessen Oberlippe ein schmales Bärtchen zierte und der nur ungern lächelte. Für einen Wicht wie Huntington lohnte es sich offenbar nicht, laut zu sprechen. »Ich hoffe, diese Eile ist angebracht. Sie wissen, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Ich habe Ihretwegen wichtige Termine absagen müssen.«
Wahrscheinlich bei einer sensationellen neuen Nutte in irgendeinem Nobelpuff, dachte Huntington, ohne seine freundlich-unterwürfige Miene zu verziehen.
Er beugte sich vor und faltete die Hände auf dem Tisch. »Sie ahnen es natürlich schon, denn Sie sind – wie jedermann weiß – ein sehr kluger Mann, verehrter Mr Asare. Die Euro Mining hat wieder einmal ein kleines Problemchen und bittet Sie inständig um Ihre wohlwollende Unterstützung.«
»Sie wissen, das Wohlergehen der ausländischen Firmen in Nigeria liegt unserem Präsidenten ganz besonders am Herzen. Aber die Polizei ist natürlich für alle Menschen da, und nicht nur …«
»I know, I know«, fiel Huntington ihm strahlend ins Wort. »Ich weiß, dass Sie und Ihre zahllosen Untergebenen außerordentlich viel zu tun haben. Aber leider ist es ein höchst unangenehmes Problem, das uns zurzeit auf der Seele lastet. Zwei unserer Mitarbeiter sind verschwunden, seit drei Tagen, und Mr de Wever, der Sie übrigens herzlich grüßen lässt, ist außer sich.«
»Bitte bestellen Sie ihm ebenfalls meine herzlichen Grüße.« Nun beugte auch Asare sich vor und fragte mit verhaltener Stimme: »Wieder einmal eine Lösegelderpressung?«
»Dieses Mal seltsamerweise nicht, wie es scheint. Zumindest hat bisher niemand Forderungen gestellt. Aber wir machen uns natürlich dennoch große Sorgen um unsere Mitarbeiter.«
»Das Befinden unserer Gäste aus dem Ausland liegt unserem Präsidenten ganz besonders am Herzen, wie Sie wissen.«
Huntington nickte eifrig. »Und Sie wissen, wie sehr wir die Freundlichkeit und Gastfreundschaft Ihres wundervollen Landes zu schätzen wissen.«
Wie jedermann wusste, waren Asare und der Präsident dieses riesigen, zugleich absurd reichen und bettelarmen Landes seit drei Jahren miteinander verwandt. Damals hatte Asare eine der unzähligen eingebildeten Töchter des Präsidenten geheiratet, und sein unaufhaltsamer Aufstieg hatte begonnen.
»Mr de Wever hat mich übrigens ermächtigt, alle Mittel einzusetzen, um unsere beiden Mitarbeiter wiederzufinden.«
»Alle Mittel?« In Asares kleinen schwarzen Augen blitzte Interesse auf.
»Nun ja«, bremste ihn Huntington mit schmalem Lächeln. »Natürlich hat jedes Budget irgendwo seine Grenzen.«
Der erste Gang wurde serviert, ein kleiner Salat mit gebratenen Tigerprawns an einer leichten Vinaigrette. Asare ergriff mit seinen Wurstfingern die weiße Batistserviette, schüttelte sie aus und legte sie sorgfältig über seine feisten Oberschenkel. Huntington tat es ihm gleich. Eine Flasche Wasser wurde aufgetischt, der Wein kredenzt. Huntington probierte, nickte, der Sommelier, ein leicht schielender Italiener namens Pietro, schenkte umsichtig ein und zog sich diskret zurück.
Über die Lagune zogen riesige Containerfrachter ihre majestätischen Bahnen. Manche fuhren in Richtung Hafen, andere strebten dem Atlantik zu. Und alle waren unterwegs, um einige internationale Konzerne und die wenigen Prozent der Nigerianer, die ohnehin schon im Überfluss lebten, noch reicher zu machen. Dazwischen kreuzten übermotorisierte Rennboote herum wie verrückt gewordene Moskitos zwischen einer Elefantenherde.
Einen schwachen Moment lang dachte Huntington daran, dass vom Gegenwert eines dieser Angeberdinger hundert nigerianische Familien zehn Jahre lang sorgenfrei leben könnten. Und dass der hochrangige Polizist, der soeben mit verträumtem Blick an seinem langstieligen Weinglas nippte, sich demnächst auch eines würde leisten können. Vielleicht schon, nachdem er das Bestechungsgeld kassiert hatte, das er fordern würde, sobald man zur Preisverhandlung kam. Schmiergeld, damit dem Willen seines Präsidenten Genüge getan und den beiden Europäern, die so dämlich gewesen waren, sich kidnappen zu lassen, wieder zur Freiheit verholfen wurde. Vielleicht würden sie nicht mehr ganz gesund sein, vielleicht auch tot. Mit Sicherheit aber würden einige seiner Landsleute im Rahmen irgendeiner martialischen Polizeiaktion ihr Leben verlieren. Am Ende würden die hohen Herren von der Euro Mining zufrieden sein und Olufunlola Solomon Asare nicht minder.
»Der Ablauf wie üblich?«, fragte Asare lauernd und noch leiser als zuvor. Er beobachtete nun ebenfalls die Rennboote, deren durch die Isolierglasscheiben der großen Fenster stark gedämpftes Motorengebrüll beständig auf- und abschwoll.
»Wie immer«, bestätige Huntington zuvorkommend. »Fünfzig Prozent jetzt, der Rest nach Erfolg.«
»Erfolg heißt, die Herren sind noch am Leben?«
»Tot nützen sie uns leider nichts, Mr Asare«, sagte Huntington milde.
»Wie viel?«, fragte Asare und lächelte zum ersten Mal ein wenig an diesem Tag, von dessen schwüler Hitze man im klimatisierten Restaurant nichts spürte.
»Fünftausend?«
»Wer sind die beiden Herren?«
»Zum einen Benoît Ducasse.«
Sichtlich irritiert wandte Asare sich wieder dem Mann zu, der später die enorme Rechnung für das frühe Abendessen bezahlen würde. »Ihr Securitychef?«
»Der Securitychef der Euro Mining bin inzwischen ich«, versetzte Huntington leicht gekränkt. »Mr Ducasse ist seit einigen Wochen einer meiner Untergebenen. Durchaus immer noch in leitender Position, nur eben mir unterstellt.«
»Und der zweite Mann?«
»Heißt Marc van Heese. Ein Vertriebsmitarbeiter. Auch er einer unserer Topleute.«
Asare zückte ein goldverziertes Notizbüchlein und machte sich mit einem ebenfalls goldenen Stift in der goldgeschmückten Hand Notizen. Am Ringfinger seiner Rechten blitzte ein großer, in Rotgold gefasster Diamant, von dessen Gegenwert man vermutlich in den preiswerteren Vierteln Londons ein hübsches Häuschen mit Garten kaufen konnte. »Was sollte ich sonst noch über die Herren wissen?«
»Mr Ducasse ist gebürtiger Belgier, hat aber seit vielen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft.«
»Ich weiß, ich habe ihn einmal kennengelernt. Er war bei der französischen Fremdenlegion, richtig?«
»So geht das Gerücht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich stimmt. Jedenfalls ist er ein beinharter Bursche.«
Erneut sah Asare ihn irritiert an. »Und so ein Mann lässt sich einfach so … Ich meine, er war doch wohl bewaffnet?«
Huntington sah zum azurblauen Himmel hinauf, an dem trotz Regenzeit kein Wölkchen schwebte. Aber das konnte sich in diesem verrückten Teil der Erde innerhalb von Minuten dramatisch ändern. »Benoît war selbstverständlich bewaffnet. Und er wird seine Waffe mit Sicherheit auch benutzt haben. Die Entführer müssen mit großer Übermacht und sehr überraschend gekommen sein. Wir haben Blut gefunden im Wagen. Von wem es stammt, wissen wir nicht.«
»Wann und wo ist es geschehen?«
»Sie waren auf dem Lagos Ibadan Expressway unterwegs, mit zwei Fahrzeugen, in Richtung Osten. Nach Shagamu, um genau zu sein.«
Welches ein noch trostloserer Ort war als Lagos, wo jedoch aus irgendeinem Grund Onkel Charly zu Hause war. Selbstverständlich nicht in den Slums, sondern in einer ebenso protzigen wie phänomenal hässlichen Villa in der sogenannten Government Reserved Area, kurz GRA, wo ausschließlich Weiße und superreiche Nigerianer wohnen durften.
»Um dort was zu tun?«, fragte Asare mit unverhohlener Neugier.
Das geht dich einen Scheißdreck an, du schmieriges Sumpfschwein, dachte Huntington und sagte mit herzlichem Lachen: »Sie wollten dort jemanden treffen. Wen und weshalb, entzieht sich leider meiner Kenntnis.«
»Zwei Fahrzeuge, sagten Sie?«
»Es waren zwei Range Rover. Der erste Wagen war mit vier Securityleuten besetzt und ist verschwunden. Im zweiten saßen van Heese und Ducasse und ihr Fahrer. Beide sind offenbar verletzt worden. Der Fahrer, einer Ihrer Landsleute leider, ist tot.«
»Auch die Securitymänner waren Bürger meines Landes, nehme ich an?«
»Ganz richtig. Sehr zuverlässige, sehr bewährte Männer.«
Die – falls sie den Überfall nicht selbst inszeniert haben – vermutlich umgehend die Flucht ergriffen, als die Schießerei losging, und den Rover gerade in irgendeinem Buschkaff in seine Einzelteile zerlegen, um diese zu Geld zu machen.
»Verzeihen Sie, wenn ich frage: Weshalb haben die Herren nicht wie üblich ihren Helikopter benutzt?«
Weil der seit vier Wochen im Hangar steht, während das neue und schon vor Wochen aus Europa eingeflogene Getriebe in einem eurer rattenverseuchten Zolllager Rost ansetzt, weil irgendein Beamtenarsch, der noch korrupter ist als du, den Hals nicht vollkriegt.
»Auch das entzieht sich leider meiner Kenntnis«, erwiderte Huntington zuckersüß.
Mit großem Pomp wurde der Hauptgang aufgetischt.
»Sieht wahrhaft köstlich aus«, fand der Polizeioffizier mit verzückter Miene. »Wie es duftet, riechen Sie nur! Sie haben wirklich nicht zu viel versprochen, Steven, mein Freund.«
Autsch, diesmal wird es teuer, dachte Huntington, zuckte jedoch mit keiner Wimper.
Asare packte mit seinen Pranken das schwere Silberbesteck, begann, in kleinen Happen zu essen, ließ sich jeden Bissen auf der Zunge zergehen und sagte ganz nebenbei: »Fünf werden leider nicht reichen, lieber Steven. Ich werde Auslagen haben. Ich habe eine große Familie zu versorgen, wie Sie wissen.«
O ja, dachte Huntington. Sechs gefräßige Frauen und inzwischen vermutlich mehr als dreißig Kids sowie die für die Unterbringung der Bagage notwendigen Immobilien stellen einen nicht zu vernachlässigenden Kostenfaktor dar.
»Sieben?«, schlug er demütig vor.
Man einigte sich schließlich auf zehntausend Dollar. Huntington zählte diskret fünfzig Hunderter ab und steckte sie in einen weißen Umschlag. Unauffällig wechselte der Umschlag die Tischseite.
»Sie werden von mir hören«, versprach Asare beim Digestif, einem zwölf Jahre alten Hennessy Richard. »Ich werde noch heute umfangreiche Maßnahmen anordnen.«
Flug LH 569
»Essen Sie das da etwa gar nicht?«, fragt die Vogelscheuche mit lüsternem Blick auf das weiße Tablett, das auf einmal auf meinem Klapptisch liegt. Als ich zum letzten Mal wach war, war der Tisch noch hochgeklappt.
»Ich esse diesen Fraß grundsätzlich nicht, der einem in den Fliegern vorgesetzt wird«, höre ich mich großspurig verkünden, obwohl meine Ernährungsgewohnheiten diese Frau, genau besehen, einen Dreck angehen. »Ich vertrage es nicht«, füge ich sogar noch hinzu, als sie mich ungläubig anstarrt, und frage mich gleichzeitig, weshalb ich mir die gegrillte Rinderlende an grüner Pfeffersoße überhaupt bestellt habe. Dunkel erinnere ich mich, dass die Stewardess partout nicht lockerlassen wollte, als sie nach dem Start die Bestellungen aufnahm.
»Ja, wenn das so ist … Dürfte ich dann vielleicht …?«
»Wenn Sie mich anschließend nicht wegen Körperverletzung verklagen.«
Ich klappe ihren Tisch herunter und platziere das Tablett darauf. Nur den Rotwein, den behalte ich für mich. Sie macht sich mit beachtlichem Appetit über mein vermutlich nur noch lauwarmes Essen her.
»Ich bin immer hungrig«, sagt sie zwischen zwei großen Happen. »Ich esse andauernd, aber es setzt einfach nicht an bei mir.«
Mit vielsagender Miene fasst sie sich an die schmalen Hüften und beinahe auch noch an die in der Tat kaum sichtbaren Brüste. Erst im letzten Moment irrt die Hand ab, und sie kratzt sich stattdessen an der Nase. Sie trägt ein weites, irgendwie indisch anmutendes kleidähnliches Ding in schreiend bunten Farben. Kunstseide vermutlich. Neunzehn Euro neunundneunzig bei H&M. An den Füßen flache Sandaletten, die Riemchen mit bunten Glitzersteinchen verziert. Am langen Hals baumelt eine dieser Ketten, wie sie in Lagos auf den Touristenmärkten verkauft werden. Angeblich Handarbeit aus irgendwelchen hinterwäldlerischen Buschdörfern, in Wirklichkeit natürlich made in Vietnam.
Inzwischen bin ich wieder so weit bei Sinnen, dass ich versuchsweise anfange zu denken. Okay, ich kenne den Namen der Frau, aber sonst weiß ich nichts über sie. Wer ist sie? Wo kommt sie her? Und wieso sitzt sie auf einmal neben mir? Sie sieht harmlos aus. Ein wenig verpeilt ist sie und nervtötend redselig. Aber das alles kann Tarnung sein. Getue, um mich einzulullen, und in Wirklichkeit hat jemand sie mir auf den Hals gehetzt, um …
Unsinn. Eben noch hätte sie sich um ein Haar an die Titten gefasst, um mir klarzumachen, wo sie noch Fett anzusetzen gedenkt. Andererseits sieht sie nicht dumm aus. Der Blick ihrer graublauen Augen ist ohne Scheu. Sie sind ungleich groß, auch die Farbe ist nicht ganz gleich. Das linke ist ein wenig größer, die Iris dunkler. Nachdem der säuerliche Geruch von vorhin verflogen ist, riecht sie nach nichts. Sie scheint kein Parfüm zu benutzen, was vielleicht nicht das Schlechteste ist.
Mein linker Arm schmerzt. Hoffentlich hat die Wunde sich nicht entzündet. Ich vermeide, wo es geht, ihn zu bewegen. Wenigstens hat es mich nicht am rechten Arm erwischt. Glück im Unglück.
»Also, eigentlich Belinda Marie«, plappert die Vogelscheuche schon wieder los. Sie scheint gleichzeitig essen und sprechen zu können. »Aber ich finde Linda praktischer. Die Leute kriegen oft so einen ehrfürchtigen Blick, wenn ich mich mit meinem vollständigen Namen vorstelle.«
»Nett«, sage ich, um irgendetwas zu sagen. »Sowohl die Lang- als auch die Kurzform.«
Irgendwie hat diese Frau einen schlechten Einfluss auf mich. Ich bin sonst nicht der Typ für Small Talk.
»Was haben Sie denn gemacht in Lagos?«, will sie wissen. »Urlaub?«
»Arbeit. Ich arbeite da.«
Genauer gesagt: Ich habe dort gearbeitet. Aber das geht sie nun wirklich nichts an.
»Und gefällt es Ihnen? Sie wohnen doch bestimmt in einem von diesen Vierteln, wo nur Weiße wohnen dürfen, gell?«
Und reiche Schwarze und schwarze Bedienstete, wenn sie einen Passierschein haben, der verhindert, dass die Security am Tor sie abknallt.
Sie selbst hat Urlaub gemacht, erfahre ich, nachdem sie einige Sekunden vergeblich auf eine Antwort gewartet hat. Eigentlich nicht nur Urlaub, sie wollte in Lagos jemanden besuchen.
»Wir haben uns in Köln kennengelernt, da wohne ich nämlich. Obwohl ich in Bayern geboren bin, wie Sie vielleicht noch hören. Und – na ja – ich wollte ihn überraschen, seine Heimat kennenlernen, aber …«
»Nicht so toll gelaufen?«, frage ich erschöpft, da sie offenkundig Anteilnahme erwartet und Mitgefühl.
»Voll Scheiße gelaufen, ehrlich gesagt.«
Der Besuchte heißt George, erzählt sie mir in den folgenden Minuten ungefragt, und studiert an der Kölner Uni Informatik. Über die Semesterferien war er nach Hause geflogen, um seine Eltern und eine im Sterben liegende Großmutter zu besuchen. Und Belinda Marie hatte nichts Besseres zu tun, als ihm nachzureisen, sicherheitshalber in Begleitung einer Freundin namens Vivian, und die Pointe der Geschichte erspart sie mir freundlicherweise. Für eine Weile schweigt sie und wirft nur kriegerische Blicke um sich. Vermutlich hat sie in Lagos entdeckt, dass ihr George keineswegs aus armen Verhältnissen stammt, seine Oma sich bester Gesundheit erfreut und er in Wahrheit seinen betörend schönen Ehefrauen heiße Nächte beschert hat.
Nicht alle Nigerianerinnen sind fett und plattfüßig. Es gibt da geradezu sagenhafte Ausnahmen. Wie man einen Mann im Bett glücklich macht, haben sie schon von ihren Müttern gelernt, da sie in diesem Land der Vielweiberei in ständiger und harter Konkurrenz zu den anderen Gemahlinnen ihrer Göttergatten stehen.
Die Schmerzen im linken Unterarm werden allmählich teuflisch, nachdem ich gestern noch dachte, die Wunde würde problemlos verheilen. Ist es nicht so, dass Wunden besonders schmerzen, wenn sie heilen? Oder jucken sie dann? Hoffentlich muss ich in Deutschland keinen Arzt aufsuchen. Ich weiß, dass die Ärzte dort Schusswunden melden müssen.
Als ich wieder aus dem Fenster sehe, sind wir über dem Mittelmeer, und in der Ferne ist schon die Südküste von Sardinien zu erahnen. Zu meiner Überraschung ist es inzwischen halb sieben. Noch eine knappe Stunde, dann beginnt der Sinkflug.
Die Vogelscheuche begutachtet mich mit unverhohlenem Interesse und überlegt vermutlich, womit sie mir sonst noch auf die Nerven gehen könnte.
Lagos
»Maurice?«, fragte Steven Huntington in sein Handy.
»Am Apparat. Nun sag schon, wie ist es gelaufen?«
»Asare wird sich unserer Sache annehmen. Er hat es fest zugesagt. Der Mann ist im Grunde ein Mafiaboss und hat Kontakte in alle möglichen Kreise und Schichten. Vor allem auch zu Kriminellen, und gerade das macht ihn ja so wertvoll für uns. Natürlich hat er wieder Geld verlangt. Und leider …«
Huntington saß in seinem Jaguar, der noch auf dem großen, kaum besetzten Parkplatz des Federal Palace Hotel stand. Asare war vor wenigen Minuten in einem Van mit dunklen Scheiben, Blaulicht und Sirenengeheul abgerauscht.
»Wie viel diesmal?«, fragte de Wever ergeben.
»Alles, was Eileen mir mitgegeben hat. Leider.«
»Fünfundzwanzigtausend? Dieser Kerl war ja immer schon unverschämt, aber das …«
»Ich habe gehandelt wie ein Löwe, glaub mir, Maurice. Andererseits, was sind fünfundzwanzigtausend gegen zwölf Millionen? Du weißt, Onkel Charly ist nicht amüsiert, gelinde gesagt, und wenn erst Brüssel Wind von der Sache bekommt, dann gnade uns Gott. Ohne Asares Verbindungen zur Unterwelt werden wir nicht weiterkommen …«
»Und ob ich das alles weiß«, seufzte de Wever. »Tue bitte, was in deiner Macht steht, Steven, um unser Problem rasch und vor allem diskret zu lösen. Du hast Asare doch klargemacht, dass alles topsecret ist?«
»Mehr als nur einmal. Aber irgendwann wirst du nicht darum herumkommen, Brüssel zu informieren.«
»Wenn ich das tue, wenn Brüssel erfährt, dass uns mal eben so zwölf Millionen Dollar abhandengekommen sind und dass uns dadurch schlimmstenfalls ein Projekt über eine Dreiviertelmilliarde durch die Lappen geht, dann bin ich eine Stunde später meinen Job los. Und du übrigens auch, Steven. Onkel Charly ist nicht nur nicht amüsiert, er tobt und macht mir die Hölle heiß. Heute Vormittag hat er mich schon dreimal angerufen.«
»Droht er wieder mit den Chinesen?«
»Er droht in jedem zweiten Satz mit den Chinesen. Ist der Rover jetzt endlich im Hafen? Ist der wenigstens noch zu retten?«
»Nein und nein. Es hat eine Schießerei gegeben …«
»Du bist doch hoffentlich …«
»Mir ist nichts passiert, keine Sorge. Aber ich musste jemanden ins Krankenhaus fahren, und der Abschleppwagen … Das erzähle ich dir alles morgen. Ich muss jetzt los.«
Flug LH 569
Ich quatsche mal wieder zu viel. Wie immer, wenn ich nervös bin. Unentwegt grüble ich über all die ungelösten Probleme, die nach der Landung auf mich warten. Und der Typ, der mir seinen Namen nicht verraten will und nichts, einfach gar nichts von sich erzählt, macht mich fertig. Vielleicht sollte ich ihn einfach ignorieren.
Aber auch er ist nervös. Immer wieder zucken seine Hände, und er wischt sie an seinem so ätzend schicken Designeranzug ab. Mit seinem linken Arm stimmt was nicht. Ganz steif hält er ihn, und wenn er ihn aus Versehen doch bewegt, verzieht er jedes Mal das Gesicht. Wahrscheinlich hat er Schmerzen.
Vorhin hat er im Schlaf geredet, von einer Eileen. Ob das seine Frau ist? Er trägt keinen Ehering und hat auch keinen hellen Streifen auf der Haut wie die meisten Typen, die verheiratet, aber solo unterwegs sind. Auch von Lagos hat er immer wieder gefaselt. Klang nicht so, als hätte er sich dort besonders wohlgefühlt, und das, obwohl er bestimmt in diesem abgeriegelten Nobelviertel gewohnt hat. Natürlich habe ich gemerkt, dass er es mir nicht verraten wollte.
Aber wer fühlt sich in dieser beschissenen Stadt schon wohl? In dem ganzen beschissenen Land, von dem ich zum Glück nur einen winzigen Bruchteil gesehen habe? Anfangs hat Lagos mich noch fasziniert, mit seinen berauschenden Farben, tausend fremden Gerüchen und exotischen Klängen. Aber wenn ich an das höllisch scharfe Essen denke, die Abertausend Mücken, diese mörderische Hitze, die viel zu vielen, viel zu lauten Menschen, ihre stinkenden Autos, das Geschrei allerorts, dann bin ich heilfroh, auf dem Weg nach Hause zu sein.
Nein, ich will nicht mehr daran denken. Auch an George will ich nicht mehr denken und nicht an Vivian und nicht an das viele Geld, das ich durch die vorzeitige Abreise aus dem Fenster werfe. Noch fast eine Woche Vollpension, fünf Sterne im Federal Palace – natürlich hat ausgerechnet diese Ziege mich dazu überredet, normalerweise hätte ich keinen Fuß in einen solchen Protzschuppen gesetzt –, die Umbuchung des Flugs, die furchtbar kompliziert und auch nicht umsonst war, mein Bahnticket, das erst in einer Woche gilt, weil ich natürlich Sparpreis gebucht habe, und in Köln …
An diesen ganzen verdammten Mist will ich nicht mehr denken.
Nicht nur die Sitze in der ersten Klasse sind viel breiter und bequemer als hinten bei den Touris, auch das Essen schmeckt besser, und sogar die Stewardessen lächeln netter. Eigentlich schade, dass man sich das nicht öfter leisten kann.
Als der Kapitän die Passagiere auffordert, sich wieder an ihre Plätze zu begeben und anzuschnallen, schiebt mein Sitznachbar die Manschette des mausgrauen Seidenhemds zurück und wirft einen Blick auf seine Uhr. He, eine echte Rolex! Er muss noch viel mehr Geld haben, als ich dachte.
Im Grunde meines Herzens bin ich ja nicht der materialistische Typ, und zum Thema Raubtierkapitalismus könnte ich aus dem Stand einen stundenlangen Vortrag halten, für den Jo mich für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen würde. Aber jetzt beneide ich meinen Sitznachbarn doch ein winzig kleines bisschen. Im Moment bin ich nämlich mal wieder ziemlich pleite. Keine zehn Euro habe ich noch im Portemonnaie. Hoffentlich spuckt der Geldautomat in Frankfurt noch was aus.
»Wo genau arbeiten Sie denn in Lagos, wenn ich fragen darf?«, starte ich einen letzten Versuch, als das Flugzeug mit dem Sinkflug beginnt.
Von Floh und Rosamunde habe ich ihm erzählt, meinen treulosen Katzen, die sich ständig bei den Nachbarn durchfüttern lassen – gleichgültig, ob ich mal wieder irgendwo in der Welt unterwegs bin oder zu Hause sitze und vom Märchenprinzen träume, der sich bei mir früher oder später grundsätzlich als fette, schleimige Kröte entpuppt. Dieses kleine Detail und meinen langweiligen Job habe ich natürlich nicht erwähnt, der jetzt eh weg ist, ebenso wenig meine Leidenschaft fürs Malen, für die Kunst. Meine durchgeknallten Bilder dürfen sowieso nur meine engsten Freunde sehen.
»Ich meine, in welcher Branche?«
Aber er stiert nur aus dem Fenster und tut, als hätte er mich nicht gehört. Will er sich interessant machen? Er fasst sich an den linken Arm, unterdrückt ein Stöhnen und verzieht kurz das Gesicht. Er hat wirklich Schmerzen.
Was ist nur los mit ihm? Alle Männer, mit denen ich bisher zu tun hatte, haben von nichts anderem geredet als von ihrer Arbeit, ihren Hobbys und megageilen Autos. Wieso er nicht? Hat er etwas zu verbergen?
Ich muss an Codename U.N.C.L.E. denken, diesen Agententhriller mit Henry Cavill, den ich kürzlich auf Netflix gesehen habe. Die beiden Hauptdarsteller waren mindestens so gut aussehend wie Brad Pitt, Matt Damon und Jonny Depp miteinander. Ständig haben sie ihre Gegenspieler und vor allem sich gegenseitig ausgetrickst. Geniale Actionszenen, der Plot einfallsreich und witzig – und erst die Liebesszenen …
Wie ein Spion sieht er eigentlich nicht aus. Er scheint weder besonders sportlich zu sein, noch wirkt er irgendwie gefährlich. Der Dreitagebart steht ihm, die Haare trägt er vielleicht ein bisschen zu lang. Und mit den Kalorien sollte er auch vorsichtiger sein. Aber vielleicht ist das ja gerade sein Trick? Und was gäbe es in Nigeria auch schon auszuspionieren?
Es muss einen anderen Grund geben, warum er nicht über sich und seine Arbeit spricht. Vielleicht hat er gelogen und arbeitet gar nicht in Lagos? Vielleicht ist er nur wegen eines dubiosen Auftrags hingeflogen. Und dabei hat er sich so schwer verletzt, dass er nun kaum mehr den Arm bewegen kann. Ist er womöglich so was wie ein Auftragskiller? Wie Jason Statham in The Mechanic oder …
Jetzt mal halblang, Belinda Marie! Deine Fantasie geht mal wieder mit dir durch. Du solltest nicht so viele Actionfilme gucken.
Der Druck in meinen Ohren nimmt zu. Kurz halte ich mir die Nase zu, atme bei geschlossenem Mund aus, der Druck lässt nach. In höchstens fünfzehn Minuten wird das Flugzeug über die Landebahn rollen, und weitere zehn Minuten später werden wir das Gepäck in Empfang nehmen und den Zoll passieren. Und der Herr neben mir, der mir locker ein bisschen Kleingeld für das Zugticket nach Hause spendieren könnte, wird auf Nimmerwiedersehen verschwinden.
Frankfurt am Main
Wie üblich dauert es mit dem Gepäck. Ich weiß nicht, warum, aber meine Koffer sind grundsätzlich die letzten, die auf das Band plumpsen. Immerhin sind am Ende beide da, was beim Flug in die Gegenrichtung nicht immer der Fall ist. Belinda Marie hat ihren riesigen, über und über mit bunten Stickern beklebten Koffer fast als Erste vom Band gezerrt, mir noch einmal übertrieben freundlich gewunken und das schwere Ding, dessen eines Rad sich nicht drehen will, in Richtung Zoll geschleppt. Einen Vorteil hat die Verzögerung immerhin: Wenn ich den Flughafen verlasse, wird sie schon ziemlich weit weg sein. Irgendwas hat sie mir erzählt von einem Zug nach Köln, den sie nehmen will. Aber da habe ich längst nicht mehr zugehört.
Während ich in der Schlange vor dem Zoll warte, versuche ich noch einmal, Helge zu erreichen, aber sein Handy ist aus. Das war es schon, als ich es vor dem Abflug versucht habe. Wieso macht er das blöde Ding nicht an, verflucht? Vor vier Tagen hat er versprochen, dass ich ein paar Tage bei ihm wohnen kann. Hätte er das nicht getan, dann wäre ich gar nicht nach Frankfurt geflogen, sondern gleich nach Holland. Und nun stehe ich da und habe keinen Unterschlupf.
Beim Zoll gibt es keine Probleme. Niemand verlangt Schmiergeld, niemand versucht, etwas aus meinen Koffern zu stehlen. Sie werden nicht einmal geöffnet. Als ich den Pass zeigen muss, bekomme ich noch einmal feuchte Hände. Aber auch der wird von einer ausnehmend hübschen kleinen Blonden mit gleichmütiger Miene abgenickt. Dr. Andreas Kühne ist deutscher Staatsbürger, hat ein Visum für Nigeria im weinroten Reisepass, was sollte es da zu meckern geben?
Aufatmend verlasse ich das brodelnde Megagebäude durch einen der zahllosen Ausgänge, und das Erste, was ich sehe, ist ein freies Taxi.
Das Zweite ist die Vogelscheuche.
»Hab gedacht, ich warte auf Sie«, empfängt sie mich mit bedröppeltem Blick. »Falls Sie vielleicht auch in die Stadt wollen – zu zweit wird’s für uns beide billiger.«
»Wollten Sie nicht nach Köln?«, frage ich verblüfft und bekomme – zweite Verblüffung – keine Antwort. »Wohin müssen Sie denn?«, frage ich misstrauisch.
»Na, zum Bahnhof.«
Ich war länger nicht in good old Germany und bin mir deshalb nicht ganz sicher, aber eigentlich dachte ich, die schnellste Verbindung zwischen Frankfurt am Main und Köln beginne am Fernbahnhof des Flughafens.
»Okay«, sage ich ergeben und sinke auf die Rücksitzbank, während der Fahrer sich, ohne zu murren oder einen Aufpreis zu verlangen, mit dem Gepäck abmüht. Irgendwann sind alle drei Koffer verstaut, die Klappe rumst zu. Er steigt ein, er fährt los.
»Und Sie?«, fragt die Vogelscheuche.
»Äh … wie?«
»Wohin fahren Sie?«
»Weiß ich noch nicht.«
Vorsicht ist bekanntlich der Vorname der Porzellankiste. Oder so ähnlich.
»Sie wissen gar nicht, wohin Sie wollen?«, fragt sie verdutzt.
»Eigentlich wollte ich einen alten Freund besuchen. Aber der geht nicht ans Handy. Werde ich wohl erst mal in irgendein Hotel gehen.«
»Ich kann Ihnen eines empfehlen, ganz in der Nähe vom Bahnhof. Nicht gerade das beste Haus am Platz, aber sauber und bezahlbar.«
Ich steige, wenn es irgend geht, immer im ersten Haus am Platz ab. Auch früher schon und heute ebenfalls und für den Rest meines Lebens sowieso. Aber das werde ich Belinda Marie ganz gewiss nicht aufs sommersprossige Näschen binden.
Als ich das Taxameter beobachte, das mit beachtlichem Tempo den Fahrpreis hochzählt, wird mir bewusst, dass ich nur Dollars habe. Die Wechselstube am Flughafen von Lagos war ohne ersichtlichen Grund geschlossen. Aber das sollte kein Problem sein. Dollars werden überall auf der Welt akzeptiert.
Das mit dem bezahlbaren Hotel war wieder mal voll daneben. Ein Typ mit einer Rolex am Handgelenk steigt nicht im Ibis ab und vermutlich nicht mal im Holiday Inn.
Allmählich spüre ich die Erschöpfung. Das Chaos der letzten Tage, die überstürzte Abreise, im Taxi zum Flughafen die Mail wegen der kleinen Buchrezension, die ich schreiben darf – immerhin ein winziger Lichtblick in meinem Elend –, der lange Flug. Im Gegensatz zu meinem Sitznachbarn, der die meiste Zeit gepennt hat und wieder mal schweigend neben mir sitzt, fallen mir fast die Augen zu. Außerdem hat er daran gedacht, dass es hier in Frankfurt viel kühler ist als im glutheißen Lagos. Ich ärgere mich, weil meine Strickjacke aus kuscheliger Schurwolle, die ich sowieso nur für die Rückfahrt eingepackt hatte, irgendwo in den Tiefen meines Koffers vergraben ist, während er sich seinen schicken weißen Trenchcoat übergezogen hat. Ein Burberry selbstverständlich, was sonst?
In meinem Kopf rattert es unentwegt, aber es kommt nichts dabei heraus. Gleich werde ich aussteigen müssen, meinen Koffer in Empfang nehmen, und ich habe mich noch immer nicht getraut, ihn um Geld anzupumpen. Wenn doch nur mein dummer Stolz nicht wäre. Seit eh und je hat Jo mir eingetrichtert: »Geld muss man sich verdienen oder denen klauen, die sowieso zu viel davon haben.« Für Letzteres wäre Mister Burberry genau der richtige Kandidat …
Zu allem Elend habe ich auch schon wieder Hunger. Sein Steak im Flugzeug, das er mir ebenso großzügig wie verächtlich überlassen hat, ist längst verdaut. Und wenn ich Hunger habe, kann ich nicht denken. Irgendwo muss ich noch was zu essen auftreiben, bevor ich mir ein Zugticket zum sündhaft teuren Normaltarif besorge. Falls es mir überhaupt gelingt, das Geld dafür aufzutreiben. Der Geldautomat am Flughafen hat nichts herausgerückt. Und in Köln brauche ich auch noch ein paar Euros für die U-Bahn … Was für ein verfluchter Mist!
Wunder über Wunder: Sie hält die Klappe.
Bald ist es acht, und es wird allmählich dunkel in Deutschland. Sehr allmählich. Dieser dämmerungslose Übergang von einem schwülheißen Tag zu einer schwülheißen Nacht in den Tropen hat mir auch nach Jahren noch den Nerv geraubt.
Ich habe mein Fenster ein wenig heruntergelassen und schnuppere. In Frankfurt – gerade fahren wir am Main entlang in Richtung Innenstadt – stinkt es nicht. Nicht nach Abgasen, nicht nach Scheiße, nicht nach verwesenden Kadavern, nicht nach hundertmal durchgeschwitzten Hemden. Es ist kaum zu fassen: Mitten in einer der größten Städte Deutschlands riecht die Luft rein und frisch wie nie, wirklich niemals in Lagos. Sofort bekomme ich Lust, für immer hierzubleiben. Was ich vielleicht tun werde. Weshalb eigentlich nicht? Bald werde ich es mir leisten können, an jedem Ort der Welt zu leben. Wenn alles nach Plan verläuft, natürlich.
Belinda Marie hängt irgendwelchen trüben Gedanken nach und schweigt immer noch. Wir überqueren den Main, auf dem Schiffe fahren. Saubere, rostfreie, aufgeräumte Schiffe, die keine schwefeligen Abgaswolken hinter sich herziehen und allesamt aussehen, als wären sie unsinkbar. Schon kommt der Hauptbahnhof in Sicht.
Der Fahrer hält, springt hinaus und stellt Belinda Marie ihren Riesenkoffer vor die zierlichen Füße in Glitzersandalen. Verlegen will sie mir einen Fünfeuroschein aufdrängen, ihren Anteil an den Fahrtkosten, aber ich nehme ihn nicht an. Sie druckst herum und gesteht schließlich mit verkniffener Miene, dass sie kein Geld mehr für das Zugticket hat. Ihre EC-Karte wird nicht akzeptiert, weil wahrscheinlich ihr Konto hoffnungslos überzogen ist. Um sie endlich loszuwerden, reiche ich ihr durchs offen stehende Fenster einen Hundertdollarschein.
»Am Bahnhof finden Sie bestimmt jemanden, der Ihnen den wechselt.«
Auch wenn ihr die Sache unsäglich peinlich ist, sieht sie jetzt aus, als wollte sie mir vor Dankbarkeit um den Hals fallen. Stattdessen drückt sie mir eine Visitenkarte in die Hand, die eher ein Visitenzettelchen ist. Dazu haspelt sie irgendwas von richtigen Visitenkarten, die sie vor ihrer Abreise bei einem dieser Online-Shops bestellt hat, und schwört hoch und heilig, dass sie mir jeden Cent zurückbezahlen wird, wenn ich sie anrufe und ihr meine Bankverbindung mitteile, weil sie im Moment leider nichts zu schreiben hat und, und, und …
»Steigenberger«, sage ich zu dem ungeduldig wartenden Fahrer und lasse das Fenster hochsurren.
Er zuckt zusammen und setzt sich gerade hin. Der Name des Hotels verspricht ein ordentliches Trinkgeld.
Zwischenzeitlich war mir noch einmal der Verdacht gekommen, sie hätten die Rothaarige auf mich angesetzt. Aber irgendwie – wie ich es auch drehe und wende –, es kann eigentlich nicht sein. Es ergibt keinen Sinn.
Lagos
Steven Huntington folgte dem Ahmadu Bello Way erst in Richtung Westen, dann nach Norden, kam am Federal Palace vorbei, wo er erst vor wenigen Stunden mit einem der höchsten und korruptesten Polizisten des Landes gespeist hatte, reihte sich auf Lagos Island in den lebhaften Verkehr auf dem E 1 ein und fuhr weiter in Richtung Norden. Innerhalb weniger Minuten fiel Dunkelheit über die Stadt wie ein nasses schwarzes Tuch. Der Umstand, dass es in den Tropen praktisch keine Dämmerung gab, beunruhigte Huntington auch nach fünf Jahren noch.
Er erreichte die über zehn Kilometer lange, ins Meer hineingebaute Third Mainland Brigde, über die sich eine schier endlose Kette von Autoscheinwerfern und Straßenlaternen zog. Weiter ging es nach Norden, im Abstand von einigen Hundert Metern vor der Küste entlang. Links spiegelte sich ein nicht enden wollendes Lichtermeer im flachen Wasser, rechts lag rabenschwarz die Lagune.
Eine halbe Stunde später zog Huntington die Handbremse am Rand eines Viertels, das in den Stadtplänen von Lagos nicht einmal verzeichnet war: Makoko, ein jahrhundertealter Slum, der zum größten Teil auf Pfählen im Wasser stand. Ein Viertel, das mit geschätzt über hunderttausend Einwohnern – exakte Zahlen existierten nicht – in Europa für sich allein schon eine Großstadt gewesen wäre. Ein Viertel, wo man sich nach Einbruch der Dunkelheit als Weißer besser nicht blicken ließ und davor auch nur mit einem sehr guten Grund.
Deshalb hatte Huntington seine geliebte, weil handliche und unauffällige Walther PPK im Büro gelassen. Stattdessen lag jetzt die schwere sechsschüssige Smith & Wesson mit gespanntem Hahn auf dem Beifahrersitz. Wegen der eingeschalteten Innenraumbeleuchtung für jede der Gestalten gut sichtbar, die draußen im Schatten herumlungerten und auf eine Gelegenheit warteten, ohne größere Anstrengung an ein bisschen Bares zu kommen. Selbstverständlich waren die Türen verriegelt, und der Zwölfzylinder schnurrte im Leerlauf wie eine schläfrige, aber sprungbereite Katze.
Dennoch fühlte Huntington sich im Moment äußerst unwohl. Die Uhr zeigte zwei Minuten vor halb neun, und der Mann, mit dem er verabredet war, stand zum Glück im Ruf, pünktlich wie ein Deutscher zu sein. In dieser Gegend war schon mancher Weiße samt seiner Habe spurlos verschwunden, und ein erstochener Schwarzer, der morgens zwischen den Pfählen im Wasser trieb, erregte nicht mehr Aufmerksamkeit als ein überfahrener Fuchs am Rande einer Landstraße in Cornwall.
Die ersten der dunklen Figuren draußen wagten sich aus dem Schatten. Traten in den Lichtkreis der trüben Straßenlaterne, in der Huntington den sündteuren Wagen abgestellt hatte. Ließen ihn ihr beutelüsternes Raubtiergrinsen sehen.
Seine Rechte angelte nach der Waffe.
Frankfurt am Main
»Herr Dr. Kühne!«, begrüßt mich der weißhaarige Gnom an der Rezeption mit herzenswarmem Lächeln. Er hat mich noch nie gesehen, kennt meinen Namen nur, weil sein Computer ihn eben ausgespuckt hat. »Die Junior-Suite, wie üblich?«
Offenbar bucht Dr. Kühne immer die Junior-Suite, wenn er hier absteigt. Mir ist alles recht, solange es ein anständiges Bett gibt und eine Minibar und eine Badewanne, in der man sich keine Krankheiten holt.
Der Concierge trägt einen perfekt gebügelten dunklen Anzug, am Revers blitzen golden gekreuzte Schlüssel, und dazu eine gestreifte Krawatte. Wäre er etwas größer, könnte er als englischer Lord durchgehen.
»Ihre Frau Gemahlin ist heute nicht dabei?«
»Verhindert«, sage ich. »Leider. Sie ist ein bisschen krank.«
»Hoffentlich nichts Ernstes?«
In Hotels dieser Klasse werden auch die nebensächlichsten Details der Gäste notiert. Wie viele Kinder hat er? Ist er verheiratet? Kommt er immer mit derselben Frau? Ist nachts mit Orgasmusgeschrei aus seinem Zimmer zu rechnen, sodass man ihn besser ein wenig abseits unterbringt? Hat er ausgefallene Wünsche fürs Frühstück? Welche Weinsorte bevorzugt er? Der Gast soll das Gefühl haben, nach Hause zu kommen, umsorgt und geschätzt zu werden, etwas ganz Besonderes zu sein. Dabei ist alles nur Fake. Kein Mensch kennt mich hier. Kein Schwein interessiert sich für mich, außer, wenn Trinkgeld lockt. Also heute genau das Richtige für mich.
Den Wisch für die Anmeldung hat der Computer schon ausgefüllt. Vorname: Andreas, Wohnort: Osnabrück. Ich brauche nur noch zu unterschreiben. In Osnabrück bin ich nie im Leben gewesen. Und es zieht mich auch nicht dorthin.
In der Lobby ist wenig los, sehe ich, als ich in Richtung Fahrstuhl gehe. Rechts und links hängen aufwendig beleuchtete Vitrinen an der Wand, in denen teurer Schmuck glitzert und gleißt. Der Boy, der vorhin meine Koffer aus dem Taxi gehoben hat, trägt sie mit kleinen, lautlosen Schritten vor mir her. Mein linker Arm tut jetzt auch weh, wenn ich ihn nicht bewege, bei jeder Erschütterung, bei jedem Schritt.
Der mittlere Lift steht offen. Sorgfältig poliertes Messing blitzt mir entgegen, der große, ebenfalls golden schimmernde Spiegel zeigt mir das Bild eines abgekämpften großen Kerls in zerknittertem hellgrauem Anzug. Kurz erschrecke ich, weil das zerzauste Haar des Manns strohblond ist und nicht dunkel wie sonst. Der Boy mit sehenswert abstehenden Ohren macht einen Bückling, lässt dem Gast den Vortritt und schleppt dann die Koffer in die Kabine.
Ein Typ in marineblauem Anzug steht vor einem der wandhohen Spiegel in der Lobby, sehe ich gerade noch, als ich mich umwende, und kämmt sein glattes weißblondes Haar, als gälte es sein Leben. In cremefarbenen Sesseln fläzen zwei langbeinige Callgirls der Fünfsterneklasse und warten mit gelangweilten Mienen auf irgendwas oder irgendwen. Bei mir sind sie sich offenbar sicher, dass ich heute nicht mehr Manns genug bin, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Als die Türen des Lifts lautlos zufahren, stecken sie die Köpfe zusammen und beginnen zu tuscheln. Der Boy grinst mich an, und es fehlt nur noch, dass er anzüglich zwinkert.
Während der Fahrt nach oben zücke ich mein Portemonnaie und mache kurz Inventur. Fünf Dollar bekommt der Boy. Hundert habe ich vorhin dieser verrückten Linda Wanzl geschenkt. Bleiben noch circa achthundert. Dreihundert dürfte die Suite kosten. Morgen früh werde ich mich mit Euros eindecken.
Lagos
Selbstverständlich hatte Huntington einen guten Grund, am Rande von Makoko zu sein. Er war hier mit einem baumlangen Schwarzen verabredet, der von allen »Fritz« gerufen wurde.
Fritz hatte einige Jahre in Deutschland gelebt und es dort durch Drogenhandel und andere mehr oder weniger illegale Geschäfte rasch zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Nach einigem Ärger mit der Polizei war er in seine Heimatstadt zurückgekehrt, wo er seinen Besitz auf Wegen vermehrte, die niemand recht erklären konnte. Er handelte mit allem Möglichen und Unmöglichen außer mit Drogen, kannte Unmengen Leute in allen Branchen und Gesellschaftsschichten, war mit jedermann gut Freund. Und genau deshalb saß Huntington nun in seinem leise summenden Jaguar und beobachtete die Typen da draußen, die ihn in immer enger werdenden Kreisen umrundeten.