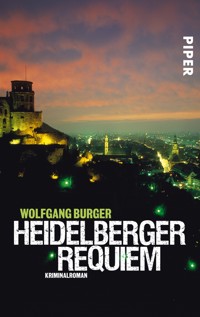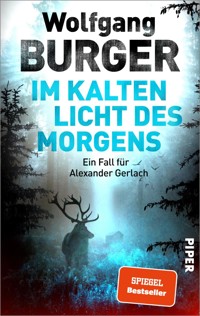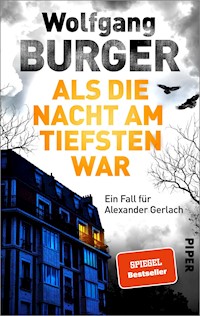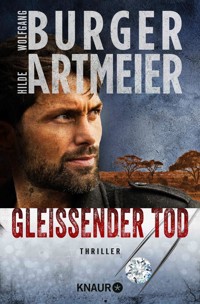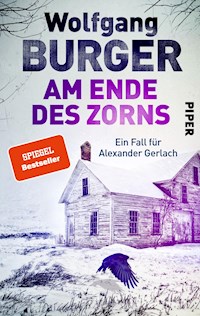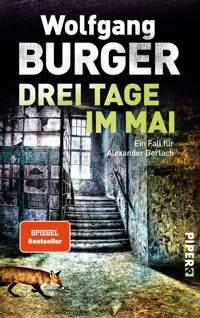9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Serienmörder für Kommissar Gerlach: Der neue Krimi von SPIEGEL-Bestsellerautor Wolfgang Burger! Eine unglaubliche Jagd in den Straßen von Heidelberg und eine Familie in großer Gefahr: Der 17. Fall in der Alexander-Gerlach-Reihe hat es in sich! Ermittler Alexander Gerlach ist einer der dienstältesten Krimi-Kommissare der deutschen Literaturlandschaft. Ein Grund für Ermüdungserscheinungen? Weit gefehlt! In seinem 17. Fall »Der sanfte Hauch des Todes« schickt ihn Bestsellerautor Wolfgang Burger auf die Jagd nach einem Serienmörder, die Gerlachs Leben aufs Schlimmste bedrohen könnte. In den Wäldern um Heidelberg beginnen sich die Leichen zu stapeln. Einer der Toten ist ein Bekannter von Gerlachs Zwillingen. Tochter Sarah tritt ambitioniert in die Fußstapfen ihres alten Herren, ermittelt heimlich selbst weiter und kommt eines Abends nicht wieder nach Hause. Es beginnt ein Albtraum, der das beschauliche Heidelberg erschüttern wird. Mit seinen atemlosen Showdowns und unerbittlich treibenden Entwicklungen rund um Kommissar Gerlach hat sich Wolfgang Burger eine riesige Fangemeinde erschrieben. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Der ultimative Heidelberg-Krimi Die Ikone der deutscher Kriminalromane hat einen Namen: Kriminaloberrat Alexander Gerlach! Über eine halbe Million verkaufte Exemplare machen die Romane von Wolfgang Burger zu einer großen Erfolgsserie, die immer wieder neue Fans anzieht. Burger gibt Heidelberg und dem Regionalkrimi einen düsteren Dreh abseits jeder Postkartenidylle. Er zeigt, wo atemloses Lesevergnügen zu Hause ist! Preisgekrönte Spannung in Krimiserie! Mit »Heidelberger Requiem« legte Wolfgang Burger 2005 ein fulminantes Krimi-Debüt vor, das sich aus dem Stand zur neuen Obsession der Fans des Ermittlerkrimis mauserte. Seine Bücher waren bereits mehrfach für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert, ein Platz in den Bestsellerlisten ist ihm so gut wie sicher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der sanfte Hauch des Todes« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für Ralph, der eine schwere Zeit hinter sich hat
Die Zitate auf den Seiten in diesem Titel stammen aus:Gustav Mahler, Das Lied von der Erde, 6. Satz, Der Abschied.Universal Edition AG, Wien 1912.
© Piper Verlag GmbH, München 2020Redaktion: Annika KrummacherCovergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Dienstag, 22. Oktober, 2:30 Uhr
1
2
3
Dienstag, 22. Oktober, 16:50 Uhr
4
5
6
7
8
Freitag, 25. Oktober, 13:00 Uhr
9
10
11
Montag, 28. Oktober, 12:30 Uhr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Samstag, 2. November, 15:30 Uhr
22
23
24
25
26
27
28
29
30
O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt
der Mond am blauen Himmelssee herauf,
ich spüre eines feinen Windes Weh’n …
Aus: Gustav Mahler, Das Lied von der Erde, 6. Satz, Der Abschied
Dienstag, 22. Oktober, 2:30 Uhr
Ich habe es getan, endlich!
Ich fühle mich so frei, so leicht, so … glücklich?
Nein, wie Glück fühlt es sich seltsamerweise nicht an. Oder ist man vielleicht einfach dann glücklich, wenn man keine Wünsche mehr hat? Wenn man eine große Aufgabe bewältigt hat, eine ungeheure Aufgabe, die trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten und Gefahren erledigt werden musste?
Zufrieden bin ich, ja. Zutiefst befriedigt, das trifft es besser.
Es war …
Ja, wie war es? Kann ich diese Stunde, die ich so lange herbeigesehnt, so akribisch vorbereitet habe, in die ich so viele Hoffnungen und Erwartungen gesetzt, vor der ich mich so sehr gefürchtet habe, überhaupt mit Worten beschreiben?
Aufwühlend war es, faszinierend. Eine berauschende Erfahrung, in eine völlig andere Welt einzutauchen. In eine Welt, die keine Tabus kennt, keine Grenzen des Tuns, keine Schranken der Lust. Eine Welt, in der nur eines zählt: der eigene Wille. Und, ja, ich gestehe gerne: auch Lust.
Am intensivsten war vielleicht das Gefühl der Macht. Das Bewusstsein, unbeschränkte Macht über einen anderen Menschen zu haben, über seinen Körper, sein Leben, über einfach alles. Ein Rausch war es, ein wilder, feuriger Ritt, der Gipfel jeglicher Euphorie, und das ganz ohne chemische Hilfsmittel.
Der Hauch des Todes hat mich angeweht, als er seinen letzten Atemzug tat, als sein Herz aufhörte zu schlagen, und es war – ich finde doch kein besseres Wort dafür – es war das reine, pure, goldene Glück.
1
»Wo?«, fragte ich ins Telefon, schon halb im Stehen. Der automatische Blick zur Uhr: zwei Minuten nach elf.
»Im Wald oberhalb von Rohrbach«, sagte Klara Vangelis in ihrer üblichen leicht unterkühlten Sachlichkeit. »Er liegt noch keine zwölf Stunden, meinen die Kollegen.«
»Woraus schließen sie das?«
»Der Regen. Die Leiche ist trocken, und in der vergangenen Nacht hat es zwischen zehn und zwölf geregnet.«
Das Opfer war ein junger Mann, erfuhr ich, als wir Minuten später in einem Dienstwagen mit Blaulicht auf dem Dach in den Heidelberger Süden rasten.
»Wer er ist, wissen wir noch nicht. Er hat nichts bei sich gehabt.« Meine Kollegin setzte zum Überholen an, scherte knapp vor dem Gegenverkehr wieder ein. Wie immer schlug mir ihre Fahrweise auf den Magen. »Der Täter hat ihm nur das gelassen, was er am Leib trug.«
»Er wird auch nicht wieder lebendig, wenn wir bei einem Autounfall ums Leben kommen«, brummte ich.
Vangelis lächelte siegessicher und war schon wieder auf der linken Spur. Manchmal kam mir der Verdacht, dass sie es genoss, mich leiden zu sehen. Vielleicht hatte sie die Enttäuschung immer noch nicht verwunden, dass ich ihr den Job des Kripochefs vor der Nase weggeschnappt hatte. Sie war die Tochter griechischer Eltern, jedoch in Deutschland zur Welt gekommen, und in manchen Dingen deutscher als jeder andere in der Heidelberger Polizeidirektion.
Im Rückspiegel sah ich weit hinter uns noch ein Blaulicht blitzen. Wahrscheinlich die Spurensicherung oder der Notarzt, den die beiden uniformierten Kollegen, die zurzeit den Tatort bewachten, ebenfalls alarmiert hatten.
»Wer hat ihn gefunden?«
»Ist noch nicht bekannt.« Vangelis spielte ständig mit der Lichthupe, um die Wirkung unseres Martinshorns und des blauen Gefunkels auf dem Dach noch zu verstärken. »Anonymer Anruf.«
Die meisten Fahrzeuge vor uns machten bereitwillig Platz. Einige wenige Fahrer beharrten stur auf ihrem vermeintlichen Recht auf was auch immer und wurden von meiner Fahrerin in oft waghalsigen Manövern überholt. Warum hatte ich sie bloß ans Steuer gelassen? Ich wusste doch, dass sie fuhr wie ein Gangster. Früher war sie hin und wieder sogar kleine Rallyes gefahren und hatte nicht selten gewonnen. Dieses Hobby hatte sie jedoch aufgegeben, als sie Mutter eines kleinen Sohnes wurde, der inzwischen wohl längst laufen und sprechen gelernt hatte. Meine Erste Kriminalhauptkommissarin sprach grundsätzlich nie über private Dinge mit mir. Über andere Kanäle hatte ich jedoch erfahren, dass sie vom Vater ihres Sohnes längst wieder getrennt lebte. Die Erziehung ihres Kindes überließ sie ihren Eltern, die in Schriesheim ein Restaurant betrieben.
»Das macht Ihnen Spaß, nicht wahr?« Instinktiv hielt ich mich am Griff über der Beifahrertür fest.
Anstelle einer Antwort lachte Vangelis nur.
Heute war Dienstag, der zweiundzwanzigste Oktober. Bis auf einige Regenschauer hatten wir in diesem Herbst bisher nur sonnige und für die Jahreszeit zu warme Tage erlebt.
Als wir den Tatort im Wald oberhalb von Rohrbach erreichten, war es Viertel vor zwölf. Der Platz hätte idyllischer nicht sein können. Eine kleine, verwunschene Lichtung, von hohen Laub- und Nadelbäumen und lichtem Gebüsch umgeben, vielleicht dreihundert Meter von einem kleinen Wanderparkplatz am Rand der Landstraße entfernt, von wo ein unbefestigter Fahrweg hierher führte. Vereinzelte Pfützen zeugten vom kurzen nächtlichen Regen. Die Schranke, die mir am Beginn des Wegs aufgefallen war, sah aus, als wäre sie schon sehr lange nicht mehr geschlossen worden.
Vögel zwitscherten fröhlich, aus dem Tal wehten Verkehrsgeräusche herauf. Ein schweres Motorrad blubberte, Lkws brummten, ein Pkw-Motor wurde von einem sportlichen Fahrer auf höchste Drehzahlen gejagt. Nie werde ich begreifen, wie man auf ein Pedal treten Sport nennen kann.
Das Gras auf der Lichtung wiegte sich im frischen Herbstwind. Buntes Laub tanzte Ringelreihen, eine freundliche Sonne beschien die Szenerie, die so lieblich hätte sein können, so friedlich, wäre da nicht die Leiche gewesen.
Der Tote lag auf dem Rücken und mit ausgestreckten Beinen in der Mitte der fast kreisrunden Lichtung, an deren südlichem Rand ich zwei grob gezimmerte Bänke neben einer kleinen Feuerstelle sah. Dahinter stand eine schon etwas baufällige Schutzhütte mit bemoostem Dach. Die Hände seines Opfers hatte der Mörder vermutlich posthum auf dem Bauch wie zum Gebet gefaltet.
Ein uniformierter Kollege kam eilig auf uns zu. Er wirkte erleichtert, weil er und sein Mitstreiter jetzt nicht mehr allein waren mit dem Toten. Ich schätzte den Uniformierten auf etwa dreißig Jahre, er war athletisch gebaut, blass, aber gefasst.
»Er hat ihm den Dings abgeschnitten«, erklärte er atemlos anstelle einer Begrüßung.
»Seinen was?«, fragte Vangelis mit krauser Stirn.
»Na.« Der Kollege kratzte sich unbehaglich am Kopf. »Den Penis halt. Daran ist er wahrscheinlich auch gestorben. Wie es aussieht, ist er verblutet. Der Täter hat ihn ausbluten lassen wie … wie Schlachtvieh.«
»Gott im Himmel!« Vangelis, die sonst nicht leicht aus der Fassung zu bringen war, erblasste ebenfalls.
Wir gingen einige Schritte näher an den Toten heran. Der obere Teil der Jeans, die der junge, kräftig gebaute Mann trug, stand offen und war schwarz von Blut. Den Oberkörper bekleidete ein hellgrauer Kapuzenpulli, dessen Aufdruck ich aus der Entfernung nicht lesen konnte. Am linken Fuß sah ich einen weißen, noch relativ neuen Sportschuh von einer der teureren Marken, am rechten nur eine rote Socke.
Um den Toten herum standen in einem Radius von vielleicht fünf Metern etwa zwanzig rote Grablichter, die alle noch brannten. Der Mörder hatte seine grausame Tat offenbar regelrecht inszeniert.
»So etwas habe ich noch nie gesehen.« Auch Vangelis schluckte bei dem makabren Anblick.
Bremsen quietschten in unserem Rücken, die Spurensicherung rückte an, zwei Frauen, zwei Männer sprangen aus ihrem grauen Kombi, stiegen – als führten sie eine oft geübte Pantomime auf – in ihre weißen Overalls, zogen Latexhandschuhe an, die Kapuzen über die Haare, zerrten wortlos schwere Metallkoffer aus dem Laderaum ihres Fahrzeugs.
Man begrüßte sich, und der Uniformierte wiederholte seinen knappen Bericht. Der anonyme Anruf bei der Heidelberger Polizeidirektion war vor anderthalb Stunden gekommen, von einem Prepaidhandy.
»Männerstimme, eher jung als alt. Hat behauptet, er sei hier spazieren gegangen und hätte eine Leiche gesehen.«
Vangelis zückte ihr eigenes Smartphone, tippte kurz darauf herum und gab jemandem in der Direktion mit verhaltener Stimme die Anweisung, den Besitzer dieses Handys ausfindig zu machen. Möglicherweise gehörte es dem Täter selbst oder jemandem, der ihn vergangene Nacht beobachtet hatte.
Die Spurensicherer achteten sorgfältig darauf, wohin sie ihre Füße setzten, um nichts zu übersehen, keine Spuren zu zerstören. Eine der Frauen begann aus allen denkbaren Perspektiven Fotos zu schießen. Das nächste Fahrzeug brummte heran. Der Arzt.
Vangelis und der überraschend junge, schmale Mann mit runder, randloser Brille und Intellektuellenstirn schienen sich von früheren Begegnungen dieser Art zu kennen.
»Hier laufen doch bestimmt jeden Morgen hundert Jogger vorbei«, sagte ich mit Blick auf den Weg.
»Das Gras steht hoch«, entgegnete Vangelis finster. »Und der Tote liegt flach am Boden. Außerdem, wer guckt beim Joggen schon in der Gegend herum?«
Da hatte sie recht. Die meisten Jogger hatten sogar Stöpsel in den Ohren, um nichts zu hören oder zu sehen von ihrer Umgebung, während sie ihre Strecke liefen, die sie schon tausendmal gelaufen waren.
»Geben Sie mir mal die Nummer von diesem unbekannten Handy«, bat ich den Kollegen, der immer noch bei uns stand, als suchte er Schutz, und nervös von einem Fuß auf den anderen trat. Er fasste in seine Hosentasche, förderte einen zerknitterten Zettel zutage.
»Er hat mit unterdrückter Nummer angerufen.« Mit der flachen Hand wischte er sich den Schweiß von der Stirn.
Die wenigsten Menschen wissen, dass bei der Polizei auch unterdrückte Nummern angezeigt werden, dass dieser billige Trick also nicht überall und immer funktioniert. Zudem wird grundsätzlich jeder Anruf aufgezeichnet.
»Ja?«, meldete sich eine mürrische Stimme nach dem dritten Tuten. »Wenn Sie wegen dem Corsa anrufen, der ist schon weg. Hab’s bloß noch nicht geschafft, die Anzeige zu …«
»Gerlach hier«, unterbrach ich den Wortschwall des Menschen am anderen Ende. »Kripo Heidelberg.«
»Äh. Polizei? Wegen dem Corsa jetzt, oder was?«
Noch immer war ich mir nicht im Klaren darüber, ob ich mit einer Frau oder einem Mann verbunden war.
»Mit wem spreche ich denn?«
»Ich … äh … Sie sind echt von der Polizei? Und … und was wollen Sie von mir?«
»Sie haben heute Morgen eine Leiche gefunden.«
»Wenn das ein Witz sein soll, dann ist es ein verdammt schlechter.«
»Mit wem spreche ich denn bitte?«
»Ich hab in meinem ganzen Leben noch keine Leiche gefunden, du Spinner! Ist das hier so eine Radioverarsche, oder was soll der Quatsch?«
Schließlich ließ der Mensch am anderen Ende sich doch dazu herab, mir seinen Namen zu nennen. Ich sprach mit Yvonne Kübelbeck, wohnhaft in Nußloch, nur fünf Kilometer von der Stelle entfernt, wo ich mich befand.
»Hat sonst noch jemand Zugriff auf Ihr Handy?«
»Wie kommen Sie darauf? Nein. Höchstens die Miriam, meine Tochter. Sie darf es aber bloß nehmen, wenn sie mich vorher gefragt hat, dass sie mir nicht wieder das ganze Guthaben verjubelt.«
»Ist Ihre Tochter zu Hause?«
»Die ist natürlich in der Schule um die Zeit, was denken Sie denn? Sie ist dreizehn.«
»Jedenfalls hat jemand vor anderthalb Stunden von Ihrem Handy aus die Polizei angerufen.«
»Das mit der Leiche ist echt wahr? Eine Nachbarin hat mir vorhin so was erzählt. Ihr Neffe ist nämlich auch Polizist. Dann ist das also echt wahr?«
»Leider ja. Wo waren Sie denn vor anderthalb Stunden?«
»Beim Doktor war ich. Bin erst vor zehn Minuten heimgekommen. Dabei hab ich einen Termin um halb neun gehabt, aber dann ist wieder ein Notfall nach dem anderen reingeschneit. Notfälle, da lach ich doch! Privatpatienten sind das gewesen, ist doch klar wie Flädlesuppe. Von denen hat keiner wie ein Notfall ausgesehen, kein einziger.«
»Das Handy hatten Sie dabei?«
Nun wurde Frau Kübelbeck eine Spur leiser. »Das hatt ich … äh … daheim vergessen. Bin ein bisschen spät dran gewesen heut Morgen. Wenn ich gewusst hätt, dass die mich zwei Stunden warten lassen, dann hätt ich nicht so hetzen brauchen.«
»Das heißt, Ihre Tochter hätte es problemlos benutzen können.«
»Hätt sie können, wenn sie nicht in der Schule wär.«
»Sie hat einen Schlüssel zu Ihrem Haus, nehme ich an?«
»Haus?« Frau Kübelbeck lachte kurz und grimmig. »Schön wär’s! Wir leben hier in einer winzigen Zweizimmerwohnung unterm Dach, und die Frage ist bloß, wer zuerst wen umbringt. Ich die Miriam oder die Miriam mich.«
»Hat sonst noch jemand einen Schlüssel?«
»Bloß die alte Kohlberg im ersten Stock. Aber die ist schon dreiundneunzig und fast blind. Die weiß wahrscheinlich nicht mal, wie ein Handy aussieht, und die Treppen zu uns rauf schafft sie schon lang nicht mehr.«
Miriam Kübelbeck war keineswegs in der Schule, erfuhr ich vom Sekretariat der Internationalen Gesamtschule in Rohrbach, dem südlichsten Stadtteil Heidelbergs.
»Sie macht uns in letzter Zeit leider ein wenig Sorgen.« Die Schulleiterin, mit der ich verbunden wurde, seufzte. »Im Grunde ist die Miriam ein kluges und aufgewecktes Mädchen, wenn auch ein wenig still und in sich gekehrt. Im Unterricht hat sie sich noch nie durch große Beteiligung hervorgetan, aber an ihren schriftlichen Arbeiten kann man sehen, dass sie durchaus bei der Sache ist beziehungsweise war.«
»Warum sagen Sie ›war‹?«
»In den letzten zwei, drei Monaten hat sie sich verändert. Wir haben erst kürzlich im Kollegium über sie gesprochen. Sie hat in ihren Leistungen sehr nachgelassen und immer öfter unentschuldigt gefehlt. Wenn Sie Genaueres wissen wollen, müssten Sie sich an den Klassenlehrer wenden, Oberstudienrat Schumann. Den werden Sie aber erst am Nachmittag erreichen.«
»Hat Miriam Freunde in der Klasse?«
»Auch dazu kann Ihnen der Kollege mehr sagen als ich.«
»Vielleicht könnte er mich zurückrufen? Es ist wirklich sehr wichtig.«
Ich diktierte der Schulleiterin meine private Handynummer.
»Und Sie sind also von der Polizei?«, fragte sie anschließend. »Ist denn etwas … vorgefallen?«
Ich berichtete der Schulleiterin, was sie wissen musste, um die Dringlichkeit meines Anliegens zu begreifen.
»Ich suche Miriam nur als Zeugin. Eventuell hat sie etwas beobachtet.«
»Wie alt ist der junge Mann denn?« Natürlich war ihr erster Gedanke, der Tote könnte einer ihrer Schüler gewesen sein.
»Dem Augenschein nach zwischen achtzehn und zweiundzwanzig.«
Ich beschrieb ihr das Mordopfer, und die Schulleiterin klang erleichtert, als sie sagte: »Nein, kommt mir zum Glück nicht bekannt vor.«
Ich hörte das Klappern einer Computertastatur.
»Kurt, will sagen, Herr Schumann, hat gleich eine Freistunde, sehe ich gerade. Ich werde ihn bitten, sich bei Ihnen zu melden.«
Tatsächlich dauerte es keine fünf Minuten, bis mein Handy die ersten Takte von Keith Jarretts Köln Concert zu spielen begann.
»Schumann hier«, sagte eine helle, aber feste Männerstimme. »Es geht um die Miriam?«
Auch der Klassenlehrer des Mädchens konnte mir nicht mehr sagen, als dass seine Schülerin sich in den vergangenen Wochen mehr und mehr abgekapselt und mit ihren eigenen Themen und Problemen beschäftigt hatte.
»Sie ist auch auf einmal ganz anders angezogen. Früher hat sie sich immer rausgeputzt, wie die Teenies es halt so machen, kurze Röckchen, bauchfreie Tops, fette Schminke und so weiter. In letzter Zeit läuft sie auf einmal so gothic-mäßig herum. Sie wissen schon: Leder und Metall, dunkler Lippenstift, jede Menge Kajal und so weiter. Anfangs ist mir nur aufgefallen, dass sie immer gelangweilter geguckt und sich überhaupt nicht mehr am Unterricht beteiligt hat. Dann kam das mit dem neuen Outfit, und vor zwei, drei Wochen ging es los, dass sie immer öfter gefehlt hat. Teils entschuldigt, teils auch unentschuldigt. Wobei …«
»Wobei?«
»Wissen Sie, ich unterstelle niemandem irgendwas«, sagte der Oberstudienrat unbehaglich. »Aber heutzutage ist es so unfassbar leicht, eine Unterschrift zu fälschen, und wir sind ja hier schließlich keine Kriminalisten …«
Freunde oder Freundinnen schien Miriam in der Klasse nicht zu haben.
»Sie ist erst seit Beginn des Schuljahrs in meiner Klasse. Ist sitzen geblieben, hauptsächlich wegen Mathe, aber auch in den anderen Fächern ist sie regelrecht abgestürzt. Besonders umgänglich ist sie leider auch nicht. Ich habe es bis heute nicht geschafft, mal ein vernünftiges Gespräch mit dem Kind zu führen.«
»Würden Sie vielleicht kurz in die Klasse gehen und Miriams Mitschüler fragen, ob jemand weiß, wo sie stecken könnte?«
»Sie meinen, jetzt sofort?«
»Ich weiß, es ist eine Zumutung, aber ich wäre Ihnen wirklich dankbar.«
»Die 7 A müsste … Chemie haben die gerade. Ich lauf schnell rüber, okay?«
»Herr Gerlach?«, fragte eine Jungmännerstimme hinter mir kläglich.
Ich wandte mich um. Der rundliche Kollege mit weichem Gesicht und blassen Augen hatte offenbar nur darauf gewartet, dass ich das Handy vom Ohr nahm. Er war der zweite Mann der Streifenwagenbesatzung, die als erste am Tatort gewesen war.
»Nämlich … also …« Er senkte den Blick. Schluckte. Würgte fast. »Also dahinten, beim Grillplatz …«
Die Spurensicherer hatten im Papierkorb einen weißen Plastikteller gefunden samt passendem Besteck. Dieser Teller war verschmiert mit Fleischsaft und Blut. Nun musste auch ich schlucken.
»Sie meinen …?«
Der Kollege nickte mit so betretener Miene, als wäre das ganze Drama seine Schuld. »Er hat es aufgegessen, genau. Erst am Feuer geröstet, aber anscheinend nicht mal, bis es ganz durch war, und dann hat er es wirklich … aufgegessen.«
Mit einem Ruck wandte der Kollege sich ab und erbrach sein Frühstück ins Gras. Als nichts mehr kam, packte ich ihn am Oberarm und führte ihn zu dem blau-silbernen Mercedes, mit dem er hergekommen war.
»Setzen Sie sich mal hin, trinken Sie einen Schluck, versuchen Sie an was Schönes zu denken.«
»Was es für Arschlöcher gibt!«, murmelte der andere und schüttelte immer wieder den Kopf. »Wieso macht denn einer so was? Wie muss einer drauf sein, dass er so was fertigbringt?«
»Atmen Sie tief und gleichmäßig. Ich schicke Ihnen den Arzt, sobald er Zeit hat.«
»Kein Arzt.« Fahrig wischte er mit der flachen Hand an der blauen Uniformhose herum, die einiges von der Bescherung abbekommen hatte. »Geht schon. Geht schon wieder.«
Wieder mein Handy – Oberstudienrat Schumann war ein wenig außer Atem.
»Also, die Miriam ist heut nur in der ersten Stunde da gewesen. Es sei ihr nicht gut gegangen, heißt es. Richtig käsig sei sie gewesen im Gesicht, und in der Pause ist dann so ein Gothic-Typ gekommen, viel älter als Miriam. Sie haben kurz geredet, und dann ist sie anscheinend mit dem Kerl zusammen verschwunden. Eines der Mädchen sagt, sie hätte die Miriam in letzter Zeit mehrfach im Park beim Schlösschen gesehen, mit einer Clique zusammen. So vier, fünf Leute, mal mehr, mal weniger, und alle auch so gruftig aufgemacht.«
Ich ließ mir den Weg zum Rohrbacher Schlösschen beschreiben, und da ich hier ohnehin nichts weiter tun konnte, bat ich Vangelis um den Schlüssel zu unserem Dienstwagen und machte mich auf den kurzen Weg ins Tal hinunter.
2
Heute bestand Miriams Clique nur aus ihr selbst und zwei hageren, hoch aufgeschossenen und deutlich älteren Männern. Alle drei trugen die in ihren Kreisen angesagte Uniform: lange, schwarze und für die herrschende Temperatur entschieden zu warme Mäntel, schwere Stiefel, Ketten hier, Nieten dort. Dazu schwarz umrandete Augen, blasse Gesichter. Nicht nur wegen der Sonne hatten sie sich in den hintersten Winkel des kleinen Parks verzogen. Das adrette frühklassizistische Gebäude, vor zweihundertfünfzig Jahren als Jagdschloss erbaut, heute eine Dependance des Heidelberger Uniklinikums, sonnte sich im warmen Mittagslicht des Oktobertages. Miriam und ihre Freunde saßen wie satt gefressene Kormorane auf einem Mäuerchen im Schatten und ließen einen Joint kreisen. Erst als meine Schuhe in ihr Blickfeld kamen, sahen sie auf und blinzelten mich schläfrig an.
»Miriam Kübelbeck?«, fragte ich mit Blick auf das Mädchen.
Sie sah mich zwei Sekunden lang abschätzig an, sagte dann: »Fick dich selber, Opa«, warf den bis auf einen letzten Zipfel heruntergerauchten Joint in den Sand, trat ihn aus und beobachtete konzentriert, wie er verglühte.
Ich hielt meinen Dienstausweis vor ihr rundliches Gesichtchen mit leicht geröteten Augen.
»Lassen Sie sie in Ruhe«, mischte sich der Lange rechts neben ihr ohne ernsthaftes Engagement ein. »Wir haben keinem was getan. Wir hocken hier bloß und unterhalten uns.«
»Und Sie konsumieren in aller Öffentlichkeit Drogen. Die junge Dame hier ist minderjährig, das wissen Sie.«
»Und was kostet das?«, fragte der andere augenrollend und zückte allen Ernstes ein riesiges schwarzes und schon sehr abgewetztes Portemonnaie.
Ich ignorierte ihn einfach und wandte mich wieder an Miriam: »Du hast vorhin die Polizei angerufen.«
»Ich?« Ihr abfällig gemeintes Lachen geriet zu schrill. Die Stimme klang, als wäre der Joint ein wenig zu stark für sie gewesen. »Was soll’n der Scheiß, ey? Verpiss dich, Alter, haste was an den Ohren?«
Durch ihre beiden Begleiter war ein merklicher Ruck gegangen, als sie das Wort »Polizei« hörten. Vor allem der linke, der bisher keinen Ton von sich gegeben hatte, war plötzlich unruhig. Sein bartloses Gesicht war von Aknepickeln übersät, von denen manche sich entzündet hatten.
»Wir haben deine Stimme auf Band«, behauptete ich und beobachtete die Reaktion des Mädchens, ohne die anderen beiden aus dem Auge zu lassen. Der Picklige spannte die Muskeln an, spähte nach links, nach rechts, machte sich offensichtlich startklar.
Miriams Lachen missriet noch kläglicher als beim ersten Mal. »So’n Bullshit, Stimme auf Band! Ich piss mir gleich ins Höschen vor Lachen.«
»Anrufe bei der Polizei werden grundsätzlich aufgezeichnet, und …«
Der Nervöse schoss hoch und begann zu laufen. Ich folgte ihm, holte ihn ohne Anstrengung schon nach wenigen Schritten ein, da er durch den langen Mantel und die schweren Stiefel behindert und außerdem wohl nicht allzu gut in Form war. Als ich ihn am Kragen packte, warf er den Mantel ab. Ich blieb mit dem linken Fuß daran hängen, kam kurz ins Straucheln, holte ihn erneut ein und stellte ihm der Einfachheit halber von hinten ein Bein. Er schlug der Länge nach ins weiche Gras. Ich hielt ihn am Genick fest, er keuchte, schnaufte, wand sich, merkte aber bald, dass sein Widerstand sinnlos war. Meine Sorge, Miriam und der andere Kerl könnten ihrem Freund zu Hilfe kommen, erwies sich als unbegründet. Als ich über die Schulter blickte, waren beide verschwunden.
Vierzig Minuten später saßen wir uns in meinem Büro gegenüber.
Mit meinem Knie im Rücken des jungen Mannes, der von empörtem Zetern bald zu Winseln und Betteln übergegangen war, hatte ich Verstärkung gerufen, und eine Streife vom Polizeirevier Süd hatte mir geholfen, den Festgenommenen in meinen Wagen zu verfrachten. Ich hätte es vermutlich auch alleine geschafft, hatte jedoch keine Lust gehabt, im Fall des Falles noch einmal hinter dem Idioten herzulaufen.
Während der Fahrt hatte ich mir die Aufzeichnung des anonymen Anrufs aufs Handy schicken lassen und sie dem schwarz gekleideten, erbärmlich schwitzenden und ständig leise klimpernden Kerl vorgespielt. Nach kurzem Leugnen hatte er zugegeben, der Anrufer zu sein.
Mein Gegenüber hieß Jörgen Balduini, war erst kürzlich volljährig geworden und nach seinem schon zwei Jahre zurückliegenden Realschulabschluss immer noch auf der Suche nach einem Beruf, der ihm Spaß machte. Zurzeit wohnte er noch bei seinen Eltern, die mein Mitgefühl hatten, und kellnerte hin und wieder in einer Wein- und Bierstube in der Altstadt, wenn dort wieder einmal Personalmangel herrschte.
»Also dann«, eröffnete ich das Gespräch freundlich, nachdem wir beide mit Kaffee versorgt waren und ich mir die Personalien von Miriams Drogenfreund notiert hatte. »Jetzt erzählen Sie mal, was diese Aktion vorhin sollte.«
Balduini schnaufte gequält, kniff kurz die Augen zu, riss sie wieder auf. Dann gab er sich einen Ruck. »Die Miri und ich, wir lieben uns nämlich«, begann er mit einem Blick, der nirgendwo länger als eine halbe Sekunde Halt fand. Bei der Eile, mit der Miriam vorhin das Weite gesucht hatte, war diese Liebe wohl eine eher einseitige Angelegenheit.
»Ihre Ma darf’s aber nicht wissen, weil sie doch erst dreizehn ist.«
Und damit fünf Jahre jünger als ihr angeblicher Geliebter, der mich jetzt unsicher, um Verständnis bittend ansah. Er war hager, knochig und roch, als hätte ihm heute Morgen die Zeit für die Dusche gefehlt. Meist nuschelte er mehr, als dass er sprach. Ich nahm einen Schluck Kaffee und lehnte mich ein wenig zurück.
»Das ist zunächst mal nicht weiter schlimm.«
»Wir … äh … manchmal knutschen wir auch.«
Seine Hände kamen nicht zur Ruhe.
»So was kommt in den besten Familien vor.«
Er nickte, schien sich allmählich ein wenig zu entspannen, hatte vermutlich mit einer rüderen Behandlung gerechnet.
»Die Miri muss nämlich immer warten, bis ihre Alte, also, ihre Ma eingepennt ist. Sie säuft ziemlich krass, ihre Ma, und wenn die mal pennt, meistens vor der Glotze, dann weckt die so schnell nichts mehr auf. Ich hab ein Auto, also, es ist nicht wirklich mein Auto, ein Kumpel leiht mir manchmal seins, und der ist zurzeit in Urlaub in Marokko, und da hab ich die Miri gestern, also … So gegen halb zwölf ist das gewesen, wir sind nach Gaiberg raufgefahren und von da in den Wald rein. Ich kenn da nämlich einen chilligen Parkplatz, wo nachts kein Mensch ist …«
Und wo es sich ungestört knutschen ließ. Miriam hatte in der vergangenen Nacht jedoch keine Lust auf Zärtlichkeiten im Kleinwagen gehabt.
»Sie hat nämlich hinterher oft blaue Flecken, weil’s so eng ist.«
So waren die beiden auf die Idee gekommen, einen kleinen Waldspaziergang bei Vollmondlicht zu machen und sich ein gemütlicheres Plätzchen fürs Knutschen zu suchen. Es war hell genug gewesen, dass man den Weg nicht verlor, und vermutlich noch warm genug, sodass man nicht fror, wenn man nicht mehr ganz vollständig bekleidet war.
»Erst haben wir gedacht, irgendwo im Wald, wo Moos ist oder so. Aber es ist alles total nass gewesen, weil’s doch vorher geregnet hat. Dann haben wir die Lichtung gefunden, wo … Also, da sind Bänke, und eine Hütte gibt’s auch. In der Hütte ist’s dann voll geil gewesen und trocken, und ich hab eine Decke dabeigehabt, aus dem Auto, und so haben wir’s dann voll chillig gehabt.«
Die Gemütlichkeit war abrupt zu Ende gewesen, als sich ein Auto näherte.
»Was für ein Auto?«, fragte ich mit dem Stift in der Hand.
Achselzucken. »Schwer zu sagen. Es war ja stockdunkel. Größer als der Peugeot von meinem Kumpel, denk ich, aber richtig groß auch wieder nicht.«
Außer den Scheinwerfern hatte er im Grunde nichts von dem Auto gesehen.
»Die sind eckig gewesen, die Scheinwerfer, zwei auf jeder Seite, das weiß ich noch, und das Auto war schon älter.«
»Woraus schließen Sie das?«
»Es hat kein Xenon-Licht gehabt wie die neuen Autos, sondern mehr gelbes Licht. Auch keine LEDs oder wie das heißt.«
Das turtelnde Pärchen hatte seine Aktivitäten vorübergehend eingestellt und beobachtet, wie der Wagen hielt und jemand ausstieg.
»Den Motor hat er ausgemacht, aber die Lichter hat er angelassen. Erst haben wir gedacht, ein Jäger vielleicht oder ein Pilzsammler. Aber dann hat er den Kofferraum aufgemacht und die Leiche rausgeholt.«
»Woraus schließen Sie, dass es eine Leiche war?«
»Der hat sich kein bisschen bewegt und auch nicht gewehrt oder so. Wie ein Sack ist der gewesen, voll tot irgendwie.«
Der dunkel gekleidete Fahrer, nicht besonders groß, nicht besonders klein, nicht gerade breitschultrig, hatte den leblosen Körper dann mit ziemlicher Mühe in die Mitte der Lichtung geschleift.
»Und da sind wir dann abgehauen. War krass gruselig, das alles.«
»Hat der Mann Sie bemerkt?«
»Nö. Wir sind immer schön im Dunkeln geblieben, und der Typ hat sich sowieso um nichts gekümmert. Der ist viel zu beschäftigt gewesen.«
»Womit?«
»Mit seiner Leiche halt, nehm ich an. Wir haben da lieber gar nicht hingeguckt, weil’s doch so gruselig war. Die Miri hat auch voll Panik geschoben. Hat gemeint, wenn er uns erwischt, dann macht er uns auch kalt.«
Anfangs waren die beiden durch den Wald gelaufen, später, als sie außer Hörweite waren, auf dem Weg.
»Dann müssten Sie den Wagen auch von hinten gesehen haben.«
Balduini zerrte an seinen Fingern herum, als wollte er sie zum Knacken bringen, was jedoch nicht klappte.
»Ehrlich, Mann, mir ist das so was von egal gewesen, was das für ein Auto war. Mir ist auch krass die Muffe gegangen, und voll schlecht ist mir gewesen und der Miri auch. Hab dann auch voll scheiße geschlafen in der Nacht, das können Sie mir glauben.«
»Wie spät war es eigentlich, als der Mann mit dem Auto kam?«
Das wusste der junge Zeuge nur ungefähr. »Daheim gewesen bin ich um halb zwei, von Gaiberg losgefahren bin ich gegen eins, glaub ich. Und dann hab ich erst mal Miri heimgebracht.«
Der Mord war also zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens geschehen. Dass der Fundort zugleich der Tatort war, hatten die Spurensicherer bereits festgestellt. Das Opfer hatte noch gelebt, als der Mörder es auf die Lichtung schleifte, war allerdings offenbar nicht bei Bewusstsein gewesen.
Balduini hatte seine kleine Freundin nach Hause gebracht und war anschließend mit dem geliehenen Auto nach Kirchheim gefahren, wo das Reihenhaus seiner Eltern stand.
»Ein saublödes Feeling hab ich gehabt die ganze Zeit«, gestand er. »War ja klar, dass da irgendeine linke Sache läuft. Drum hab ich dann gleich gesagt, wir müssen Bescheid geben. Wir müssen die Polizei anrufen. Aber die Miri wollt nichts hören von Polizei. Weil sie doch erst dreizehn ist.«
Am Morgen hatte er zu seinem Schrecken festgestellt, dass die Decke, die ins Auto seines Kumpels gehörte, in der Schutzhütte geblieben war.
»Ich also noch mal hin zu der Hütte. Nicht dass die Decke einer findet, hab ich gedacht. Mein Kumpel wär bestimmt auch megasauer, wenn die weg wär, die Decke, weil, die ist noch fast neu.«
Als er wieder an der Lichtung war, hatte die Decke noch an ihrem Platz gelegen, und vorübergehend hatte Balduini gedacht, alles sei nur ein schlechter Traum gewesen.
»Aber dann bin ich ein Stück auf die Lichtung raus, und da hat er dann gelegen, und so rote Kerzen waren da und haben sogar noch gebrannt. Näher ran hab ich mich nicht getraut.«
»Wieso haben Sie nicht gleich die Polizei angerufen?«
»Dann wär doch rausgekommen, dass die Miri nachts nicht daheim gewesen ist, und sie hätt wieder Zoff mit ihrer Alten gehabt. Drum wollt ich erst mit ihr reden. Ich wollt auch nicht in irgendwas reingezogen werden, weil … Ich steh nicht auf Stress mit der Bullerei.«
So war er weiter nach Rohrbach gefahren, hatte Miriam nach der ersten Stunde im Klassenzimmer abgefangen und ihr erzählt, was er auf der Lichtung gesehen hatte: dass dort wirklich und wahrhaftig ein Toter lag.
»Da ist sie gleich wieder voll ausgetickt, hat gemeint, das geht ihr alles am Arsch vorbei und ich soll sie in Ruhe lassen und sie will nichts mit so Zeug zu tun haben. Bringt bloß Stress, hat sie gemeint, und bestimmt kriegen wir total Ärger, weil sie doch erst dreizehn ist. Drum wollten wir dann auch nicht mit einem von unseren Handys anrufen, und da sind wir auf die Idee gekommen mit dem Handy von ihrer Alten. Die ist beim Arzt gewesen, das hat die Miri gewusst, und das Handy lässt sie meistens daheim liegen.«
»Noch mal zurück zur vergangenen Nacht. Versuchen Sie bitte, sich die Szene genau vorzustellen. Vielleicht haben Sie ja noch mehr gesehen, etwas, das uns helfen könnte, den Täter zu finden.«
Balduini schloss die Augen, öffnete zögernd den Mund: »Also, das Auto ist gekommen. Ziemlich langsam. Der Weg da ist übelst holprig, und drum wollt er vielleicht nicht schneller fahren, keine Ahnung.«
»Wie hat sich das Auto angehört? Hat es normale Geräusche gemacht? Oder war irgendwas ungewöhnlich?«
»Der Motor hat okay geklungen. Da hat nichts geklappert oder gescheppert oder so. Aber, jetzt, wo Sie fragen: Die Federn, die haben gequietscht. Und die Tür auch, wie er sie aufgemacht hat.«
Dann war es wohl wirklich ein älteres Fahrzeug gewesen. Eckige Scheinwerfer waren in den Achtziger- oder frühen Neunzigerjahren modern gewesen, meinte ich mich zu erinnern.
»Diesel oder Benziner?«
»Kein Diesel.«
»Die Standlichter, waren die extra oder in die Scheinwerfer integriert?«
Dieses Mal überlegte Balduini länger. »Extra«, sagte er schließlich und vollführte wieder den Augen-zukneifen-und-aufreißen-Ritus. »Unter den Scheinwerfern sind die gewesen und auch eckig. Und, jetzt fällt’s mir ein, eins war kaputt.«
»Von den Standlichtern?«
Plötzlich blinzelte er aufgeregt. »Genau, das linke. Nein, das rechte. Also, vom Fahrer aus gesehen das rechte.«
»Er hat den Motor ausgemacht, die Lichter aber angelassen.«
»Damit er was sehen kann, nehm ich an. Sonst war’s ja ziemlich schattig da.«
»Der Mond hat geschienen.«
»Klar, aber trotzdem.«
»Er hat also die Tür aufgemacht …«
»Und die hat gequietscht, die Tür, aber das hab ich schon gesagt, glaub ich.«
Der Fahrer war ausgestiegen und nach hinten gegangen, hatte den Kofferraum geöffnet und den leblosen Körper herausgezerrt.
»Sie haben vorhin gesagt, er hätte sich ein bisschen schwergetan damit. Er war also nicht besonders kräftig.«
»Gar nicht, nein.«
»Wie konnten Sie das eigentlich sehen? Haben die Scheinwerfer Sie nicht geblendet?«
Die Augen wurden geschlossen und wieder aufgerissen. »Wir haben das Auto mehr so von schräg vorne gesehen. Er hat den anderen rausgezerrt und einfach fallen lassen. Wollt ihn wohl rausheben, hat’s aber nicht geschafft, und dann hat er den einfach volle Kanne runterknallen lassen. Hab noch gedacht, autsch, das hat bestimmt wehgetan.«
»War er gefesselt?«
Ratloses Kopfschütteln. »Glaub ich nicht, nein. Jedenfalls hat er den dann unter den Achseln gepackt und auf die Lichtung geschleift. Übelst geschnauft hat er dabei und gestöhnt und so. Der Fitteste ist der echt nicht gewesen.«
Im Vorzimmer hörte ich Sönnchen telefonieren. Offenbar ging es nicht um dienstliche Angelegenheiten, denn sie lachte viel und herzlich dabei. Auf der Straße unten beschimpfte eine Frau mit kreischender Stimme ein jämmerlich weinendes Kind.
Ich ging noch einmal die Beschreibung des Täters durch, die ich mir eben notiert hatte. Balduini blieb dabei, der Mann sei weder auffallend groß noch ungewöhnlich klein gewesen.
»Was für Haare hatte er?«, hakte ich nach.
Wieder grübelte mein Zeuge ein Weilchen mit geschlossenen Augen. »Kann ich nichts zu sagen, sorry. Jedenfalls ist nichts Auffälliges dran gewesen, an den Haaren. Kein Iro oder Afro oder so. Voll normal halt, irgendwie.«
»Vom Gesamteindruck – wie alt würden Sie ihn schätzen?«
»Jung nicht. Richtig alt auch nicht. Vielleicht wie mein Pa, Mitte vierzig? Keine Ahnung.«
»Was haben Sie von dem anderen Mann gesehen?«
»Von dem aus dem Kofferraum? Gar nichts, eigentlich.«
»Immerhin so viel, dass Sie sagen können, dass es ein Mann war.«
Sein Blick wurde ratlos. »Stimmt. Wieso eigentlich? Vielleicht, wie er angezogen war? Oder weil eine Frau leichter gewesen wär?«
»Es gibt auch schwere Frauen.«
Balduini grinste kurz und schief. »Sie müssten Miris Alte mal sehen. Stimmt total!«
»Konnten Sie erkennen, was das Opfer angehabt hat?«
Er kratzte sich umständlich an der Nase. »Eine Jeans, wahrscheinlich. Einen Pulli mit Kapuze, da bin ich sicher. Der ist heller gewesen als die Hose, ein bisschen.«
»Schuhe?«
»Sneakers, denk ich, oder … Warten Sie, ich glaub fast, er hat bloß einen angehabt, bloß einen Schuh. Den anderen hat er vielleicht verloren bei dem Gezerre. Oder er ist im Auto geblieben, keine Ahnung. Oder er hat ihn vorher schon verloren, wie der Typ ihn in den Kofferraum gestopft hat?«
So schlecht, wie ich befürchtet hatte, schien Balduinis Erinnerungsvermögen doch nicht zu sein.
»Und heute Morgen? Was haben Sie da gesehen?«
»Bloß, dass er noch da gewesen ist. Dass irgendwas da gewesen ist. Ich … Ich bin da nicht hingegangen, wissen Sie? Wollt nicht mal genau hingucken, weil mir gleich wieder die Kotze hochgekommen ist.«
»Sie sind sich also nicht sicher, dass das, was Sie heute Morgen gesehen haben, der Mann aus dem Kofferraum war?«
»Was …« Balduini schluckte, dass sein ausgeprägter Adamsapfel hüpfte. Der Pickel an der Nase, an dem er sich eben gekratzt hatte, begann ein wenig zu bluten. »Ich mein, was hätt’s denn sonst sein sollen?«
Ich stellte ihm noch mehr Fragen, wiederholte, was wir schon besprochen hatten. Aber es kam nichts Neues mehr hinzu.
»Jetzt hätte ich noch eine Bitte«, sagte ich, als ich meine Notizen zur Seite legte. »Wir haben hier eine Art digitales Fotoalbum mit Bildern von allen möglichen Autos. Und wir haben Leute, die sich mit dem Thema gut auskennen und Ihnen helfen können. Es wäre für mich eine sehr große Hilfe, wenn ich wüsste, was für ein Auto der Täter fährt.«
Balduini war geradezu begeistert von meinem Vorschlag, vermutlich auch heilfroh, dass die lästige Fragerei endlich zu Ende war. Er bedankte sich überschwänglich für den Kaffee und war offenkundig erleichtert, dass er immer noch keine Handschellen trug.
»Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf«, sagte ich, als ich seine kalte, schweißklebrige Hand drückte. »Passen Sie auf mit Ihrer Miriam. Sie ist noch nicht mal vierzehn, und Sie sind schon erwachsen. Wenn da irgendwas anbrennt, dann kommen Sie schlimmstenfalls vor Gericht, ist Ihnen das klar?«
Als Jörgen Balduini die Tür hinter sich schloss, war es zehn Minuten vor drei. In Kürze würde die erste Sitzung der Soko »Grablicht« beginnen, zu deren Leiterin ich Klara Vangelis bestimmt hatte.
Gerade noch genug Zeit, um noch einmal Frau Kübelbeck anzurufen, Miriams Mutter. Ich musste unbedingt heute noch mit ihrer Tochter sprechen. Frau Kübelbeck ging allerdings nicht an ihr Handy. So ließ ich mir einen Cappuccino aus der Maschine und machte mich mit ihm zusammen auf den Weg zum Besprechungsraum.
3
Vierzehn Beamtinnen und Beamte saßen um den großen, quadratischen Tisch herum. Vangelis eröffnete die Sitzung mit einem knappen Bericht zum Stand der Ermittlungen. Per Beamer projizierte sie Tatortfotos an die Wand, referierte den mutmaßlichen Ablauf der Geschehnisse in der vergangenen Nacht und vergaß auch nicht, unsere beiden Augenzeugen zu erwähnen.
»Immerhin haben wir Reifenspuren gefunden«, sagte sie am Ende. »Leider keine besonders guten, obwohl der Boden weich war vom Regen. So konnten wir zumindest den Reifenhersteller und die Größe bestimmen.«
Ich berichtete, was mir Jörgen Balduini zum Tatablauf und dem Fahrzeug des Täters erzählt hatte.
»Also, der Typ ist eindeutig ein Perverser!«, verkündete Rolf Runkel aufgebracht. Er war der Älteste in der Runde, hatte nur noch wenige Monate bis zur Pensionierung. »Einem den Schniepel abschneiden ist ja schon krank genug. Aber den Zipfel anschließend auch noch aufessen, also wirklich! Wahrscheinlich hat er sich dabei auch noch einen runtergeholt, diese perverse Sau.«
»Entsprechende Spuren haben wir nicht gefunden«, widersprach Vangelis kühl, »aber danke für den Hinweis.« Sie blickte in die Runde und fuhr fort: »Fingerspuren haben wir dagegen reichlich gefunden. Der Täter hat keinerlei Maßnahmen getroffen, um seine Identität zu verschleiern. Und das, obwohl wir es eindeutig nicht mit einer Spontantat zu tun haben. Das war alles bis ins Detail geplant und vorbereitet. Dafür sprechen zum Beispiel die Grablichter, aber auch der Ort, die Tatzeit. Seine DNA werden wir vermutlich am Opfer finden und mit Sicherheit an dem Plastikbesteck, das er benutzt hat, um … Nun ja.«
»Und an dem Stöckchen, mit dem er den … ähm … Penis ins Feuer gehalten hat«, fügte Laila Khatari hinzu.
»Was ist eigentlich mit der Tatwaffe?«, fragte ich.
»Haben wir bisher nicht gefunden. Nach den sauberen Wundrändern zu schließen, muss es ein sehr scharfes Messer gewesen sein. Im Mülleimer lag übrigens auch ein blutiges Papiertaschentuch, mit dem er es vermutlich abgewischt hat. Mehr lässt sich zu diesem Punkt nicht sagen, solange uns der Obduktionsbericht nicht vorliegt.«
Mit einem ersten, vorläufigen Bericht der Rechtsmediziner rechnete Vangelis noch heute.
Außerdem hatten die Spurensicherer Textilfasern an der Bank gefunden, auf der der Täter gesessen hatte.
»Er scheint eine Hose aus einem braunen Wollstoff getragen zu haben. Eventuell haben wir auch noch ein Haar von ihm«, sagte Vangelis zu diesem Punkt. »Dunkelblond, dünn, noch nicht ergraut, knapp fünfzehn Zentimeter lang.«
»Ganz schön langes Haar für einen Mann«, fand Laila.
»Außerdem zwei Fußabdrücke, glatte Sohlen, vermutlich Slipper, eventuell auch Schnürschuhe. Größe zweiundvierzig oder dreiundvierzig, meint die KTU. Mit Zeugen sieht es abgesehen von dem Pärchen …«, Vangelis schenkte mir ein halbes Lächeln, »schlecht aus. Da oben ist nachts natürlich niemand mehr unterwegs. Ich schlage vor, wir gehen gleich massiv an die Öffentlichkeit.«
Ich reckte den Daumen.
»Vielleicht ist jemandem in der fraglichen Zeit auf der Straße ein Auto mit viereckigen Scheinwerfern und defektem Standlicht aufgefallen«, überlegte ich. »Die Form der Scheinwerfer ist ja heutzutage eher ungewöhnlich.«
»Rolf hat recht, wer macht denn so was, um Gottes willen?«, fragte eine junge Kollegin fassungslos, als Vangelis sich setzte. »Wie muss einer ticken, um sich so was auszudenken, Herrgott noch mal!«
»Ein Perverser«, wiederholte Rolf Runkel voller Überzeugung.
»Oder eine Emanze«, schlug ein anderer grinsend vor. »So eine mit lila Latzhose und Penisneid.«
»Blödmann!«, fuhr ihn die Kollegin an.
»Die Hose war nicht lila, sondern braun«, korrigierte Vangelis kühl. »Aber wir können de facto noch nicht ausschließen, dass wir es mit einer Täterin zu tun haben.«
»Wenn ich richtig verstanden habe, dann sagt der Zeuge klipp und klar, es war ein Mann«, versetzte die Kollegin gekränkt.
»Es gibt genug Emanzen, die wie Kerle aussehen.« Der Kollege musste offenbar unbedingt das letzte Wort haben.
»Schluss jetzt!«, sagte ich scharf und blickte finster in die Runde. »Witze können Sie nachher beim Kaffee machen.«
Natürlich fragte auch ich mich, was in dem Täter (oder der Täterin) vorgegangen sein mochte. Was ihn (beziehungsweise sie) dazu getrieben hatte, einen Menschen auf derart grausame und erniedrigende Weise zu töten. Wie viel Hass musste dabei im Spiel sein? Oder sollte es eine rituelle Handlung gewesen sein? Wollte das Opfer womöglich sogar von seinem Penis befreit werden, und sein Tod war gar nicht eingeplant gewesen, sondern nur ein Betriebsunfall? So etwas kam hin und wieder vor. Da kaum ein Arzt dieser Welt eine solche Operation ohne medizinische Indikation oder im Rahmen einer amtlich abgesegneten Geschlechtsumwandlung durchführen würde, blieb in solchen Fällen nur, selbst zum Messer zu greifen oder einen Freund um Hilfe zu bitten.
All diese Fragen würde uns am Ende wohl nur der Täter oder die Täterin beantworten können.
Unsere Hoffnungen ruhten auf der in Kürze zu erwartenden Identifizierung des Opfers und den DNA-Spuren des Mörders. Früher oder später würde sich jemand wundern, wo der junge Mann aus der Nachbarschaft geblieben war, der erwachsene Sohn, der Freund, der Geliebte. Und da in neun von zehn Mordfällen der Täter im nahen Umfeld des Opfers zu finden war, würden wir dann hoffentlich leichtes Spiel haben. Sollte die DNA des Täters in den Datenbanken des BKA abgelegt sein, dann würden wir in ein, zwei Tagen seinen Namen kennen. Sollte das Opfer nicht vermisst werden und der Täter noch nicht polizeibekannt sein, aber in der Vergangenheit schon einmal ein ähnliches Delikt begangen haben, dann würden sich aus dem Vergleich der Tatumstände möglicherweise Anhaltspunkte ergeben. Außerdem war wirklich nicht auszuschließen, dass sein Fahrzeug in der vergangenen Nacht jemandem aufgefallen war. Ein Mensch, der etwas so Abartiges tat, stand unter enormem Stress und machte deshalb häufig kleine oder große Fehler. Wäre es nicht so, dann blieben unendlich viele Verbrechen unaufgeklärt. Die Erfolge der Kriminalpolizei basieren nur zu oft auf der Dummheit oder Schusseligkeit der Täter.
Ich zwang mich, wieder zuzuhören.
»Fünf mögliche Zufahrtswege«, erläuterte Runkel gerade, der jetzt vor der Leinwand stand, wo eine Luftbildaufnahme des Tatortbereichs zu sehen war. »Er kann von Osten her gekommen sein, von Neckargemünd und Waldhilsbach, oder von Süden, von Gaiberg, von Westen entweder über den Bergfriedhof oder über den Boxberg oder aus der Stadt über den Königstuhl.«
»An den meisten Strecken gibt’s doch bestimmt Kameras«, vermutete Laila Khatari. »Da haben wir vielleicht eine Chance.«
»In Gaiberg eher nicht«, meinte Runkel stirnrunzelnd. »Und in Waldhilsbach auch nicht. Das sind Dörfer.«
»Aber wenn er durch Heidelberg gefahren ist, dann haben wir eine reelle Chance, dass eine Kamera den Wagen aufgezeichnet hat«, behauptete Laila Khatari hartnäckig.
»Das ist in jedem Fall ein Ansatz«, meinte auch Vangelis. »Würdest du das übernehmen, Laila?«
So ist es am Anfang oft. Man hat einen Tatort, man hat ein Opfer, manchmal nicht einmal das, vielleicht schon die eine oder andere mehr oder weniger glaubwürdige Information über Täter und Tathergang. Ansonsten stochert man im Nebel herum, macht sich unendlich viele, größtenteils sinnlose Gedanken, die auf Vermutungen basieren, auf Hoffnungen und mehr oder weniger fragwürdigen Annahmen. Und wartet auf den großen Knall, die plötzliche Erleuchtung, den erlösenden Anruf, die eine, alles entscheidende, alles verändernde Information, nach der nichts mehr ist wie zuvor.
Dienstag, 22. Oktober, 16:50 Uhr
Wären nicht die Blutflecken an meinem Hemd, an meiner Hose, an meinen Schuhen – ich könnte glauben, alles sei nur eine Illusion gewesen, wie schon so oft. Wieder nur ein Wunschtraum, aus dem man mit dem schalen Gefühl erwacht, sich wieder nicht getraut zu haben. Einmal mehr versagt zu haben, sich selbst gedemütigt.
Dabei fällt mir ein: Ich muss unbedingt die beschmutzten Sachen vernichten, verbrennen am besten. Aber noch kann ich es nicht. Immer wieder muss ich mir die braunen Flecken ansehen, um mich zu versichern, dass es dieses Mal kein Traum war, sondern glasklare, kristallharte Realität.
Eine grandiose, eine vollkommen neue Art von Realität.
Eine ganz und gar neue Welt, in der alles möglich ist.
… um im Schlaf vergess’nes Glück
und Jugend neu zu lernen!
4
Jörgen Balduini hatte gefühlte tausend Fotos von älteren Kleinwagen mit Stufenheck betrachtet, erzählte er mir aufgekratzt, als er später noch einmal bei mir hereinschaute. »Aber irgendwie … je mehr Fotos ich angeguckt hab, desto unsicherer bin ich geworden. Es könnt ein VW sein, ein Opel, ein Ford, ein Japaner, ein Koreaner. Es sind einfach zu viele, sorry, tut mir leid.«
Schon eine Stunde später meldete Klara Vangelis Neuigkeiten. Auf die ersten Radiomeldungen hin hatte sich tatsächlich eine Autofahrerin gemeldet, der in der vergangenen Nacht ein Wagen aufgefallen war, dessen Fahrer sich merkwürdig verhalten hatte.
»Sie ist auf dem Weg hierher«, berichtete sie. »Wollen Sie dabei sein?«
Was für eine Frage!
Der Name der Zeugin war Angela Fromm. Sie war Mitte dreißig und bei einem großen Architekturbüro in Eppelheim angestellt, erfuhren wir, als wir ihr eine Viertelstunde später gegenübersaßen. Sie war farbenfroh gekleidet, mutig geschminkt und duftete stark nach einem Parfüm der mittleren Preisklasse. Ihr etwas zu rotes Haar war kunstvoll zu einem chaotischen Mopp toupiert. Obwohl schon Herbst war, trug sie ein verwegen kurzes Kleidchen in Sommerfarben, dazu raffiniert gemusterte dunkle Strümpfe und schwindelerregende High Heels, deren flammendes Rot perfekt zur Haarfarbe passte.
»Eigentlich müsste ich ja jetzt arbeiten, aber die Chefin hat mir freigegeben, wie sie gehört hat, dass es um den Mord geht«, erklärte sie mit großen, runden Augen. »Wir gucken alle total gerne Krimis, und ich habe den Mädels versprechen müssen, hinterher haarklein zu erzählen, wie es hier ist und so. Dürfte ich ein Selfie machen mit Ihnen zusammen?«
»Später«, entschied ich. »Und nur, wenn es nicht im Internet auftaucht.«
Letzteres hätte ich besser nicht sagen sollen, denn nun war sie verunsichert, starrte krampfhaft auf ihre schmalen Hände mit vielfarbig lackierten und bunt glitzernden Nägeln.
Das Gespräch fand in Vangelis’ Büro statt, das sie zurzeit allein benutzte. Ihr früherer Bürogenosse war vor drei Monaten in Pension gegangen, und wir hatten zurzeit große Probleme, geeigneten Nachwuchs zu finden.
»Es ist nur wegen Datenschutz«, versuchte ich die bunte Frau zu beruhigen. »Natürlich unterstellen wir Ihnen nicht, dass Sie so etwas tun würden.«
Nun lächelte sie wieder, wollte zu einer Erklärung ansetzen, aber ich winkte ab und überließ die weitere Gesprächsführung meiner Kollegin.
»Ihnen ist also in der vergangenen Nacht ein Auto aufgefallen.«
»Stimmt«, bestätigte die Zeugin aufgeregt nickend und mit leicht geröteten Bäckchen. »An der Kreuzung war das, wo es rechts nach Rohrbach geht.«
Das Auto hatte vor ihr an der Ampel gestanden.
»So ein kleines, hellgraues ist es gewesen, schon ziemlich alt. Und ich glaube, der Auspuff ist kaputt gewesen. Wir haben Rot gehabt, weit und breit war sonst niemand. Und die ganze Zeit hat der mit dem Gas gespielt, so brumm, brumm, brumm. Als wenn er total nervös wäre.«
»Wie spät war es da?«
»Nach Mitternacht. Viertel nach oder zwanzig nach. Später auf keinen Fall. Und dann, wie’s grün wird, da würgt der Blödmann auch noch den Motor ab.«
»Der Fahrer war ein Mann?«
»Frauen machen nicht so mit dem Gas rum. Auch, wie er dann losgefahren ist.«
»Wie ist er denn gefahren?«
»Es hat ein wenig gedauert, bis der Motor wieder angesprungen ist, und wie ich schon zurücksetzen und um den Deppen rumfahren will, da schießt er auf einmal los. Der Motor hat richtig geheult, und die Reifen haben sogar gequietscht, so hat der Gas gegeben! Wie ein Irrer ist der davon. Und einen Wahnsinnskrach hat er auch gemacht, drum glaub ich doch, dass der Auspuff kaputt war. So fahren doch normalerweise nur Männer.«
Ich dachte an den Fahrstil meiner Mitarbeiterin und konnte mir ein Grinsen nicht ganz verkneifen.
»War sonst etwas Besonderes an dem Auto?«, fragte Vangelis ungerührt weiter.
»Eigentlich nicht, wieso?«, fragte Angela Fromm mit treuherzigem Blick zurück. »Aber das ist doch nicht normal, dass man mitten in der Stadt so rast, noch dazu nachts, wenn die Leute schlafen.«
»Kennen Sie sich mit Autos aus?«, fragte ich.
»Bisschen, wieso?«
»Was war es denn für eines?«
»Sie meinen die Marke? Also … Ehrlich, kann ich nicht sagen. Habe den ja auch bloß von hinten gesehen, und wie sollte ich ahnen, dass da ein Mörder drinsitzt?«
»Die Farbe?«
»Habe ich doch schon gesagt: hellgrau. Vielleicht auch beige oder cremeweiß. So genau weiß ich das nicht. Es war doch mitten in der Nacht.«
»Das Auto war eher klein …«
»Ganz klein auch nicht. Vielleicht so mittel. Oder nein, doch eher klein, wenn ich darüber nachdenke.«
»Was fahren Sie denn?«
»Einen Fiat Punto. Sooo klein ist er aber nicht gewesen. Eher wie ein Passat vielleicht. Meine Chefin fährt einen Passat. Oder nein, so groß war er auch wieder nicht. Eher wie ein Golf, vielleicht?«
»Ein VW war es aber nicht? Den hätten Sie vermutlich erkannt.«
»Ich kann Ihnen sagen, was es bestimmt nicht war: BMW, Mercedes, Volvo oder so was. VW – könnte sein, wieso eigentlich nicht?«
Ratlos zuckte sie die wohlgeformten Schultern, wodurch ihre ebenfalls wohlgeformten Brüste hüpften.
»Haben Sie das Nummernschild gesehen?« Ich zwang mich, ihr wieder ins Gesicht zu blicken.
»Gesehen ja, aber nicht darauf geachtet. Ich konnte ja nicht ahnen …«
»Heidelberg oder nicht Heidelberg?«
»Ehrlich, ich … Wenn ich raten soll, würde ich sagen: eher nicht von hier.«
»In welche Richtung ist er weitergefahren?«
»In den Tunnel rein. Ich bin dann nach Neuenheim abgebogen, weil ich da wohne.«
»Können Sie den Wagen vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben?«, übernahm Vangelis wieder. »War es ein Kombi? Hat er ein schräges Heck gehabt mit einer großen Heckklappe oder einen Kofferraum? Wie haben die Rücklichter ausgesehen?«
»Also, ein Kombi war’s nicht. Ich glaube, er hat so einen normalen, altmodischen Kofferraum gehabt. Die Rücklichter? Ja also, was kann man dazu sagen?«
»Waren sie rund oder eckig?«
»Eines hat nicht funktioniert, das rechte, glaube ich. War wirklich schon eine ziemlich alte Kiste, und der Auspuff ist ja auch kaputt gewesen. Frisch gewaschen ist er mir vorgekommen, er war ziemlich sauber. Sauberer jedenfalls als mein Punto, und … warten Sie … Etwas war noch. Etwas ist mir noch aufgefallen. Aber was?« Unsere Zeugin dachte angestrengt nach, presste die hellrot geschminkten Lippen zusammen. Dann sah sie wieder auf. »Jetzt hab ich’s: Er hat schwarze Stoßstangen gehabt, so richtige Stoßstangen, meine ich. Das ist mir aufgefallen, heutzutage haben sie ja alle nur noch diese Plastikdinger, wo man gleich in die Werkstatt muss, wenn man mal irgendwo ein bisschen anbumst.«
Klara Vangelis drückte einige Tasten an ihrem Notebook und drehte es so, dass die Zeugin den Bildschirm sehen konnte.
»Blättern Sie das hier mal in Ruhe durch. Vielleicht ist das Auto ja dabei, das Sie gesehen haben. Oder wenigstens eines, das so ähnlich aussieht.«
Angela Fromm zupfte eine bunte Brille aus ihrer bunten Handtasche, zog das Notebook näher zu sich heran, klemmte die Zungenspitze zwischen die Zähne und begann, Fotos durchzuklicken. Schon nach wenigen Augenblicken sah sie mit betretener Miene auf.
»Wär’s vielleicht okay, wenn ich das allein machen könnte? Macht mich ein bisschen nervös, wenn Sie zugucken.«
Wir erhoben uns ohne Zögern. »Ich wollte sowieso gerade einen Kaffee trinken«, sagte ich. »Möchten Sie auch einen?« Angela Fromm mochte gerne. »Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Wir werden noch eine ganze Weile hier sein.«
Vangelis warf eine Münze in den Schlitz der Kaffeemaschine am Ende des Flurs und ließ einen Café creme für unsere Zeugin heraus.
»Was halten Sie davon?«, fragte sie, als wir kurz darauf mit weißen Pappbechern in den Händen neben dem Automaten am Fenster standen. »Wirklich ein Geisteskranker, wie unser Kollege Runkel meint, oder Tötung auf Verlangen mit speziellen Begleitumständen?«
»Ich weiß nicht, ob man zuverlässig verblutet, nachdem einem der Penis abgeschnitten wurde.«
»Wenn die Wunde nicht versorgt wird, vielleicht schon.«
»Dagegen, dass das Opfer mit der Amputation einverstanden war, spricht, dass es schon bewusstlos war, als der Täter es zum Tatort gefahren hat.«
Vangelis nickte in ihren Kaffee. »Also doch eher ein sexuelles Motiv?«
»Oder eine besonders perfide Form von Rache? Das mit dem Penis muss etwas zu bedeuten haben. Vielleicht soll es ein Symbol sein, vielleicht will er uns damit eine Nachricht zukommen lassen.«
Für Sekunden herrschte ratloses Schweigen.
»Wir haben immer noch keine Vermisstenmeldung?«, fragte ich dann.
Vangelis schüttelte den Kopf, dass die schwarzen Locken wippten. »Vielleicht ist er Student und neu in der Stadt. Das Semester hat gerade erst begonnen, er hat hier noch keine Freunde gefunden, die Eltern leben weit weg oder sind es gewohnt, dass ihr Sohn tagelang nichts von sich hören lässt.«
»Früher oder später wird sich jemand wundern, wo er bleibt. Jemand in diesem Alter verschwindet nicht unbemerkt.«
Die Tür zu Vangelis’ Büro sprang auf, und Angela Fromm streckte das toupierte Köpfchen heraus. »Ich glaube, ich habe ihn!«, verkündete sie triumphierend.
Der Wagen sei ein Mazda gewesen, behauptete sie, als wir wieder in Vangelis’ Büro saßen, Modell 323, Baujahr 1979 oder 1980.
»Auf der Ablage hat so ein gehäkelter Hut gelegen, Sie wissen schon, wie man die ganz früher gehabt hat, mit einer Rolle Klopapier drin. Und außerdem zwei oder drei Kuscheltiere.«
Vangelis warf ihren Becher zielsicher in den Papierkorb. Ich tat es ihr nach und traf daneben.
»Wie sicher sind Sie bei der Uhrzeit?«, fragte ich.
»Ziemlich. Ich bin mit einer Kollegin essen gewesen, beim Thai in der Bergheimer Straße. Und ich hatte, na ja, das sollte ich hier vielleicht besser nicht sagen …«
»Wir sind nicht die Verkehrspolizei. Sie können es ruhig zugeben, wenn Sie etwas getrunken haben.«
»Bloß ein Bierchen. Und vielleicht noch einen Schluck von meiner Kollegin. Die hat mehr getrunken, hat sich sogar ziemlich die Kante gegeben. Wir haben ihre Trennung gefeiert. War ein langer Krieg mit ihrem Typ, bis sie endlich von ihm losgekommen ist. Der ist aber auch ein Kotzbrocken. Geprügelt hat er sie, und – na ja – im Bett ist er auch nicht gerade zartbesaitet gewesen.«
Vangelis machte sich mit stoischer Miene Notizen.
»Wie oft die arme Tina mit blauen Flecken zur Arbeit gekommen ist! Am Ende hat sie schon davon geträumt, dem Kerl nachts sein Ding abzuschneiden und es aus dem Fenster zu schmeißen, damit ein Hund es frisst oder eine Katze. Aber das hat sie zum Glück dann doch nicht gemacht. Er hat dafür gedroht, sie umzubringen, wenn sie ihn verlässt, stellen Sie sich das mal vor! Sachen gibt’s, man würd’s nicht glauben, wenn man’s nicht selber erlebt hätte. Jedenfalls ist sie megafroh, dass es endlich vorbei ist.«
»Haben Sie zufällig noch den Kassenbeleg von dem Lokal?«, fragte ich.
Den hatte die glücklich getrennte Kollegin. »Sie hat mich eingeladen.«
»Könnten Sie sie bitte danach fragen? Es wäre wichtig für uns, möglichst genau zu wissen, wann Sie den Mazda gesehen haben.«
»Die im Lokal müssten das doch im Computer nachgucken können, oder nicht?«
Vangelis hielt den Hörer schon in der Hand, und Sekunden später wussten wir, dass Angela Fromm das Lokal wenige Minuten vor Mitternacht verlassen hatte.
»Wir haben dann auf dem Gehweg noch ein wenig gequatscht und eine geraucht. Aber höchstens zehn Minuten, und mein Punto hat gleich um die Ecke gestanden.«
Wir erhoben uns, um die Zeugin zu verabschieden, die uns möglicherweise ein gutes Stück vorangebracht hatte. Bevor sie mir die Hand reichte, zückte sie mit verschmitztem Grinsen ihr Handy.
»Selfie! Sie haben’s versprochen.«
Als ich wieder an meinem Schreibtisch saß, war es schon halb sechs, und ich wählte noch einmal die Nummer von Frau Kübelbeck. Dieses Mal ging sie ans Telefon.
»Die Miriam ist krank«, verkündete sie resolut. »Mit der können Sie nicht reden.«
»Es wäre aber sehr, sehr dringend.«
»Ist mir egal. Rufen Sie morgen wieder an. Vielleicht geht’s ihr morgen besser.«
»Was hat sie denn?«
»Schlecht ist ihr. Und essen will sie auch nichts.«
Sarah saß mit finsterer Miene in der Küche, als ich gegen neun nach Hause kam, und spielte an ihrem Handy herum.
»Geht’s gut?«, fragte ich und hängte meinen Mantel an die Garderobe.
»Mhm.« Ihre Antwort ließ eher das Gegenteil befürchten, und so war es dann auch: Sie hatte einen Mathetest vergeigt.
»Schon den zweiten dieses Jahr. Der neue Lehrer ist voll die Schlaftablette. Ich blick überhaupt nichts, wenn der was erklärt. Wenn’s so weitergeht, seh ich schwarz fürs Abi.«
»Wie läuft’s bei Louise?«
»Besser. Aber nicht sehr. Es liegt wirklich am Lehrer, Paps. Wenn der Kröger nicht krank geworden wär …«
»Kann euch Michael nicht Nachhilfe geben?«
Michael war Louises Freund und ein Mathematik-Ass. Allerdings behauptete Sarah, auch er sei nicht gut darin, meine Mädchen beim Lernen zu unterstützen.
»Wenn man was nicht gleich beim ersten Mal versteht, dann flippt er aus, und am Ende haben alle miese Laune.«
Ich setzte mich zu ihr an den Tisch.
»Wie wär’s denn mit richtiger Nachhilfe?«
Das Problem war, dass sie sich in den Kopf gesetzt hatte, nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre zu studieren.
»Und da ist Mathe voll wichtig, hab ich gelesen. Analytisches Denken und so. Das Abi pack ich schon irgendwie, da mach ich mir keinen Kopf. Aber BWL mit fünf Punkten in Mathe …?«
Auf Nachhilfe hatte sie dennoch keine Lust.
»Ich hab so schon jeden Tag sechs, sieben Stunden und ohne Ende Hausaufgaben und dann auch noch in irgendein Nachhilfedingsbums? Nee, Paps, danke. Das pack ich nicht.«
Sarah machte mir in letzter Zeit nicht nur wegen ihrer schulischen Leistungen Sorgen. Während Louise in ihrem Mick einen sympathischen und verlässlichen Freund gefunden hatte, war ihre eine halbe Stunde ältere Zwillingsschwester schon wieder solo. Vermutlich war sie auch ein wenig eifersüchtig auf Louise.
»Loui sieht das mit den Noten sowieso locker.«
»Braucht man für Psychologie nicht viel Statistik?«
»Sie denkt jetzt doch wieder mehr in Richtung Soziale Arbeit. Psychologie ist ihr zu verkopft, sagt sie.«
Nach Sarahs unglücklicher Liebe zu einem illegal eingewanderten jungen Burschen aus Afrika hatte ich nichts mehr von einer Beziehung zu einem Mann gehört. Allerdings erzählte sie mir in letzter Zeit nur noch selten etwas von diesen Dingen. Oft kam sie abends spät nach Hause, manchmal erst nach Mitternacht, und weigerte sich, mir zu sagen, wo sie gewesen war und was sie den Abend über getrieben hatte. Meist bekam ich dann etwas wie »mit Freunden abhängen« zu hören. Oft wirkte sie bedrückt, unzufrieden, mit sich und der Welt im Unreinen. Was in ihrem Alter – meine Töchter waren erst vor wenigen Wochen volljährig geworden – natürlich nichts Ungewöhnliches oder Besorgniserregendes war.
»Und wenn du dich nach einem Nachhilfelehrer umsiehst, zu dem du am Samstag gehen kannst?«
Sarah nickte mit einer Miene, als fände sie auch diese Vorstellung nicht prickelnd.
»Vielleicht ist BWL doch nicht das Richtige für dich?«, sagte ich nach einigen Sekunden missmutigen Schweigens.
»Aber was dann?«, fragte Sarah mürrisch. »Ich hab ja nicht mal auf BWL wirklich Bock. Eigentlich hab ich auf gar nichts Bock, das ist ja der Mist.«
»Dann erst mal ein Soziales Jahr?«
»Wenn gar nichts geht, kann ich ja immer noch Lehrerin werden. Irgendwie hat Loui auch recht. Es ist bestimmt interessanter, im Job mit Menschen zu tun zu haben statt immer bloß mit Zahlen und Bilanzen und solchem Scheiß.«
»Lehrerin für welche Fächer?«
Ihre Miene wurde noch abweisender. »Jedenfalls nicht für Mathe.«
»Hast du schon mal daran gedacht …«
»Was?«
»Bitte schrei jetzt nicht gleich. Bei der Polizei suchen wir ständig intelligente, junge Menschen …«
Sie schrie nicht, sie sah mich nur an, als könnte sie nicht fassen, dass ich ihr mit diesem Vorschlag kam.
Ende der Leseprobe