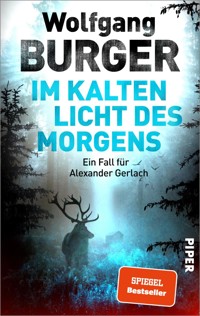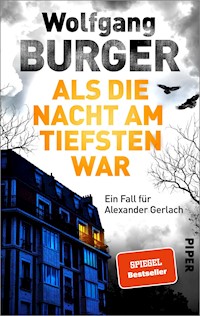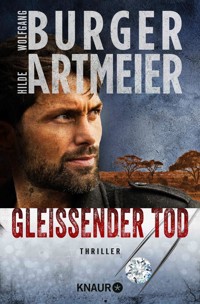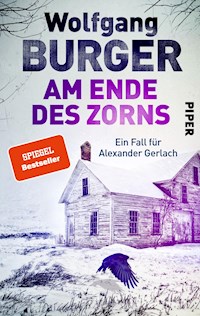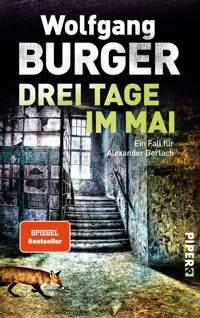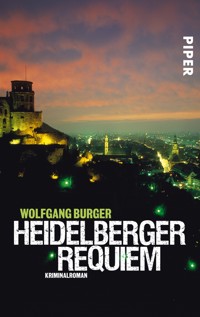
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Alexander Gerlach glaubt, mit seiner Beförderung zum Chef der Heidelberger Kriminalpolizei einen ruhigen Posten bekommen zu haben. Doch schon am ersten Tag wird die Leiche eines Chemiestudenten gefunden, der auf grausamste Weise ermordet wurde. Die Lösung des Falls scheint einfach, denn der junge Mann hatte synthetische Drogen hergestellt, um sein Budget aufzubessern. Doch bald kommt es zu einem weiteren Mord, der alle bisherigen Vermutungen über den Haufen wirft. Als Gerlach beginnt, das grausame Spiel zu durchschauen, ist es fast zu spät … Ein spannender Roman mit einem ungewöhnlich sympathischen Helden, der sich nicht nur ständig in die falschen Frauen verliebt, sondern zudem als allein erziehender Vater von seinen beiden Töchtern in Atem gehalten wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Dieses Buch widme ich all den vielen Menschen, die auf die ein oder andere Weise zu seinem Gelingen beigetragen haben und die ich hier namentlich gar nicht alle nennen kann.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
12. Auflage Februar 2013
ISBN 978-3-492-95457-0
Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH 2005 Umschlag: semper smile, München Umschlagabbildung: Karl Kinne/Corbis
1
Erst Wochen später, als wir längst im tiefsten Schlamassel steckten, wurde mir bewusst, dass ich die Frau mit der Perlenkette in den Minuten zum ersten Mal sah, als Patrick Grotheer seinem Mörder die Tür öffnete.
Liebekind, der Chef der Heidelberger Polizeidirektion, hatte mir zu Ehren einen kleinen Empfang organisiert: im dritten Stock des modernen Gebäudes, im großen Besprechungsraum, dessen altmodische schwere Stühle man an der Wand entlang gestapelt hatte, um Platz für die anwesenden Personen zu schaffen. Es war Mittwoch, der siebenundzwanzigste August. Nach einem überschwemmungsreichen Sommer war es endlich doch noch trocken, sonnig und schließlich heiß geworden. Seit Tagen fiel das Thermometer nachts nicht mehr unter fünfundzwanzig Grad. Meine Zwillinge hatten immer noch Ferien und langweilten sich die meiste Zeit.
Sogar ein paar Vertreter der Kommunalpolitik waren da: Zwei ständig auf die Uhr sehende Stadträte und Bürgermeister Schreber, zuständig für Straßenbau und die städtische Ordnung, die in Heidelberg im Großen und Ganzen durch verloren gegangene japanische Touristen oder über die Stränge schlagende Studenten gefährdet war. Hatte ich zumindest bis zu diesem Zeitpunkt gedacht. Es herrschte eine Höllenhitze, und der Sekt in den Gläsern wurde schneller warm, als man ihn trinken konnte. Dazu passend gab es ein lauwarmes Büfett, das gar nicht mal übel schmeckte. Launige Reden wurden gehalten, ich schnappte Worte auf wie »Blitzkarriere«, »der rechte Mann am richtigen Ort«, »Fortführung einer großen Tradition« und war die meiste Zeit damit beschäftigt, mir den Schweiß von der Stirn zu wischen.
Mir grauste vor dem Moment, in dem ich das tun sollte, was ich nie im Leben wollte:mich vorstellen, mich wichtig machen, eine Rede halten. Eine kurze nur, hatte mir Liebekind mit wohlwollendem Schulterklopfen erklärt, aber eine Rede eben, vor viel zu vielen Zuhörern.
»Das wird nun öfter auf Sie zukommen in Zukunft, Herr Gerlach«, hatte er schmunzelnd gebrummt. »So ist das nun mal, wenn man sich nach oben gestrampelt hat. Werden sich dran gewöhnen. Ist noch keiner dran gestorben.«
Seine eigenen »Worte« waren wohltuend kurz und der Temperatur angemessen. Er lobte meinen Vorgänger Seifried, der praktisch in Ausübung seines Dienstes sein Leben hatte lassen müssen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich allerdings bereits, dass er nach einer außerordentlich gelungenen Weihnachtsfeier seinen goldmetallicfarbenen Opel Calibra auf der kerzengeraden Speyerer Straße kurz hinter dem Ortsschild mit hundertfünfzig gegen einen Brückenpfeiler gesetzt hatte. Sogar ein Foto aus einer automatischen Radarkamera hatte man verschwinden lassen müssen, um seine Witwe nicht um ihre Pensionsansprüche zu bringen.
Liebekind verlor noch ein paar Bemerkungen zu den großartigen Mitarbeitern der Polizeidirektion im Allgemeinen und der Kripo im Besonderen. Dann hörte ich es zum ersten Mal in der Öffentlichkeit: Kriminalrat Alexander Gerlach, der neue Leiter der Kriminalpolizei unserer traditionsreichen Stadt, auf die die Welt schaut. Und schließlich war ich dran.
Ich fummelte meinen Zettel aus der Gesäßtasche der Anzughose, trat an das Rednerpult und ließ mir von meinem zukünftigen Chef, der mir mit seiner gemütlichen und nachdenklichen Art schon beim ersten Gespräch sympathisch gewesen war, lange und überaus kräftig die Hand schütteln.
Ich weiß nicht, ob Patrick Grotheer überrascht war, als nicht der vor ihm stand, den er erwartet hatte. Ich weiß nicht, was er dachte in den wenigen Sekunden, bevor sein Gast die Tür hinter sich zutrat. Mit Sicherheit aber muss er sehr überrascht gewesen sein, als er endlich verstand, was die tödliche Absicht seines Besuchers war.
Das Pult war zu wackelig, als dass man sich wirklich daran hätte festhalten können. Um zu Atem und Stimme zu kommen, sah ich, wie ich hoffte, ausdrucksvoll in die Runde. Es wurde ruhiger und ruhiger. Manche räusperten sich an meiner Stelle. Hinten beim Büfett standen die Zwillinge mit vollen Mündern, roten Backen und leuchtenden Augen. Ihr Paps auf einem Podium und mit einem Mikrophon vor dem Mund, cool!
»Sehr geehrter Herr Doktor Liebekind, sehr geehrter Herr Bürgermeister Schreber, verehrte Vertreter des Stadtrats, liebe zukünftige Kolleginnen und Kollegen.« Meine Stimme klang nicht ganz so zittrig, wie ich mich fühlte. Die Zwillinge wagten schon wieder zu kauen und nickten sich zufrieden zu. Manche lächelten zu mir herauf. Andere nicht. Nicht alle meine zukünftigen Untergebenen freuten sich über den Umstand, dass ihr neuer Chef aus Karlsruhe und nicht aus Heidelberg kam. Die eine oder der andere hatte sich in den letzten Monaten, als die Stelle kommissarisch besetzt gewesen war, ausgerechnet, wie groß die eigenen Chancen sein mochten. Liebekind hatte von einer Menge Bewerbungen gesprochen, und ich hatte keine Ahnung, warum man am Ende ausgerechnet mich ausgewählt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade mal vierzehn Monate Erster Kommissar und konnte auf knapp drei Jahre Erfahrung als Leiter einer kleinen Fahndungsgruppe zurückblicken. Keine Karriere, die einen unbedingt für die Stellung empfahl, die ich gerade antrat. Und außerdem war ich erst dreiundvierzig und damit eigentlich zu jung.
Auch einige meiner Karlsruher Kollegen waren gekommen, worüber ich mich zu meiner Überraschung unmäßig freute. Petzold, nicht zu übersehen bei seiner Größe, lungerte wie üblich beim Büfett herum, dicht daneben die blonde Malmberg, mit der er seit einiger Zeit verbandelt war, und Schilling natürlich, der nun, wie er mir sofort berichtet hatte, endlich zum Oberkommissar befördert worden war.
»In Anbetracht der Hitze und des knapp werdenden Sauerstoffs möchte ich mich kurz fassen«, begann ich und erzählte tapfer etwas von der Verantwortung, der ich mir durchaus bewusst sei, von großen Fußstapfen, in die ich erst noch hineinwachsen müsse, und wunderte mich, dass all dies kein bisschen dümmer klang als die vielen anderen Reden, die ich bei ähnlichen Anlässen schon hatte über mich ergehen lassen müssen.
Und dann sah ich sie. Sie war groß, das offene Haar changierte zwischen Dunkelblond und Brünett, sie war nicht eben schlank, aber auch nicht füllig. Soweit ich es aus der Ferne erkennen konnte, trug sie einen eleganten tannengrünen Hosenanzug, und im Ausschnitt hing eine dieser altmodischen Perlenketten, wie meine Mutter sie zu festlichen Anlässen gerne getragen hatte. Mit einem halb vollen Sektkelch in der Hand stand sie neben dem Bürgermeister und sah mich mit einem leisen Lächeln im Gesicht unverwandt an. Ungefähr so, wie eine Lehrerin ihren Musterschüler beobachtet, der so lange sein Gedicht geübt und immer wieder aufgesagt hat. Sie hat ihm Mut gemacht, hat mit ihm gelitten und gelernt, und nun ist der große Tag, die Aula ist voll, und wie sie erwartet hat, macht er seine Sache gut. So sah sie mich an, genau so.
Für eine halbe Sekunde verlor ich den Faden, dann zwang ich meinen Blick in eine andere Richtung, konzentrierte mich auf Petzold als eines der wenigen bekannten Gesichter und erzählte ihm mit fester werdender Stimme, dass er keine großen Veränderungen zu fürchten brauche, dass man gewachsene Strukturen nicht ohne Not zerschlagen solle, dass ich bereit sei zu lernen und für jeden allzeit eine offene Tür und zwei offene Ohren haben werde. Und dass wir mit vereinten Kräften die Aufklärungsquote hochhalten wollten. Nein, würden. Jawohl.
»Ein Chef ohne seine Mannschaft ist so wenig wert wie ein Haus ohne Wände«, erklärte ich voller Stolz auf dieses Bild, das mir letzte Nacht um halb fünf im Bett eingefallen war. Und natürlich dachte ich wieder einmal an Vera. Fragte mich, was sie wohl von mir halten würde, wenn sie noch da wäre. Bestimmt wäre sie stolz gewesen auf mich, ihren Alex, der nun endlich die Karriere machte, die sie sich immer für ihn gewünscht hatte.
Die Zwillinge hörten längst nicht mehr zu, sondern kauten andächtig Lachskanapees und Kaviarschnittchen. Es entging mir nicht, dass sie hin und wieder angebissene Happen, die ihnen nicht schmeckten, hinter den Blumensträußen verschwinden ließen. Ich beschloss, ihnen später die Leviten zu lesen.
Als mein Blick wieder einmal in Richtung Liebekind wanderte, beobachtete mich die unbekannte Frau mit unveränderter Miene. Ich sah schnell weg, um nicht erneut aus dem Konzept zu geraten.
Schließlich waren meine Notizen zu Ende, ich faltete meinen Zettel zusammen, man klatschte höflich. Liebekind drückte noch einmal herzhaft meine Hand, irgendwer reichte mir ein volles Glas, und ich musste mit allen möglichen wildfremden Menschen anstoßen. Ein verhuschtes Mädchen stellte sich als Mitarbeiterin der Rhein-Neckar-Zeitung vor und stellte mir ein paar sinnlose Fragen zu meinem Werdegang und meinen Plänen. Auch das war neu für mich, ein Interview hatte ich noch nie gegeben. Liebekind blieb in der Nähe und hörte mit gesenktem Blick zu. Aber ich schien die richtigen Antworten zu finden.
Dann drängten die Karlsruher heran, um sich zu verabschieden. Birgit Malmberg überreichte mir eine grüne Flasche ohne Etikett, und Petzold erklärte, darin befinde sich ein köstlicher Kirschbrand aus leider nicht ganz legaler Produktion. Malmberg stieg auf die Zehenspitzen, um mir einen Kuss auf die Backe zu drücken, Schilling hielt lange, lange meine Hand, die inzwischen anfing wehzutun, und erzählte mir allerlei von den alten Kollegen und seinen neuen Karriereplänen. Und außerdem seien sie alle überhaupt nicht glücklich darüber, dass ich sie nun allein lassen würde. Merkwürdigerweise rührte mich das so, dass ich ihn um ein Haar in den Arm genommen und an mich gedrückt hätte.
Plötzlich rückten die Zwillinge in den Mittelpunkt des Interesses.
»Wie heißen denn Ihre zwei entzückenden Töchter?«, fragte mich eine wie für einen Opernbesuch gekleidete Dame mit blasslila Haaren.
»Louise und Sarah«, erwiderte ich höflich.
Die Reihenfolge war dabei sehr wichtig, weil man im umgekehrten Fall unweigerlich von irgendeinem Witzbold gefragt wurde, ob Saarlouis etwa ihre Patenstadt wäre. Auf die Frage, wie um Gottes Willen ich die beiden auseinander halten könne, antwortete ich wahrheitsgemäß: »Überhaupt nicht.« Vera hatte sie auf hundert Meter erkannt, ich nie. Nur ganz aus der Nähe gelang es mir, sie anhand einer kleinen Narbe an der Stirn zu unterscheiden, die Sarah sich im Alter von vier Jahren bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte. Ich war sicher, dass sie in der Schule hin und wieder die Plätze tauschten, um wechselseitig ihre Noten aufzupolieren. Aber niemand konnte etwas dagegen tun, sie waren einfach zu ähnlich und weigerten sich, seit sie sprechen konnten, sich anders als vollkommen identisch zu kleiden und zu benehmen. Ich hatte von Zwillingspaaren gehört, die irgendwann bestrebt waren, eigene Identitäten zu entwickeln. Meine Töchter schienen diesen Drang bisher nicht zu spüren, obwohl sie inzwischen dreizehn Jahre alt waren.
Als ich wieder zur Besinnung kam, war die Frau mit der Perlenkette verschwunden. Und gegen neun löste die Veranstaltung sich ziemlich plötzlich auf.
Zu diesem Zeitpunkt muss Patrick Grotheer gestorben sein. Langsam, tropfenweise verblutet. Ungefähr neunzig Minuten lang.
2
Die Tage, bis ich meine neue Stelle antreten sollte, verbrachte ich damit, den Verkauf unseres Hauses in Karlsruhe vorzubereiten und über den kommenden Umzug nachzudenken. Nahezu täglich fuhr ich mit meinen Töchtern nach Heidelberg, um Stadtviertel zu besichtigen und Schulen von außen zu begucken, die natürlich wegen der Sommerferien alle noch geschlossen waren. Schon vor Wochen hatte ich einen Makler beauftragt, eine schöne, große Altbauwohnung für uns zu finden, bisher aber noch keine Angebote erhalten. Die Zwillinge gaben sich erwachsen, vielleicht weil sie fühlten, dass ich zurzeit nicht viel vertragen konnte.
Immer wieder grauste mir vor all den Veränderungen und unbekannten Anforderungen, die unaufhaltsam auf mich zukamen. Weder war ich mir sicher, meinem neuen Job gewachsen zu sein, noch, dass ich ihn wirklich haben wollte. Eigentlich hatte ich mich mehr aus Verlegenheit beworben und mit dem Gedanken, dass es nie schaden könne, auf diese Weise schon mal für den Ernstfall zu üben. Dann war zu meiner Überraschung die Einladung zum Vorstellungsgespräch gekommen und schon zwei Wochen später die Zusage, verbunden mit der Aussicht auf sofortige Beförderung zum Kriminalrat.
Ich war immer gerne Polizist gewesen. Es machte mir nichts aus, Verantwortung zu tragen, ein Team zu führen. Nur eines hatte ich niemals werden wollen: ein Schreibtischtäter, der die Welt nur noch durch die Berichte seiner Untergebenen kennt. Und genau dies war es, was mir nun bevorstand.
Den Samstag verbrachte ich damit, den Keller auszumisten, alles Mögliche und Unmögliche aus Regalen und alten Schränken zu zerren und im Vorraum einen großen Stapel zu bilden mit Dingen, die den Umzug nicht erleben würden. Auf einmal freute ich mich auf einen von Erinnerungen unbeschwerten Neuanfang in fremder Umgebung. Ich genoss die körperliche Tätigkeit und nahm mir vor, endlich wieder mehr auf meine Gesundheit zu achten, ein bisschen Sport zu treiben, hin und wieder das Rad zu nehmen und den Wagen stehen zu lassen.
Am ersten September, einem Montag, begann mein Dienst. Ohne zu frühstücken, fuhr ich morgens um sieben in Karlsruhe los, um nicht gleich am ersten Tag zu spät zu kommen. Meinen Töchtern hatte ich ihr Nutella und Toastbrot bereitgestellt, damit sie sich nicht zu einsam fühlten, wenn sie gegen Mittag aufstehen würden. Die Nachbarn, die sich ein wenig um sie kümmerten, seit sie keine Mutter mehr hatten, waren seit zwei Wochen in Urlaub auf Madeira. Da meine Eltern vor drei Jahren ihren Alterswohnsitz im Süden Portugals bezogen hatten, musste ich die Kinder notgedrungen allein lassen. Die Schule begann erst in vierzehn Tagen wieder, und die Mädchen würden den Tag vermutlich wie üblich an irgendeinem Baggersee verbringen, zusammen mit Leuten, die ich nicht kannte und vielleicht auch nicht kennen sollte. Einen Bullen zum Vater zu haben, galt in gewissen Kreisen als krass uncool. Zuletzt hatte ich noch einen Zehn-Euro-Schein unter das Nutella-Glas geklemmt, damit sie sich etwas zu essen kaufen konnten. Ich hoffte, dass er nicht nur gegen Big-Macs und Cola eingetauscht würde.
In dem für meinen Geschmack ungemütlich großen Büro fühlte ich mich schon nach wenigen Minuten einsam. Bis halb neun räumte ich ohne viel Sinn in meinem altmodischen und muffig riechenden Schreibtisch herum, stellte ein paar mitgebrachte Bücher in den dunkelbraunen, noch altmodischeren Bücherschrank mit gruselig knarrenden Türen und versuchte herauszufinden, ob es hier eher nach Bohnerwachs oder Möbelpolitur roch.
Alles in allem hatte ich nun zweiundzwanzig Beamte unter mir, darunter vier Frauen. Ich würde eine Weile brauchen, um mir die Namen zu merken.
Eine der Frauen war meine Sekretärin, Sonja Walldorf. Sie war schon vor mir am Platz gewesen, trug ein sommerliches Blumenkleid und schien merkwürdigerweise noch aufgeregter zu sein als ich. Meine Frage, ob es wohl eine Chance gebe, diese scheußlichen Antiquitäten gegen etwas Moderneres auszutauschen, brachte sie in Verlegenheit, da sie keine Antwort wusste. Offenbar war sie gewohnt, auf alles eine Antwort zu wissen. Ich beschloss, bei nächster Gelegenheit mit Liebekind über das Thema Möbel zu sprechen. In diesem Museum wollte ich auf keinen Fall hausen.
Mein nächstes Problem war der Kaffee. Die ganze Polizeidirektion duftete inzwischen nach frischem Kaffee, aber ich traute mich nicht, Frau Walldorf danach zu fragen, aus Angst, sie könnte beleidigt sein. Sie war ja die erste Sekretärin meines Lebens, und ich hatte gehört, manche von ihrer Sorte könnten tödlich beleidigt sein, wenn man ihnen solch niedere Dienste zumutete. Andererseits hatte ich keinen Schimmer, wo sich die Quelle befand, die diesen verflixten Duft verbreitete. Erst, als sie mich verlegen-bestürzt fragte, ob ich denn gar keinen Kaffee wünschte, kam heraus, dass mein Vorgänger darauf bestanden hatte, täglich Punkt halb neun ein dampfendes Kännchen zusammen mit zwei frischen Croissants auf dem Schreibtisch zu haben. Wir kamen überein, dass man mit guten alten Gewohnheiten nicht ohne zwingenden Grund brechen solle.
Die Croissants vom Bäcker an der Ecke schmeckten vorzüglich. Der Arabica-Kaffee war frisch gebrüht, eigens für mich, wie sie betonte. Wir saßen noch zehn Minuten zusammen, und sie gab mir einen ersten Überblick über die aktuellen Themen der Gerüchteküche. Draußen schien die Sonne, durch die offenen Fenster drangen Vogelgezwitscher und eine angenehm kühle Luft herein, die nach Sommer und Ferien roch. Ich fühlte mich wohl. Hier konnte man offenbar leben. Sollte ich doch die richtige Entscheidung getroffen haben? Die Zwillinge würden sich einleben, neue Freunde finden. In ihrem Alter vergisst der Mensch noch schnell.
Frau Walldorf hatte eine kleine Zusammenstellung der offenen Fälle vorbereitet. Derzeit arbeiteten meine Leute noch an einem Überfall auf die Volksbank in Eppelheim. Zwei vierzehnjährige Jungs waren seit Anfang der Schulferien vermisst, die sich wegen schlechter Noten nicht nach Hause getraut hatten. Die Universität wurde seit Beginn der Semesterferien von einer Einbruchserie heimgesucht, bei der hauptsächlich teure Laptops verschwanden, die sich bei ebay leicht zu Geld machen ließen. Und außerdem häuften sich in der Stadt die Taschendiebstähle, deren Opfer fast immer Touristen waren. Sonst lag nichts an. Auch Verbrecher müssen hin und wieder Urlaub machen.
Schließlich war es neun, der Kaffee zu Ende, und ich bat meine Sekretärin, mich auf meiner Begrüßungsrunde bei der Truppe zu begleiten. Auf dem Flur trafen wir Polizeioberrat Lamparth, den Chef der Schutzpolizei. In der letzten Woche war er noch in Urlaub gewesen, Tunesien, wie er mir strahlend erklärte, weshalb wir uns noch nicht kannten. Lamparth war zehn Jahre älter als ich, hatte ein offenes Lachen, ein kantiges Kinn, kräftige Zähne und schien ein umgänglicher Kerl zu sein. Schon nach drei Sätzen erklärte er mir, dass es in diesem Haus bisher nicht die üblichen dummen Eifersüchteleien zwischen Schutzpolizei und Kripo gegeben habe. Ich versprach ihm, dass ich daran nichts zu ändern gedenke, und hielt ihm aus dem Stegreif ungefähr ein Drittel meiner Rede vom letzten Mittwoch. Inzwischen begann es schon wieder heiß zu werden.
Die Kripo belegte fast das komplette erste Obergeschoss des weitläufigen Gebäudes. Ich klopfte energisch an die erste Tür und trat ein. Irgendwo hatte ich gehört, man solle als Vorgesetzter nicht auf ein »herein« warten. Ein entschlossener Auftritt schafft Respekt. Draußen hatte ich zwei Namen gelesen: Erste KHK K. Vangelis und KOK S. Balke. Die beiden sprangen auf, als ich eintrat. Balke deutlich schneller als seine Kollegin. Ich ging auf die Frau zu, um ihr die Hand zu schütteln. Ihr Blick war kühl, um nicht zu sagen abweisend. Liebekind hatte mir im Vertrauen mitgeteilt, sie habe zu meinen engsten Konkurrentinnen gezählt, und Frau Walldorf hatte mich mit bedeutenden Blicken darauf vorbereitet, dass die Erste Kriminalhauptkommissarin Klara Vangelis leider oft gar kein umgänglicher Mensch sei.
Für ihren Dienstgrad war die Frau überraschend jung. Sie musste äußerst ehrgeizig sein. Sehr zögernd hob sie die Hand, und es war offensichtlich, dass sie absolut nichts dagegen gehabt hätte, wenn mich genau jetzt und vor ihren großen dunklen Augen der Teufel geholt hätte.
Zu ihrer sichtlichen Erleichterung klingelte das Telefon. Sie wandte sich ab und ließ mich mit ausgestreckter Hand stehen, obwohl auch Balke das Gespräch hätte annehmen können. Während sie telefonierte, hatte ich Gelegenheit, sie zu betrachten. Wäre sie einige Zentimeter größer gewesen, sie hätte als Model arbeiten können. Üppiges schwarz glänzendes Haar, eine Figur wie aus einem Modekatalog ausgeschnitten und dazu eine helle Bluse und ein dunkles Kostüm, dem sogar ich ansah, dass es dem Gehalt einer Kripobeamtin in keiner Weise angemessen war.
Das Gespräch dauerte nur wenige Sekunden. Mit unbewegter Miene machte sie sich Notizen und legte auf mit der Bemerkung: »Okay. In zehn Minuten.« Sie riss das Blatt vom Block und warf Balke einen Blick zu. »Mord im Emmertsgrund draußen.«
Balke sah ratlos von ihr zu mir. Offensichtlich wusste er nicht, wer hier im Augenblick das Sagen hatte. Sie ergriff mit der linken Hand eine große Schultertasche aus schwarzem Leder, während ihre Rechte einen Schlüsselbund aus der Schreibtischschublade fischte.
»Ich komme mit«, sagte ich entschlossen.
Balke guckte verdutzt, Sonja Walldorf errötete.
»Sie sind der Boss«, meinte Vangelis achselzuckend.
»So lerne ich gleich ein bisschen die Stadt und Ihre Arbeitsweise kennen«, erklärte ich Balke, da Vangelis eisern in eine andere Richtung sah.
»Ich alarmiere mal die Spurensicherung«, murmelte Balke verwirrt.
»Das haben die Kollegen vom Revier schon getan.« Vangelis ging davon, ohne sich weiter um uns zu kümmern. Wir hatten Mühe, ihr zu folgen. Frau Walldorf sah uns mit verzweifeltem Gesichtsausdruck nach und fürchtete offenbar das Schlimmste.
Im Wagen, einem Siebener BMW, den Vangelis fuhr wie der Leibhaftige persönlich, klärte sie uns darüber auf, dass der Anruf von einer Streifenwagenbesatzung gekommen sei, die ihrerseits der Hausmeister eines der Hochhäuser im Emmertsgrund alarmiert habe. Ich hörte den Namen des Viertels zum ersten Mal. Nach den Bemerkungen meiner Untergebenen zu schließen, lag es im Süden und war nicht gerade eine der besten Wohngegenden Heidelbergs. Aufgrund eines immer unerträglicher werdenden Gestanks hatte der Hausmeister heute Morgen eine der Penthouse-Wohnungen geöffnet und die Leiche des Bewohners darin gefunden. Bei dem Toten handelte es sich um einen jungen Mann namens Patrick Grotheer, las Vangelis von ihrem Zettel ab, während der BMW mit hundertzwanzig die holprige Rohrbacher Straße entlangdonnerte.
Balke fand endlich den Knopf für das Martinshorn und setzte das Blaulicht aufs Dach. »Grotheer?«, fragte er mit hochgezogenen Brauen.
»Exakt.« Vangelis schaltete hoch. »Warum?«
Irgendwie war ich auf dem Rücksitz gelandet, beschloss aber, dass mir das nichts ausmachte. Autorität hat nur bei altmodisch denkenden Menschen mit Sitzordnung zu tun.
»Muss ja nichts zu bedeuten haben«, erwiderte Balke ausweichend. »Den Namen wird’s mehr als einmal geben.«
Sven Balke war von der Sorte, die meine Töchter seit neuestem in die Kategorie »supersüße Jungs« eingruppierten. Man sah und hörte, dass er aus dem Norden stammte. Er trug enge Jeans und ein T-Shirt, das jede Rundung seines muskulösen Oberkörpers nachzeichnete. Im rechten Ohr zählte ich drei und im linken fünf silberne Ringe. Seine Hautfarbe verriet, dass er sich gerne und oft im Freien aufhielt und es wie viele Hellblonde nicht vertrug. Seinen Kopf zierte eine Art Dreitage-Glatze, mit dem Rasieren schien er sich nicht viel Arbeit zu machen.
In einem lebensgefährlichen Manöver überholte Vangelis einen Bus und schaffte es gerade eben, nicht mit der entgegenkommenden Straßenbahn zu kollidieren.
»Nu mach mal halblang, Mädchen! Der läuft uns ja nicht weg«, maulte Balke. Sein Handy fiepte.
»Oh, oh«, sagte er leise, nachdem er die SMS gelesen hatte.
»Die von gestern?«, fragte Vangelis leichthin und setzte schon wieder den Blinker zum Überholen.
Betrübt schüttelte er den Kopf. »Immer noch die von Dienstag. Schlimme Klette, das Kind.«
»Irgendwann muss dich ja mal eine an den Haken kriegen«, meinte sie achselzuckend.
»Nicht, bevor ich vierzig bin.«
Siebzehn Minuten nachdem das Telefon geklingelt hatte, kletterte ich benommen aus dem Wagen. Ein verstörter Mittvierziger mit dunklem Vollbart und zwei ungewöhnlich blasse Streifenpolizisten begrüßten uns mit Mienen, als ginge es zu einer Beerdigung. Im Lift zum obersten Stock zogen wir unsere fusselfreien Latex-Handschuhe an. Vangelis ließ sich von den aufgeregten Schupos Bericht erstatten und tat, als wären Balke und ich gar nicht da.
Der Körper eines erwachsenen Menschen enthält ungefähr fünf Liter Blut. Ein halber Putzeimer voll, mehr nicht. Zudem muss man in Rechnung stellen, dass ein Mensch, dessen Pulsadern geöffnet werden, nicht einmal die Hälfte seines Bluts verliert. Dann versagt das Herz, der Rest bleibt im Körper zurück und gerinnt im Lauf der folgenden Stunden. Alles in allem konnte der Tote also kaum mehr als zwei Liter Blut verloren haben. Aber wenn diese zwei Liter in einem siebzig Quadratmeter großen Raum verteilt sind, der zudem weitgehend in Weiß gehalten ist, dann ist das eine Menge. Schwarzes, geronnenes Blut war das Erste, was ich sah. Überall. Es war eine Schweinerei ohnegleichen.
Der Hausmeister weigerte sich panisch, die Wohnung noch einmal zu betreten. Meine Croissants drängten zusammen mit zwei Tassen Kaffee an die frische Luft. Auch Balkes Blick schien fieberhaft die richtige Tür für den Krisenfall zu suchen. Klara Vangelis riss die breite Glastür zur Terrasse auf. Ich sah mich kurz um. Der Täter hatte sein Opfer an das Kopfteil des großen Betts gefesselt, das an der Wand gegenüber der Terrassentür stand, ihm die Pulsadern aufgeschnitten und es langsam verbluten lassen.
Als ich den Gestank nicht mehr aushielt, sagte ich: »Warten wir, bis es ein wenig durchgelüftet hat«, und trat auf die Terrasse hinaus. Balke folgte mir aufatmend. Vangelis blieb drin.
»Diese Frau ist ein Tier«, murmelte er, als er neben mich ans Geländer trat.
»Lächelt sie auch manchmal?«
»Eher selten.«
Die Aussicht war beeindruckend. Das Hochhaus stand in einer Lage, wo man eher Villen als sozialen Wohnungsbau erwartet hätte. Unter uns am Hang verstreut einige kleine Weingärten, hinter uns Wald, vor uns ausgebreitet das Oberrheintal, heute ausnahmsweise ohne die übliche Dunstglocke. Ein hellblauer Bus quälte sich die kurvige Straße herauf. Balke gab mir einen Schnellkurs in Heimatkunde.
»Da unten, das ist Rohrbach. Dort draußen sehen Sie die Autobahn. Und da ganz rechts hinten, das sind die Campbell Barracks. US-Hauptquartier der Landstreitkräfte Europa. Richtig wichtig.«
»Hier gibt’s immer noch Amerikaner?«
»Nicht mehr so viele wie früher, aber immer noch genug.« Langsam kam wieder Farbe in sein Gesicht.
In der Ferne heulte ein Martinshorn, kurze Zeit später hielt unten der Notarztwagen hinter unserem BMW. Zwei breite Kerle in Orange stiegen aus und bewegten sich ohne Eile auf den Eingang zu. Natürlich wussten sie schon, dass es hier kein Leben zu retten galt. Von drinnen hörte ich kurze Zeit später, wie Vangelis den Männern die Situation erklärte, dann kam sie gemächlich zu uns heraus. Mit ausdruckslosem Blick musterte sie uns, als wollte sie abschätzen, wie viel wir schon wieder vertragen konnten. Sie hielt ein kleines ledergebundenes Notizbuch in der Hand und war praktisch fertig mit den Ermittlungen.
»Keine Spuren von gewaltsamem Eindringen. Er muss den Täter gekannt haben. Keinerlei Hinweise auf einen sexuellen Hintergrund. Spermaspuren, entsprechende Verletzungen – Fehlanzeige. Soweit ich das bisher beurteilen kann, hat der Täter ihn geknebelt, ans Bett gefesselt und dann …«, endlich musste auch sie schlucken, »… abgestochen.« Sie versenkte das Büchlein in ihrer Handtasche. »Er hat ihm die Pulsadern an beiden Unterarmen aufgeschnitten und ihn langsam verbluten lassen. Das Opfer dürfte seit vier oder fünf Tagen tot sein. Schwer zu sagen, bei dieser Hitze.«
Unten quietschten die Bremsen eines grauen Passat Kombi. Die Spurensicherung.
Vangelis fuhr fort: »Was merkwürdig ist: Der Täter hat das Blut teilweise aufgefangen und im Raum verteilt. Hat ein bisschen was von einem Ritualmord. Ich habe so was noch nie gesehen.«
Ich besann mich darauf, dass ich es war, der hier das Kommando führen sollte. »Irgendwelche Hinweise auf Raub?«
Sie schüttelte den Kopf. »Sein Portemonnaie liegt neben dem Telefon, und es steckt eine Menge Bargeld drin, Kreditkarten, alles. Die Wohnung sieht auch nicht so aus, als wäre sie durchsucht worden.«
Ich überlegte kurz. »Wir brauchen mehr Leute. Sagen wir noch fünf. Dann sind wir zu acht, das sollte fürs erste reichen.«
Balke zückte sein Handy.
»Wieso acht?«, fragte Vangelis mit hochgezogenen Brauen. »Fünf und zwei …?«
»Fünf und drei«, verbesserte ich verbindlich lächelnd. »Ich mache mit.«
Ihre Augenbrauen sanken wieder herab. Sie machte kehrt und ging hinein.
»Wir zwei knöpfen uns mal den Hausmeister vor«, sagte ich zu Balke, nachdem er das Handy wieder zugeklappt hatte. »Nachbarn dürften ziemlich zwecklos sein. In solchen Häusern wissen die Leute normalerweise nichts über ihre Mitbewohner.«
Der bärtige Hausmeister, der einen langen, polnisch klingenden Namen führte, hockte in seiner IKEA-Küche in einer dunklen Erdgeschosswohnung, trank mit nervösen kleinen Schlucken große Mengen Pfefferminztee und wusste eine ganze Menge.
»Student war er, der junge Herr Grotheer.«
»Student?« Ich dachte an die Einrichtung oben, für deren Gegenwert unsereins sich einen Neuwagen leistet.
»Ja. Student.«
Balke führte mit raumgreifender und vollständig unleserlicher Handschrift Protokoll.
»Dann stammt er wohl nicht gerade aus ärmlichen Verhältnissen?«
»Der hat einen Ferrari 456 GT mit über vierhundert PS!«, erklärte uns der Mann wichtig.
Balkes Stift stockte. »Ein 456 GT? Wo steht das Teil?«
Der Hausmeister wies mit bedeutungsvollem Blick nach unten. »Tiefgarage.«
Ich hielt Balke am Ärmel fest, um ihn daran zu hindern, den Wagen gleich mal Probe zu fahren.
»Woher hat der Herr Grotheer das viele Geld? Als Student?«
»Von seinen Eltern vermutlich. Professor Grotheer«, antwortete der Hausmeister, als wäre damit alles gesagt.
»Also doch.« Balke signalisierte mir mit einem Seitenblick, dass dieses Thema damit erledigt war.
»Hat er öfter Besuch gehabt?«
Bevor unser Zeuge antworten konnte, platzte Klara Vangelis herein. Ohne anzuklopfen natürlich. »Das hier haben wir oben gefunden«, sagte sie in einem Ton, als hätte sie es von Anfang an gewusst, und warf ein Tütchen mit blassgelben Pillen auf den Tisch. »Eine ziemliche Menge.«
»Drogen?« Balke besah sich die Dinger mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ecstasy«, stellte ich fest.
»Und zwar ein bisschen zu viel für den Eigenbedarf«, ergänzte Vangelis.
Der Hausmeister kopierte uns die Liste der Hausbewohner. Auf den ersten Blick war nichts Auffälliges darunter. Relativ hoher Ausländeranteil, drei junge Angestellte der Universität, ein arbeitsloser Innenarchitekt, eine allein stehende Dame, die als Broterwerb »Körperkünstlerin« angab, worüber Balke gar nicht mehr aufhören wollte zu lachen. Die zweite Penthouse-Wohnung, die gegenüber von Patrick Grotheers lag, gehörte einer Firma.
»Marvenport and Partners auf Guernsey?«, las ich.
Der Hausmeister hob die Hände, als hätte ich ihm einen Vorwurf gemacht. »Das ist eine Insel. Im Ärmelkanal.«
»Ein Steuerparadies«, erklärte Balke überflüssigerweise.
»Die Wohnung steht aber die meiste Zeit leer«, murmelte der Hausmeister bedrückt. »Dabei ist es die schönste im ganzen Haus. Nur hin und wieder übernachten da Leute, Angestellte der Firma, nehme ich an.«
»War in den letzten Wochen jemand dort?«, fragte Vangelis.
»Nicht, dass ich wüsste.«
Ich mischte mich ein: »Woher wollen Sie das wissen?«
»Dann wäre da natürlich abends Licht gewesen«, erklärte er mit offenem Blick.
»Sind es immer dieselben?«
Unglücklich hob er die Schultern. »Das ist ja hier keine Jugendherberge, wo man sich an- und abmelden muss, nicht wahr?«
3
Ungefähr eine Stunde nachdem wir den Tatort betreten hatten, erinnerte Balke mich mit vorsichtig gewählten Worten daran, dass es an der Zeit sei, die Angehörigen zu benachrichtigen. Seine Blicke ließen keinen Zweifel daran, wessen Aufgabe dies war. Zum zweitenmal an diesem herrlichen Spätsommermorgen wurde mir flau im Magen. Zum einen ist so etwas nie eine angenehme Aufgabe, und zum anderen musste ich mich dazu in Kreise begeben, wo ich mich auch unter weniger tragischen Umständen unwohl fühlte. Wie ich inzwischen erfahren hatte, war der Vater des Opfers, Professor Dr. Dr. h.c. mult. Franz K. Grotheer, Leiter der unfallchirurgischen Abteilung des Universitäts-Klinikums und in seinem Fach eine weltberühmte Kapazität. Seit Jahren munkelte man von einem fälligen Nobelpreis. Ich bat Vangelis mitzukommen. Balke blieb erfreut zurück und versprach, sich den Ferrari anzusehen.
Diesmal fuhr Vangelis langsamer. Ich hatte etwas von Neuenheim aufgeschnappt und wusste nur, dass es nach Norden, über den Neckar ging. Unser Schweigen war zäh und ungemütlich. Natürlich gab es in dem inzwischen glühend heißen Wagen keine Klimaanlage.
Der Polizeifunk sorgte für die Unterhaltung. Verkehrsunfall auf der B 37 vor Neckargemünd. Notarzt war unterwegs. In der Akademiestraße hilflose Person, die sich von der al-Quaida verfolgt glaubte. Vermutlich Alkoholdelirium, morgens um zehn. In Eppelheim, jenseits der A 5, war eine Frau aus dem achten Stock eines Hochhauses gestürzt. Da die Ursache unklar und Fremdverschulden nicht auszuschließen war, wurde die Kripo angefordert. Notarzt war unterwegs. Ich wählte meine eigene Nummer und ließ mir von Frau Walldorf bestätigen, dass ein Team unterwegs war und ich mir keine Gedanken zu machen brauchte.
Ich versuchte, die Zeit zu nutzen, um ein paar Informationen über die Familie Grotheer zu sammeln. Aber das erwies sich als nicht so einfach, weil man mich in der Telefonzentrale der Polizeidirektion noch nicht kannte. Man sprach erst mit mir, nachdem Vangelis mit dürren Worten meine Identität bestätigt hatte.
Als wir den Neckar überquerten, beschloss ich, das Problem frontal anzugehen. Ich bemühte mich um einen leutseligen Ton:
»Sie sind Griechin?«,
»Ich bin in Weinheim geboren, meine Eltern in Griechenland.«
»Ich dachte eigentlich, Vangelis wäre ein Vorname. Für einen Mann?«
»Das ist korrekt.«
»Aber?«
»Ein Missverständnis.«
Ihr Blick klebte auf der Straße. Ich räusperte mich. »Hören Sie, Frau Vangelis. Es ist ja nicht meine Schuld, dass nicht Sie die Stelle gekriegt haben, sondern ich.«
»Das ist mir klar.«
»Vermutlich wären Sie sogar die bessere Wahl gewesen. Sie kennen den Laden. Sie kennen die Stadt, die Leute.«
»Aber ich bin eine Frau.«
Aus dieser Ecke blies mir also der Wind ins Gesicht. »Glauben Sie im Ernst, das hat eine Rolle gespielt?«
Ich wünschte, sie hätte wenigstens ein einziges Mal in meine Richtung gesehen.
»Ich glaube das nicht. Ich weiß es.«
Sie hielt an einer roten Ampel und schien sich ein wenig zu entspannen. Ein Schwarm fröhlich schnatternder Kindergartenkinder überquerte die Straße. Nach einem kleinen Schild an der Hausecke zu schließen, auf dem Weg zum Philosophenweg, einem der bekanntesten Spazierwege der Welt. Schon seit Wochen hatte ich vor, meine Töchter einmal dort hinaufzunötigen. Aber bisher war es ihnen immer gelungen, mich mit den abenteuerlichsten Begründungen abzuwimmeln.
Die Ampel schaltete auf Grün.
»Können Sie sich nicht vorstellen, dass wir auch so gut zusammenarbeiten werden?«
»Haben Sie denn den Eindruck, dass wir nicht gut zusammenarbeiten?«, fragte sie, ohne mit einer ihrer wohl gerundeten Wimpern zu zucken.
»Nein, so meine ich das natürlich nicht …«
»Wenn Sie an meiner Arbeit etwas auszusetzen haben, dann sagen Sie es mir bitte. Ich werde mich dann bemühen, mich zu bessern.«
Ich hätte sie würgen können! Einfach am Hals packen und schütteln, bis sie um Gnade wimmerte. Oder wenigstens eine Spur von Gefühl zeige. Sie setzte den Blinker und bog ab, zu meiner Verblüffung nach links statt nach rechts. Rechts am Hang lag das Neuenheimer Villenviertel, so viel wusste ich schon. Links lag – nichts von Bedeutung. Zwei Querstraßen weiter hielt sie vor einer nicht gerade bescheidenen, aber auch keineswegs großzügigen Doppelhaushälfte. Nur das Fehlen eines Namens an der Klingel wies darauf hin, dass hier vielleicht keine gewöhnlichen Menschen wohnten. Inzwischen hatte ich immerhin in Erfahrung bringen können, dass die Grotheers zwei Kinder hatten. Es gab noch eine Tochter, Sylvia, zwei Jahre älter als Patrick.
Ich wartete, bis Vangelis den Wagen abgeschlossen hatte, und drückte den Knopf. Ein Dreiklanggong ertönte und Schritte näherten sich. Die Hausfrau persönlich öffnete uns.
Frau Grotheer zählte zu den Menschen, die mit einem einzigen kurzen Adjektiv vollständig zu beschreiben sind. Das ihre war: blass. Eine wächserne Haut, blassblaue Augen, graublondes, streng gescheiteltes Haar, ein hellgraues Kleid, ebensolche Schuhe mit flachen Absätzen, und alles zwar nicht gerade billig, aber mit geradezu nach Absicht riechendem Mangel an Eleganz.
»Sie wünschen?«, fragte sie mit farbloser Stimme, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass wir ihr weder ein Zeitschriftenabonnement aufnötigen wollten, noch an ihrer Meinung zum drohenden Weltuntergang interessiert waren. Wir zeigten unsere Ausweiskärtchen.
»Dürften wir kurz hereinkommen, Frau Professor?«, fragte ich. Mit regloser Miene trat sie zur Seite und ließ uns ein.
»Wir müssen Ihnen leider eine schlechte Nachricht überbringen«, fuhr ich fort, nachdem wir uns im altbürgerlichen Wohnzimmer niedergelassen hatten. »Eine sehr schlechte Nachricht. Leider.«
Sie musterte mich mit mattem Blick. Ich fragte mich, ob sie Medikamente nahm.
»Es geht um Ihren Sohn.«
Klara Vangelis betrachtete voller Interesse die scheußlichen Ölbilder an den Wänden und ließ mich leiden.
»Was ist mit ihm?« Jetzt klang die Stimme von Patrick Grotheers Mutter doch eine Spur beunruhigt.
»Er ist tot.«
»Tot?«, fragte sie verständnislos. Oder teilnahmslos? »War es … sein Wagen?«
»Leider nein.« Ich zwang mich, in ihr Gesicht zu sehen. Vangelis war immer noch in ihre Kunstbetrachtungen vertieft. »Er ist ermordet worden.«
Der Körper der grauen Frau machte eine langsame, fast unmerkliche Veränderung durch. Zuerst senkte sie den Blick, dann die Schultern. Nach und nach wich jede Anspannung aus ihrer Muskulatur. Aber sie weinte nicht, sie schrie nicht, sie sah einfach nur auf den Teppich und schwieg.
»Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmern kann, Frau Professor?«
Keine Reaktion.
»Sollen wir jemanden rufen? Einen Arzt? Ihren Mann?«
»Mein Arzt ist mein Mann«, erwiderte sie mit einer Stimme ohne jeden Klang. »Er ist in den Staaten. Auf einem Kongress.«
»Ihre Tochter vielleicht?«
Sie erhob sich, ging mit überraschend sicheren Schritten zum Telefon, einem alten grünen Tastentelefon mit schwarzer Schnur und wählte eine Nummer.
»Sylvia, würdest du bitte kommen? Ja, es ist etwas vorgefallen. Mit Patrick, ja.«
In der nächsten Viertelstunde lernte ich meinen neuen Job hassen. Frau Grotheer saß auf ihrem Sessel und studierte das Muster des Perserteppichs, als wäre er eben erst geliefert worden. Vangelis tat, als ginge sie das alles nichts an, und ich versuchte verzweifelt, etwas wie ein Gespräch in Gang zu bringen. Es gelang mir nicht. Frau Grotheer wollte nicht wissen, wer ihren Sohn ermordet hatte, es interessierte sie nicht, wann oder weshalb. Er war tot, und alles andere war ihr gleichgültig. Mir wurde klar, dass sie mit diesem Besuch gerechnet hatte, dass ihr Sohn für sie schon vor langem gestorben war. Wir lieferten nur die letzte Bestätigung einer Nachricht, die sie längst kannte. Wenn er wirklich im Drogenhandel mitgemischt haben sollte, wie wir inzwischen vermuteten, dann war ihre Haltung vielleicht nicht verwunderlich.
Ich trat an die offene Terrassentür, nahm mein Handy heraus und wählte Balkes Nummer. Er berichtete mir aufgeräumt, nach Angaben der Zulassungsstelle habe Grotheer neben dem Ferrari noch einen zweiten Wagen besessen, einen dunkelblauen Renault Kombi, den sie bisher jedoch weder in der Tiefgarage noch in der näheren Umgebung gefunden hatten. Weiter erfuhr ich, dass unsere Spezialisten in der Wohnung bisher nicht die geringste Spur von seinem Mörder gefunden hatten. Keine Fusseln, die seiner Kleidung zuzuordnen waren, kein Haar, keine Hautschuppen, keine Gewebereste unten den Fingernägeln des Opfers – einfach nichts. Offenbar hatten wir es mit jemandem zu tun, der bei aller Brutalität äußerst überlegt und emotionslos vorgegangen war.
»Und noch was«, Balke schien das Lachen nur mühsam unterdrücken zu können. »Sie glauben nicht, was wir in der Küche gefunden haben. Gut versteckt unter der Spüle.«
Ich wartete. Mir war nicht nach Ratespielen.
»Viagra. Zwei Packungen.«
»Viagra? Ist das nicht eher was für ältere Herren?«
»Er scheint öfter Mädels zu Besuch gehabt zu haben, sagen die Leute hier.« Die Sympathie in seiner Stimme war unüberhörbar. »Vielleicht hat er sich dabei ein bisschen übernommen?«
Und schließlich erklärte er mir noch, neben ihm stehe ein höchst aufgebrachter Staatsanwalt, der mehr oder weniger durch Zufall von dem Mord erfahren habe.
Na wunderbar. Es wäre meine erste Aufgabe gewesen, die Staatsanwaltschaft von dem Tötungsdelikt in Kenntnis zu setzen, und ich Idiot hatte es vergessen. Für die Kripo ist ein guter Draht zu ihrer vorgesetzten Dienststelle lebenswichtig, für ihren Chef ist er überlebenswichtig. Balke gab mir einen empörten Herrn Grüner ans Telefon, und es gelang mir, ihn mit vielen freundlichen Worten und halbseidenen Ausflüchten zu beruhigen. Am Ende meldete Balke sich noch einmal und berichtete mir, sie hätten inzwischen doch noch etwas ähnliches wie Schuhabdrücke gefunden, die vermutlich vom Mörder stammten. Außerdem gab es natürlich den schmutzigen Lappen, der als Knebel gedient hatte. Sonst hatten wir nichts. Absolut nichts.
Mittlerweile hatten meine Leute an allen Wohnungstüren im Haus geläutet. Kaum eine hatte sich geöffnet. Die meisten Bewohner waren in Urlaub oder zur Arbeit. Die wenigen, die sie antrafen, hatten erwartungsgemäß nichts gesehen und wenig gehört.
Ich bat Balke, mir Informationen über diese Firma zu verschaffen, der die zweite Penthouse-Wohnung gehörte. Man soll ja als Vorgesetzter niemals den Eindruck erwecken, man wüsste nicht, wie es weitergeht. Er versprach stramm, sich darum zu kümmern.
Als ich wieder in meinen Sessel sank, hatte ich den Eindruck, dass Klara Vangelis nur mühsam ein Grinsen unterdrückte.
Eine genau gehende große Standuhr vertickte die Sekunden, durch die Terrassentür sah man in einen kleinen, gut gepflegten Garten hinaus. Draußen stritt ein hysterischer Spatzenschwarm lautstark um irgendwas. In der Nachbarschaft brummte ein Gerät, dessen Zweck mir nicht klar wurde. Ein Mitglied der Familie Grotheer spielte Querflöte, wie ein Notenständer mit aufgeschlagenem Heft verriet. Vivaldi, die Vier Jahreszeiten. Frau Grotheer konnte sich an ihrem Teppich nicht satt sehen. Ein Hauch von Blümchenparfüm hing in der Luft, vermischt mit dem Geruch nach wohlhabender Trostlosigkeit und alten Möbeln. Endlich hielt draußen ein Auto, eilende Schritte, ein Schlüssel in der Tür.
Sylvia Grotheer sah aus, wie ich mir eine gut genährte und schlecht gelaunte junge Nonne in Zivil vorstellte. Wie ich mühsam in Erfahrung gebracht hatte, studierte sie Medizin im zwölften Semester. Eine Schönheit war sie nicht. Eine Spur zu pummelig, die Nase ein wenig zu spitz, ein etwas zu kleiner Mund.
»Was ist passiert?«, fragte sie atemlos. »Wer sind Sie?«
»Polizei.« Ich zeigte ihr meinen Ausweis. Sie sah nicht hin, sondern fixierte mich, als wüsste sie schon jetzt, dass ich an allem schuld war. Sie trug kein Make-up im Gesicht und schien sich die Haare selbst zu schneiden. Über ihrem dünnen, beigen Kaschmir-Pullover baumelte eine Modeschmuck-Kette mit bunten Kugeln, und in dieser Sekunde fiel mir die Frau mit der Perlenkette wieder ein, an die ich seit vergangenem Mittwoch nicht ein einziges Mal gedacht hatte. Diese Frau, die mich angesehen hatte, als würde sie mich seit Ewigkeiten kennen. Vielleicht hörte sie einfach nur schlecht? Schwerhörige sehen einen ja manchmal so übertrieben aufmerksam an.
Ich weihte Sylvia Grotheer noch im Stehen ein. Und jetzt endlich begann die Mutter lautlos zu weinen. Die Tochter setzte sie sich neben sie und legte mit eher wütender als trauriger Miene den Arm um ihre Schulter. Das Gebrumm im Nachbargarten verstummte. Den Spatzen war es inzwischen zu heiß geworden zum Zanken. Die Standuhr interessierte sich für nichts als die Zeit. Ich hätte alles dafür gegeben, weglaufen zu dürfen. Allmählich versiegten Frau Grotheers stille Tränen.
Sylvia räusperte sich dreimal. »Ich … Wir haben mit so etwas gerechnet. Irgendwann«, murmelte sie. »Es lag doch auf der Hand.«
Ende der Leseprobe