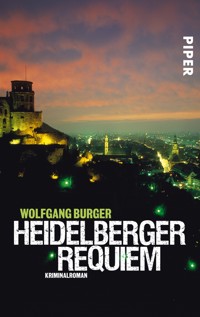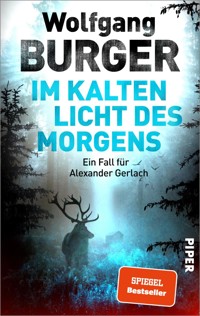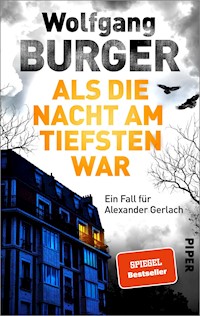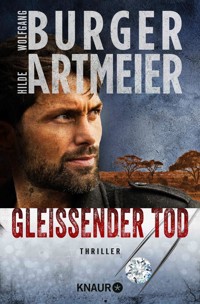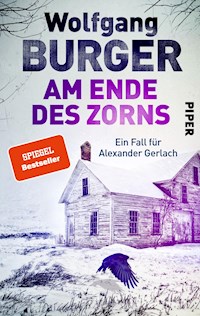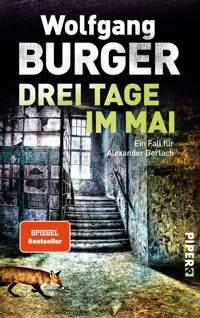9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kriminalrat Gerlach und seine Töchter haben sich in Heidelberg eingelebt, und eigentlich könnte sein Leben endlich in ruhigeren Bahnen verlaufen. Doch dann verspricht er einer jungen Witwe, deren Mann unter seltsamen Umständen ums Leben kam, bei der Aufklärung zu helfen. Tatsächlich scheint es bei dem Autounfall nicht mit rechten Dingen zugegangen zu sein, denn in das Geschehen war auch eine Frau verwickelt, mit der Kriegel seinerzeit verabredet war. Gerlach vermutet ein Eifersuchtsdrama, doch dann taucht ein Aktenkoffer voller Geld auf, der offenbar dem Toten gehört hat. Der ausgesprochen sympathische Kriminalrat muss in einem Fall ermitteln, der ihn rund um die Uhr fordert. Weshalb er wieder einmal zu wenig Zeit für seine Zwillingstöchter hat, die sich gerade zum ersten Mal verlieben, nur leider in denselben Jungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine Eltern
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
9. Auflage November 2012
ISBN 978-3-492-95458-7
Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH 2006 Umschlag: semper smile, München Umschlagmotiv: Konrad Wothe / Getty Images
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Hätte sie das Kind nicht bei sich gehabt, wäre mir vielleicht manches erspart geblieben.
Frau Brenneisen, die in der Heidelberger Weststadt seit Jahrzehnten einen Kiosk betrieb, machte mich auf die magere, schwarzhaarige Frau aufmerksam. Sie trug ein Baby im Arm und war offensichtlich gestrandet. Ich war unterwegs zu meiner abendlichen Joggingrunde, als Frau Brenneisen mich zu sich winkte.
»Sie hat ihr Auto verloren!«, flüsterte sie mit Verschwörerblick. »Zwei Stunden hockt sie jetzt schon auf dieser Bank. Ich hab ihr einen Tee angeboten, aber sie wollte keinen. Sie hat kein Geld, sagt sie, und geschenkt nimmt sie nichts. Das arme Kindchen hat doch bestimmt Hunger. Könnten Sie der Frau nicht helfen, Herr Gerlach? Sie sind doch schließlich Polizist.«
»Wie um Himmels willen kann man ein Auto verlieren?«, erwiderte ich mürrisch. »Außerdem bin ich bei der Kripo und nicht beim Fundbüro.«
Nein, ich hatte nicht die geringste Lust, heute irgendwem zu helfen. Um mein Gewissen ein wenig zu beruhigen und meinen Frust abzureagieren, hatte ich vor, eine Runde zu laufen. Anschließend wollte ich ein Glas Rotwein trinken und keinen Menschen mehr sehen.
Die Frau mit dem Kind wirkte nicht wie eine Obdachlose, aber Haltung und Miene strahlten eine solche Hoffnungslosigkeit aus, dass ich gar nicht hinsehen mochte. Mit starrem Blick wiegte sie ihr unentwegt quengelndes Kind, als wäre es alles, was ihr auf der Welt noch geblieben war. Nein, ich wollte nicht mit ihr reden. Ich hatte kein Interesse an traurigen Geschichten. Und zudem kann ich Frauen nicht ausstehen, die diesen Schlag-mich-nicht-Blick haben. Aber sie hielt ein Kind in den Armen. Fast noch ein Säugling, acht, vielleicht zehn Monate alt. Nur deshalb lief ich nicht fort.
Aus dem Kiosk roch es verführerisch nach Frau Brenneisens Bockwürsten, von denen sie schwor, es seien die besten der Welt. Aber heute würde ich stark bleiben. Diät war angesagt, hatte mir meine Waage heute Morgen unmissverständlich erklärt. Inzwischen lag ich drei Kilo über meinem absoluten Maximalgewicht. Auch wenn Frau Brenneisen meinte, alle Menschen nähmen im Winter zu, ab heute war Schluss mit dem Lotterleben.
Eine Straßenbahn hielt an der Haltestelle neben dem Kiosk, fuhr weiter. Das Wimmern des Kindes wurde lauter, drängender. Seufzend gab ich mich geschlagen. Ich ging hinüber zu diesem seltsamen Paar.
»Kann man Ihnen irgendwie helfen?«
Nach einem verschreckten Blick sah die Frau sofort wieder zu Boden. Ihr zotteliges Haar wirkte, als hätte sie es eigenhändig und ohne jedes Talent geschnitten. Ihr langes, hellblaues Kleid war zu leicht für die Jahreszeit. Im Lauf des Nachmittags hatte zwar ein wenig die Sonne geschienen, aber gegen Abend war es so kühl geworden, dass ich sogar im warmen Jogginganzug fröstelte. Immerhin schrieben wir Anfang Februar, von Frühling noch keine Spur.
»Es ist wegen meinem Mann«, murmelte sie. »Er ist tot.«
Selbst das hübsche Kleid wirkte an dieser Frau trist und billig. Das Kind starrte mich mit großen Augen an. Hatte sie meine Frage nicht verstanden? Ich versuchte es noch einmal, diesmal deutlicher:
»Es gibt ein Problem mit Ihrem Auto, habe ich gehört?«
»Es ist weg. Wie sollen wir denn jetzt heimkommen?«
Die Frau war wirklich nicht der Typ, nach dem Männer sich auf der Straße umdrehen. Im Gegenteil, sie zählte zu den Menschen, die man noch übersieht, wenn man sie im Gedränge schon angerempelt hat, und die sich dann auch noch dafür entschuldigen, dass sie im Weg waren. Ich merkte, wie ihre kraftlose Art mich aggressiv machte.
»Wie genau haben Sie denn Ihr Auto … verloren?«
»Ich habe irgendwo hier geparkt, weil Björn auf einmal Hunger hatte.« Sie schaukelte das Kind stärker, als würde sie allmählich wieder zum Leben erwachen. »Da drüben an der großen Straße habe ich eine Tüte Kekse für ihn gekauft, Amarettini, die mag er so gern, und dann habe ich das Auto einfach nicht mehr gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich geparkt habe. So was passiert mir dauernd. Ich habe keinen Orientierungssinn, hat mein Mann immer gesagt. Über eine Stunde lang habe ich Björn kreuz und quer durch die Straßen geschleppt, aber …« Als könnte sie ihre Schusseligkeit selbst nicht fassen, schüttelte sie den Kopf. »Ich kann es nicht wiederfinden. Ob es gestohlen ist?«
»Haben Sie es schon bei der Polizei versucht?«
Die Antwort war ein verzagtes Nicken. Vermutlich hatte ein weniger feinfühliger Kollege sie ausgelacht. Frau Brenneisen beobachtete unsere Unterhaltung aufmerksam.
»Was ist das denn für ein Auto?«
»Ein Passat. Ein weißer Kombi. Ziemlich alt schon, aber er fährt noch ganz gut«, flüsterte die Frau und nannte mir ein Mannheimer Kennzeichen.
Ich zückte mein Handy und wählte die Nummer der Polizeidirektion.
»Augenblick, Herr Kriminalrat«, erklang es dienstbeflissen. Sekunden später meldete sich ein Hauptkommissar Scheuerlein, an dessen Gesicht ich mich aus irgendeiner langweiligen Sitzung erinnerte. Ich war ja erst seit einem halben Jahr Chef der Heidelberger Kriminalpolizei und hatte mir noch nicht alle Namen merken können. Ich beschrieb dem Kollegen die Notlage der Frau sowie ihren verschwundenen Passat. Mutter und Kind beobachteten mich mit feuchten Augen. Dann nickte ich den beiden aufmunternd zu und ging zu Frau Brenneisen zurück.
Ich gebe zu, ich war unhöflich, aber ich wollte nicht mit der Frau sprechen. Ich wollte mit niemandem sprechen. Mein Bedarf an Ärger und Problemen war gedeckt für diesen Tag.
Morgens im Bad hatte ich schon wieder ein paar neue graue Haare auf meinem Kopf entdeckt, obwohl ich doch erst gestern sieben von der Sorte ausgezupft hatte. Zum Frühstück legten meine vierzehnjährigen Zwillinge mir zwei rekordverdächtige Französischarbeiten zum Unterschreiben vor. Obwohl sie alle Eide schworen, an weit entfernten Ecken des Klassenzimmers gesessen zu haben, hatten sie zwei völlig identische Katastrophen abgeliefert und ihre Quittung dafür bekommen: zwei Mal Fünf minus. Ich wusste, sie hassten ihre neue Heimat, sie hassten ihre neue Schule. Aber das war kein Grund, sich die Zukunft zu ruinieren.
Kaum im Büro, war mir Liebekind, mein Vorgesetzter, auf die Nerven gegangen wegen irgendwelcher Statistiken und Aufklärungsquoten, die ich spätestens Ende Januar hätte ans Innenministerium liefern sollen. Ich war mir sicher, alles längst fertig gemacht zu haben, aber aus unerfindlichen Gründen waren plötzlich zwei Dateien von meinem Computer verschwunden, und nun durfte ich alles noch einmal tippen.
Um das Maß voll zu machen, hatte Theresa nachmittags unser Treffen für heute Abend abgesagt. Theresa war Liebekinds Frau und seit Monaten unglücklicherweise meine Geliebte. Die Absage war per E-Mail gekommen, zwei Zeilen, ohne Begründung. Und seitdem war ihr Handy ausgeschaltet. Ich wusste nicht, was los war. War sie sauer? Wollte sie mich bestrafen? Wenn ja, dann wusste ich leider nicht, wofür.
Einen großen Teil des Tages hatte ich in ewig langen Sitzungen zugebracht, bei denen es um die Verbesserung der inneren Sicherheit unserer Stadt ging, und das bei Jahr für Jahr sinkenden Budgets. Die restliche Zeit über hatte ich so wichtige Dinge erledigt wie das Unterschreiben von Reisekostenabrechnungen, das Erfinden phantasiereicher Begründungen für Mittelanforderungen, das Beantragen neuer Dienstwagen als Ersatz für die Rostlauben, mit denen meine Leute ihre Einsätze fahren mussten.
»Haben Sie schon von den zwei entlaufenen Killern gehört?«, holte mich Frau Brenneisen in die Gegenwart zurück. Dabei schmunzelte sie so herzerwärmend, als wären ausgebrochene Schwerverbrecher eine wirklich hübsche Nachricht zum Feierabend.
Selbstverständlich hatte ich schon von den in der Nähe von Heilbronn entflohenen Untersuchungsgefangenen erfahren. Die Fahndungsmeldung war bereits gestern Morgen über meinen Schreibtisch gegangen. Die beiden waren in der Nacht von Montag auf Dienstag aus der psychiatrischen Landesklinik in Weinsberg verschwunden. Einer hatte im Suff seine Frau ermordet, der andere im Zustand religiöser Erleuchtung ein altes Ehepaar aus der Nachbarschaft zerstückelt und, säuberlich in Frischhaltebeuteln verpackt, in seiner Tiefkühltruhe eingelagert.
Es sei schon gestern den ganzen Tag über im Radio gekommen, erzählte mir Frau Brenneisen aufgeräumt, und man solle in der Gegend auf keinen Fall Anhalter mitnehmen.
»Aber ich nehm sowieso nie Anhalter mit. Schon gar keine Männer«, meinte sie und schrubbte, als müsste sie alle Schlechtigkeit dieser Welt wegputzen, mit einem harten Schwamm auf ihrem Tresen herum.
Inzwischen war es dunkel geworden. Die Glocke der nur wenige Schritte entfernten Christuskirche dröhnte sechs Mal. Eine neue, diesmal proppenvolle Straßenbahn kam aus der Stadt und hielt quietschend an der Haltestelle. Ein Schwall grauer Gestalten ergoss sich auf den feuchten Gehsteig und zerstreute sich rasch. Mir war kalt. Frau Brenneisens Bockwürste dufteten. Mein Magen knurrte. Ich war wütend auf mich, meine Töchter, Theresa und die Welt und beschloss, das Joggen heute zu lassen. Stattdessen würde ich das Abendessen auf eine Scheibe Vollkornbrot mit Kräuterquark reduzieren und auf den Rotwein verzichten. Bald würde der Frühling kommen und mit ihm die Wärme. Dann würde es abends wieder länger hell sein. Winter ist einfach eine schlechte Zeit, um Charakter zu beweisen.
»Stellen Sie sich vor, wenn die zwei Mörder nach Heidelberg kommen, und Sie können sie festnehmen! Dann sieht man Sie endlich mal wieder in der Zeitung.«
Ich legte keinen Wert darauf, in die Zeitung zu kommen.
Endlich summte das Handy in meiner Hosentasche, und ich durfte der Frau mit dem Baby die frohe Botschaft überbringen, dass ihr Passat in der Bunsenstraße im absoluten Halteverbot stand und eben im Begriff war, auf einen Abschleppwagen geladen zu werden. Wie ich befürchtet hatte, begann sie sofort zu weinen. Das Kind stimmte mit beachtlicher Lautstärke ein.
Ich kann es nicht ertragen, wenn in meiner Gegenwart geweint wird, weil ich mich dann unweigerlich schuldig fühle. Wie ich erwartet hatte, wusste sie nicht, wo die Bunsenstraße war.
So telefonierte ich erneut, besänftigte einen herzhaft fluchenden Abschleppwagen-Fahrer, beruhigte zwei sehr verwunderte Schupos und versprach dem tränenfeuchten Paar vor mir, sie auf dem Weg zu ihrem verschollenen Fahrzeug zu begleiten, damit sie nicht noch einmal verloren gingen.
Frau Brenneisen sah uns nach mit dem Blick eines Menschen, der seine gute Tat für heute vollbracht hat.
Der Name der Frau war Vanessa Kriegel, erfuhr ich, während sie mit dem Kind im Arm neben mir her lief. Björn war neun Monate alt, nur acht Wochen vor dem plötzlichen Tod seines Vaters geboren. Sie wohne in Viernheim, erzählte sie mir, und habe eigentlich gar nicht vorgehabt, in Heidelberg Halt zu machen. Langsam gingen wir die Römerstraße nordwärts, aber wir kamen keine zweihundert Meter weit. An der Ecke zur Blumenstraße bemerkte ich, dass sie plötzlich zurückblieb. Ich konnte ihr gerade noch den Jungen abnehmen und sie am Oberarm festhalten, sonst wäre sie zusammengebrochen.
»Mir ist auf einmal so komisch«, flüsterte sie, fasste sich an die Stirn und stützte sich mit der anderen Hand gegen die Hauswand. »Ich weiß gar nicht …«
»Haben Sie denn etwas zu Mittag gegessen?«
Als müsste sie sich dafür schämen, hungrig zu sein, schüttelte sie den Kopf. Björn sah mich neugierig an und strampelte vergnügt. Er schien mich zu mögen. Ich hingegen mochte ihn nicht. Da ich selbst nur Töchter hatte, fand ich kleine Jungs immer schon hässlich. Vermutlich findet jeder nur die eigenen Babys schön. Dabei hatte Björn den zierlichen Körperbau seiner Mutter geerbt und vielleicht das fein geschnittene Gesicht des Vaters. Und wenn der Kleine einen anstrahlte, dann fiel es bei aller schlechten Laune schwer, nicht zu lächeln. Aber ich mochte ihn trotzdem nicht.
Wenige Schritte zurück war der Eingang zum Kalimera, einem griechischen Restaurant. Da ich die Frau in ihrem Zustand unmöglich nach Hause fahren lassen konnte, bugsierte ich Vanessa Kriegel in den dämmrigen Gastraum. Griechen sind von Natur aus kinderlieb, und da wir die ersten Gäste waren, konnten alle Anwesenden sich mit überwältigender Inbrunst um Mutter und Kind kümmern. Björn wurde vorne und hinten gekrault und betatscht, ein Hochstuhl herbeigeschleppt, Vanessa Kriegel gebührend bemitleidet und umsorgt. Irgendjemand fand sogar eine Strickjacke für sie.
Die hagere, weißhaarige Wirtin glaubte mir unbesehen, dass ich Polizist sei und morgen bezahlen würde, da ich zum Joggen natürlich weder Geld noch einen Ausweis mit mir führte. Sie war fast beleidigt, als ich zu weiteren Erklärungen ansetzen wollte. Hier galt es, das Leben eines Kindes zu retten, und so saßen wir im Nu am Tisch und studierten die Speisekarte.
Aus der Küche drangen verlockende Düfte. Mein Magen knurrte schon wieder vorwurfsvoll. Heute Mittag hatte ich mir nur einen gemischten Salatteller erlaubt. Aber da ich für heute genug gelitten hatte, würde ich mir nun eine kleine Ausnahme gönnen. Einen solchen Tag konnte ich unmöglich hungrig beenden. Bestimmt hatten auch Griechen Vegetarisches, Kalorienreduziertes auf der Karte. Irgendeine Kleinigkeit. Nach einigem Hin und Her entschied ich mich für die Athen-Platte mit Pommes und ein Viertel Athos dazu.
Für den Jungen wurde in der Küche ein Kleinkinder-Menü aufgewärmt, das seine Mutter aus ihrer Kunstleder-Handtasche genestelt hatte. Sie selbst wählte nach langem Überlegen das Billigste, was die Karte hergab: Gyros mit Gemüsereis.
»Ich werde es Ihnen später bezahlen«, murmelte sie verlegen. »Mein Portmonee liegt im Auto.«
Mit überschäumender Herzenswärme und weiteren Streicheleinheiten wurde Björns Essen serviert. Püriertes Hühnchen mit Karotte.
»Was war denn eigentlich das Ziel Ihrer Reise?«, fragte ich, während sie voller Konzentration ihren Sohn fütterte. »Wenn Sie gar nicht nach Heidelberg wollten?«
Vergnügt quietschend versuchte der zappelnde Kleine, seiner Mutter den Löffel aus der Hand zu schlagen.
»Ich habe es doch schon gesagt.« Wie alle Menschen, die ein Baby füttern, sperrte auch Vanessa Kriegel den Mund auf und schloss ihn wieder, während sie den Löffel zwischen Björns Lippen schob. »Es geht um meinen Mann.«
Eine sehenswerte dunkeläugige Bedienung, vermutlich eine Tochter des Hauses, stellte uns zwei Portionen Krautsalat hin und konnte es natürlich nicht lassen, dabei Björns Hinterkopf zu tätscheln, was dieser mit einem nährstoffhaltigen Pruster quittierte.
»Was ist mit Ihrem Mann?«
»Er hatte einen Verkehrsunfall, letzten Sommer.«
Sören Kriegel war im letzten Juli auf der Bundesstraße zwischen Mosbach und Eberbach tödlich verunglückt, erfuhr ich.
»Und da wollte ich heute hinfahren. Ich muss wissen, wie das passiert ist. Was er da gewollt hat.«
»Und was tun Sie dann hier, in Heidelberg?«
Geduldig reinigte sie Gesicht und Hände des Kindes mit einer Papierserviette. Das Essen kam. Die noch nicht angerührten Salatschüsselchen wurden zur Seite gerückt, zwei dampfende und köstlich riechende Teller vor uns hingestellt. Große Teller mit Bergen von Essen darauf. Ich bestellte mir ein zweites Glas Athos. Wenn ich schon sündigte, dann sollte sich die Reue morgen früh wenigstens lohnen.
»Es ist kompliziert.« Endlich ließ sie von dem Kind ab, wandte sich mir zu und sah auf den Kragen meiner Jacke. »Sie sind bei der Polizei?«
Vanessa Kriegel machte sich an ihr Gyros, als hätte sie seit Tagen gehungert. Erst als der Teller halb leer war, hielt sie plötzlich inne und sah wieder auf.
»Sie können gerne meinen Ouzo haben«, sagte sie kauend. »Ich trinke keinen Alkohol.«
Dankend nahm ich an. Die Reue würde fürchterlich werden.
»Wenn Sie Polizist sind, vielleicht können Sie mir ja helfen? Ich meine … Sie sind so nett zu uns und …« Langsam nahmen ihre Wangen wieder Farbe an.
»Ich kann es versuchen.« Ich lächelte sie aufmunternd an. Mit dem ärgsten Hunger verschwand allmählich auch meine miserable Laune. »War denn irgendwas nicht in Ordnung mit diesem Unfall?«
In Gedanken schüttelte sie den Kopf. »Sören war damals beruflich unterwegs. Nach Saarbrücken, hat er gesagt. Er sollte da irgendwelche Verhandlungen führen für die Firma, wo er gearbeitet hat.«
Mit konzentrierten Bewegungen steckte sie einen großen Bissen in den Mund. Björn brabbelte vor sich hin und hantierte mit dem Löffel, den die Mutter ihm zum Spielen überlassen hatte.
Das Essen schmeckte mir wie schon lange nichts mehr. Vor allem die würzigen Lammkoteletts mit Thymian hatten es mir angetan. Endlich fühlte ich mich wieder als Mensch. »Und weiter?«
»Irgendetwas stimmt da nicht. Ich habe es erst vor ein paar Tagen gemerkt. Da, wo Sören verunglückt ist, geht es überhaupt nicht nach Saarbrücken. Das ist die ganz falsche Richtung. Und außerdem ist er mitten in der Nacht verunglückt, und um diese Zeit hätte er doch im Hotel sein sollen, in Saarbrücken, und nicht am Neckar herumfahren. Erst wollte ich es nicht glauben. Aber dann habe ich das Hotel angerufen, wo er übernachten wollte. Und, stellen Sie sich vor, er hatte gar kein Zimmer reserviert!« Zum ersten Mal sah sie mir direkt ins Gesicht.
»Das ist ja wirklich merkwürdig. Was war Ihr Mann von Beruf?«
»Er hat Computerprogramme entwickelt. Für irgendwelche Geräte.«
»Was für Geräte?«
Sie senkte den Blick. »Ich weiß es nicht genau. Ich verstehe nichts von Technik.«
Ich nippte an meinem Athos.
»Sind Sie verheiratet?«, fragte sie unvermittelt und sah wieder auf.
Ich schluckte. »Ich war. Meine Frau ist auch gestorben.«
»Ja«, sagte sie ernst nickend. »Es ist schlimm. Vor allem, wenn man Kinder hat.«
Plötzlich hatte auch ich keine Lust mehr auf Essen. Ich legte das Besteck auf den Teller und schob ihn zur Seite.
»Ich habe dann Sörens Anrufbeantworter abgehört. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich mit so einem Ding nicht auskennt. Aber ich habe die Bedienungsanleitung gefunden, und dann ging es irgendwie. Der hat die ganze Zeit auf seinem Schreibtisch gestanden und geblinkt. Seit Sören tot ist. Acht Monate lang. Ich konnte einfach nichts von seinen Sachen anfassen, verstehen Sie das? Ich habe sein Zimmer gelassen, wie es war. Nur alle zwei Wochen gehe ich rein und lüfte durch.«
Auf einmal tat sie mir Leid. Wenn es etwas gab, worin ich Bescheid wusste, dann waren es die Gefühle und Stimmungen, die der Verlust eines geliebten Menschen in einem auslöst. Noch heute, eineinhalb Jahre nach ihrem Tod, rebellierte mein Magen beim Gedanken an die schlimme Zeit, nachdem Vera so vollkommen überraschend gestorben war. Allein aus diesem Grund war ich jetzt hier, in Heidelberg. Weil ich das Haus nicht mehr hatte ertragen können, in dem wir so lange zusammen gelebt, geliebt und gestritten hatten.
»Und einer der Anrufe war von einem Schlosshotel in Heinsheim. Das ist in der Nähe von Bad Wimpfen. Sie haben eine Buchung bestätigt für die Nacht, in der Sören verunglückt ist. Und dort wollte ich heute hinfahren, zu diesem Hotel.« Lustlos piekste sie in ihrem Essen herum. »Wissen Sie, was ich nämlich glaube?«, sagte sie nach einer Weile tonlos. »Ich glaube, er war bei einer anderen Frau.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«, protestierte ich halbherzig. Natürlich war auch mein erster Verdacht in diese Richtung gegangen. »Vielleicht hat ihm seine Firma überraschend einen anderen Auftrag gegeben? Oder er hat sich einfach nur vertan mit Saarbrücken?« Der letzte Satz war wirklich zu blöd gewesen. »Vielleicht haben Sie ihn falsch verstanden?« Dieser war wohl noch blöder.
Zum Glück hörte sie gar nicht zu. »Er war die ganzen Wochen schon so komisch.«
»Komisch?«
»Ja.« Sie steckte das kleinste Fleischfitzelchen in den Mund, das sie finden konnte. »Ganz aufgedreht. So … gut gelaunt auf einmal. So ist er sonst nie gewesen. Obwohl er doch endlich Arbeit gefunden hatte. Es war damals eine schwere Zeit für ihn. Für uns.«
»Warum haben Sie dieses Hotel nicht einfach angerufen und gefragt, ob Ihr Mann dort ein Zimmer hatte?«
»Das habe ich doch«, erwiderte sie. »Aber sie sagen einem nichts am Telefon. Das dürften sie nicht, heißt es. Wegen Datenschutz.«
»Und deshalb wollten Sie heute hinfahren und fragen.« Ich nahm die Gabel wieder in die Hand. Ich war doch noch hungrig.
»Mindestens fünf Mal habe ich mich verfahren in diesem verflixten Heidelberg!«, schimpfte sie mit plötzlicher Energie. »Ich weiß gar nicht, wie oft wir über den Neckar gekommen sind. Überall diese Einbahnstraßen, und dann hat Björn auch noch Hunger gekriegt, und …« Jetzt liefen wieder Tränen über ihre ungeschminkten Wangen. »Verstehen Sie, ich … ich könnte das nicht aushalten, wenn ich wüsste, dass er …«
»Und Sie können es ebenso wenig ertragen, es nicht zu wissen«, ergänzte ich leise.
Björn warf den Löffel in weitem Bogen durchs Lokal und quiekte begeistert, als es schepperte. Zum Glück ging nichts von der überladenen Dekoration zu Bruch, denn vermutlich hätte ich für den Schaden aufkommen dürfen.
»Ein hübsches Kleid haben Sie an«, sagte ich, um sie ein wenig aufzumuntern. Sie lachte wie jemand, der Komplimente nicht gewohnt ist.
»Mein Hochzeitskleid.« Verschämt senkte sie den Blick. »Ich dachte, ein Schlosshotel, da kann man vielleicht nicht so in Jeans und Pulli …« Sinnlos schob sie das Essen auf ihrem Teller herum. »Ich habe nicht viel Geld, wissen Sie. Sören hat früher eine Firma gehabt. Aber sie ist Pleite gegangen. Danach ist er eine ganze Zeit arbeitslos gewesen, und dann, kurz nach unserer Hochzeit, hat er zum Glück diese Stelle gefunden, bei der Analytech. Da hat er aber nur ein halbes Jahr gearbeitet. Und gerade als wir dachten, jetzt wird es besser, jetzt geht es ein bisschen aufwärts, da ist er gestorben.«
Mein Teller war leer. Ich schlürfte den zweiten Ouzo und spülte mit einem Schluck Athos nach.
»Und jetzt sitze ich da mit dem Kind«, murmelte sie. »Ich dachte, ich kriege wenigstens ein bisschen Rente. Aber dann hat sich herausgestellt, dass Sören gar keine Rentenversicherung gehabt hat, weil er doch selbstständig war. Abends arbeite ich vier Stunden bei Lidl an der Kasse.« Sie schloss die Augen. Ihre mageren Hände krampften sich zu bebenden Fäusten. »Zum Glück hat mir die Firma noch drei Monatsgehälter überwiesen. So konnte ich ihm wenigstens eine anständige Beerdigung bezahlen.«
Beerdigung. Es gibt kein Wort, das ich mehr hasse.
»Wenigstens kann ich Björn bei meiner Mutter lassen, wenn ich arbeiten gehe. Aber sie ist schon dreiundsiebzig und nicht mehr so gesund, und …« Mit zitternder Unterlippe verstummte sie. Lange sah sie durch mich hindurch. »Manchmal weiß ich nicht, wie alles weitergehen soll«, flüsterte sie endlich. »Kinder kosten so viel Geld. Alle paar Wochen braucht er etwas Neues zum Anziehen. Sie wachsen doch so schnell in diesem Alter.«
Björn hieb mit beiden Händen auf den Tisch und strahlte mich an, als wären wir alte Kumpels.
2
Meine gerstenblonden Zwillinge saßen in der Küche, tippten auf ihren neuen Handys herum, aßen ohne hinzusehen selbst gebratenes Rührei und waren wieder einmal böse auf mich. Leider nicht ganz zu Unrecht. Ich hatte einfach zu wenig Zeit für sie.
Als Beilagen gab es Ketschup sowie ihr innig geliebtes und offenbar zu jeder Mahlzeit passendes Nutella-Brot.
»Wie üblich« hatte es nichts zu essen gegeben. »Wie üblich« hatte ich mich lieber meinen Hobbys gewidmet als meinen armen, vernachlässigten Töchtern. Als ob Joggen ein Hobby sein könnte.
»Dabei warst du ja nicht mal joggen«, konstatierte Louise mit blitzenden Augen. »Dein Anzug ist ganz trocken!«
»Und außerdem riechst du nach Knoblauch«, fügte Sarah kauend hinzu.
Ich versuchte den Trick, den alle Feldherren anwenden, wenn eine Schlacht verloren zu gehen droht. Ich eröffnete eine zweite Front. »Habt ihr eure Französisch-Hausaufgaben gemacht?«
Sie wurden kein bisschen verlegen. Es schien nichts zu werden mit der zweiten Front. »Logo!«
»Die will ich sehen.«
»Ist nicht nötig«, behauptete Louise unerwartet selbstbewusst. »Die sind schon okay.«
»Wir haben alles genau überprüft«, ergänzte Sarah. »Und außerdem haben wir eine Eins bis Zwei in Mathe.«
»Beide?«
»Beide.«
»Und was heißt das genau, überprüft?«
Theatralisch seufzend rollten sie die Augen. »Wir haben einen Neuen in der Klasse, Franky. Der ist total super in Französisch. Und der hat uns geholfen.«
»Mit anderen Worten, er hat euch am Telefon diktiert, was ihr schreiben sollt.«
Aus ihrer Reaktion schloss ich, dass ich richtig lag mit meinem Verdacht.
»Außerdem habt ihr den Müll nicht runtergebracht.«
»Sarah ist dran.« Louise wandte sich demonstrativ wieder ihrem Handy zu.
»Stimmt gar nicht«, widersprach die andere. »Ich hab’s nämlich die letzten beiden Male gemacht!«
»Dafür hab ich am Montag die Spülmaschine und …«
»Und ich am Sonntag …«
»Es ist mir völlig egal, wer ihn runterbringt«, fuhr ich den beiden lautstark ins Wort. »In einer Viertelstunde ist das Zeug verschwunden, oder ich kippe es in euer Zimmer.«
Nun entspann sich ein längerer und lautstarker Disput über die Unterschiede zwischen modernen und mittelalterlichen Erziehungsmethoden. Am Ende schleppten sie die Mülltüte maulend gemeinsam hinunter.
Um die Wogen ein wenig zu glätten, erzählte ich ihnen später die Geschichte von der Frau, die ihr Auto verloren hatte. Die Hintergründe verschwieg ich natürlich. Mit ihren vierzehn Jahren waren die Mädchen noch ein bisschen jung für Bettgeschichten. Dass es sich um eine solche handelte, stand für mich außer Zweifel.
»Sie will rausfinden, warum ihr Mann verunglückt ist, und du wirst ihr dabei helfen?«, fragte Sarah mit runden Augen.
»Das ist ja keine große Sache. Wozu bin ich bei der Kripo. Ich werd mich morgen früh ans Telefon hängen, und nach spätestens einer Viertelstunde ist die Sache erledigt.«
»Wo liegt eigentlich Saarbrücken?«, wollte Louise wissen.
»Das meinst du ja hoffentlich nicht ernst«, stöhnte ich. »Was lernt ihr denn in der Schule? Saarbrücken, das liegt von hier aus im Westen, jenseits der Pfalz und kurz vor der französischen Grenze.«
Sie sahen sich an und begannen, Theorien zu entwickeln.
»Wenn der nach Westen gewollt hätte …«
»… dann wäre er ja nie im Leben an den Neckar gefahren!«
»So doof kann ja keiner sein.«
»Und er ist mitten in der Nacht verunglückt!«
»Er muss da irgendwo übernachtet haben.«
Sie brauchten eine Minute und zwanzig Sekunden.
»Der ist bestimmt fremdgegangen«, fasste Sarah die Ergebnisse ihrer Analysen zusammen. »Da muss eine Frau dahinter stecken.«
Die Überprüfung der Hausaufgaben ersparte ich mir. Ich hatte keine Lust auf weiteren Erziehungsstress. Ich freute mich auf einen ruhigen Abend. Theresa hatte mir einige Bücher ausgeliehen, unter anderem »Die Entdeckung der Langsamkeit« von Sten Nadolny. Ich mochte es, aber heute gab ich schon nach wenigen Seiten auf. Das üppige Essen machte mich müde. So hörte ich mit geschlossenen Augen noch ein wenig Musik, Keith Jarrets »At the Blue Note«, und ging bald schlafen. Aus dem Zimmer der Mädchen hörte ich Gekicher. Ein Lämpchen im Flur zeigte an, dass sie schon wieder telefonierten. Mir graute vor der nächsten Rechnung. Demnächst würden wir einen zweiten Anschluss brauchen, wenn ich überhaupt noch telefonisch erreichbar sein wollte.
Die Reue kam nicht am nächsten Morgen, sondern schon um Viertel nach eins. Nach kaum zwei Stunden Schlaf erwachte ich schweißgebadet und fühlte mich wie der Wolf, nachdem er das siebte Geißlein gefressen hat. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Die Schuld dafür gab ich Vanessa Kriegel und ihrem Tunichtgut von Ehemann. Früher hatte ich über Menschen gespottet, die nach einem üppigen Abendessen nicht schlafen konnten. Eines der Zipperlein alter Leute. Auch nach einer großen Pizza abends um elf hatte ich zuverlässig geschlafen wie ein Murmeltierbaby. Heute war das offenbar nicht mehr so. Ich mochte nicht darüber nachdenken, was das bedeutete. So wälzte ich mich im Bett und dachte stattdessen an all die Dinge, die ich morgen im Büro erledigen musste. Der Stapel mit den unerledigten Sachen auf meinem Schreibtisch wurde immer höher statt niedriger, und wenn Sönnchen, meine unersetzliche Sekretärin, nicht auf mich aufgepasst hätte, dann wäre mir schon mehr als ein Mal ein wichtiger Termin durch die Lappen gegangen.
Erst spät fiel ich erneut in einen unruhigen Schlaf, in dessen Träumen Berge von Gyros, Pommes und ketschupverschmierte Kleinkinder durcheinander wirbelten. Um zehn nach halb vier schreckte mich das Telefon aus dem Schlaf.
Am Schluß hatte ich wie so oft in letzter Zeit von Theresa geträumt. Ich musste sie morgen unbedingt anrufen, um sie zu besänftigen und vor allen Dingen herauszufinden, was sie mir eigentlich vorwarf.
Wenn mein Telefon zwischen neun Uhr abends und sieben Uhr morgens klingelt, dann bedeutet dies in aller Regel eine Katastrophe. Nicht für mich, sondern für irgendjemanden dort draußen, eine Ehefrau vielleicht, einen Mann, eine Mutter, ein Kind. Für jemanden, der urplötzlich allein ist auf der Welt, weil ein anderer einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.
Natürlich gehörte es nicht zu meinen Aufgaben als Kripochef, mir nachts im Regen an Tatorten die Beine in den Bauch zu stehen, mehr oder weniger ansehnliche Leichen zu betrachten und den ewig schlecht gelaunten Kollegen von der Spurensicherung bei ihrer sterbenslangweiligen Tätigkeit zuzusehen. Aber ich hatte mir angewöhnt, zumindest am Anfang dabei zu sein, mir ein eigenes Bild zu machen. Ich hasste Schreibtischarbeit seit jeher, und wenn man nicht aufpasst, dann kennt man als Chef bald nichts anderes mehr als das viele trockene Papier auf seinem Tisch.
Liebekind hatte sich stirnrunzelnd damit abgefunden, dass ich es nicht lassen konnte, mich in die Arbeit meiner Untergebenen einzumischen. Vermutlich baute er darauf, dass ich irgendwann von alleine vernünftig oder doch wenigstens faul werden würde.
»Männliche Leiche im Schleusenbecken am Karlstor«, erklärte mir eine mürrische Stimme aus der Telefonzentrale der Polizeidirektion. Mehr wusste zu diesem Zeitpunkt niemand. Kriminaldauerdienst und Spurensicherung waren unterwegs, der Notarzt alarmiert.
Fünfzehn Minuten nach dem Anruf steuerte ich meinen guten alten Peugeot-Kombi durch das ausgestorbene Heidelberg. Der Wagen war fast auf den Tag genau drei Monate älter als meine Töchter, und besonders humorvolle Kollegen hatten ihn früher gerne als Pampers-Bomber bezeichnet. Ein böiger Wind ließ die Straßenlaternen schaukeln, der Asphalt glänzte feucht. Ich fühlte mich zerschlagen und fror. Schon von ferne sah ich die Blaulichter am Straßenrand.
Klara Vangelis war natürlich schon da, als ich ankam. Sie musste ja immer und überall die Erste sein. Sven Balke kam Minuten später fast gleichzeitig mit dem Notarztwagen auf einem Mountainbike, das sicherlich mehr wert war als mein Auto. Er sah verschlafen und ungekämmt aus. Meine Töchter hatten mich erst kürzlich darüber aufgeklärt, dass man dies heute nicht mehr als ungepflegt bezeichnete, sondern als »Out-of-bed-Look«.
Die Kollegen vom Kriminaldauerdienst hatten die Leiche des übergewichtigen Mannes schon aus dem Wasser gefischt und am betonierten Rand des südlichen Schleusenbeckens neben einem der Poller abgelegt. Die Pfütze um den Leichnam herum wurde rasch größer. Die Beamten der Spurensicherung zupften gähnend an dem Körper herum. Sie waren zu zweit und hatten eine gewisse Ähnlichkeit mit Dick und Doof.
Es roch nach Tang und Teer. Irgendwo im Dunkeln toste der Hochwasser führende Neckar über die Wehre in die Tiefe. In der Schwärze unter uns gluckste es tückisch, Wellen klatschten gegen die Mauern. Eine rote Ampel für Schiffe und die zuckenden Blaulichter erhellten die Szenerie.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte ich einen glasig dreinblickenden Uniformierten. Stumm wies er auf ein verschüchtertes Pärchen im Hintergrund, das sich Hilfe und Wärme suchend aneinander klammerte. Das Mädchen mochte fünfzehn, höchstens sechzehn sein, der schlaksige Junge knapp volljährig. Ihre Augen wirkten, als stünden sie unter einer milden Droge. Vielleicht war es auch nur der Schock.
Viel zu erzählen hatten die beiden nicht. Guck mal, da schwimmt ’ne Wasserleiche, hatte sie kichernd zu ihrem Liebsten gesagt und erst nach Sekunden begriffen, wie gründlich ihr Scherz misslungen war.
»Der Mann ist vorläufig nicht zu identifizieren«, erklärte mir Doof, der eine Spurensicherer, und wischte sich die Hände an der Hose trocken. »Keine Papiere, nichts, woraus man auf seine Identität schließen könnte. Alter auf den ersten Blick zwischen vierzig und fünfzig, Hände gepflegt, kein Ehering, Kleidung Mittelklasse, Typ Junggeselle.«
»Am Jackett fehlt ein Knopf«, ergänzte Dick. »Der ist vermutlich noch nicht lange ab.«
»Seit wann ist er tot?«, fragte Vangelis.
Ich schätzte sie als zuverlässige und intelligente Mitarbeiterin, mochte sie aber nicht besonders, weil sie in meinen Augen zu ehrgeizig war. Und sie konnte mich noch weniger leiden, weil sie gehofft hatte, an meiner Stelle Kripochefin zu werden. Im Großen und Ganzen kamen wir miteinander klar, nur die rechte Herzenswärme wollte sich zwischen uns nicht einstellen.
Der Arzt, ein junger Kerl mit athletischer Figur und offenbar unverwüstlicher Laune, trat hinzu. »Der Körper hat exakt Wassertemperatur«, erklärte er mit breitem Lächeln, während seine Hände die zahllosen Taschen seines Sanitäter-Anzugs absuchten. »Die Totenstarre ist schon fast wieder verschwunden. Mindestens vierundzwanzig Stunden, würde ich sagen, eher sogar länger.«
»Was meinen Sie mit Typ Junggeselle?«, wollte Balke wissen.
Doof machte ein schmatzendes Geräusch und sah an Vangelis vorbei auf die erleuchtete Altstadt. »Gucken Sie doch hin: Lila Hemd zu auberginenfarbenem Jackett! Wenn ich meiner Frau so unter die Augen kommen würde, die würde am nächsten Morgen zu ihrer Mutter ziehen.«
Der eklig feuchte Ostwind aus dem Neckartal durchdrang selbst meinen Wollmantel. Man spürte, dass der Winter noch lange nicht zu Ende war. Der Januar war zu warm gewesen, sodass die Zeitungen wieder einmal über den Treibhauseffekt und den drohenden Weltuntergang philosophierten. In den letzten Tagen war das Wetter umgeschlagen, jetzt sollte es sogar Schnee geben. Irgendwo klapperte ein Rettungsring im Wind gegen seine Halterung. Hin und wieder erhellte ein Blitzlicht die Szene. Die Leiche wurde fotografiert.
Inzwischen war mir lausekalt, und ich suchte einen unverdächtigen Grund, mich wieder in mein Bett zurückziehen zu dürfen. Aber auf keinen Fall würde ich vor Vangelis gehen. Die schien jedoch nicht einmal zu frieren in ihrem makellosen Kostüm. Diese Frau wurde mir immer unheimlicher. Balkes Laune hingegen verschlechterte sich rapide. Er sah immer öfter auf die Uhr. Endlich klappten die Spurensicherer ihre Metallkoffer zu. Schlösser schnappten als Zeichen zum Aufbruch.
Ein Fiat fuhr mit viel zu hohem Tempo die südliche Uferstraße hinauf. Als er die vielen Blaulichter am Straßenrand bemerkte, trat der Fahrer so hart auf die Bremse, dass er um ein Haar ins Schleudern gekommen wäre.
»Der Anzug?« Balke schlug die Arme um den Oberkörper.
»C & A«, brummte Dick. »Können wir ihn dann wegschaffen lassen?«
»Augenblick noch!«, mischte sich Vangelis ein. »Die Todesursache?«
Die Kollegen wechselten amüsierte Blicke mit dem Arzt, der sich inzwischen eine filterlose Zigarette angesteckt hatte. »In Anbetracht der Gesamtsituation können wir Tod durch Ertrinken nicht völlig ausschließen«, erklärte Doof mit amtlicher Miene. »Ansonsten sind wir die Spusi und nicht die Gerichtsmedizin.«
»Mir fallen auf Anhieb genau drei Möglichkeiten ein«, erwiderte Vangelis kalt und zählte an den Fingern auf: »Erstens, er ist freiwillig reingesprungen. Zweitens, er ist aus Versehen reingefallen, und drittens, jemand hat ihn reingeworfen. Also, was nun?«
»Nummer eins oder zwei.« Der Kollege hielt den Unterarm so, dass er im Licht der Straßenbeleuchtung seine Armbanduhr ablesen konnte. »Er hat keine offensichtlichen Verletzungen, die auf einen Kampf hindeuten.«
Der andere blies in seine Hände und trat von einem Fuß auf den anderen. Die beiden wollten nach Hause. Ich auch.
Vangelis kannte keine Gnade: »Wo ist er ins Wasser gefallen? Irgendeine Theorie? Vielleicht sogar schon eine Spur?«
»Keine Theorie«, brummte Dick, der Wortführer, und wandte sich demonstrativ zum Gehen. »Und wir haben noch selten eine so gut eingeweichte Wasserleiche gesehen.«
Ich gab Anweisung, die Umgebung des Fundorts abzusperren, damit die Spurensicherer sich bei Tageslicht noch einmal genauer umsehen konnten. Zwei erschrockene Schupos wurden zum Wacheschieben verdonnert. Ein dunkler Kombi kam, zwei bullige, Kaugummi kauende Kerle in schwarzen Anzügen wuchteten den schweren Körper mit Hauruck in einen Zinksarg, schraubten mit tausendfach geübten Bewegungen den Deckel darauf und verschwanden so rasch, wie sie gekommen waren. Das Ganze wirkte wie ein Sondereinsatz der Stadtreinigung.
»Mir ist kalt«, sagte Vangelis endlich. »Ich denke, hier gibt es nichts mehr zu tun.«
»Ich hau mich nochmal in die Falle.« Balke saß schon auf seinem Rad. »Bis später dann.«
Inzwischen war es halb sechs. Im Osten graute der Morgen. Mir graute vor dem Tag.
Punkt neun Uhr, noch vor der täglichen Morgenbesprechung mit den Dezernatsleitern, trafen wir in meinem Büro wieder zusammen. Balke hatte schon ein wenig telefoniert und sich beim Wasser- und Schifffahrtsamt über Strömungsgeschwindigkeiten des Neckars, Betriebszeiten der Schleusen und dergleichen schlau gemacht.
»Wenn es stimmt, dass die Leiche mindestens vierundzwanzig Stunden im Wasser gelegen hat, dann müsste sie irgendwo zwischen der Schleuse und Ziegelhausen reingefallen sein.«
»Er könnte eine Weile irgendwo festgehangen haben.« Auch heute trug Vangelis wieder eines ihrer sensationellen maßgeschneiderten Kostüme. Wie ich wusste, schneiderte sie ihre Sachen zum größten Teil selbst, nachdem sie zuvor in irgendeiner teuren Boutique den Schnitt eines Edelschneiders analysiert hatte. Es schien nicht vieles zu geben, was Vangelis nicht konnte. Vor kurzem hatte ich Balke im Vertrauen gefragt, ob seine Kollegin nicht wenigstens eine einzige kleine Macke habe.
»Ihre Macke ist, dass sie keine hat«, hatte er ernst geantwortet. »Deshalb traut sich ja auch kein Kerl an sie ran. Die Frau ist einfach zu perfekt. Wer will sich so was antun?«
»Wir sollten gleich ein paar Kollegen losschicken. Die Ufer im entsprechenden Bereich müssen gründlich abgesucht werden«, schlug Balke vor.
»Ich habe eine Pressemeldung veranlasst, mit Foto«, berichtete ich. »Früher oder später wird ihn irgendwer vermissen. Und vielleicht hat ja auch jemand in letzter Zeit etwas Verdächtiges beobachtet.«
Balke lehnte sich entspannt zurück. »Ich tippe auf Selbstmord oder Unfall. Mein Gefühl sagt mir, mit dem haben wir nicht viel Arbeit.«
Ich sah Vangelis an. »Wann ist mit den Ergebnissen der Obduktion zu rechnen?«
»Frühestens am späten Nachmittag«, erwiderte sie mit Blick in ihr ledergebundenes Notizbüchlein. »Und an Selbstmord oder Unfall glaube ich eher nicht.«
»Warum?«, fragten Balke und ich gleichzeitig.
»Ich habe vorhin mit dem Arzt telefoniert, der letzte Nacht dort war. Der Tote hatte kein Wasser in der Lunge. Er hat schon nicht mehr geatmet, als er in den Neckar fiel«, erklärte sie uns mit diesem leisem Lächeln, für das ich sie manchmal hasste. »Außerdem habe ich mir seine Sachen angesehen. Reich war er nicht. Aber auch nicht arm. Die Fingernägel lassen den Schluss zu, dass er eher mit dem Kopf gearbeitet hat als mit den Händen.«
»Was war in seinen Taschen?«
Sie zog eine Braue hoch und zählte auf: »Ein halbes Päckchen Kaugummi, Minzgeschmack, zuckerfrei. Ein Kassenbon von einer Tankstelle in Mosbach. Der hat leider sehr gelitten im Wasser. Die Kollegen in der Kriminaltechnik versuchen gerade, ihn wieder lesbar zu machen. Und dann war in der Innentasche des Jacketts noch eine Viererkarte der Straßenbahn. Zwei Fahrten sind abgestempelt. Beide vor über einer Woche.« Sie sah auf. »Kein Portmonee, keine Schlüssel, absolut nichts, was uns einen Hinweis auf seine Identität geben könnte.«
»Außer dem Bon von dieser Tankstelle«, sagte ich langsam. »Haben die heute nicht alle Überwachungskameras? Die Bänder sollten wir uns vielleicht mal ansehen. Da müsste er ja drauf sein.«
Ich weiß nicht, warum mir genau in diesem Augenblick das Schlosshotel in Heinsheim einfiel, wo Sören Kriegel in seiner Todesnacht ein Zimmer gemietet haben sollte. Mosbach lag auf dem Weg dorthin.
»Die Tankstelle übernehme ich«, erklärte ich kurz entschlossen. Ich brauchte unbedingt frische Luft. Den Papierkram konnte ich ebenso gut am Nachmittag erledigen.
3
Während der Fahrt fing es wieder an zu regnen. Der Wind war stärker geworden, und bald lief der Scheibenwischer auf Hochtouren. Schon hinter Ziegelhausen musste ich das Licht einschalten. Östlich von Eberbach wurde das Tal offener, die Straße breiter, und ich konnte ein wenig schneller fahren. Versuchsweise wählte ich Theresas Nummer. Aber ihr Handy war immer noch ausgeschaltet.
Eine Weile behinderte mich ein langsam fahrender Lkw, der erst kurz vor Mosbach nach Obrigheim abbog, um vermutlich beim dortigen Kernkraftwerk, das seit einigen Monaten im Zuge des Atomausstiegs stillgelegt war, seine Fracht abzuladen.
Kurze Zeit später verließ auch ich die Bundesstraße und überquerte die Brücke. Die Aral-Tankstelle, wo unsere unbekannte Wasserleiche vor ziemlich genau sechzig Stunden Halt gemacht hatte, befand sich rechts, wenige hundert Meter vor dem Ortseingang. Ich parkte im überdachten Bereich und betrat das Gebäude, das man früher Kassenhäuschen genannt hätte, das aber, wie heute üblich, ein mittlerer Supermarkt war. Kaffeeduft empfing mich.
Ich musste einige Minuten warten, bis ich an der Reihe war. Vor mir stand eine stramme Kastanienbraune, die sich von ihren drei lautstark um Süßigkeiten bettelnden Kindern nicht aus der Ruhe bringen ließ. Es gab ein Problem mit ihrer EC-Karte. Als sie endlich bezahlt hatte und mit ihrem quengelnden Tross abgezogen war, erklärte ich dem südländisch aussehenden jungen Mann an der Kasse mein Anliegen und zeigte ihm die technisch aufgebesserte Kopie des Kassenzettels aus den Taschen unseres unbekannten Toten.
»Stimmt, der ist von uns.« Er gab mir das Papier zurück. »Zweiter Februar, das war vorgestern.«
»Wenn ich richtig lese, nachts gegen halb zwölf. Waren Sie zu dieser Zeit zufällig hier?«
Grinsend schüttelte er den Kopf. »Die Nachtschicht macht immer der Egon. Der ist Rentner und kann nachts sowieso nicht schlafen. Da ist auch nicht so viel los hier.«
»Könnte ich Ihren Kollegen sprechen? Vielleicht kann er sich ja an den Kunden erinnern.«
Er grinste immer noch. »Vergessen Sie’s. Egon erinnert sich nie an irgendwas. Ist schon über siebzig. Aber zuverlässig und relativ ehrlich.«
»Ich habe gesehen, Sie haben Videokameras da draußen. Könnte ich mir das entsprechende Band anschauen?«
»Klar.« Er griff nach einem Handy, das neben der Kasse lag. »Muss aber den Chef holen. Da hat nur er den Schlüssel.«
»Ist im Anmarsch«, erklärte er wenig später. »Dauert ein paar Minuten. Wohnt ganz in der Nähe.«
Die Uhr zeigte Viertel nach elf. Draußen rauschte der Regen, und es war inzwischen so dunkel, als begänne demnächst Egons Schicht. Ich zählte ein paar Münzen auf den Tisch und bestellte einen doppelten Espresso.
Der Besitzer der Tankstelle sah aus wie ein alter Weinbauer, dem das Herumkraxeln auf den steilen Neckarhängen zu mühselig geworden war. Sein Gesicht war wettergegerbt, die Hände schwielig und mit schwarzen Rändern an den Nägeln. Stumm und mit beängstigender Kraft drückte er meine Hand.
Nachdem auch er einen langen Blick darauf geworfen hatte, reichte er mir das Papier wortlos zurück. Dann sah er eine Weile mit tausendfach gerunzelter Stirn auf einen Kalender an der Wand. Dort tat eine Blondine so, als machte es ihr Spaß, sich unbekleidet auf der Motorhaube eines Ferrari zu räkeln. Vielleicht hatte er das Februar-Foto noch nicht gesehen. Schließlich winkte mir der alte Mann im ölverschmierten Blaumann, ihm zu folgen. Seine knappe Geste ließ mich vermuten, dass er einen gut erzogenen Hund hatte.
Weder er noch sein Angestellter wunderte sich im Geringsten darüber, dass die Polizei sich für die Überwachungsbänder der Tankstelle interessierte. Durch eine Tür am Ende des Zeitschriftenregals betraten wir einen überraschend großen Raum. Neonröhren flackerten sirrend auf. Es stank nach Lösungsmittel und Räucherwurst. In einem weiß lackierten Stahlregal an der linken Wand standen zwei Videorekorder übereinander. Daneben etwa zwanzig durchnummerierte Kassetten. Mit sicherem Griff wählte er eine aus, schob sie in den Schlitz des unteren Geräts und ließ die Kassette vorspulen.
Da ich den Zeitpunkt anhand des Kassenzettels genau kannte, dauerte es nicht einmal fünf Minuten, dann sah ich unsere Wasserleiche in lebendigem Zustand aus einem weißen, nicht mehr ganz neuen Mercedes der S-Klasse steigen. Das Kennzeichen war gut zu erkennen. Am unteren Rand des Bilds lief die Uhrzeit mit. Die Aufnahme war zeitlich stark gerafft, die Kamera machte nur alle zwei Sekunden ein Bild. So tankte der Unbekannte mit Slapstickgeschwindigkeit, verschwand für Augenblicke und stieg wieder ein.
»Spulen Sie bitte nochmal zurück?«
Ich hatte mich nicht getäuscht: Sekunden, nachdem der Mercedes an der Zapfsäule gehalten hatte, kam am oberen Bildrand ein anderes Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrer hatte die Scheinwerfer ausgeschaltet, bevor der Wagen ins Sichtfeld der Kamera kam. Sobald der Mercedes verschwunden war, flammten auch die Lichter des anderen Autos wieder auf, und es fuhr ebenfalls davon. Leider waren weder Typ noch Kennzeichen zu erkennen.
»Dürfte ich das Band mitnehmen? Sie bekommen natürlich eine Quittung.«
Gleichmütig hob mein Begleiter die Schultern und drückte den Eject-Knopf.
»Was hat er angestellt?«, fragte er, als er mir die Kassette in die Hand drückte. Es waren die ersten Worte, die ich von ihm hörte. Sein Atem roch nach schwarzem Tabak und Kräuterlikör. »Hat er einen umgebracht?«
»Im Gegenteil. Möglicherweise hat man ihn umgebracht.«
»Ach was«, brummte er, als würden täglich Kunden seiner Tankstelle gewaltsam ums Leben kommen.
Ich warf die Videokassette auf den Beifahrersitz und gab das Kennzeichen des Mercedes per Handy nach Heidelberg durch. Bald war ich wieder auf der Bundesstraße in Richtung Süden unterwegs. Der Regen hatte nicht nachgelassen. Meine Scheibenwischer arbeiteten wütend gegen die Wassermassen an.
Aus den Zwölf-Uhr-Nachrichten im Radio erfuhr ich, dass einer der beiden flüchtigen Gewalttäter inzwischen wieder hinter Gittern saß. Er hatte sich nach wenigen Kilometern im Geräteschuppen eines Winzers versteckt und frierend gewartet, bis ihn jemand fand. Es war derjenige, der seine armen Nachbarn zerstückelt hatte. Laut Aussage eines Arztes hatte der Mann einen IQ am Rande der Schwachsinnigkeit, und war offenbar nur geflohen, weil sein Zimmergenosse es ihm vorgemacht hatte. Der zweite Ausbrecher war dagegen wesentlich intelligenter und befand sich nach wie vor auf der Flucht. In der Nacht des Ausbruchs war in der Nähe von Weinsberg ein hellblauer Rover verschwunden, und die Heilbronner Kollegen vermuteten, er sei mit diesem Fahrzeug unterwegs.
Fürs Wochenende versprach der Wetterbericht Aufheiterung.
Eine Viertelstunde später stellte ich meinen Peugeot vor dem Eingang des Schlosshotels Heinsheim ab. Bis auf einen roten Golf war der Parkplatz leer, anscheinend herrschte derzeit nicht viel Betrieb. Ich lief wenige Meter durch den Sturzregen und betrat das von warmem Licht beleuchtete Entree des großen, zweigeschossigen Schlossgebäudes. Man hatte gut geheizt, gediegene alte Möbel verbreiteten Behaglichkeit. Selbst eine Ritterrüstung fehlte nicht. An der Rezeption studierte eine schmale dunkelhaarige Frau mittleren Alters handbeschriebene Formulare und tippte hin und wieder etwas in ihren Computer. Sie nahm ihre zierliche Brille ab und strahlte mich mit jener professionellen Herzenswärme an, die man als Gast eines teuren Hotels erwarten kann.
Beim Anblick meines Dienstausweises schaltete sie ihr Lächeln zwei Stufen herunter.
»Kriminalpolizei?« Verwundert reichte sie mir das Kärtchen zurück. »Was kann ich für Sie tun?«
»Nichts Aufregendes. Ich würde nur gerne wissen, ob im Juli letzten Jahres ein bestimmter Gast hier übernachtet hat.« Ich nannte ihr Namen und Datum. Ihr Parfüm war eine Nuance zu aufdringlich für ihre zerbrechlich wirkende Figur.
»Fünfter auf sechster Juli, sagen Sie?« Offensichtlich war sie unsicher, wie sie sich verhalten sollte. »Also eigentlich …«
»Eigentlich dürfen Sie das nicht, ich weiß. Nicht ohne richterlichen Beschluss und so weiter. Deshalb habe ich mir ja die Mühe gemacht, persönlich vorbeizukommen. Der Mann, um den es geht, ist in jener Nacht hier ganz in der Nähe ums Leben gekommen, und wir vermuten, dass er sich hier einquartiert hatte. Ein kurzer Blick in Ihren Computer, und schon sind Sie mich wieder los.«
»Ums Leben gekommen?« Erschrocken starrte sie mich an. »Was heißt das denn?«
Ich klärte sie über die Umstände von Sören Kriegels Tod auf.
»Ach so. Hm.« Betreten sah sie wieder auf den Bildschirm. Ihre Finger spielten an der Tastatur. »Ich rufe vielleicht doch lieber mal den Chef.«
Dies war eine sehr schlechte Idee gewesen, wie ich rasch feststellen musste. Herr Habicht trug einen perfekt sitzenden dunklen Anzug und dazu eine silbergraue Krawatte, hatte eine zum Namen passende Nase und offenbar keine gute Meinung von Polizisten, die in seinem ehrenwerten Haus herumschnüffelten.
»Ein Hotel wie das unsere lebt vom Vertrauen seiner Gäste«, erklärte er mir streng und sah auf den Computermonitor, als müsste er sich vergewissern, dass dort nichts fehlte.
»Selbstverständlich werde ich Ihre Informationen streng vertraulich behandeln. Sie werden in keiner Akte erwähnt werden.«
»Darf ich das so verstehen, dass Sie nicht in offizieller Mission hier sind?«, fragte er mit einem gierigen Raubvogelblick.
»Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Herr Kriegel bei einem Verkehrsunfall ohne Fremdverschulden ums Leben kam. Aber nun gibt es plötzlich gewisse Hinweise, dass der Fall etwas komplizierter liegt.«
Ich versuchte, mir mit meinem Dienstausweis ein wenig Autorität und Vertrauen zu verschaffen. Herr Habicht studierte ihn mit entnervender Ausdauer, verglich sogar das Foto mit meinem Gesicht. Die Bewegung, mit der er mir das Kärtchen schließlich zurückgab, kam einer Verabschiedung gleich.
»Tut mir Leid, aber Sie müssen bitte verstehen …«
Frustriert zupfte ich einen Hausprospekt aus einem schmiedeeisernen Ständerchen. Vielleicht würde ich einmal anrufen, wenn Herr Habicht nicht im Haus war.
Kurz vor Neckargemünd hörte der Regen schlagartig auf, und als Heidelberg wieder in Sicht kam, blitzten mir die Türme und Dächer der Altstadt in einer silbernen Sonne entgegen, dass ich die Augen zukneifen musste. Inzwischen war es schon nach eins. Ich war hungrig und hatte schon wieder Lust auf Kaffee.
»Der Name des Toten ist Dean Morris McFerrin«, berichtete mir Klara Vangelis, die ich auf der Treppe traf. »Sechsundvierzig Jahre alt, hat in Kirchheim draußen gewohnt. Das ist ein Vorort im Südwesten«, fügte sie hinzu, als sie meinen fragenden Blick bemerkte.
»Ist schon jemand in seiner Wohnung?«
»Die Spurensicherung ist seit einer Stunde draußen. Sie müssten bald fertig sein. Ich bin auf dem Sprung.«
Ende der Leseprobe