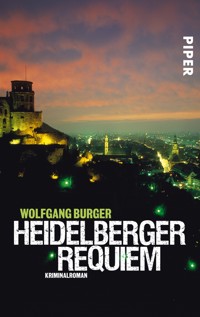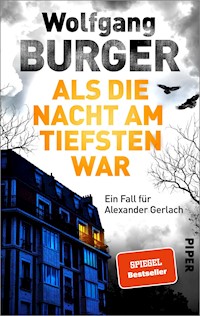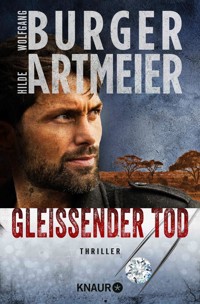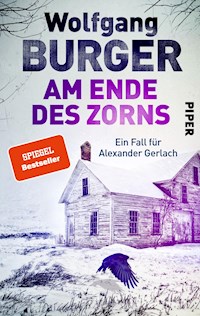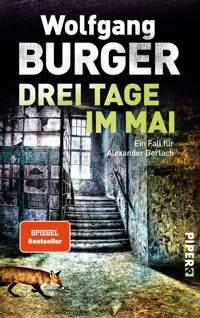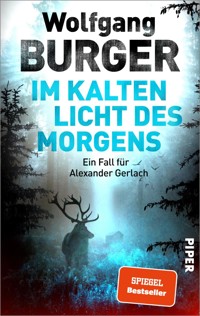
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wir feiern Jubiläum: Kultermittler Alexander Gerlach löst seinen 20. Fall! »Dass die Gerlach-Reihe zu den erfolgreichsten deutschsprachige Krimiserien zählt, kommt nicht von ungefähr: Der Heidelberger Ermittler ist kein unglaubwürdiger Superheld, sondern ein Mann aus dem Leben, mit allzu menschlichen Schwächen. Vor allem das macht ihn so beliebt.« Rhein-Neckar-Zeitung Auch Gerlachs 20. Fall hat es in sich: Am frühen Morgen stolpert Alexander Gerlach beim Joggen im Wald über die Leiche einer jungen Frau. Kurz darauf ist die Tote verschwunden, dafür liegt ein bewusstloser Unbekannter neben der Fundstelle. Haben die beiden Fälle etwas miteinander zu tun? Gerlach muss zeitgleich verschiedenen Spuren folgen, während sein Privatleben aus dem Ruder zu laufen droht: Seine Tochter ist plötzlich nicht mehr erreichbar. ----- Wolfgang Burgers Krimireihe um den Heidelberger Kripochef Alexander Gerlach fand 2005 ihren Anfang im Piper Verlag und erobert regelmäßig die SPIEGEL-Bestsellerliste. Aus der deutschen Krimilandschaft ist der sympathische Ermittler nicht mehr wegzudenken. ----- Lieber Herr Burger, nun »kennen« Sie Ihren Ermittler Alexander Gerlach schon seit vielen Jahren. Gibt es Charakterzüge an ihm, die Sie nicht mögen? »Nein, eigentlich nicht. Oder vielleicht doch: Er sollte ein wenig besser auf sich aufpassen. Er arbeitet sich zunehmend kaputt, ist inzwischen ja auch schon über fünfzig und zu seinem Ärger längst nicht mehr so belastbar wie früher. In letzter Zeit überlegt er immer öfter, ob Polizist wirklich noch der richtige Beruf für ihn ist. Das finde ich nicht gut, und ich versuche, es ihm auszureden.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Im kalten Licht des Morgens« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Annika Krummacher
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
Wie jeden Morgen musste ich mich auch heute wieder zwingen, langsamer zu laufen. Die Gerüche und Geräusche der erwachenden Natur wahrzunehmen, dem zaghaften Gesang der ersten Vögel zu lauschen, statt nur blind und taub durch die Landschaft zu hetzen. Im Moment war es noch angenehm kühl, aber in wenigen Minuten würde die Sonne aufgehen, und dann würde es wieder zügig warm werden. Seit Anfang Juli war kein Tropfen Regen mehr gefallen, und auch für heute hatte der Wetterbericht einen wolkenlosen Himmel und tropische Temperaturen angekündigt. Zwischen den Kiefern und Birken des Hardtwalds hing ein zarter Morgendunst, die Luft war noch klar und rein, und wären nicht unentwegt diese finsteren Gedanken in meinem Kopf herumgegeistert, hätte ich glücklich sein können. Ein schöner, gemütlich kurviger Weg am Bach entlang, hie und da Blümchen, ein Amselmännchen, das aus voller Kehle zu tirilieren begann, als wäre es mir zu Ehren.
»Pass doch auf, Arschloch«, maulte mich ein Radfahrer an, der mich auf dem weiß Gott nicht übertrieben schmalen Weg überholte. Verschwitzt, mit der verbissenen Miene der Kampfbiker, die glaubten, ihnen gehörte die Welt.
»Selber Arschloch!«, rief ich und sprang erschrocken zur Seite, obwohl er schon vorbei war.
Der Rüpel trug nicht die bunte Uniform der Flachland-Mountainbiker, sondern steckte in weißen Shorts und einem grauen T-Shirt. Mitte dreißig, schätzte ich, drahtige Statur, kurz geschnittenes dunkelblondes Haar, kein Helm, und auch sein Rad war keines dieser sündteuren Hightech-Geräte, auf denen viele Hobbyradler heutzutage ihrer Leidenschaft frönen. Schon war er um die nächste Kurve verschwunden, und ich hatte den Wald wieder für mich allein. Ich trabte weiter und ärgerte mich, weil mir keine originellere Beleidigung eingefallen war. So etwas wie »hirnamputierter Drahtesel-Torero« vielleicht.
Nebenbei ärgerte ich mich auch darüber, wie viel achtlos weggeworfenes Zeug das idyllische Bild verschandelte. Leere Bierdosen sah ich am Wegrand, Pappbecher, Papiertaschentücher, zerknülltes Butterbrotpapier. In einer Ecke des Parkplatzes bei den Spargelhöfen, wo mein Wagen stand, hatte ich großzügig bemessene Müllcontainer gesichtet. Da könnten die Leute doch eigentlich …
Aber nein, ich wollte mich jetzt nicht ärgern.
Sogar eine hübsche Sandalette mit hohem Absatz und Glitzersteinchen sah ich im Vorbeilaufen im Sand liegen. Schuhwerk, wie meine Mädchen es früher trugen, wenn sie am Samstagabend loszogen, um sich, viel zu verwegen geschminkt, ins Heidelberger Nachtleben zu stürzen.
Allmählich kamen meine Muskeln auf Betriebstemperatur, ich fand meinen Rhythmus, mein Atem ging ruhig und gleichmäßig. Doch die verlorene Sandalette ließ meinem Polizistenhirn keine Ruhe. Vielleicht, weil sie mich an meine Töchter erinnerte. Als Kriminaler denkt man ja immer gleich das Schlimmste. Wie mochte das Schühchen dorthin gekommen sein, wo es jetzt lag? Ich drehte einen U-Turn und lief zurück in Richtung Fundstelle.
Und was war wohl aus der Frau geworden, die den Schuh verloren hatte?, fragte ich mich. War eines der zarten Riemchen gerissen, und sie hatte den unbeschädigten Schuh in die Hand genommen, um auf Strümpfen weiterzugehen? Oder hatte jemand sie bis zum Auto getragen? Nicht weit von hier verlief die Bundesstraße. Jetzt, am frühen Sonntagmorgen, hörte ich nur selten ein Auto vorbeirauschen.
Ich verlangsamte meine Schritte, blieb schließlich stehen. Auch hier schwebte die hauchdünne Nebelschicht über dem friedlich gurgelnden Bach und dem taufeuchten Gras seiner Böschung.
Ich nahm die Sandalette in die Hand. Sie war völlig unbeschädigt und, wie es aussah, noch so gut wie nie getragen. Warum hatte die Besitzerin sie zurückgelassen? Alkohol? Drogen? Albernheit? Ratlos sah ich mich um. Rechts der Bach, links Wald, Kiefernwald mit wenig Unterholz und … was war das? Etwas lag auf der Erde, vielleicht zwanzig Schritte von mir entfernt. Ein Müllsack? Ein Pärchen, das nach einer Runde Freiluftsex selig eingeschlafen war?
Ich ließ das Schuhwerk fallen. Die herrinnenlose Sandalette, das merkwürdige Bündel unter den Bäumen …
Es war eine Frau, erkannte ich, als ich nur noch wenige Meter entfernt war. Eine schmale, vermutlich junge Frau mit nur noch einem Schuh. Sie lag auf dem Bauch. Mittelblondes langes Haar, ein metallisch schimmerndes Kleidchen am grazilen Körper. Der kurze Rock war ein wenig hochgerutscht und legte einen knappen weinroten Slip frei. Ein silbernes, zum Kleid passendes Handtäschchen lag neben ihr auf verdorrten spitzen Kiefernnadeln, der dünne Tragriemen hing noch an ihrem linken Arm. Die Nägel der schmalen Mädchenfinger waren blutrot lackiert und mit Flitter verziert. Kein Schmuck an den Händen, nichts an den Handgelenken.
Sorgsam darauf achtend, wohin ich trat, umrundete ich den leblosen Körper. Keine Spuren vernichten, ein Automatismus, der sich über Jahrzehnte in meinem Kopf festgefressen hatte. Beine und Arme waren ausgestreckt, als wäre sie im vollen Lauf gestürzt und aufs Gesicht gefallen. Spuren hin oder her, ich musste feststellen, ob die junge Frau noch lebte. Ob ich einen Rettungswagen rufen musste oder die Kollegen vom Kriminaldauerdienst.
Mit einem Mal fröstelte mich. Eine Gänsehaut überzog meine bloßen Arme. Das Morgenlicht schien jede Farbe verloren zu haben. Versprach plötzlich keinen heißen Sommertag mehr, sondern Frost.
Immer noch sorgfältig darauf achtend, wohin ich meine Füße setzte, näherte ich mich dem Körper.
Ging in die Hocke.
Fühlte am Hals.
Kein Puls.
Und soweit ich feststellen konnte, auch keine Atmung.
Die Frau reagierte weder auf Ansprache noch auf vorsichtiges Schütteln an der Schulter. Der Slip saß dort, wo er zu sitzen hatte, demnach hatte ich es hier wohl nicht mit einem Sexualdelikt zu tun. Soweit ich erkennen konnte, keine äußeren Verletzungen, keine Anzeichen von Gewalteinwirkung. Oder doch? Als ich ihren Kopf ein wenig zur Seite drehte, sah ich Blut an dem scharfkantigen Stein, auf dem sie mit der Stirn aufgeschlagen war. Wenig nur, aber es war eindeutig Blut. Und es war noch feucht. Der Körper war warm. Sie konnte noch nicht lange hier liegen.
Sollte ich sie umdrehen, um ganz sicher zu sein, dass sie nicht mehr lebte? Dass hier wirklich nichts mehr zu retten war?
Noch einmal tastete ich nach dem Puls.
Immer noch nichts.
Stöhnend richtete ich mich auf, und in diesem Moment erst wurde mir bewusst, dass die Vögel nicht mehr sangen. Für Sekunden war es vollkommen still, und ich hörte nur das Hämmern meines eigenen Herzschlags.
Ich entfernte mich rückwärts von der Toten, versuchte, meine Füße an die Stellen zu setzen, wo ich vorher schon hingetreten war. Dort, wo ihre Füße lagen, sah ich jetzt, war der Boden aufgewühlt. Fußabdrücke, die nicht von ihren zierlichen Sandaletten stammten.
Ich musste beide anrufen, wurde mir klar, als ich in die Gürteltasche fasste, wo normalerweise mein Handy steckte, die Rettung und meine Kollegen. Allerdings war da kein Handy. Der Akku meines Smartphones war wieder einmal leer gewesen, als ich es vorhin einstecken wollte. Von Tag zu Tag verlangte das blöde Ding öfter nach einer Steckdose. Reparieren könne man es nicht, hatte mir vor einigen Tagen ein pickliger Schnösel im Handyshop erklärt. Und das Fossil von einem Smartphone, das ich ihm entgegenhielt, sei es auch nicht wert, eine Reparatur ins Auge zu fassen. Außerdem habe er gerade heute ein sensationelles Angebot hereinbekommen …
Es half nichts, ich musste zum Auto zurück.
Dazu musste ich allerdings die Tote vorübergehend ohne Aufsicht lassen, was mir sehr widerstrebte. Wer konnte wissen, was in den zehn Minuten geschehen würde, die ich weg war? Ein Hund konnte sich an der Leiche zu schaffen machen, ein Perverser, Krähen, ein Fuchs.
Da! Ein Geräusch, das Quietschen einer Fahrradbremse.
Ein älterer Mann stieg gerade von seinem Rad. Etwas unbeholfen, da er wohl nicht mehr der Fitteste war. Doch er hielt ein Mobiltelefon in seiner Rechten. Diesen Kerl schickte mir zweifellos der Himmel.
Ich lief auf ihn zu, er hob den Blick, starrte mich durch seine dicke, klotzig schwarz gerahmte Brille an, als wäre ich ein Alien, der soeben vom Himmel gefallen war. Seine widerspenstigen Haare waren grau und leicht gelockt. Offenbar hatte er nicht damit gerechnet, hier um diese Uhrzeit jemanden anzutreffen. Er ließ sein noch relativ neu wirkendes Rad einfach fallen.
»Gut, dass Sie da sind!«, keuchte ich. »Dürfte ich kurz Ihr Handy benutzen? Ich bin Polizist, und es ist etwas Schlimmes passiert.«
Aus der Nähe wirkte er nicht ganz so alt, wie ich im ersten Moment gedacht hatte. Vermutlich war er nur ein wenig älter als ich. Er steckte in einem hellgrauen Anzug, der ihm zu groß war. Sein trauriger Bernhardinerblick und die fahle, eingefallene Haut ließen mich vermuten, dass er kein besonders komfortables Leben führte.
Er sah mir verständnislos ins Gesicht, dann auf sein Smartphone und schließlich wieder auf mich. Jetzt erst entdeckte er den Körper, der einige Meter von uns entfernt am Boden lag. Seine Augen wurden groß, seine Miene verfinsterte sich.
»Ihr Handy«, sagte ich eindringlich. »Dürfte ich bitte?«
Als ich die Hand nach dem Gerät ausstreckte, drückte er es an seine Brust, als fürchtete er, ich wollte es ihm wegnehmen.
»Ich bin Polizist«, sagte ich zum zweiten Mal und allmählich ein wenig gereizt. »Hier ist ein Verbrechen geschehen, und …«
»Polißei?«, wiederholte er undeutlich, und jetzt erst begriff ich, dass er kein Deutsch verstand.
»Sprechen Sie Englisch? Do you speak English?«
»A little«, murmelte er, während er starr auf die junge Frau am Boden blickte. »Very little.«
»Could I use your cellphone please?«
Keine Reaktion. Der Kerl wirkte, als stände er unter Drogen. Oder unter Schock. Die goldene Uhr an seinem breiten Handgelenk zeigte halb sechs. Die Zeit verrann, und ich … ich hätte schreien können.
»Just for one single call«, drängte ich.
Nichts. Ich verspürte große Lust, ihm das Ding einfach zu entreißen. Aber vermutlich brauchte man eine PIN, um damit telefonieren zu können.
Plötzlich löste sich seine Erstarrung, er ließ mich einfach stehen, trat mit festen Schritten näher an die Tote heran, betrachtete sie mit gerunzelter Stirn, bückte sich sogar, wollte offenbar ihren Kopf drehen, um das Gesicht zu sehen.
»Nicht!«, rief ich. »Nicht anfassen!«
Jetzt schien er sich zu erinnern, dass es mich auch noch gab.
»What?«, fragte er heiser. »What happened?«
»I don’t know. I want to call the police, do you understand?«
Nein, er verstand nicht. Ich musste also doch zum Auto zurück, und zwar so schnell wie möglich. Hoffentlich machte der alte Trottel hier in der Zwischenzeit keinen Unsinn.
»You stay here, okay?« Ich deutete mit beiden Händen auf den Boden. »You don’t touch the body. I will be back in one minute.«
Wieder keine Reaktion. War der Mann blöde? Was hatte er nur für ein Problem? Ich deutete auf seine Füße.
»You! Stay! Here! You do not move, okay? And you do not touch the body.«
Einfältiges Nicken. Es war hoffnungslos. Und ich hatte keine Zeit mehr, mich noch länger mit ihm herumzuärgern.
So ließ ich den begriffsstutzigen Deppen notgedrungen stehen und machte mich auf den Weg zum Parkplatz. Dieses Mal zwang ich mich nicht, langsam zu laufen.
Als ich gut zehn Minuten später restlos außer Atem zu der Stelle zurückkehrte, wo ich die Tote gefunden hatte, lag das Fahrrad des Alten noch da, wo er es hatte fallen lassen. Der trottelige Besitzer hingegen stand nicht mehr dort, wo ich ihn verlassen hatte, sondern – ich traute meinen Augen nicht – lag ungefähr dort, wo sich eben noch die junge Frau befunden hatte. Und diese war … verschwunden, inklusive ihrer beiden Sandaletten.
Hatte sie das Bewusstsein wiedererlangt und das Weite gesucht? Hatte der Alte ihr auf die Beine geholfen, und sie hatte ihn zum Dank niedergeschlagen?
Ich stieß einen ebenso herzhaften wie lauten Fluch aus. Und gleich noch einen. Ein Schwarm Spatzen stob empört zeternd davon.
2
Der Rettungswagen kam nach einer gefühlten Ewigkeit, die Kollegen vom KDD ließen sich sogar noch mehr Zeit. Immerhin hatte jemand daran gedacht, gleich die Spurensicherung mitzubringen.
Zwischenzeitlich hatte ich zu meiner Erleichterung festgestellt, dass der Alte noch lebte. Er hatte eine klaffende Wunde am Hinterkopf, offenbar mithilfe eines kräftigen Holzstücks beigebracht, das gleich danebenlag.
Als Erstes musste nun natürlich der Verletzte versorgt werden.
»Heftiger Schlag mit stumpfem Gegenstand«, diagnostizierte der schmale, fast noch knabenhafte Arzt mit struppigem Haar und viel zu großen Händen. »Nach dem ersten Augenschein hat der Täter sogar mehrfach zugeschlagen.«
»Ich nehme an, mit dem Knüppel da.« Ich deutete auf die mutmaßliche Tatwaffe.
»Ich sehe Moos und Rindenstückchen in der Wunde«, fuhr der Arzt fort, als hätte er mich nicht gehört. »Offenkundig hat das Opfer eine schwere Schädelfraktur. Möglicherweise Einblutungen unter die Dura, Vitalfunktionen nur noch schwach.« Er richtete sich auf, wandte sich an mich. »Der Mann muss umgehend in die Klinik. Es besteht akute Lebensgefahr.«
Sekunden später lag der Verletzte auf einer Trage und wurde von zwei Sanitätern im Laufschritt zum Rettungswagen geschafft, der nur etwa hundert Meter von hier am Rand der Bundesstraße 291 parkte. Ich sah das Blaulicht zwischen den Bäumen zucken.
»Geht’s Ihnen gut, Chef?«, fragte Oberkommissarin Laila Khatari besorgt, eine junge Kollegin, die das Pech hatte, Wochenenddienst zu haben. Als ich nur die Achseln zuckte, fuhr sie fort: »Um ehrlich zu sein, Sie sehen furchtbar aus. Entschuldigen Sie, wenn ich das einfach so sage, aber … Sie haben abgenommen, gell?«
Die Kollegin hatte mich eine Weile nicht mehr gesehen, da ich seit Mai krankgeschrieben war.
»Ich mache viel Sport«, antwortete ich missmutig. »Ich jogge jeden Morgen meine zehn, zwölf Kilometer, versuche mich gesund zu ernähren …«
»Man kann alles auch übertreiben, Chef.«
Sie hielt die Tatwaffe in der latexbehandschuhten Rechten, hob sie hoch, um sie mir zu zeigen. »Hat ein Gewicht wie ein Baseballschläger.«
Das Beweismittel wurde sachgerecht verpackt, bevor ich es in die Hand nehmen durfte. Die Sirene des Rettungswagens jaulte auf. Das Tatütata entfernte sich rasch. Hoffentlich kam der Verletzte bald wieder zu sich. Ich brannte darauf zu erfahren, was hier während meiner kurzen Abwesenheit geschehen war.
»Und hier hat echt eine tote Frau gelegen?«, fragte ein älterer Kollege zweifelnd. »Vielleicht ist sie gar nicht tot gewesen, hat den Typ im Anzug kommen sehen, hat’s mit der Angst gekriegt und ihm eins übergebraten …«
»Sie war tot«, fiel ich ihm barsch ins Wort. »Glauben Sie mir, ich bin lange genug beim Verein, um das beurteilen zu können. Und wenn sie wirklich nur scheintot gewesen sein sollte, dann war sie bestimmt nicht in der Verfassung, um aufzuspringen und einen Knüppel zu suchen … Nein, vergessen Sie’s einfach.«
»Ja, aber …« Laila kratzte sich an der Stirn. Sie trug ihr schwarzes Haar seit Neuestem knabenhaft kurz geschnitten, was ihr sehr gut stand. »Wo ist sie hin? Wer hat sie fortgeschafft? Und wozu?«
»Das sind alles sehr kluge Fragen, liebe Kollegin«, ätzte ich, wütend auf mich selbst. »Ein paar gescheite Antworten wären mir allerdings sehr viel lieber.«
Seit diesen vermaledeiten Ereignissen im Mai hatte ich mich nicht mehr im Griff. Ich war aufbrausend, geriet wegen Nichtigkeiten in Zorn, ging meinen Mitmenschen und mir selbst auf die Nerven.
»Hier sind Schleifspuren!«, rief einer der Spurensicherer, der im weißen Ganzkörper-Schutzanzug die weitere Umgebung des Tatorts absuchte. »Und Fußspuren auch. Ganz frisch noch.«
»Wohin geht’s da?«, fragte ich, jetzt wieder halbwegs beherrscht.
Wie alle, die nichts am Tatort zu tun hatten, stand ich einige Meter entfernt. Laila, die mir meinen Ausbruch nicht weiter übel zu nehmen schien, hatte schon ihr Smartphone in der Hand und hielt es mir hin.
»Wir sind hier.« Sie deutete auf das Display. »Da ist der Bach, da der Weg, auf dem Sie gelaufen sind.« Sie sprach in einem Ton voller Nachsicht und Verständnis, der mich schon fast wieder rasend machte. »Und da drüben …«, sie vergrößerte den Kartenausschnitt mit Daumen und Zeigefinger, runzelte die Stirn, »… da geht’s auf direktem Weg zur Bundesstraße, und auf der anderen Seite scheint ein kleiner Parkplatz zu sein.«
Wir rätselten eine Weile sinn- und ergebnislos herum, was hier geschehen sein mochte. Und am Ende kristallisierte sich dann doch so etwas wie eine erste Arbeitshypothese heraus: Vermutlich war der Täter, der die Frau getötet hatte, zurückgekommen, um die Leiche verschwinden zu lassen, und dabei auf den Mann getroffen, der ratlos neben der leblosen Frau stand. Der Täter hatte natürlich befürchtet, der Alte könnte ihn beschreiben, und den lästigen Zeugen mit dem herumliegenden Aststück niedergeschlagen. Anschließend hatte er sein erstes Opfer davongeschleppt, um es irgendwo zu verscharren. So schmal und klein, wie sie war, konnte die Frau nicht sonderlich schwer gewesen sein.
»Was ist mit Papieren?«, fragte ich in die Runde. »Ich erinnere mich an eine Handtasche.«
»Nichts«, erwiderte Laila. »Bis auf ein gebrauchtes Tempo und ein paar Flusen hat er nichts in den Taschen gehabt. Und die Handtasche hat der Täter wohl mitgenommen.«
Ihre Miene verriet, was sie dachte, aber nicht aussprechen mochte: Falls hier je eine Handtasche gewesen sein sollte.
»Das Handy?«, bellte ich, schon wieder auf hundert. »Vielleicht hilft uns das weiter.«
»Welches Handy?«
»Als der Mann vom Rad gestiegen ist, hat er ein Smartphone in der Hand gehabt, da bin ich mir vollkommen sicher.«
Inzwischen hatte sich der Kollege, der die Schleifspur entdeckt hatte, zu uns gesellt. Er schüttelte den Kopf.
»Da war kein Handy, Chef. Wir haben schon die ganze Umgebung abgesucht. Bis auf ein paar Kronkorken, ein Fünfzigcentstück, zwei gebrauchte Kondome und einen Haufen Hasenköttel haben wir nichts gefunden.«
Sein süßliches Aftershave verursachte mir Übelkeit. In mir kochte die nächste Aggressionswelle hoch.
Zwei Kolleginnen suchten in gebückter Haltung Zentimeter für Zentimeter die Stelle ab, wo erst die junge Frau und später der alte Mann gelegen hatten. Das Einzige, was sie bisher in Spurenbeutel verpackt hatten, waren ein abgesplittertes Stückchen von einem blutrot lackierten und mit Silberflitter verzierten Fingernagel sowie eine Reihe von künstlichen Wimpern.
Längst war die Sonne aufgegangen. In zwei, drei Stunden würde es wieder so unerträglich heiß werden wie jeden Tag. Das Klima spielte mehr und mehr verrückt. In meiner Jugend war ein Sommertag, an dem das Thermometer über dreißig Grad stieg, eine große Sensation gewesen. Man bekam schulfrei und durfte den Tag im Freibad verbringen. Inzwischen waren über dreißig Grad im Sommer die Regel und vierzig keine Seltenheit. Wo zur Hölle sollte das alles noch hinführen? Im Radio taten die Sprecher immer noch tapfer so, als wäre ein heißer Tag ein Grund zur Freude.
»War’s denn ein teures Handy?«, hörte ich Laila durch das Rauschen in meinen Ohren fragen.
Zwei Kollegen machten sich auf den Weg, um der Schleifspur zu folgen. Immer öfter hörte man jetzt auf der nahen Bundesstraße Autos fahren.
»Nein, es war ein ziemlich altes«, meinte ich mich zu erinnern. »Kein iPhone, so viel kann ich sagen.«
»Aber schon ein Smartphone, oder?«
»Vielleicht eines von diesen Chinadingern. Wenn ich richtig gesehen habe, dann hatte das Display einen Sprung.«
»Aber wer klaut denn so was?«, wunderte sich Laila. »Jeder Sechzehnjährige hat heutzutage ein besseres Handy in der Tasche.«
Ich zuckte die Achseln. Mit einem Mal übermannte mich eine Erschöpfung, als hätte ich die ganze Nacht durchgearbeitet.
»Er war Ausländer, sagen Sie?«
»Irgendwo aus dem Osten vielleicht. Ein bisschen Englisch hat er verstanden. Deutsch so gut wie gar nicht. Und ja, dem Akzent nach stammt er aus dem Osten. Oder Süden?« Ich griff mir an den Kopf. »Keine Ahnung«, gestand ich. »In dem Moment habe ich Besseres zu tun gehabt, als darüber nachzudenken, woher der Kerl kommt und was für ein Handy er in der Hand hält.«
»Er könnte zum Beispiel auch ein Türke gewesen sein?«
»Schon möglich, ja.«
»Wahrscheinlich ein Flüchtling.« Laila legte die Stirn in Falten und einen Finger ans hübsche Näschen, an dem ein weißes Glitzersteinchen im Licht der Morgensonne blitzte.
»Flüchtling darf man nicht mehr sagen«, ermahnte sie der Kollege, der die Schleifspur gefunden hatte. »Mensch mit Migrationshintergrund heißt das heutzutage. Glaub ich wenigstens.«
»Ich darf das sagen«, widersprach Laila ungerührt. »Bin schließlich selber mal ein Flüchtling gewesen.«
Vor sechsundzwanzig Jahren war sie im Irak zur Welt gekommen. Als Jesiden hatten ihre Eltern dort schon unter Saddam Hussein zu einer verfolgten Minderheit gehört. Und als ihr Töchterchen zwei Jahre alt war, hatten sie ihre Koffer gepackt, um ihrer Heimat für immer den Rücken zu kehren.
Sollte die Tote eine Prostituierte gewesen sein?, überlegte ich. Eine dieser armen jungen Frauen aus Rumänien, Bulgarien oder Moldawien, die mit blumigen Versprechungen nach Deutschland gelockt wurden, um hier dann in irgendeinem Flatrate-Bordell die Kosten der Reise und irgendwelche fingierte Gebühren abarbeiten zu müssen. In aller Regel mussten die Opfer dieser überaus profitablen Menschenverschleppung ihre Papiere und Handys abgeben. Sie sprachen kein Deutsch und hatten deshalb keine Möglichkeit, sich mit jemandem in Verbindung zu setzen, der ihnen hätte helfen können.
»Wirklich alles okay bei Ihnen, Chef?«, fragte Laila mit mütterlich besorgtem Blick.
»Es wird mit jedem Tag besser«, log ich angestrengt lächelnd. »Aber ich verabschiede mich jetzt trotzdem. Sie kommen hier allein zurecht. Viel Glück und Erfolg allerseits. Hoffen wir, dass der Mann bald zu sich kommt und keine allzu großen Gedächtnislücken hat.«
Nein, bei mir war gar nichts okay, gestand ich mir ein, als ich mit bleischweren Füßen zu meinem Citroën zurückschlurfte. Seit dem Erlebnis mit Noras Bruder, der mich in meiner Wohnung überfallen hatte, mit einer Pistole in der Hand, um mich zu töten, war mein Leben aus den Fugen geraten. Es war nicht sein erster Anschlag auf mich gewesen, aber hoffentlich der letzte. Zurzeit saß Knut Vestergaard in Untersuchungshaft im Heidelberger Gefängnis und wartete auf seinen Prozess. Nach allem, was er sonst noch verbrochen hatte, würde er vor meiner Pensionierung nicht wieder freikommen. Obwohl, ein gerissener Anwalt, ein wohlmeinender Gutachter, ein Richter, der noch an das Gute im Menschen glaubte …
Schon beschleunigte sich mein Puls wieder, und meine Hände wurden feucht.
In den ersten Tagen nach dem Zusammentreffen mit Knut dem Wahnsinnigen hatte ich ständig zwei Meter neben mir gestanden, war mehr oder weniger benebelt gewesen, hatte mich ansonsten jedoch noch ganz gesund gefühlt. Doch dann, als ich glaubte, die Sache verarbeitet und überstanden zu haben, fuhr ich eines Nachts aus einem ohnmachtsähnlichen Schlaf auf, schweißgebadet und mit rasendem Puls. Als der taffe Kerl, der ich zu diesem Zeitpunkt noch zu sein glaubte, dachte ich natürlich, das wird wieder, kein Grund zur Aufregung, es ist nur vorübergehend. Stattdessen wurde es jedoch von Tag zu Tag schlimmer. Posttraumatische Belastungsstörung, diagnostizierte mein Hausarzt, was ich ohnehin schon gewusst hatte, und empfahl mir eine Therapie. An Arbeiten war ohnehin nicht mehr zu denken gewesen, und so wurde ich offiziell krankgeschrieben. Zunächst für vier Wochen und anschließend noch einmal für vier Wochen.
Hinzu kam, dass ich auf einmal sehr einsam war. Mit Nora war ich nicht mehr zusammengekommen. Wenn wir überhaupt jemals zusammen gewesen waren. Im Grunde genommen hatte unsere Beziehung nie wirklich funktioniert, wurde mir klar, als sie mir mit einer höflich, aber distanziert formulierten Handynachricht den Laufpass gab. Und von Theresa hatte ich seit dem großen Krach Anfang Januar nichts mehr gehört. Beziehungsweise doch, aber nur auf Umwegen. Sie war inzwischen zur Bestsellerautorin mutiert, und mich hatte fast der Schlag getroffen, als ich sie eines Abends in einer TV-Talkshow sitzen und eifrig mitdiskutieren sah.
Die Verkaufszahlen ihres dritten Buchs, in dem es um das angeblich älteste Gewerbe der Welt ging, waren nach diesem Auftritt durch die Decke gegangen. Theresa vertrat hartnäckig die provokante und nicht überall konsensfähige Meinung, nicht jede Prostituierte sei ein bemitleidenswertes Opfer, das dringend aus seiner Zwangslage befreit werden müsse. Es gebe auch die andere Sorte. Brave Hausfrauen, die hin und wieder – nicht selten mit Wissen und Billigung ihres Ehemanns – durch sexuelle Dienstleistungen den nächsten Familienurlaub finanzierten. Studentinnen, die als Escort-Girls ihr BAföG aufbesserten. Die Diskussion im Studio war heftig gewesen, eine allseits bekannte Berufsfeministin war drauf und dran gewesen, die nicht weniger streitlustige Theresa in Stücke zu reißen, und in der folgenden Woche hatte ihr Buch zum ersten Mal auf der Bestsellerliste gestanden.
Auch meine Töchter spendeten mir keinen Trost in meinem Elend. Sarah war nach der Abiturfeier des Gymnasiums nach Italien desertiert, um den Sommer in Ancona bei ihrem geliebten Giuseppe zu verbringen, und ihre eine halbe Stunde jüngere Zwillingsschwester Louise war wenige Tage später zusammen mit ihrem Freund Mick zu einer seit Längerem geplanten Weltreise per Rad aufgebrochen. Anfangs hatten sie mir noch täglich Nachrichten und Fotos geschickt, aber bald waren die Statusmeldungen spärlicher geworden. Abnabelung im Zeitraffer.
So saß ich nun die meiste Zeit allein zu Hause, versuchte, Romane zu lesen, verlor jedoch immer wieder den Faden und degenerierte allmählich zum Netflix-Junkie. Keine Serie konnte so dämlich sein, dass ich mir nicht die eine oder andere Folge ansah, und plötzlich war Mitternacht, und ich ging mit dem Gefühl ins Bett, wieder ein kostbares Stück Lebenszeit verschwendet zu haben. Ich schluckte brav meine Tabletten, ging zweimal die Woche zur Therapie, machte, wenn mir die Decke auf den Kopf zu fallen drohte, lange Spaziergänge, ging schwimmen oder joggte eben in aller Herrgottsfrühe, bis mir die Luft wegblieb.
Immer öfter haderte ich mit meiner Berufswahl. Hatten die ganze Schinderei, all der Stress, die Gefahren, denen man sich aussetzte, hatte all das wirklich einen Sinn? Immer öfter beschlich mich das Gefühl, dass für jeden Bösewicht, den ich und meine Mitarbeiter aus dem Verkehr zogen, zwei andere nachwuchsen. Dann wieder war ich überzeugt, dass es keinen anderen Beruf für mich gab. Ich mochte es, mit Menschen zu tun zu haben, an ihren Schicksalen teilzunehmen. Zu helfen, zu trösten, Verbrechensopfern die Befriedigung zu verschaffen, dass der Mensch, der ihnen Böses angetan hatte, seine gerechte Strafe erhielt. Und natürlich genoss ich auch den Siegesrausch, wenn wieder einmal ein vertrackter Fall gelöst war, wenn Betroffene sich überschwänglich bei mir bedankten. Ja, verdammt, die Arbeit fehlte mir. Die Kolleginnen und Kollegen, Sönnchen, meine Sekretärin, Assistentin und Trösterin in allen Lebenslagen.
Außerdem vermisste ich natürlich meine Mädchen, die sträflich wenig von sich hören ließen. Bis vor wenigen Wochen war immer Leben in meiner Wohnung gewesen, manchmal mehr, als mir lieb war. Jetzt empfing mich gähnende Leere, wenn ich nach Hause kam. Kein »Hi, Paps«, kein »Hättest du mal ’ne Minute?«, was meist bedeutete, dass jemand Geld brauchte. Wenn ich nicht einkaufen ging, dann blieb der Kühlschrank leer. Wenn ich nicht kochte, dann wurde kalt gegessen. Mit der Zeit hatte ich sogar einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, was das Kochen betraf. Ich hatte meine Mutter um die Rezepte meiner Lieblingsgerichte in Kindertagen gebeten, suchte mir im Internet Anleitungen, um interessante Rezepte nachzukochen. Zu meiner Überraschung schmeckte das Ergebnis meiner dilettantischen Bemühungen immer öfter richtig gut.
Und jetzt hatte ich also einen Mordfall entdeckt und durfte nicht einmal mithelfen, ihn aufzuklären.
Nein, das kam überhaupt nicht infrage, entschied ich auf der Fahrt zurück in die Heidelberger Weststadt. Krankschreibung hin oder her, morgen würde ich wieder an meinem Schreibtisch sitzen und das Steuer in die Hand nehmen.
Ich freute mich darauf wie schon lange auf nichts mehr.
3
»Okay«, sagte ich am Montagmorgen um Punkt neun zu den Kolleginnen und Kollegen, die fürs Erste die Sonderkommission »Partygirl« bilden würden. Wir saßen im kleinen Besprechungszimmer der Polizeidirektion, alle mit Kaffeebechern vor uns, einige mit Tablets, auf denen sie ihre Notizen machten. Bis auf Laila sahen alle aus, wie man am Montagmorgen eben aussieht: ein wenig übernächtigt, noch nicht ganz wieder im Alltag angekommen. Sämtliche Fenster waren gekippt, aber die Luft, die hereinkam, war nicht besser als die, die schon drin war, und brachte keinerlei Linderung, sondern den Gestank von Autoabgasen.
»Was haben wir?«, fragte ich mit meiner Chefstimme.
»Einen Zeugen«, sagte Laila mit Blick auf mich und spitzbübischem Grinsen. »Ich hoffe, einen guten.«
Ich konnte mir ein Lächeln nicht ganz verkneifen und begann vorzulesen, was ich mir notiert hatte. Sicherheitshalber hatte ich gestern Morgen noch vor der Dusche eine handschriftliche Liste angefertigt, die Laila nun auf den Beamer schickte, sodass alle mitlesen konnten.
Opfer 1:
weiblich, Alter wahrscheinlich zwischen 16 und 25
Statur: schlank bis grazil
Größe: 1,55 bis 1,65 Meter
Haar: mittelblond, glatt, fast hüftlang
Nägel: blutrot lackiert mit Flitter
Schmuck: nicht erkennbar oder nicht vorhanden
Gesicht: nicht erkennbar wegen Bauchlage
Kleidung: silbern glänzendes Kleid mit Spaghettiträgern, figurbetont, auffallend kurz; am rechten Fuß eine Sandalette mit hohem Absatz, die linke lag etwa zwanzig Meter entfernt am Wegrand
Slip: weinrot
Strümpfe: hell, glatt
silberne kleine Handtasche (nicht auffindbar)
Gesamteindruck: gepflegt und sauber
Opfer 2:
männlich, Alter zwischen 55 und 65
Größe: ca. 1,75 Meter
Statur: gedrungen, kräftig, aber nicht dick
Haar: grau, wellig
Brille mit schwerem schwarzem Horngestell, Hersteller unbekannt
Kleidung: Anzug, hellgrau, etwas abgetragen, zwei Nummern zu groß, weißes Hemd, geschlossener Kragen, keine Krawatte
Schnürschuhe: hellbraun, abgetragen
Armbanduhr: golden mit braunem Band, vermutlich Leder (nicht auffindbar)
Smartphone: unbekannte Marke, älter, Display beschädigt (nicht auffindbar)
Gesamteindruck: sauber, aber ärmlich. Wirkt älter, als er möglicherweise ist. Hände kräftig, sauber. Gelbe Stellen am rechten Zeige- und Mittelfinger, wahrscheinlich Kettenraucher. Nägel gepflegt und sauber. Beruf eher nichts Handwerkliches.
spricht kein Deutsch und nur wenig Englisch, harter Akzent, Muttersprache unbekannt, eventuell Türkisch, Arabisch, Tschechisch oder Russisch
»Und das war’s dann leider auch schon«, schloss ich und begann in allen Einzelheiten zu erzählen, was ich gestern am frühen Morgen gesehen und erlebt hatte.
»Weitere Zeugen Fehlanzeige, bisher keine auf die Beschreibung der Frau passende Vermisstenmeldung«, sagte Laila knapp, als ich geendet hatte.
»Stimmt nicht«, widersprach Tim Kurtz, unser Neuling, triumphierend. »Grad vorhin hat nämlich eine Frau angerufen. Sie behauptet, sie hätte gestern Morgen gegen fünf einen schwarzen oder dunkelblauen Kombi gesehen. Er hat am Rand der Bundesstraße gestanden, und zwei Männer, angeblich jung und sportlich, hätten was Schweres in den Laderaum gewuchtet.«
»Was für ein Kombi?«
»Sie versteht nichts von Autos. Aber das dürften die zwei Burschen gewesen sein, die das Opfer weggeschafft haben. Die Spusi hat inzwischen ein paar Fußabdrücke gesichert, die werden zurzeit ausgewertet. Der Boden ist leider furztrocken, wird wahrscheinlich nicht viel bei rauskommen. Das Auto hat übrigens am Rand der nördlichen Fahrbahn gestanden und kein Licht angehabt. Nicht mal die Warnblinker. Zum Glück ist es schon hell gewesen.«
»Was kann die Zeugin sonst noch über die Männer sagen?«
»Einer war eher klein und stämmig, dunkle Haare. Wahrscheinlich schwarze Jeans und ein ebenfalls schwarzes Shirt. Der andere war größer und schlank, die Haare heller. Die Gesichter hat sie nicht gesehen.«
»Prima«, sagte ich anerkennend. »Es fängt gut an.«
Gegenüber der Stelle, wo der Kombi gestanden hatte, befand sich ein kleiner Wanderparkplatz mit sandigem Boden. Auch dort hatten die Kollegen von der Kriminaltechnik frische Fußspuren gefunden, vermutlich von zwei verschiedenen Sneakers, die teilweise so gut waren, dass wir in Kürze Typ und Hersteller der Schuhe kennen würden, die die Täter getragen hatten.
»Gibt es Reifenspuren am Straßenrand?«, fragte ich. »Von dem Kombi, meine ich.«
»Werd ich gleich mal checken.« Tim Kurtz machte sich eine Notiz in seinem übergroßen Smartphone. »Aber dafür haben wir Spuren von einem Kleinwagen auf dem Parkplatz gesichert. Details wissen wir im Moment aber noch nicht.«
»Fußspuren von der Frau haben sie auch gefunden«, berichtete Laila. »Und zwar vom Parkplatz in Richtung Tatort. Wie es aussieht, ist sie davongelaufen, und einer der Kerle ist ihr nach. Beim Bach hat er sie eingeholt, sie hat wieder kehrtgemacht, den linken Schuh verloren und dann – na ja.«
»Die Reifenspuren von dem Kleinwagen«, sagte ich, »die wären wichtig. Wenn wir wissen, mit was für einem Auto sie unterwegs waren …«
»Wie Tim sagt, die KT ist dran«, schloss Laila und klappte ihren kleinen Spiralblock mit leisem Knall zu. »Mehr wissen wir im Moment noch nicht.«
»Der Alte …«, sagte ich langsam und mit schmalen Augen. »Er hat irgendwie komisch reagiert. Wie er die junge Frau gesehen hat, da ist er zusammengezuckt, und seine Augen sind groß geworden. Er hat sich überhaupt nicht mehr für mich interessiert, sondern wollte nur noch zu der Frau, sie anschauen und anfassen. Es war fast …« Ich ruderte hilflos mit den Händen. »… als hätte er nach ihr gesucht. Als … ja, als hätte er sie gekannt.«
»Na, das ist doch schon mal was«, fand Laila aufgeräumt. »Dabei fangen wir grad erst an.«
»Ich gehe mit der Sache gleich an die Öffentlichkeit«, verkündete ich. »Das Fahrrad sollten wir übrigens nicht vergessen.«
Es war ein Citybike der Marke Carver, hatte Tim Kurtz bereits recherchiert, silberfarben, Reifengröße 28 Zoll.
»Kostet im Handel um die achthundert Murmeln und dürfte circa zwei Jahre alt sein. Im Internet kriegt man es auch schon mal für einen Hunderter weniger. Scheint wenig benutzt worden zu sein. Sieht aus wie neu.«
Mehr war über das Rad bislang nicht bekannt. Es hatte keinerlei Sonderausstattung, keine auffälligen Extras. Der junge und offenbar sehr eifrige Kollege war davon überzeugt, dass es von einem Internetshop stammte.
»Für die niedergelassenen Händler ist es zu billig. Da ist kaum was dran zu verdienen.«
»Versuchen Sie trotzdem rauszufinden, ob sich einer an das Rad erinnert«, entschied ich. »Weiß übrigens jemand, wie es dem Mann geht?«
Laila hatte gleich am Morgen mit der Klinik telefoniert. »Er liegt im Koma. Die Hirnverletzungen scheinen ziemlich heftig zu sein. Sobald er zu sich kommt, melden sie sich. Kann aber ein paar Tage dauern, hat die Ärztin gemeint.«
Siebzehn Minuten nach neun löste ich die kleine Versammlung auf mit dem guten Gefühl, dass dieser Fall bald geklärt sein würde.
Ich saß kaum an meinem Schreibtisch und hielt den Telefonhörer in der Hand, um die Pressestelle zu instruieren, als Laila in mein Büro platzte.
»Ich hab hier was, Chef.« Aufgeregt wedelte sie mit einem Papier. »Die Mannheimer haben einen Vermisstenfall auf der Homepage. Der könnte auf unser Opfer passen.«
Ein siebzehnjähriges Mädchen war seit drei Wochen abgängig. Es trug den ungewöhnlichen Namen Tuuli Seljamaa.
»Ist das finnisch?«
»Estnisch. Sie lebt noch bei ihrer Mutter. Die Beschreibung passt fast zu gut: schlank, Größe eins siebenundsechzig, Haare zurzeit blond, hängt an den Wochenenden viel in Discos ab. Das Blond ist gefärbt. In echt sind die Haare braun.«
Sie legte mir ein großes Foto auf den Tisch, das Tuuli Seljamaa zeigte, allerdings nicht herausgeputzt und im Discofummel, sondern mit strähnigem Haar, in Jeans und grauem Schlabberpulli. Die Mannheimer Kollegin, die den Fall bearbeitete, hatte Laila noch nicht erreicht.
»Ich regle noch schnell das mit der Pressestelle, und Sie besorgen in der Zwischenzeit die Adresse der Mutter.«
»Hab ich schon.«
»Und ein Auto.«
Hatte sie auch schon.
Zehn Minuten später waren wir unterwegs nach Mannheim.
4
Tuulis Mutter lebte im Süden der Stadt.
»Traitteurstraße, Ecke B 37«, sagte Laila, die am Steuer saß, während ich das Navi mit den nötigen Informationen fütterte.
Frau Seljamaa wohnte im zwölften Stockwerk eines hässlichen betongrauen Hochhauses, auf dessen Dach Handy-Sendemasten in den Himmel ragten wie junges Gemüse. Eine Parklücke fand Laila erst hundert Meter weiter am Straßenrand, zwischen einem stahlgrauen Golf-Cabrio und einem giftgrünen Fiat.
»Ja, bitte?«, krächzte es missmutig aus der Sprechanlage.
»Khatari hier«, sagte meine Mitarbeiterin fröhlich. »Wir haben telefoniert.«
Ich roch ihr frisches Parfüm, das gut zu ihrem sportlichen Typ passte. Der Türöffner schnarrte, als würde er im Namen aller Hausbewohner Protest gegen die Störung einlegen.
Es gab zwei Aufzüge, die sogar halbwegs sauber waren. Wir wählten den linken und standen Sekunden später Frau Seljamaa gegenüber. Sie mochte um die vierzig sein, war groß, schlank, langes dunkles Haar, helle Haut. Sie trug eine schreiend bunte, eng anliegende Jogginghose und einen übergroßen dunkelgrauen Rollkragenpullover, der mich an das Foto ihrer Tochter denken ließ. Ihr Händedruck war beeindruckend fest, die Rechte eiskalt. Aus der Küche dufteten uns fremdländische Gerüche entgegen. Und kühl war es hier. Offenbar verfügte die Wohnung über eine leistungsfähige Klimaanlage, denn draußen näherte sich das Thermometer wieder einmal zügig der Vierzig-Grad-Marke.
»Hmmm«, machte Laila schnuppernd. »Das riecht aber fein!«
»Lammfleisch mit Gemüse«, sagte die Köchin mit müdem Lächeln und in fast akzentfreiem Deutsch. »Ich kann Ihnen aber leider nichts davon anbieten. Es muss noch mindestens eine Stunde simmern. Ein Rezept meiner Großmutter.«
Sie koche immer für mehrere Tage vor, erzählte sie uns, während wir den langen Flur entlanggingen und das Wohnzimmer betraten, da es sich für sie nicht lohne, jeden Tag aufs Neue den Herd anzuwerfen. Ihr Geld verdiente sie bei einer Bank in der Innenstadt als Kundenberaterin. Heute war ihr freier Tag.
Nicht nur die Luft, auch das Ambiente war kühl. Viel Glas und Chrom, eckige Sesselchen in verschiedenen Grautönen, ein ebenfalls grauer weicher Teppich. Das einzig Bunte waren einige Modezeitschriften auf dem selbstredend gläsernen Beistelltischchen. Wer immer diesen Raum eingerichtet hatte, er hatte streng darauf geachtet, keinerlei Gemütlichkeit aufkommen zu lassen.
»Ich mache hauptsächlich Immobilienfinanzierungen«, sagte unsere Gastgeberin, die bei der Arbeit todsicher ein graues Businesskostüm trug. Den einzigen Schmuck bildete ein silbernes Halskettchen. Das Make-up war dezent, die sorgfältig manikürten Nägel waren in einem blassen Rosa lackiert, das hie und da schon abgesprungen war.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Kaffee, Tee, Wasser still oder sprudelnd, Cola original oder light, Bier mit oder ohne Alkohol? Stärkeres hab ich leider nicht im Haus.«
Ich wählte stilles Wasser, Laila grünen Tee.
Wir nahmen Platz auf den überraschend bequemen Sesseln. Ich saß mit Blick zum breiten Fenster. Die Aussicht war beeindruckend. Die vierspurige Bundesstraße, die wenige Meter vom Haus entfernt verlief, konnte ich nicht sehen, ebenso wenig die vielen Gleise, die jenseits der Straße zum Hauptbahnhof führten. Was ich sah, waren ein Kleingartengelände und dahinter der Rhein, auf dem gerade mehrere Frachtschiffe und ein weißer Ausflugsdampfer ihre Bahnen zogen. Vom Lärm der Straße war hier oben kaum etwas zu hören.
»Nun sagen Sie schon, weshalb Sie hier sind«, sagte Frau Seljamaa nach einem ersten, symbolischen Schluck aus ihrem Teeglas zu Laila. »Vorhin am Telefon wollten Sie ja nicht mit der Sprache heraus. Haben Sie Tuuli gefunden? Wie geht es ihr? Wo ist sie jetzt?«
»Wir können es noch nicht mit Sicherheit sagen«, gestand ich an Lailas Stelle. »Aber … bitte erschrecken Sie jetzt nicht.« Ich räusperte mich. »Gestern am frühen Morgen ist eine junge Frau gefunden worden, tot, die Ihrer Tochter leider sehr ähnlich sah.«
Sie schien noch eine Spur blasser zu werden, schluckte, schlug die seegrünen Augen nieder, behielt jedoch eisern die Fassung.
Ich schilderte in knappen Worten, was vorgefallen war.
»Wie oft habe ich auf sie eingeredet, sie soll aufpassen, mit wem sie sich einlässt«, murmelte sie mit immer noch gesenktem Blick. »Aber es … Tuuli kann so unfassbar dickköpfig sein. Da kann man schimpfen und argumentieren oder schreien, es nützt alles nichts. Inzwischen bekomme ich nicht einmal mehr eine Antwort.«
Mit einem Ruck hob sie den Kopf, presste die ungeschminkten Lippen aufeinander, zwinkerte zwei Tränen weg, sah aus dem Fenster.
»Es ist bis jetzt absolut nicht sicher, dass sie es überhaupt ist«, sagte Laila ruhig. »Bisher ist es nicht einmal ein Verdacht, sondern höchstens eine Befürchtung. Wir müssen in so einem Fall jede Möglichkeit in Betracht ziehen und jeder noch so abwegigen Spur nachgehen.«
»Gibt es Fotos?«, fragte Tuulis Mutter.
»Leider noch nicht.«
Frau Seljamaa schluckte erneut und sagte mit fester Stimme: »Und was erwarten Sie nun von mir?«
Ich beschrieb das Kleid, das die Tote getragen hatte, die Sandaletten, das Haar, zeigte ihr Fotos vom Tatort.
»Gesehen habe ich das Kleid noch nie«, sagte die Mutter mit krauser Stirn. »Aber das bedeutet nichts. Sie hat sich ständig neue Sachen gekauft. Bei Primark oder H&M oder im Internet. In letzter Zeit auch in teuren Boutiquen. Fragen Sie mich bitte nicht, woher sie das Geld dafür hatte. Von mir jedenfalls nicht.«
Sie verstummte, sah auf ihre Hände mit den schlanken, ein wenig knochigen Fingern. Das Rosa der Nägel erinnerte mich an Theresa.
»Und jetzt«, fuhr sie fort, »ist Tuuli also verschwunden, sagen Sie. Das heißt, das Schwein, das sie auf dem Gewissen hat, hat sie irgendwo in den Rhein geworfen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?«
»Frau Seljamaa«, sagte ich eindringlich. »Bisher ist nicht erwiesen, dass das Opfer wirklich Ihre Tochter ist, und im Grunde sind wir nicht einmal sicher, dass es nicht mehr lebt.«
»Aber was denken Sie? Ganz ehrlich?«
»Mein Eindruck war, dass sie nicht mehr lebt«, gab ich zu. »Aber ich bin kein Arzt.«
Für kurze Zeit herrschte betretenes Schweigen.
»Sie hat ein Muttermal am Hals.« Frau Seljamaa deutete auf eine Stelle unter dem linken Ohr. »Hier.«
»Ich habe leider auf der rechten Seite gestanden.«
Ich bat sie, uns ein wenig von ihrer Tochter zu erzählen, was sie anfangs nur widerstrebend tat. Aber bald begannen die Worte und Geschichten zu fließen. Tuuli war ein braves Kind gewesen, das oft von einer Nachbarin versorgt wurde, da die alleinerziehende Mutter Geld verdienen musste.
»Ihr Vater ist gestorben, als ich im vierten Monat schwanger war.«
Das junge Ehepaar hatte im beginnenden Frühling Urlaub an der mexikanischen Pazifikküste gemacht.
»Wir dachten, wenn das Kind erst mal da ist, dann geht so etwas nicht mehr. Leider oder Gott sei Dank habe ich mir gleich am ersten Tag den Magen verdorben. Mein Mann wollte noch einen Abendspaziergang durch den Ort machen, ich bin lieber im Hotel geblieben. Irgendwie ist er auf der Strandpromenade mit einer Jugendbande aneinandergeraten. Was genau geschehen ist, konnte nie geklärt werden. Es gab Geschrei, und am Ende hatte er ein Messer im Rücken. Die wenigen Zeugen, die sich meldeten, haben sich widersprochen, und die Täter wurden nie gefasst. Die Polizei vermutete, dass es um Drogengeschäfte ging und Tuulis Vater einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war.«
Im August kam Tuuli zur Welt und war zum Glück ein pflegeleichtes Baby.
»Zu der Zeit war ich bereits in Deutschland. Ich wollte schon lange weg von Estland. Nicht, dass ich meine Heimat nicht lieben würde. Aber diese ewige Angst vor den Russen … Ich wollte, dass meine Tochter in Frieden und Sicherheit aufwachsen kann.«
Sie schwieg kurz, betrachtete wieder mit kritischer Miene ihre Nägel.
»Wenn ich arbeiten war, hat Frau Asam im dritten Stock Tuuli betreut. Sie ist schon in Rente und hat Tuuli geliebt und verhätschelt, als wäre sie ihr eigenes Kind.«
Tuuli war eine gute Schülerin gewesen, hatte eifrig ihre Hausaufgaben gemacht und war nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gewechselt.
»Alles wunderbar, ein Sonnenkind, so was von lieb und folgsam, man glaubt es kaum. Bis sie in die Pubertät kam. Da hat sich alles verändert.«
Frau Asam war inzwischen alt geworden und hatte das Mädchen, das sich immer häufiger wie ein Wildfang gebärdete, nicht mehr zu bändigen gewusst.
»Auf einmal hatte sie nur noch Jungs im Kopf. Jungs, Jungs, Jungs. Sie ist ohne plausible Erklärung viel zu spät aus der Schule gekommen, war bockig und frech. Der Vater hat ihr gefehlt, denke ich. Auf mich hat sie kaum noch gehört, auf Frau Asam zweimal nicht. Ständig wollte sie Geld, um sich Burger zu kaufen oder Kebab oder Klamotten, Schmuck, Schuhe, Schminksachen. In der Schule ist es nur noch bergab gegangen, und mit fünfzehn ist sie zum ersten Mal nachts nicht nach Hause gekommen. Ich habe alles versucht, bitte glauben Sie mir. Mit Güte, mit Strenge, mit Bestechung, aber nichts hat gefruchtet. Und dann hat sie auf einmal so viel Geld gehabt. Ständig hat sie neue Sachen nach Hause gebracht, angeblich alles von einer Freundin ausgeborgt. Erst dachte ich, sie stiehlt. Aber dann habe ich die Kassenzettel im Küchenmüll gefunden.«
»Woher sie das Geld hatte, wissen Sie aber nicht?«
»Von Jungs, nehme ich an, älteren Jungs, die schon verdienen. Ihr Taschengeld hatte sie immer schon in der ersten Woche ausgegeben. Tuuli ist ein Flittchen, ich muss es leider so sagen. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Ich war in dem Alter ganz anders.«
Tuuli hatte ihre von Natur nussbraunen Haare alle paar Wochen anders gefärbt, war schließlich sitzen geblieben, woraufhin sie für einige Zeit ruhiger wurde. Aber schon nach wenigen Wochen war der Tanz erneut losgegangen.
»Irgendwann hat die Polizei sie nach Hause gebracht. Sie hatte nun doch geklaut, Schminksachen bei Douglas. Sie hatten sie zusammen mit zwei Freundinnen erwischt, deren Namen ich noch nie gehört hatte.«
Auch ihre Mutter hatte sie hin und wieder bestohlen, was diese lange nicht bemerkte oder nicht bemerken wollte.
»Ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen. Als Nächstes ist dann jemand vom Jugendamt gekommen und hat mir kluge Vorträge gehalten über Kindererziehung und so weiter. Ich habe nur noch halbtags gearbeitet, um mehr Zeit für Tuuli zu haben. Aber mein Töchterchen fand es überhaupt nicht lustig, dass Mama nachmittags auf einmal zu Hause war.«
Tuuli wurde erneut nachts um zwei in der Mannheimer Innenstadt aufgegriffen, und das Jugendamt mischte sich nun immer öfter ein. Man traf Vereinbarungen, handelte Deals aus. Mehr Taschengeld bei Wohlverhalten, Ausgehverbot bei erneuter Aufsässigkeit.
Der nächste Schlag kam vor drei Monaten, als Tuuli, für die geplagte Mutter völlig überraschend, von der Schule flog. Den Ausschlag hatte ein tätlicher Angriff auf eine Lehrerin gegeben. Mahnende Briefe der Schulleitung an Frau Seljamaa hatten diese aus durchsichtigen Gründen nicht erreicht. Die Unterschrift ihrer Mutter hatte Tuuli mit Talent gefälscht.
»Ich habe den Tag herbeigesehnt, an dem sie endlich achtzehn wurde und ich die Verantwortung los war. Einmal hat sie sogar eine Nacht in einer Zelle verbracht. Ich kann nicht ausschließen, dass sie sogar mit irgendwelchen Kerlen geschlafen hat, um an Geld zu kommen. Eine kleine Nutte habe ich aufgezogen, eine kleine, rotzfreche, skrupellose Hure.«
Und vor drei Wochen, wenige Tage vor ihrem achtzehnten Geburtstag, war Tuuli dann verschwunden.
»Ohne Nachricht, ohne Gepäck, das Handy aus, weg war sie.«
Tuulis Mutter biss sich auf die Unterlippe. Ihre Hände zitterten. Mein Wasserglas war längst geleert, Lailas Tasse ausgetrunken. Die unglückliche Gastgeberin schien ihren Tee vergessen zu haben.