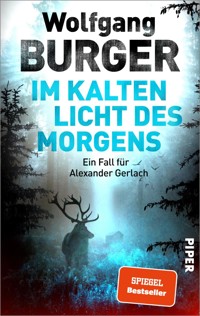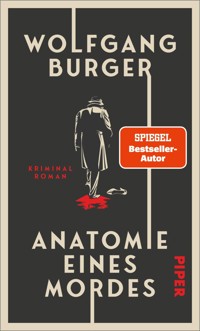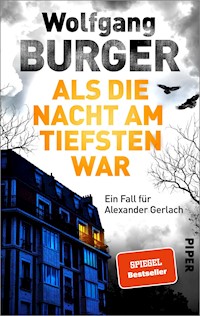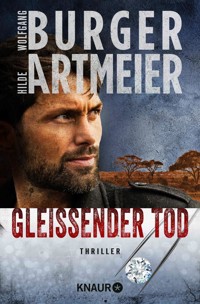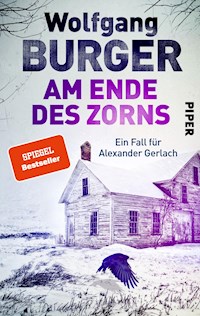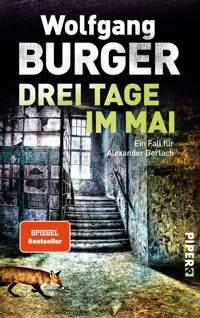9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Juliana von Lembke, erfolgreiche Managerin und gefürchtete Spezialistin für die Sanierung bankrotter Firmen, wird tot aus dem Neckar gezogen. Anfangs deutet alles auf Selbstmord hin. Doch dann taucht eine Obdachlose auf, die bezeugt, dass Juliana von einer Brücke in den Fluss gestoßen wurde. Kripochef Alexander Gerlach hat zunächst den Ehemann in Verdacht oder einen ihrer vielen verflossenen Liebhaber. Da Juliana sich bei den Sanierungsaktionen aber viele Feinde gemacht hat, ermittelt er bald auch in dieser Richtung. Dann findet einer von Julianas früheren Liebhaber den Tod, ein Mitarbeiter wird in die Luft gesprengt, und der Ehemann ist plötzlich spurlos verschwunden. Gerlach steht vor seinem vielleicht undurchsichtigsten Fall …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Jamie
ISBN 978-3-492-99174-2
© Piper Verlag GmbH, München Jahr 2018
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Richard Fairless/Getty Images; Erik Hageman/EyeEm/Getty Images; Andrew Latshaw/EyeEm/GettyImages
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
1. Was soll ich ...
2. »Vergiss es«, keuchte ...
3. Wieder zwei Tage ...
4. Praktischerweise war Kai ...
5. »Juli?«, fragte Anita ...
6. Louise war zu ...
7. Am späten Sonntagvormittag ...
8. »Ein Gefühl«, sagte ...
9. Anderthalb Stunden nachdem ...
10. Ich saß noch ...
11. Um neunzehn Uhr ...
12. Meine erste Amtstätigkeit ...
13. Sollte Meerbuschs Verschwinden ...
14. »Wie kann ich ...
15. Am Freitagmorgen – ...
16. Am späten Nachmittag, ...
17. Eigentlich hatte ich ...
18. Nachmittags um halb ...
19. Auf die Minute ...
20. Als unser Zug ...
21. Ulrich Lenzes Haus ...
22. Michael war wieder ...
23. Noch bevor das ...
24. So spät wie ...
25. Irene Raile öffnete ...
26. Ich war müde
27. Schon während des ...
28. Zu viert saßen ...
29. Nachmittags um halb ...
30. Balke hatte in ...
31. Auf Höhe der ...
32. »Was ist denn ...
1
Was soll ich es leugnen – ich habe ihn auf den ersten Blick nicht leiden können. Selbstverständlich haben meine Eltern mir beigebracht, dass Vorurteile etwas Schlechtes sind. Natürlich weiß ich, dass man sich nie vom ersten Eindruck leiten lassen darf, dass man stets versuchen soll, Fremden unvoreingenommen gegenüberzutreten. Und dennoch, ich kann es nicht ändern, Kai Meerbusch war mir schon in der ersten Sekunde unsympathisch.
Sein verdruckstes Getue, die Art, einem nie, einfach nie in die Augen zu sehen, mehr zu nuscheln als zu sprechen, die demütige Körperhaltung, alles an diesem Mann machte mich aggressiv. Aus der Sicht eines Kriminalisten war er das geborene Opfer. Ein Mensch, der geradezu darum bettelte, herumgeschubst und drangsaliert, auf der Straße ausgeraubt und verprügelt zu werden.
Hinzu kam, aber dafür konnte er nun wirklich nichts, dass ich an dem Tag, als ich ihn zum ersten Mal traf, hundsmiserable Laune hatte. Ärger mit Theresa, auf meinem Schreibtisch türmte sich wieder einmal der Papierkram, das Wetter war kalt und feucht, der Tag ein graues Etwas zwischen nicht mehr könnendem Winter und noch nicht wollendem Frühjahr. Obwohl der März schon einige Tage alt war, war von Frühlingserwachen noch nichts zu spüren.
Dass mir Kai Meerbusch über den Weg lief, war reiner Zufall. Ich war von meinem Schreibtisch geflüchtet, die Treppen hinunter ins Erdgeschoss gelaufen, um vor die Tür zu treten und meinen dumpfen Kopf auszulüften.
»Verzeihung?«, sprach mich jemand von der Seite an, gerade als ich den ersten bewussten Atemzug dieses trüben Tages tat.
Und da stand er. Einen Kopf kleiner als ich, schmaler auch und schlanker, mit leicht gebeugtem Rücken und betretener Miene. Seine hochwertige Kleidung fiel mir sofort auf. Der hellbraune Anzug nicht gerade vom Edelschneider, aber sicherlich auch nicht von der Stange. Die im Farbton exakt dazu passenden Schnürschuhe blitzblank gewienert und wohl ebenfalls nicht billig. Etwas nachlässig rasiert war er, offener Hemdkragen, keine Krawatte, gepflegte Hände, die nicht von körperlicher Arbeit zeugten.
»Ja?«, fragte ich unfreundlich und riss mich gleich darauf zusammen. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
Schließlich ist man als Polizist ja auch ein Freund und Helfer. Obwohl wir unter unserem neuen Chef mehr und mehr zu Statistikern und Excel-Künstlern mutierten, wie Balke es kürzlich so treffend ausgedrückt hatte.
»Ich weiß nicht«, antwortete der verschreckte Mann im teuren Anzug. »Meine Frau ist verschwunden.«
Wen wundert’s?, war mein erster, selbstredend völlig unangemessener Gedanke.
»Das tut mir leid«, sagte ich.
Sie seien nur zu Besuch in Heidelberg, gestand er mir verlegen, hätten einige Tage Urlaub hinter sich, am Comer See, und seien auf der Rückreise nach Norden von der Autobahn abgefahren, um sich die weltberühmte Stadt am Neckar anzusehen, irgendwo eine Kleinigkeit zu essen und anschließend weiterzufahren.
»Aber dann haben wir spontan unsere Pläne geändert«, fuhr er fort. »Meine Frau wollte eine alte Freundin besuchen, wo wir schon mal hier waren.«
Und so hatte man sich kurz entschlossen im Crowne Plaza ein Zimmer genommen.
»Juli steigt immer dort ab, wenn sie in Heidelberg ist.«
»Ihre Frau heißt Juli?«
»Eigentlich Juliana.« Verkrampft gestikulierte er mit seinen gepflegten Händen, rang um Worte. Seine Frau habe abends gegen sechs Uhr mit dem Wagen gut gelaunt das Hotel verlassen und sei bisher nicht zurückgekommen.
»Was sagt die Freundin dazu?«
Von der wusste er leider nur den Vornamen. »Anita, und dass die beiden sich aus Studienzeiten kennen. Die Krankenhäuser habe ich heute Morgen schon alle angerufen. Dort ist Juli aber nicht.«
»Ihre Frau hat doch bestimmt ein Handy dabei.«
»Das hat sie, natürlich. Aber sie geht nicht ran. Ich habe es x-mal versucht. Ich dachte, sie hat gestern vielleicht zu viel getrunken, wollte nicht mehr Auto fahren und hat deshalb bei Anita übernachtet.«
Als wollte er mir ein Geheimnis anvertrauen, trat er näher an mich heran. Sein Atem roch nach Alkohol. Der Frust und die Einsamkeit gestern Abend mussten ziemlich groß gewesen sein.
»Aber dann würde sie sich doch allmählich mal melden, finden Sie nicht auch?« Er sah mich verzweifelt an.
»Hatten Sie Streit?«, lautete meine nächste Frage, die ein Polizist an dieser Stelle immer stellt.
Erschrocken schüttelte er den länglichen, für einen Mann ungewöhnlich schönen Kopf mit glattem, dunklem, an den Schläfen schon dezent angegrautem Haar. »Wir … nun ja … wir hatten tatsächlich eine kleine Ehekrise in den vergangenen Wochen. Wo gibt es das nicht, dass man sich hin und wieder ein wenig zankt? Aber nicht gestern. Gestern nicht. Eigentlich war alles … ganz normal. Juli hat fröhlich ›Tschüss‹ gesagt, ihren Mantel angezogen, die Handtasche genommen und ist gegangen.«
»Ihre Frau hat sich nicht über Sie geärgert und ist vielleicht einfach allein weitergefahren?«
Dieses Mal fiel das Kopfschütteln noch entschiedener aus. »So ist Juli nicht. Sie geht Konflikten nicht aus dem Weg. Das kann manchmal etwas anstrengend sein, zugegeben. Ist aber besser, als die Dinge unter den Teppich zu kehren.«
Gegensätze sollen sich ja bekanntlich anziehen. Nachdem er am Morgen eine Weile erfolglos auf ein Lebenszeichen seiner Frau gewartet und mit diversen Krankenhäusern telefoniert hatte, wandte er sich schließlich an die Polizei.
»Ich war beunruhigt, sehr beunruhigt … aber dann …«
Die Kollegin, an die er geriet, hatte ihm wohl ein wenig von oben herab erklärt, sie könne ihm nicht helfen. Seine Frau sei erwachsen, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und deshalb berechtigt, sich aufzuhalten, wo immer sie wollte, und dort zu tun, wozu sie Lust hatte.
Vermutlich war er auch der Kollegin auf die Nerven gegangen. In meinem Beruf hört man solche Geschichten jeden Tag. Männer verschwinden, tauchen zwei Tage später reumütig, verkatert und zerknittert wieder auf, nachdem sie mit Freunden zusammen eine Sauftour durch die Kneipen Mannheims gemacht oder sich in irgendeinem Flatratebordell ausgetobt haben. Frauen verschwinden und werden am Ende bei ihrer Mutter oder der besten Freundin wiedergefunden. Deshalb vermutete auch ich hinter dem unerklärlichen Verschwinden dieser Juliana eine sehr erklärliche Ehekrise.
»Sie hat ihr Handy aber nicht ausgeschaltet?«, fragte ich sicherheitshalber nach.
»Nein, es tutet. Aber sie geht nicht ran.« Der unglückliche Mann straffte sich und streckte mir seine Rechte hin. »Verzeihen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Kai von Lembke-Meerbusch ist mein Name. Ich bin ein wenig … konfus, was vielleicht angesichts der Umstände …«
»Gerlach.« Ich drückte seine Hand vielleicht ein wenig kräftiger, als nötig gewesen wäre. »Alexander Gerlach.«
Sagte ich schon, dass ich Menschen nicht ausstehen kann, die sich unentwegt entschuldigen und einen schlaffen Händedruck haben? Ich versuchte, dem armen Kerl klarzumachen, dass auch ich, obwohl Chef der hiesigen Kriminalpolizei, nichts für ihn tun konnte. Meine Kollegin hatte vollkommen recht: Erwachsene Menschen dürfen in einem freien Land im Rahmen der Gesetze tun und lassen, was ihnen gefällt. Um ihn wieder loszuwerden, bat ich ihn um die Daten der Frau, die ihn hatte sitzen lassen – wofür ich inzwischen jedes Verständnis hatte –, und eine Beschreibung ihres Wagens. Dieser war ein Mercedes, S-Klasse, silbergrau, das Kennzeichen begann mit »D«.
»Düsseldorf«, fügte er überflüssigerweise hinzu. »Dort sind wir zu Hause.«
Vierundvierzig Jahre alt war die Vermisste, eher klein als groß, schlank, graziös, schwarzer Kurzhaarschnitt.
»Sie trägt rote Schuhe mit hohen Absätzen, eine schwarze Hose und einen knallroten Kurzmantel, aus Mailand, erst vor drei Tagen gekauft. Den liebt sie über alles, den roten Mantel. Juli hebt sich nämlich gern von der Masse ab.«
»Am besten, Sie gehen ins Hotel zurück und warten ab, bis sie sich meldet. Ich bin überzeugt, es wird nicht mehr lange dauern. Vielleicht ist sie längst wieder dort und wundert sich, wo Sie stecken.«
Jetzt lernte ich den Mann von einer neuen Seite kennen: »Ich habe lange genug gewartet. Ich fahre jetzt nach Hause. Mit dem Zug.«
Genug Geld für ein Ticket nach Düsseldorf hatte er in der Tasche. Außerdem Kreditkarten. Allerdings musste er erst noch sein Gepäck aus dem Hotel holen und das Zimmer bezahlen. Zum Bahnhof würde er ein Taxi nehmen. Am Ende überreichte er mir eine nobel aussehende Visitenkarte. Als Beruf war »Künstler« angegeben.
»Falls ich etwas höre, melde ich mich umgehend«, versprach ich ein wenig versöhnlicher. »Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen.«
Acht Stunden später war ausgerechnet ich es, der Juliana von Lembkes Leiche fand.
2
»Vergiss es«, keuchte ich. »Glaub mir doch, Theresa, es wird nicht klappen.«
Auch meine Göttin war außer Atem, weshalb es mit der Antwort ein wenig dauerte. »Es muss aber«, brachte sie endlich heraus. »Es muss und es wird klappen. Ich lasse da nicht locker.«
Abrupt blieb sie stehen, stützte die Hände auf die Knie, schnappte mit rotem Gesicht nach Luft. Ich lief einige Schritte weiter und freute mich, dass sie vor mir aufgegeben hatte. Noch hundert Meter und ich hätte selbst die weiße Fahne gehisst. Seit die Tage wieder länger wurden, hatten wir unser von Theresa verordnetes und streng überwachtes Abnehmprogramm um den Punkt »körperliche Fitness« erweitert. Jede Kalorie, die man verbrauchte, konnte sich einem nicht um die Taille legen. Mit dem Abnehmen hatten wir im November begonnen. Inzwischen hatte sie fast zehn Kilo verloren, was ihr sehr gut stand, obwohl sie noch immer eine üppige Frau mit den richtigen Rundungen an den passenden Stellen war. Ich selbst hatte nur acht Kilo geschafft, aber auch das war ein deutlicher Gewinn an Lebensqualität, wie ich zugeben musste.
Ich machte einige symbolische Dehn- und Lockerungsübungen, und es gelang mir recht gut zu verbergen, dass auch ich nach Atem rang. Schließlich richtete Theresa sich wieder auf, und wir trabten in gemäßigtem Tempo weiter. Die Runde, die wir jeden zweiten Abend liefen, führte in nordwestlicher Richtung aus Neuenheim hinaus auf die Felder westlich von Handschuhsheim, in weitem Bogen zum Neckar und an dessen Ufer entlang zurück zu Theresas Haus. Hin und wieder versuchten wir, die Laufstrecke um zwei-, dreihundert Meter zu verlängern. Anfangs hatte das recht gut funktioniert, aber jetzt, nach drei Wochen mehr oder weniger eifrigen Joggens, ging es plötzlich nicht mehr voran. Theresa hatte auch zu diesem Punkt Ratgeber studiert und meinte, das sei völlig normal. Nicht nur Kinder, auch Fitness entwickle sich in Schüben, und man müsse eben Geduld mit sich selbst haben.
Wir bogen auf den Weg am Neckarufer ein. Weit vor uns tauchten die Hochhäuser des Uniklinikums und des Deutschen Krebsforschungszentrums auf. Noch weiter entfernt, im Abenddunst kaum noch zu erkennen, das Heidelberger Schloss über den Türmen der Altstadt. Es roch nach brackigem Wasser und ein wenig vielleicht doch schon nach beginnendem Frühling. Noch immer war es abends so kalt, dass wir zum Laufen lange Hosen und Kapuzenpullis trugen.
Erst jetzt wurde mir bewusst, dass Theresa seit einiger Zeit schwieg, und als ich sie ansah, blickte ich in eine sauertöpfische Miene.
»Ich meine es doch nicht böse«, sagte ich versöhnlich. »Ich würde mich ja freuen für dich und Milena. Aber es gibt nun mal Vorschriften und Regeln …«
»Vorschriften und Regeln sind das eine«, schnappte sie, »Moral ist etwas anderes.«
»Das brauchst du einem Polizisten nicht zu erklären«, biss ich zurück. »Trotzdem wirst auch du um die Bestimmungen des deutschen Asylrechts nicht herumkommen.«
»Ich will und werde Milena nicht in ihr Elend zurückschicken, ist das denn so schwer zu begreifen?«, schnaubte sie in einem Ton, als wäre ich es, der sich all die lästigen Gesetze ausdachte.
»Im Gegenteil«, blaffte ich zurück, »das ist sogar für einen einfältigen Beamten wie mich zu begreifen. Aber es ändert nichts an den Tatsachen. Wir können nun mal nicht alle Menschen aufnehmen, die sich in ihrer Heimat nicht wohlfühlen.«
»Erstens geht es nicht um alle Menschen, sondern um Milena. Und zweitens will ich sie nicht aufnehmen, denn sie ist ja schon da.«
Es hatte keinen Zweck. Die Diskussion drehte sich im Kreis, wie sie es schon seit Wochen tat. Milena, eine – falls ihre Angaben überhaupt stimmten – siebzehnjährige Armenierin, wohnte nun schon seit vier Monaten bei Theresa. Im Zuge eines verzwickten Falls von miesester Geschäftemacherei war sie ohne Papiere in Deutschland gestrandet, mit knapper Not dem Mann entronnen, der sie hergebracht und für sein schmutziges Gewerbe missbraucht hatte. Um die junge Frau vor ihm in Sicherheit zu bringen, hatte ich sie seinerzeit kurz entschlossen bei Theresa einquartiert. Heute saß der Täter längst in U-Haft, wartete auf seinen Prozess, und Theresas Schützling drohte zumindest von seiner Seite keine Gefahr mehr.
Das eigentliche Problem war, dass Theresa einen Narren an der Frau gefressen hatte, die fast noch ein Teenager war, und partout nicht einsehen wollte, dass diese nun in ihr Heimatland zurückkehren musste. Theresa konnte aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen, worunter sie zeitlebens gelitten hatte. Und nun war ihr ausgerechnet durch mich mehr oder weniger in den Schoß gefallen, wonach sie sich so lange erfolglos gesehnt hatte: ein junger Mensch, um den sie sich kümmern, für den sie sorgen konnte. Und das tat sie nun mit aller Energie und Verbissenheit, die ihr zur Verfügung stand, und das war eine Menge. Leider rannte sie dabei jedoch unentwegt gegen die dicken Mauern der deutschen Bürokratie und des Asylrechts an.
Am Flussufer stob eine Gruppe erschrockener Stockenten laut quakend ins Wasser, die wir wohl aus dem Halbschlaf geschreckt hatten.
»Ich verlange doch nur, dass man sich ausnahmsweise mal nicht so ganz genau an deine verfluchten Vorschriften hält«, lenkte Theresa ein. »Das passiert doch praktisch jeden … Was ist?«
Ich war stehen geblieben, weil ich etwas gesehen hatte. Etwas Rotes an einer Stelle, wo es nicht hingehörte.
»Was ist los?«, fragte Theresa noch einmal, als ich zurückging, um unter den Ästen einer Weide zum steinigen Ufer hinabzusteigen.
Juliana von Lembke – roter Kurzmantel, schwarze Hose, nicht allzu groß, schwarzhaarig – lag mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Ihr auffälliger Mantel hatte sich in den Ästen der Weide verfangen, weshalb sie nicht weiter flussabwärts getrieben war.
Theresa hatte schon ihr Handy gezückt und reichte es mir, da ich mein eigenes zum Joggen nie mitnahm.
Dreißig Minuten später wimmelte es am Neckarufer von Menschen. Uniformierte Kollegen sicherten das Umfeld und hielten die Neugierigen in Schach, die immer und überall aus dem Boden zu wachsen schienen, wo es etwas vermeintlich Spektakuläres zu sehen gab. Mitarbeiter des Dezernats für Kriminaltechnik sicherten Spuren und machten Fotos. Kollegen vom Kriminaldauerdienst nahmen meine Aussage zu Protokoll und fertigten Skizzen vom Fundort an. Auch ein Arzt war da, und alle taten mit unaufgeregter Professionalität, was zu tun war. Die Leiche lag inzwischen am Rand des Uferwegs auf dem Rücken. Nach einer ersten flüchtigen Untersuchung erklärte der junge Arzt mit sommersprossigem Lausbubengesicht, zur Todesursache könne er noch nichts sagen.
»Äußere Verletzungen hat sie auf den ersten Blick keine. Mit der Obduktion wird es ein paar Tage dauern. Wir sind zurzeit ziemlich voll.«
Inzwischen war es dunkel geworden, und es nieselte ein wenig. Ich hatte die Kollegen um eine Decke gebeten, da mir beim Warten kalt geworden war. Theresa hatte sich bald verabschiedet, um sich zu Hause zusammen mit ihrer Untermieterin um das Abendessen zu kümmern.
Hübsch war sie, diese Frau von Lembke, ja, beinahe schön mit ihrer im Tod so überraschend friedlichen und unschuldigen Miene. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch nicht ahnen, dass sie mir die nächsten Wochen zur Qual machen sollte.
»Laut Obduktionsbericht eindeutig Suizid«, verkündete Klara Vangelis vier Tage später bei der Lagebesprechung zum Wochenbeginn. »Nach dem Wenigen, was das Labor an Spuren gefunden hat, ist sie wohl von der Alten Brücke gesprungen.«
Abgesehen von Abschürfungen an der linken Hand und an der Hinterseite des rechten Unterschenkels hatten die Rechtsmediziner keinerlei Verletzungen an der Toten gefunden. Weder innere noch äußere.
»An der verletzten Hand waren Anhaftungen von rotem Sandstein«, fuhr Vangelis fort. »Sie hat sich die Schrammen vermutlich zugezogen, als sie im letzten Moment versuchte, sich an der Brüstung festzuhalten.«
Was Selbstmörder nicht selten taten, wenn in der letzten Sekunde der Selbsterhaltungstrieb noch einmal die Oberhand über die Todessehnsucht gewann. Vangelis blätterte den vorläufigen Bericht um, der aus nur drei zusammengetackerten Blättern bestand, überflog den Text.
»Keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung, keine Hämatome, keine Abwehrverletzungen, nichts, was irgendwie auffällig wäre.«
Da die Tote nicht einmal vierundzwanzig Stunden im Wasser gelegen hatte, war es unseren Technikern gelungen, am Mantel DNA-Spuren zu sichern, deren Auswertung jedoch noch einige Tage dauern würde.
Vangelis sah auf. »Sie hatte einiges getrunken an dem Abend. Ansonsten keine ungewöhnlichen Substanzen im Blut, keine Anzeichen für Betäubungsmittel, alles clean und unauffällig.«
Der noble Mercedes mit Düsseldorfer Kennzeichen war erst gestern, am Sonntag, gefunden worden. Er hatte im Halteverbot nahe der Handschuhsheimer Tiefburg gestanden, im Zentrum des nördlichsten Stadtteils Heidelbergs. Ein wutentbrannter Anwohner hatte die Polizei gerufen, nachdem er sich mehrere Tage lang über den rücksichtslosen Besitzer der Nobelkarosse geärgert hatte, und einem ausgeschlafenen Kollegen war aufgefallen, dass der Wagen auf der Suchliste stand.
Der Mercedes gehörte nicht Frau von Lembke, sondern ihrem Arbeitgeber, der ORMAG, einer Aktiengesellschaft, deren Namen ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal hörte und bis ans Ende meiner Tage nicht wieder vergessen werde.
»Der Kofferraum war voll mit Reisegepäck.« Vangelis klappte die dünne Akte zu. »Im Innenraum eine ziemliche Unordnung, wie das so ist auf dem Heimweg aus dem Urlaub. Ansonsten nichts von Bedeutung. Keine Anzeichen für einen Kampf oder auch nur ein Handgemenge.«
Nur ein Punkt war momentan noch ungeklärt: Die Handtasche der Toten war verschwunden. Und außerdem ihr Handy, das sich vermutlich darin befand. Die Tasche war von Prada, hatte Vangelis in Erfahrung gebracht, aus schwarzem Kalbsleder, mit Schulterriemen. Ein letztes Mal blätterte sie in ihren Unterlagen, klappte die Mappe dieses Mal endgültig zu.
»Also vielleicht doch ein Raubüberfall?«, überlegte ich laut.
Meine Mitarbeiterin schüttelte energisch ihre schwarze Lockenpracht. »Eine Frau lässt sich nicht einfach die Handtasche wegnehmen, ohne sich zu wehren. Ich bin mir sicher, die Tasche treibt noch irgendwo im Neckar und wird früher oder später gefunden.«
Die Erste Kriminalhauptkommissarin Klara Vangelis war die Tochter griechischer Eltern, jedoch in Deutschland geboren und aufgewachsen und eine meiner besten Kräfte. Wenn nicht die beste.
»Gut.« Ich lehnte mich entspannt zurück. »Was haben wir sonst?«
Abgesehen vom alltäglichen Wahnsinn – Wohnungseinbrüchen, Taschendiebstählen, den üblichen Altstadtraufereien am Samstagabend mit diversen blutigen Nasen und vermissten Zähnen – herrschte in Heidelberg und Umgebung Frieden. Eine ruhige Woche lag vor uns. Und der Fall Juliana von Lembke konnte zu den Akten gelegt werden.
Dachte ich.
3
Wieder zwei Tage später trillerte mittags um kurz vor eins mein Telefon. Sönnchen, meine unersetzliche Sekretärin, Beraterin und Trösterin in allen Lebenslagen, hatte einen Anruf aus Berlin in der Leitung.
»Ein Herr Schmidt vom Verteidigungsministerium«, sagte sie. »Ich weiß, Sie essen grad …«
»Stellen Sie ruhig durch.« Ich würgte den Happen hinunter, den ich eben von meinem zweiten Mittagsapfel gebissen hatte.
Am Vorabend hatten Theresa und ich wieder einmal das Endlosproblem Milena durchgekaut. Meine Liebste war eine kluge, gebildete Frau, aber bei diesem Thema versagte ihre Intelligenz vollständig. Mit Zähnen und Klauen wehrte sie sich gegen die Einsicht, dass sie ihre Beinahe-Adoptivtochter früher oder später würde ziehen lassen müssen, wenn sie sich nicht zumindest der Verdeckung einer Straftat schuldig machen wollte. Ihre Argumente waren im Lauf des Abends immer absurder geworden, und als sie mir schließlich in ihrer Rage unterstellte, ich würde sie im Fall des Falles vermutlich anzeigen, war mir der Kragen geplatzt. Zum ersten Mal seit Langem waren wir ohne Kuss auseinandergegangen. Entsprechend mies war heute meine Laune.
»Schmidt hier!«, wurde ich angebellt, nachdem es im Hörer einige Male geknackt hatte. »Sekündchen noch, bitte.«
Herrn Schmidt gefiel es, mich noch eine Weile warten zu lassen. Vielleicht wechselte er noch einige letzte Sätze mit einem Besucher, während ich mir fast die Hälfte von »Für Elise« von Ludwig van Beethoven anhören durfte. Hätte er mich nicht behandelt wie einen Bittsteller oder einen kleinen Bediensteten, dann wäre Juliana von Lembkes Tod vielleicht für alle Ewigkeit ein Selbstmord geblieben. Aber so war ich schon ziemlich verärgert, als ich zum zweiten Mal seine laute Stimme hörte.
»Herr Gerlach!«, begrüßte er mich schließlich in leutseligem, beängstigend gut gelauntem Ton. Und in genau diesem Moment drückte ich – bis heute kann ich nicht sagen, weshalb – das Knöpfchen an meinem Cheftelefon, das die Gesprächsaufzeichnung aktivierte. »Ich spreche doch mit Kriminaloberrat Gerlach?«
Ich bejahte. »Und mit wem habe ich die Ehre?«
»Schmidt hier, Axel Schmidt. Schön, ja. Ich habe eigentlich nur eine einzige kurze Frage, dann lasse ich Sie auch schon wieder in Ruhe, verehrter Herr Gerlach. Es geht um eine Frau von Lembke, Juliana. Sie ist kürzlich in Ihrem Zuständigkeitsbereich zu Tode gekommen, wie ich eben erfahren habe. Sie kennen den Fall?«
Er hatte einen leichten Sprachfehler, der sich insbesondere bei s-Lauten bemerkbar machte.
»Natürlich …«
»Schön, ja. Es heißt, sie habe Selbstmord begangen?«
»Die Spurenlage und die Ergebnisse der Obduktion sprechen dafür.«
»Fremdverschulden kann also ausgeschlossen werden?«
Axel Schmidt stammte aus dem Norden und hatte einen ganz ähnlichen Akzent wie Sven Balke, einer meiner Mitarbeiter, der in der Nähe von Bremen groß geworden war.
»Definitiv. Aber darf ich vielleicht erfahren, weshalb Sie sich für den Fall interessieren?«
Der Mann in Berlin lachte laut und herzlich. »Das dürfen Sie, selbstverständlich dürfen Sie das, Herr Gerlach. Es ist ja überhaupt kein Geheimnis. Ich habe Frau von Lembke gekannt, das ist alles. Wir hatten hin und wieder beruflich miteinander zu tun und haben uns – nun ja – angefreundet wäre zu viel gesagt. Aber dennoch, so eine Nachricht …«
Die Tote hatte bei ihrem Arbeitgeber in Düsseldorf eine hohe Position bekleidet, erfuhr ich erst jetzt.
»Mitglied des Vorstands, wie Ihnen sicherlich bekannt ist.«
Missmutig verneinte ich.
»Schön, ja. Juliana ist … sie war eine toughe Frau. Hart im Verhandeln, aber verlässlich wie der sprichwörtliche Kruppstahl, hahaha. Wenn Juli sagte, das läuft, Vertrag kommt nächste Woche, dann lief das, und der Vertrag kam in der folgenden Woche …«
Eine uralte Regel, die jeder Polizist dieser Welt im Blut hat, geht so: Macht jemand um einen bestimmten Punkt auffallend viele Worte, dann ist etwas faul an dem, was er sagt. Die Wahrheit lässt sich fast immer kurz und knapp ausdrücken.
»Ich darf Ihren Ausführungen also entnehmen, dass Frau von Lembke aus freien Stücken aus dem Leben geschieden ist?«, fragte Herr Schmidt in Berlin nun schon zum dritten Mal. »Gibt es vielleicht irgendeinen Hinweis auf den Grund ihres Freitods?«
»Ihr Mann sagte etwas von einer Ehekrise, aber …«
»Eine Ehekrise, aha. Schön, ja.«
»Mehr kann ich nicht dazu sagen.«
»Das ist auch gar nicht nötig, verehrter Herr Gerlach«, rief Herr Schmidt, jetzt plötzlich wieder voller Begeisterung und keineswegs im Ton eines Menschen, der um eine Beinahe-Freundin trauert. »Ich bin Ihnen zu allergrößtem Dank verpflichtet und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.«
Die Nummer, von der dieser merkwürdige Zeitgenosse angerufen hatte, war nicht angezeigt worden, stellte Sönnchen fest. Und sie ließ sich mit unseren üblichen Methoden auch nicht herausfinden, obwohl das Unterdrücken der Telefonnummer vor einem Anruf bei der Polizei normalerweise wirkungslos ist.
Nachdenklich verspeiste ich den Rest meines Apfels. Anschließend wählte ich die Nummer des Verteidigungsministeriums, die Sönnchen für mich in der Zwischenzeit recherchiert und auf einen ihrer rosafarbenen Klebezettelchen geschrieben hatte. Am anderen Ende meldete sich eine jugendliche Stimme, bei der ich mir nicht sicher war, ob ich mit einer Frau oder einem Mann sprach.
»Säuberlich?«
»Ich möchte gerne noch mal kurz Herrn Schmidt sprechen. Axel Schmidt. Wir haben gerade eben telefoniert.«
»Das kann … Moment … eigentlich nicht sein. Ich sitze hier in der Telefonzentrale, und auf meiner Liste steht kein Axel Schmidt.«
Was wir beide seltsam fanden.
»Wissen Sie was? Ich gebe Sie mal an die Regierungszentrale.«
Es klickte und knackte. Dann eine andere Stimme, dieses Mal eindeutig die eines Mannes.
»Axel Schmidt«, wiederholte ein abgekämpft klingender Telefonist in einem Ton, als hätte ich ihn gebeten, am Wochenende mein Bad zu putzen. »Hinten mit t oder d oder dt?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung«, gestand ich wahrheitsgemäß.
»Wann soll das gewesen sein? Ist es vielleicht schon länger her?«
»Vor fünf Minuten haben wir aufgelegt.«
»Moment, das haben wir gleich …«
Es dauerte dann doch eine ganze Weile, bis ich hörte: »Neun Stück kann ich Ihnen anbieten.«
Ein Axel Schmitt war Hausmeister beim Wirtschaftsministerium, ein Axel Schmied Pilot bei der Flugbereitschaft, einer mit ie und t Ministerialdirigent im Kanzleramt. Am Ende war der arme Kerl in Berlin hörbar froh, mich süddeutschen Plagegeist endlich loszuwerden.
»Und er hat wirklich gesagt, er sei von der Regierung?«, fragte ich Sönnchen, als wir kurz darauf unseren gemeinsamen Nachmittagskaffee tranken.
»Er ruft aus Berlin an, vom Verteidigungsministerium, hat er gesagt. Hat superwichtig getan, da hab ich ihn lieber gleich an Sie weitergereicht.«
Die entspannte Stimmung von Montagmorgen hatte bis heute angehalten. Unser aller Chef, der leitende Kriminaldirektor Thaddäus Kaltenbach – wie sadistisch müssen Menschen veranlagt sein, die ihrem Sohn einen solchen Vornamen geben? –, weilte auf Dienstreise in den USA, wodurch das E-Mail-Aufkommen merklich nachgelassen hatte. Als einer von nur vier deutschen Teilnehmern (ein Punkt, auf den er mächtig stolz war) besuchte er in Seattle eine internationale Konferenz zum Thema »Predictive Policing«. Der Begriff bedeutete im Wesentlichen, dass man Computerprogramme einsetzte, die imstande waren, Verbrechen vorherzusagen. Das Ganze basierte letztlich, soweit ich es verstanden hatte, auf Erfahrungen aus der Vergangenheit und einer Sammlung von Vorurteilen. Wo früher schon eingebrochen wurde, war das Risiko hoch, dass es auch künftig geschehen würde. In einem Viertel, in dem bevorzugt Langzeitarbeitslose und Trinker lebten, war die Wahrscheinlichkeit größer, nachts auf der Straße belästigt zu werden, als dort, wo die wohlhabenden Schichten zu Hause waren. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass man solche Dinge auch früher schon und ohne Zuhilfenahme ausgeklügelter Software gewusst hatte, aber so etwas durfte man in Kaltenbachs Beisein nicht sagen, wollte man nicht als alter Zausel dastehen, der mit den Fortschritten der modernen Technik nicht mehr Schritt halten konnte.
Während des Gesprächs mit Berlin war mir siedend heiß eingefallen, dass ich seit Tagen ein privates Telefonat führen wollte. Seit dem Wochenende schob ich es schon vor mir her, dachte mir immer neue Ausreden aus, weshalb ich es dann doch wieder auf morgen verschob.
Sönnchen saß wieder an ihrem Schreibtisch, mein Kaffeebecher war geleert, das Handy lag vor mir, die Nummer war eingespeichert. Ich gab mir einen Ruck.
Es tutete einmal, zweimal, dreimal, dann hörte ich eine erschreckend brüchig gewordene Altmännerstimme »Gerlach?« sagen.
»Ich bin’s.«
»Wer? Alex, du?«
Nach der Pensionierung meines Vaters hatten sich meine Eltern im Süden niedergelassen. Schon immer hatten sie davon geträumt, am Meer zu leben, und zwar dort, wo auch im Winter die Sonne schien und Minusgrade Seltenheitswert hatten. An der Algarve, ganz im Süden Portugals, meinten sie das Ziel ihrer Träume gefunden zu haben. Sie hatten sich einen Bungalow mit unverbaubarem Blick auf den Atlantik gekauft, keine zweihundert Meter vom Strand entfernt.
»Wie geht’s dir, Papa?«
»Wie soll’s mir schon gehen?«, knurrte er. »Scheiße geht’s mir. Wieso willst du das wissen? Interessierst dich doch sonst nicht dafür, was mit mir los ist.«
Ich atmete tief durch. Sagte stumm: Ommmmm. Laut sagte ich: »Natürlich interessiert es mich. Ich hab nur nicht jeden Tag Zeit zum Telefonieren.«
»Jeden Tag?« Mein alter Vater lachte bitter. »Wann hast du denn zum letzten Mal angerufen?«
»Das kann ich dir genau sagen: an Weihnachten. Und davor an deinem Geburtstag. Und jedes Mal hatte ich den Eindruck, dass es dir gut geht. Dass du eigentlich gar keine Lust hast, mit mir zu reden. Weil du viel lieber mit deiner Elvira rummachst.«
Vor anderthalb Jahren hatte es meinem damals dreiundsiebzigjährigen Vater gefallen, sich eine zwanzig Jahre jüngere Geliebte zuzulegen. Was unter anderem dazu führte, dass meine Mutter nun seit einiger Zeit in Heidelberg lebte.
»Elvira?« Sein Lachen wurde noch böser. »Wer ist das denn?«
»Es ist aus zwischen euch?«
»Das freut dich jetzt, gell?«
»Im Gegenteil, es tut mir leid.«
»Lüg nicht. Immer hab ich versucht, dir beizubringen, dass man nicht lügen soll. Aber es klappt einfach nicht. Sogar als Vater bin ich ein Versager.«
»Bist du betrunken?«
»Red keinen Blödsinn. Ich bin stocknüchtern.«
»Ich meine es ehrlich, Papa. Ich habe mir eingebildet, ihr seid glücklich miteinander.«
»Glücklich? Scheiß drauf!«
»Du hast auch versucht, mir beizubringen, dass man solche Wörter nicht sagt.«
»Da warst du ein Kind. Ich bin alt. Ich darf das. Ich hab’s nicht mehr nötig, den Leuten zu gefallen. Soll ich dir was sagen? Es geht mir sogar am Arsch vorbei, ob man mich mag oder nicht. Ich komm allein klar. Und die paar Jahre, bis ich abkratze, die krieg ich schon noch irgendwie rum. Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, sich totzusaufen. Die haben einen verdammt guten Rotwein hier unten.«
Ich würgte den Seufzer hinunter, der in meiner Kehle steckte. »Eigentlich rufe ich wegen Mama an. Es geht ihr nicht besonders.«
Am Freitagabend hatte ich meine Mutter endlich wieder einmal besucht. Wie meist mit schlechtem Gewissen, einem kleinen Frühlingsstrauß aus dem Supermarkt und einer Flasche halbtrockenem Spätburgunder vom Kaiserstuhl. Ich hatte an ihrer Tür geläutet in der Erwartung, wie üblich ein fröhliches Damenkränzchen anzutreffen. Meine inzwischen fünfundsiebzigjährige, aber immer noch lebenslustige und kontaktfreudige Mutter inmitten ihrer zahllosen Freundinnen, sodass ich mich bald wieder verdrücken konnte. Aber in der Wohnung war es merkwürdig still gewesen. Mutter hatte mir erst nach mehrmaligem Läuten die Tür geöffnet, mich anfangs nicht einmal hereinlassen wollen.
Sie war ganz allein gewesen.
Und außerdem betrunken, abends um halb sieben.
»Und es war nicht das erste Mal, Papa.«
»Dann kümmere dich mehr um sie.«
»Sie ist deine Frau.«
»Sie hat mich sitzen lassen.«
Nun war ich derjenige, der gallig lachte. »Du hast sie betrogen, mit allem Drum und Dran. Was hättest du denn an ihrer Stelle gemacht?«
»Ich? Na ja, gekämpft wahrscheinlich. Gekämpft wie ein Löwe. Man rennt doch nicht einfach weg, wenn einem am anderen irgendwas liegt, verdammte Scheiße noch mal.«
»Weglaufen war vielleicht ihre Art zu kämpfen.«
»Und was soll ich jetzt machen? Kathrin ist alt genug. Die weiß schon, was sie tut.«
»Genau das glaube ich nicht. Ich denke, es wäre gut, wenn du sie wenigstens mal anrufen würdest.«
Kurzes Schweigen. Dann plötzlich ziemlich verzagt: »Sie legt doch sowieso gleich auf. Das brauch ich gar nicht zu versuchen. Die Sache mit Elvira, die verzeiht sie mir nie.«
Ein zweites Mal atmete ich tief durch, um nicht loszubrüllen. »Sie ruft dich nicht an, weil sie sauer auf dich ist. Du rufst sie nicht an, weil du dich nicht traust. Wie wäre es, wenn ihr zwei alten Sturköpfe euch zur Abwechslung mal wie erwachsene Menschen benehmen würdet?«
»Sag mal, spinnst du jetzt? Wie redest du eigentlich mit mir?«
So ging es eine Weile hin und her, der Ton wurde lauter und schärfer, manchmal verletzend, und am Ende geschah etwas völlig Unerwartetes: Mein Vater gab klein bei. Er räumte ein, dass sein schlechtes Gewissen ihn quälte und er einsam war in seinem weißen Haus mit Dattelpalmen im Garten und blühenden Mandelbäumen und Meerblick.
»Aber anrufen tu ich sie nicht. Auf keinen Fall.«
»Doch, Papa, genau das wirst du tun. Und zwar am besten jetzt gleich.«
Er sperrte und zierte sich noch ein wenig. Aber schließlich willigte er brummelnd ein.
Mehr aus Langeweile und weil mein Chef so weit weg war, besuchte ich die Internetseiten der ORMAG in Düsseldorf. Hinter dem nichtssagenden Namen verbarg sich ein Konzern, der weltweit fast fünfzigtausend Menschen beschäftigte. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der sogenannten Wende war er aus dem Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf hervorgegangen. Die Treuhand hatte die traditionsreiche Stahlschmelze westlich von Berlin in ihre Einzelteile zerlegt, um die verkäuflichen Brocken zu Geld zu machen und den Rest zackig abzuwickeln, wie es seinerzeit Brauch war. Heute war die ORMAG ein Mischkonzern, der offenbar alles Mögliche machte, solange es irgendwie mit Technik zu tun hatte. Unter vielem anderen baute man Stanz- und Spritzgussmaschinen, kleine Kräne, die auf große Lkws montiert wurden, Gabelstapler, aber auch Elektronik für industrielle Anwendungen und andere kompliziert klingende Dinge, die mir nichts sagten.
Juliana von Lembke stand als CSO auf Platz drei der sieben Vorstandsmitglieder. Chief Strategy Officer – auf Deutsch Chefin der Strategieplanung. Ein hübsches, herzförmiges, für ihr Alter erstaunlich jung wirkendes Gesicht lächelte mich an. Nur wenn man genauer hinsah, bemerkte man eine gewisse Kälte in ihrem Blick. Eine Kälte, die darauf schließen ließ, dass man sich diese Frau besser nicht zum Feind machte.
»Ich finde, er spricht ein wenig wie Sie«, sagte ich zu Sven Balke, nachdem ich ihm die Aufzeichnung meines Telefonats vorgespielt hatte.
»Aus meiner Ecke kommt er nicht«, meinte er mit gerunzelter Stirn. »Ich tippe eher auf Hamburg, vielleicht Richtung Süden. Dürfte ich noch mal?«
Balke stammte aus dem Norden, man hörte es, sobald er den Mund öffnete, und auch seine helle Haut und das weißblonde Haar verrieten es. Allerdings war von Haaren momentan kaum etwas zu sehen, da er sie täglich abrasierte. An beiden Ohren funkelten silberne Stecker und Ringe fröhlich im Licht einer bleichen Spätnachmittagssonne.
Erneut startete ich die Wiedergabe.
»Lüneburg vielleicht. Oder Soltau …«
Über Balkes markantes Gesicht ging ein Leuchten. »Ich habe einen Cousin in der Nähe von Soltau. Wenn ich dem den Mitschnitt schicken dürfte …?«
»Kann er den Mund halten?«
»Jörg ist ein norddeutscher Bauer ohne Frau. Der redet, sogar wenn er stockbesoffen ist, nicht mehr als drei Worte pro Stunde.«
»Wenn wir das machen, dann stehen wir beide mit einem Fuß im Gefängnis.«
»Schon klar, Chef.«
»Niemand sonst darf das hören. Nur Ihr schweigsamer Cousin.«
»Selbstverständlich, Chef.«
»Und Sie können die Aufzeichnung aus meinem Telefon herausholen?«
»Die ist nicht in Ihrem Telefon, Herr Gerlach«, erwiderte Balke milde und federte hoch. »Lassen Sie mich nur machen.«
4
Praktischerweise war Kai Meerbusch schon wieder in Heidelberg, erfuhr ich, als ich seine Handynummer wählte.
»Ich musste Juli identifizieren«, murmelte er erschöpft. »Man hat mich darum gebeten. Und es war … Ich war … oh Gott!«
Ich sprach ihm mein Beileid aus, was er kommentarlos über sich ergehen ließ, und fügte hinzu, ich würde mich gerne noch einmal mit ihm unterhalten.
»Es haben sich in der Zwischenzeit noch ein, zwei Fragen ergeben.«
»Fragen?«, hauchte der frischgebackene Witwer erschrocken. »Ich dachte … ist nicht längst alles geklärt?«
»Im Prinzip ja, natürlich.«
»Muss ich zu Ihnen kommen?«
»Wenn es Ihnen lieber ist, können wir uns auch gerne irgendwo anders treffen.«
»Das wäre mir wirklich lieber. Ich fühle mich im Moment nicht so …«
»Vielleicht in einem Lokal in Ihrer Nähe?«
Auch ein Lokal war dem verstörten Künstler nicht angenehm. Dieses Mal war er nicht in einem teuren Hotel abgestiegen, sondern hatte sich per Airbnb eine preiswerte Unterkunft an der Rohrbacher Straße besorgt.
»Ein kleines Zimmer mit Kochecke und Kühlschrank, so kann ich … muss ich nicht … Sie können gerne zu mir kommen. Ich habe … ohnehin nichts zu tun. Die meiste Zeit liege ich auf dem Bett und versuche erfolglos, diese … diese entsetzlichen Bilder aus meinem Kopf zu bekommen.«
Seine Unterkunft lag mehr oder weniger auf meinem Heimweg, einige Kleinigkeiten waren zuvor noch zu erledigen. »Passt es Ihnen in einer Stunde?«
Als wir uns wortkarg verabschiedeten, klang Meerbusch noch frustrierter als zu Beginn unseres Telefonats. Vermutlich, weil es ihm nicht gelungen war, mich abzuwimmeln.
»Ich werde es nicht los«, waren seine ersten Worte, als er noch kraftloser als beim letzten Mal meine Hand drückte. Kai Meerbusch war blass wie ein Leichentuch. »Der Anblick hat sich mir regelrecht ins Gehirn gebrannt wie … Ich habe noch nie zuvor einen toten Menschen gesehen. Sogar als meine Eltern starben … Ich bin dem immer aus dem Weg gegangen. Und jetzt, ausgerechnet Juli, ich bin so … Aber kommen Sie doch bitte erst einmal herein.«
Sein Zimmer war Teil einer unübersichtlich großen Altbauwohnung im zweiten Obergeschoss eines gepflegten Hauses aus den Anfängen des zwanzigsten Jahrhunderts. Im langen Flur roch es säuerlich, als hätte jemand Gurken eingekocht. An den lindgrün gestrichenen Wänden hingen verstaubte Ölschinken in schweren, goldenen Rahmen. Irgendwo in den Tiefen der Wohnung lief überlaut ein Fernseher.
Wir betraten sein überraschend kleines Zimmer.
»Nehmen Sie doch Platz, bitte. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Zu trinken habe ich leider nur Wasser da. Ich könnte uns einen Kaffee machen. Aber ich muss Sie warnen, es gibt nur Instantkaffee.«
Die beiden hohen Fenster gingen zur Straße. Eines davon war gekippt, dennoch war die Luft hier stickig. Von unten drangen die Geräusche des Feierabendverkehrs herauf.
Meerbusch machte sich an einem alten, üppig verkalkten Wasserkocher zu schaffen. Minuten später stellte er auf den quadratischen Tisch zwischen den Fenstern ein kleines Holztablett, auf dem eine Glaskaraffe mit Leitungswasser sowie zwei dampfende Tassen samt Tellerchen mit Goldrand und Blümchenmuster standen. Sogar an Milch und Zucker hatte er gedacht. Nur die Gläser für das Wasser hatte er vergessen. Beinahe panisch stürzte er zurück in seine Kochecke, um das Fehlende zu holen.
Dann waren die Vorbereitungen endlich erledigt, Meerbusch setzte sich auf das leise quietschende Singlebett, und wir konnten beginnen.
»Sie haben mir gar nicht erzählt, dass Ihre Frau Managerin war«, sagte ich, ohne ihn anzusehen. »Vorstandsmitglied eines Weltkonzerns, das ist schon was.«
»Spielt das denn … irgendeine Rolle? Denken Sie, sie hat sich wegen ihrer Arbeit …? Das wäre doch ganz … sinnlos. Sie hatte doch Erfolg. Viel Erfolg. Oder denken Sie etwa, sie hat sich doch nicht …?«
Ich nippte an dem brühheißen Kaffee, der überraschend gut schmeckte. »Alle Indizien sprechen für Selbstmord. Es ist nur …« Verlegen zuckte ich mit den Achseln, drehte die Tasse ein wenig hin und her. »Ich sehe einfach kein Motiv. Sie sagen selbst, Ihre Frau war beruflich erfolgreich. Ihre Ehe war nicht ganz problemlos, aber welche Ehe ist das schon? Und wegen einer kleinen Ehekrise springt man nicht gleich von einer Brücke. Hatten Sie den Eindruck, dass sie sich in letzter Zeit verändert hat? Dass sie Sorgen hatte? Sich mit dem Vorstandsposten vielleicht zu viel zugemutet hat?«
Meerbusch sah mich aus trüben Augen verständnislos an. »Im Gegenteil. Juli stand in letzter Zeit unter Dauerstrom. Ständig war sie unterwegs, hat Firmenzukäufe organisiert und solche Dinge. Allerdings haben wir wenig über ihre Arbeit gesprochen. Was ich weiß, weiß ich fast nur von Telefonaten, die ich mitgehört habe. Sogar während unseres Urlaubs hat sie telefoniert. Ziemlich oft.«
»Was Sie nicht immer gefreut hat, nehme ich an.«
Er lächelte verwirrt, trank einen Schluck, verzog den Mund, weil der Kaffee immer noch heiß war. »Eigentlich sollte dieser Kurzurlaub eine Auszeit sein. Eine Pause, in der wir wieder zu uns finden wollten, als Paar, aber dann …«
»… stand für Ihre Frau doch wieder der Job an erster Stelle.«
Der trauernde Witwer blickte in seine Tasse, als wäre dort eine Lösung für seine Probleme zu finden.
Auf der Straße unten wurde wütend gehupt. Ein Radfahrer oder Fußgänger beschwerte sich brüllend und mit Kurpfälzer Kraftausdrücken garniert wegen irgendetwas. Daraufhin wurde die Hupe noch einmal gedrückt, dieses Mal länger.
»Sie haben sie sehr geliebt?«, fragte ich leise.
Meerbusch nickte, ohne aufzusehen. »Vielleicht zu sehr, denke ich manchmal.«
»Und umgekehrt?«
Dieses Mal musste ich lange auf die Antwort warten. Aber dann sagte er so fest, als müsste er sich selbst überzeugen: »Auf ihre Weise hat sie mich auch geliebt. Natürlich hat sie das.« Endlich sah er wieder auf und in mein Gesicht. »Was erwarten Sie von mir? Weshalb sind Sie hier?«
»Ich möchte mir einfach nur ein Bild von Ihrer Frau und ihren Lebensumständen machen. Ich möchte verstehen, was am vergangenen Mittwoch geschehen ist.«
Ich erzählte ihm, dass auch Vera, die Mutter meiner Töchter, vor drei Jahren überraschend verstorben war. Allerdings nicht durch Selbstmord, sondern an einem vereiterten Zahn.
»Sie haben Kinder?«, fragte er so überrascht, als wäre das eine absurde Vorstellung.
»Zwei Töchter. Zwillinge. Sie sind aber schon fast erwachsen.«
Er schlug die Augen nieder. »Ich hätte auch so gerne … Aber Juli wollte keine. Dabei hätte ich alles gemacht. Sie hätte weiter an ihrer Karriere arbeiten können.« Trostlos schüttelte er den schönen Kopf mit den leicht angegrauten Schläfen, rührte sinnlos in seiner immer noch vollen Tasse herum. »Kinder passten nicht in ihr Lebenskonzept, meinte sie. Inzwischen glaube ich, sie hat mich …«
Kai Meerbusch hätte sein Geld als Model verdienen können, dachte ich unwillkürlich. Für einen Mann war er wirklich auffallend schön. Wenn man diesen Typ Mann mit langen Wimpern, ewig traurigem Blick und ungeschickten Händen mag.
»Sie hat mich für einen Schwächling gehalten«, fuhr er fort. »Und im Grunde hatte sie recht. Wahrscheinlich hätten die Kinder sich nichts von mir sagen lassen, wären mir auf der Nase herumgetanzt. Sie war so voller Energie, immer sprudelte sie über vor neuen Ideen und Plänen.« Noch einmal nippte er versuchsweise an seinem Kaffee. »Was soll denn jetzt werden?«, fragte er seine Tasse. »Wie soll ich denn jetzt … Was soll denn jetzt werden?«
»Das Leben geht weiter«, versuchte ich ihm mit dem blödesten aller Trostsprüche Mut zu machen.
»Nicht zwingend, Herr Gerlach«, erwiderte er leise, aber bestimmt. »Nicht zwingend.«
An der Wand hinter ihm hing ein billig gerahmtes Aquarell, das in pathetischen Farben einen Sonnenuntergang über dem Meer zeigte. Kurz dachte ich an Portugal, an den Atlantik und meine Eltern, die sich gegenseitig das Leben schwer machten, statt es zu genießen.
»Haben Sie jemanden, der sich ein wenig um Sie kümmern kann?«
Meerbusch schüttelte matt den Kopf. »Meine Eltern leben nicht mehr. Mein bester Freund hat sich vor drei Jahren …« Mit einem Ruck sah er auf. »Haben Sie überhaupt so viel Zeit? Sie haben Fragen an mich, und ich jammere Ihnen die Ohren voll.«
»Ich habe Feierabend. Was war mit Ihrem Freund?«
Er hatte sich das Leben genommen. Früher schon hatte er an Depressionen gelitten, hatte irgendwann geheiratet, auch er nicht glücklich. Dann die Scheidung, Knall auf Fall, einige Monate Einsamkeit und am Ende Schlaftabletten.
Um ehrlich zu sein, es gab noch einen weiteren Grund für meine Geduld. Ich war froh, auf diese Weise Theresa noch eine Weile aus dem Weg gehen zu können. Den Tag über hatte sie sich nicht gemeldet. Und ich mich auch nicht bei ihr. Zudem hatte ich mit jeder Minute mehr den Eindruck, dass dieser übersensible und lebensuntüchtige Mann dringend jemanden zum Reden brauchte. Dass ich ihn jetzt nicht allein lassen durfte, wollte ich nicht den nächsten Todesfall mit nicht natürlicher Ursache am Hals haben.
»Ich muss Ihnen noch etwas sagen«, murmelte Meerbusch und pustete in seinen Kaffee. »Sie hat mir eine Nachricht geschickt. Eine SMS. Kurz vor ihrem Tod.«
Ich fuhr hoch. »Das sagen Sie mir erst jetzt?«
Der Grund dafür war, dass er nachts in seiner Wut und Einsamkeit das Handy an die Wand geworfen hatte. »Zu Hause in Düsseldorf habe ich mir dann ein neues gekauft, vorgestern erst, und deshalb habe ich die Nachricht erst so spät gelesen.«
Er zückte sein nagelneues dunkelblaues iPhone, fummelte mit unsicheren Bewegungen und krauser Stirn darauf herum, reichte es mir schließlich.
»Lieber Kai«, las ich, »ich kann so nicht weiterleiten. Ich halte es eindach nicht Meer aus. Es hat keinen zweckmehr. Biete verzeih mir, wenn du …«
Die Nachricht war am Mittwoch, dem neunten März um dreiundzwanzig Uhr siebenundvierzig versendet worden. Offenbar in großer Eile getippt und aus irgendeinem Grund abgeschickt, bevor sie fertig war.
»Das ändert die Situation natürlich grundlegend«, sagte ich. »Weshalb haben Sie mich nicht gleich informiert?«
»Ich dachte, es spielt keine Rolle mehr«, antwortete er mit der Miene eines beim Onanieren erwischten Vierzehnjährigen.
»Haben Sie heute überhaupt schon etwas gegessen?«, fragte ich, nachdem er die SMS an mich weitergeleitet und ich mich wieder beruhigt hatte.
»Gegessen?«, fragte er, als wäre ihm der Sinn dieses Wortes vorübergehend entfallen.
»Wir könnten zusammen irgendwo hingehen und uns beim Essen weiter unterhalten. So kommen Sie ein wenig unter Menschen.«
Diese Aussicht schien ihn nicht gerade zu erfreuen. Aber schließlich erhob er sich doch, zog wortlos ein sandfarbenes Leinenjackett über, und wir pilgerten los.
»Erfolg kann eine Droge sein«, sagte Kai Meerbusch, als wir uns einige Zeit später in einem ruhigen und noch schwach besuchten Ristorante gegenübersaßen.
Die Suche nach einem passenden Lokal war nicht einfach gewesen. Italiener schied aus, da der Magen meines Begleiters weder Olivenöl noch Käse vertrug. Inder kam nicht infrage, weil zu scharf für seinen empfindlichen Gaumen. Thai mochte er einfach so nicht. Grieche ging überhaupt nicht wegen des Geruchs und der Gewürze. Als mir klar wurde, dass es zumindest an diesem Abend nirgendwo auf der Welt ein Restaurant geben würde, das Meerbusch zusagte, hatte ich ihm die Entscheidung abgenommen und ihn kurzerhand ins Da Vinci an der Bahnhofstraße geführt, wo es auch Leichtes und Vegetarisches gab.
»Eine Droge wie Alkohol oder Kokain«, fuhr er fort.
Ich gab ihm recht.
»Das Verrückte ist nur, dass man für Drogen normalerweise bezahlen muss. Juli hingegen hat Geld dafür bekommen, dass sie ihrer Sucht frönte. Viel Geld.«
»Sie war für die Strategieplanung zuständig. Was bedeutet das konkret?«
Meerbusch seufzte einmal mehr. »Die Märkte ändern sich heutzutage ständig, hat sie mir einmal erklärt. Ein Unternehmen von der Größe der ORMAG muss sich deshalb unentwegt neu erfinden. Unrentable Unternehmensteile werden geschlossen oder abgestoßen. Neue Produkte werden entwickelt, neue Fabriken gebaut oder Firmen zugekauft.«
Aus unerfindlichem Grund kicherte er plötzlich albern und nippte dann wieder an seinem stillen, zimmerwarmen Wasser.
»Ständig hatte sie Besprechungen, ist in der Welt herumgejettet, um Kooperationen anzubahnen, neue, strategisch wichtige Kunden zu akquirieren oder kleine, zukunftsträchtige Hightechfirmen zu kaufen.«
Das Da Vinci war modern und hell eingerichtet. Edle weiße Tischdecken, dunkle Lederstühle und schlanke Vasen aus rotem Glas, die in den Fensternischen farbliche Akzente setzten. Inzwischen war es Viertel nach sieben, mehr und mehr Gäste kamen. Es duftete nach dem Süden, nach Meer und Knoblauch, dass mir das Wasser im Mund zusammenlief.
Wieder nippte der Künstler an seinem großen Becherglas, ohne wirklich zu trinken. Erst vor drei Wochen war seine umtriebige Frau zum Beispiel in Tel Aviv gewesen.
»Wozu, weiß ich natürlich nicht. Wie gesagt – wir haben wenig über ihre Arbeit gesprochen. Wenn sie abends nach Hause kam, dann wollte sie sich entspannen und den Stress des Tages hinter sich lassen.«
»Haben Sie den Namen Axel Schmidt schon einmal gehört?«, fragte ich auf gut Glück.
Ohne aufzusehen, schüttelte er den Kopf. Dann sah er mir plötzlich in die Augen, als wäre er eben erst aufgewacht. »Herr Gerlach, ich begreife immer noch nicht ganz, was das alles mit Julis Tod zu tun haben soll. Die SMS ist doch ganz eindeutig. Weshalb geben Sie sich nicht zufrieden damit, dass sie … es getan hat, aus welchen Gründen auch immer?«
»Von der SMS wusste ich vor einer halben Stunde noch nichts.« Ich trank ein Schlückchen von meinem Barbera d’Alba. »Damit haben sich meine Zweifel natürlich erledigt, Sie haben vollkommen recht.«
Wenn ich davon absah, dass Frau von Lembke die kurze Nachricht nicht zu Ende geschrieben hatte, bevor sie über das Brückengeländer kletterte. Und dass ich immer noch weit und breit kein Motiv für einen Selbstmord erkennen konnte. Weshalb diese Eile? Hatte sie Sorge gehabt, sie könnte Sekunden später den Mut für den letzten Schritt nicht mehr haben? Hatte sie plötzlich eine solche Verzweiflung übermannt, dass sie das Leben keinen Augenblick länger ertragen wollte?
Unser Essen wurde serviert. Ich hatte mir in einem Anfall von Verschwendungssucht Linguine al Gusto di Mare bestellt, mein Gegenüber einen Tomatensalat, der zu seinem Entsetzen Zwiebeln enthielt.
»Was für eine Art Künstler sind Sie eigentlich?«, fragte ich, um das Gespräch vorübergehend auf unvermintes Gebiet zu lenken.
»Ich male«, erwiderte er in einem Ton, als wäre dies ein Grund, sich zu schämen. »Und ich komponiere auch ein wenig. Nicht allzu erfolgreich, um ehrlich zu sein.«
Wieder herrschte eine Weile Stille. Meerbusch häufte stumm Zwiebeln an den Rand seines Tellers. Ich genoss meine Pasta und verbannte alle Gedanken an Kalorien für heute aus meinem Kopf. Am Nachbartisch lachte eine Frau auf, brach erschrocken wieder ab, als wäre es hier verboten, sich zu amüsieren. Eros Ramazzotti sang über Amore e Passione. Meerbusch starrte auf seinen Teller. Würgte schließlich mit sichtlichem Widerwillen ein Stück Tomate herunter. Es war nicht leicht, mit diesem unglücklichen Mann ein Gespräch zu führen, das diesen Namen verdiente.
»Die Angehörigen Ihrer Frau haben Sie schon informiert?«, fragte ich zwischen zwei Happen.
»Oh Gott!« Entsetzt sah er auf. »Daran habe ich bisher … Aber es gibt ja auch gar nicht viele Angehörige. Julis Mutter lebt noch, nicht weit von hier. Juli ist in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, wussten Sie das? In … wie heißt der Ort? Leimen? Gibt es das?«
Sie war ein Einzelkind gewesen, der Vater hatte seine Familie verlassen, als sie noch keine sechs Jahre alt war.
»Aber die Mutter, wie konnte ich nur …« Fahrig griff er sich an die Stirn.
»Was ist mit der Freundin, die sie besuchen wollte?«
Er steckte sich ein weiteres Tomatenstückchen in den Mund. »Ich weiß nicht, wo sie wohnt, ich habe ihre Nummer nicht. Ich weiß gar nichts über diese Anita, außer dass die beiden zusammen studiert haben, in Berlin.«
»Wann in der Nacht haben Sie Ihr Handy an die Wand geworfen?«
Er zögerte mit der Antwort. Das Thema war ihm sichtlich unangenehm. »Ich weiß es nicht mehr. Ich war betrunken. Irgendwann wurde es mir zu langweilig im Hotel. Ich bin in die Stadt gegangen, um noch irgendwo ein Glas Wein zu trinken. Wenn sie sich amüsierte, weshalb nicht auch ich?«
»In welchem Lokal waren Sie?«
»In verschiedenen. Ich habe mich treiben lassen, und am Ende war ich ziemlich … nun ja.«
»Wie und wann sind Sie wieder zum Hotel gekommen?«
Mit einem Taxi, so viel wusste er immerhin noch. »Es war schon spät. Aber wann genau …?« Achselzucken.
In diesem Moment kam mir zum ersten Mal der Verdacht, Meerbusch könnte befürchtet haben, seine Frau hätte die Nacht nicht bei ihrer Freundin, sondern bei einem anderen Mann verbracht. Zu dumm, dass wir das Handy der Toten bisher nicht gefunden hatten. Unsinn. Solange ich keine belastbaren Indizien dafür hatte, dass Frau von Lembke einer Gewalttat zum Opfer gefallen war, würde mir kein Richter erlauben, ihr Handy auch nur anzufassen.
»Diese Freundin, Anita, Sie wissen sonst wirklich nichts über sie?«
»Nur dass sie irgendwo in Heidelberg wohnt, verheiratet ist und drei Söhne hat. Laut Juli alles wüste Rabauken. Lärmig, rotzfrech, respektlos.«
All das also, was schon die alten Ägypter an der damaligen Jugend auszusetzen hatten.
Wieder stach er in ein Tomatenstück, betrachtete es gedankenverloren, legte die Gabel auf den Teller zurück, senkte den Kopf und begann unvermittelt, lautlos zu weinen. Seine Schultern zuckten, der Atem ging unruhig und stoßweise.
Ich fand ein unbenutztes Papiertaschentuch in der linken Hosentasche und reichte es ihm. Er schnäuzte sich wie ein Mädchen, wischte sich die Augen trocken, sah mir endlich wieder ins Gesicht.
»Ich kann nicht mehr«, flüsterte er mit jetzt fast irrem Blick. »Ich möchte jetzt lieber … bitte …«
Ich winkte der Bedienung und bat um die Rechnung.
»Und wenn er einfach mal eine Weile bei uns wohnt?«, fragte Louise beim gemeinsamen Abendessen mit hoffnungsvollem Blick.
Sie war die jüngere meiner beiden Zwillingstöchter und sah mitleiderregend aus. Blass, müde, mit dunklen Ringen unter den Augen. Seit Wochen, ach was, Monaten, machte ich mir Sorgen um sie. Erst nach langem Hin und Her hatte sie mir gestanden, dass ihr neuer und leider ziemlich fester Freund – wie von mir bereits länger vermutet − Michael Waßmer war. Der junge Mann studierte in Heidelberg Mathematik, war außerdem heroinabhängig und lebte zurzeit in einer Drogen-WG der übelsten Sorte. Ich hatte erst seine Mutter, dann ihn selbst während der Aufklärung eines abscheulichen Verbrechens kennengelernt, in dessen Umfeld mir später Milena in den Schoß fiel. Die jetzt bei Theresa wohnte und der Grund dafür war, dass ich nicht nur den Abend außer der Reihe bei meinen Töchtern verbrachte, sondern auch hier schlafen würde.
Nach dem Gespräch mit Kai Meerbusch hatte ich Theresa angerufen und versucht, die sinnlose Verstimmung aus der Welt zu schaffen, die seit Neuestem zwischen uns stand wie eine Wand aus Panzerglas. Aber schon ziemlich bald war sie wieder auf das Thema Milena gekommen, hatte erneut von Asylanträgen gefaselt und mich am Ende allen Ernstes gefragt, ob ich wisse, wie man zu überschaubaren Kosten an einen halbwegs gut gefälschten Personalausweis kommen könne. Daraufhin hatte ich sie für verrückt erklärt, ein scharfes Wort hatte ein noch schärferes ergeben, und so saß ich nun noch schlechter gelaunt als am Morgen an meinem eigenen Küchentisch und nicht bei meiner zurzeit so kratzbürstigen Göttin.
Im November war es gewesen. Einer meiner Mitarbeiter war auf sadistische Weise ermordet worden. Vier Monate war das nun schon wieder her, und noch immer litt ich unter den Nachwehen. Und daran, dass meine Jüngste sich ausgerechnet einen Drogensüchtigen als ersten festen Freund hatte aussuchen müssen.
»Mick muss raus aus der WG«, fuhr sie kraftlos fort. »Er kommt von dem Zeug nicht los, wenn er ständig mit Junkies zusammen ist. Er will ja aufhören, er will es wirklich, Paps. Aber er findet einfach kein anderes Zimmer, und ich mach mir solche Sorgen um ihn.«
Dass es schwer war, in Heidelberg eine bezahlbare Studentenbude oder ein WG-Zimmer zu finden, war mir nicht neu. Aber in diesem Fall wirklich nicht mein Problem.
»Kein Wunder, so wie er rumläuft«, warf ich herzlos ein.
Mick sah leider genau so aus, wie der gemeine Bürger sich einen Junkie vorstellte. Mit seinen fettigen Rastazöpfen, der ungepflegten Kleidung, seinem ewig schlecht rasierten Gesicht war er der Albtraum jeder Schwiegermutter in spe. Und jedes Schwiegervaters auch. Obwohl ich ihn glücklicherweise nur selten zu Gesicht bekam, war mir nicht entgangen, dass er seit November weiter abgemagert war. Dass er immer weniger auf sein Äußeres achtete, auf Körperpflege, Kleidung, auf Haltung. Meine größte Sorge war natürlich, er könnte meine Louise mit in seinen Sumpf ziehen. Inzwischen beobachtete ich sie ständig, suchte nach ersten Alarmzeichen. Nicht nur einmal hatte es Streit gegeben wegen dieser Liebe, die in meinen Augen eine Amour fou der allerschlimmsten Sorte war. Aber was waren meine Optionen? Verbot ich ihr den Kontakt, dann würde sie ihren Mick eben heimlich treffen. Oder im schlimmsten Fall zu ihm ziehen, in diese stinkende und verlotterte Wohngemeinschaft an der Sandgasse. Und ich hatte wahrhaftig keine Lust, sie dort mit Gewalt wieder herauszuholen und zu Hause einzusperren.
»Ich sehe absolut nicht ein …«, ereiferte ich mich, bremste mich jedoch sofort wieder. »Versteh doch, wir haben hier einfach zu wenig Platz.«
»Wieso denn?«, quengelte sie mit feuchten Augen. »Er kann in meinem Zimmer pennen. Er kann sein Zeug in meinen Schrank tun. Er hat ja eh nicht viel. Könnte sogar Miete zahlen. Zahlt er in der Sandgasse ja auch. Zweihundertzehn pro Monat.«