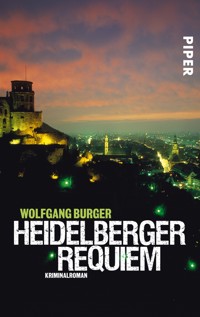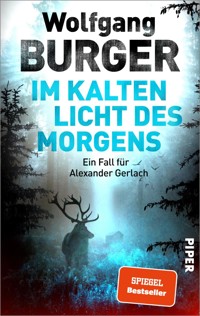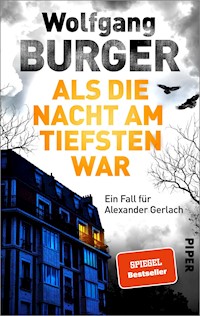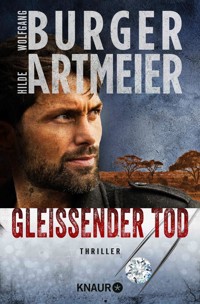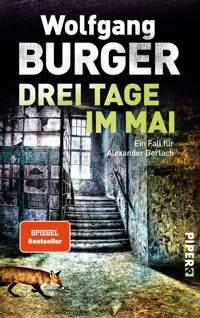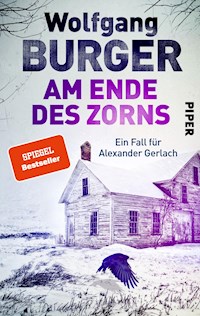
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der achtzehnte Fall für Kommissar Alexander Gerlach von Spiegel-Bestsellerautor Wolfgang Burger Auf dem verschneiten Heidelberger Weihnachtsmarkt prallt Kripochef Alexander Gerlach mit einer jungen Taschendiebin zusammen. Das Mädchen entkommt, doch wenig später begegnen sich die beiden in der Polizeidirektion wieder. Da die kleine Marie nicht sagen will, wo sie zu Hause ist, nehmen Gerlach und seine Tochter Sarah sie über die Feiertage bei sich auf. Bald wird klar, dass Maries Vater sich vor Kurzem das Leben genommen hat. Doch der Fall bereitet Gerlach Kopfzerbrechen, denn immer mehr Indizien sprechen gegen einen Suizid. Und Marie scheint in der Tragödie eine zentrale Rolle zu spielen. »Gerlach ist der sympathischste Beamte, den je ein Autor erfunden hat!« Rhein-Neckar-Zeitung Preisgekrönte Spannung in Krimiserie! Mit »Heidelberger Requiem« legte Wolfgang Burger 2005 ein fulminantes Krimi-Debüt vor, das sich aus dem Stand zur neuen Obsession der Fans des Ermittlerkrimis mauserte. Seine Bücher waren bereits mehrfach für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, so auch der achtzehnte Band »Am Ende des Zorns«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Am Ende des Zorns« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Annika Krummacher
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Coverabbildung: Sandra Cunningham/Trevillion Images; Eric Isselee/shutterstock.com; Craig Easton/Getty Images.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Einführungstext
1
2
3
4
Für Hilde, ohne die mein Leben eine Wüste wäre
»Eins, zwei, drei …«
Marie zählt bis zehn, ich schalte das Deckenlicht neunmal ein und aus. Sie beginnt von vorn, und wieder drücke ich den Schalter. Während sie zum dritten Mal zählt, laufe ich zum Fenster, rüttle noch einmal an dem tausendmal verfluchten Gitter, das immer noch um keinen Millimeter nachgibt.
»Zehn!«
Ich renne zum Lichtschalter zurück, spule mein Blinkprogramm ab. Mit jeder Sekunde scheint es heißer zu werden. Ich meine schon das Brummen und Knacken des Feuers zu hören, das unaufhaltsam näher kommt, im Treppenhaus überreichlich Nahrung findet und unseren einzigen Fluchtweg, die hölzerne Treppe ins Erdgeschoss hinab, vermutlich schon zerstört hat. Mehr und mehr Rauch quillt durch die Ritzen der schweren Eichentür, die hoffentlich noch einige Minuten standhalten wird. Aber es ist nur eine Frage der Zeit …
»Zehn!«
Und wieder blinke ich: dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz – SOS.
Himmel, hilf! Wenn nicht mir, dann wenigstens dem Kind.
Ausgerechnet jetzt fällt mir ein, wie ich Marie zum ersten Mal begegnete. Auch damals war es Abend gewesen.
1
Drei Wochen früher
Mein erster Kontakt mit Marie war ein kräftiger Stoß in den Rücken. Mitten im Gewühl des Heidelberger Weihnachtsmarkts, abends um halb sieben, umgeben von Bratwurstgebrutzel, Glühweinschwaden, dem Duft von Tannenbäumen und gebrannten Mandeln. Noch während ich mich umschaute, wer mich so rücksichtslos angerempelt hatte, begann nicht weit von mir mit schriller Stimme eine Frau zu schreien.
»Festhalten! Sie hat mich beklaut! Halten Sie sie fest! Mein Geldbeutel, mein Geldbeutel ist weg, jetzt halten Sie das kleine Luder doch fest, um Gottes willen!«
Aber bevor ich reagieren konnte, war die Diebin schon außer Reichweite. Die Zehn-, maximal Zwölfjährige, die ich nur noch von hinten sah, war wie ein Junge gekleidet. Jeans, eine billige, schmutzig orangene Steppjacke, die Kapuze tief in die Stirn gezogen, registrierte mein Polizistenhirn automatisch. Auf dem Rücken trug sie einen blaugrünen Schulrucksack. Wie ein quecksilbriges Fischchen tauchte das Kind durch das Getümmel schwitzender, lärmender, glühweinseliger Einheimischer und Touristen aus aller Welt. Der Heidelberger Weihnachtsmarkt ist ja berühmt für seine romantische Kulisse.
Obwohl ich solche Massenveranstaltungen nicht besonders schätze, hatte ich mich heute, eine Woche vor Heiligabend, ins Gewühl gestürzt, in der Hoffnung, hier ein Geschenk für Sönnchen zu finden, meine Sekretärin und unverzichtbare Ratgeberin in beruflichen und nicht selten auch privaten Angelegenheiten. Irgendeine nette, nicht allzu alberne Kleinigkeit mit lokalem Bezug, da sie eine geborene und heimatverliebte Heidelbergerin war. In den vergangenen Tagen hatte es fast ununterbrochen geregnet, heute war der erste Abend, an dem man sich wieder ins Freie traute.
Eine gängige Methode von Diebesbanden war, Kinder als Taschendiebe einzusetzen. Kinder unter vierzehn Jahren, die nach deutschem Recht noch nicht strafmündig waren. Wurden sie erwischt, dann sprachen sie kein Wort Deutsch, wussten nicht, wie sie hießen, woher sie kamen oder wer ihre Eltern waren. Nach ein, zwei Tagen mussten wir sie regelmäßig wieder laufen lassen. Und bald darauf waren sie meist schon wieder auf Beutezug, in derselben oder einer anderen Stadt. Diese Banden blieben nur für kurze Zeit im Land, immer wurden die Kinder begleitet und beaufsichtigt von Erwachsenen, die sie anleiteten, ihnen die Beute abnahmen und sie am Ende des Tages verprügelten, wenn sie nicht genug eingebracht hatten.
Die bestohlene Frau stand jetzt vor mir, funkelte mich wütend an.
»Wieso haben Sie das Miststück laufen lassen, Sie Penner?«, zeterte sie. »Sie ist Ihnen doch praktisch in die Arme gelaufen, Herrgott noch mal! In meinem Geldbeutel sind fast zweihundert Euro, und die sind jetzt futsch. Dazu Ausweis, Karten und, Herrgott, ich weiß gar nicht, was noch alles, und Sie lassen das Miststück einfach laufen, Sie Schnarchsack, Sie kreuzblöder.«
Sie verstummte kurz, um Luft zu holen für die Fortsetzung ihrer Tirade. Ihre Kleidung war gepflegter als ihre Ausdrucksweise, der dunkle, elegant geschnittene Wollmantel mit echtem Pelzkragen zeugte von Wohlstand. Am Arm trug sie eine große, offene Handtasche, in der vor wenigen Sekunden vermutlich noch das jetzt vermisste Portemonnaie gelegen hatte.
»Machen Sie vielleicht gemeinsame Sache mit dem Miststück? Haben Sie jetzt meinen Geldbeutel?«, fuhr sie fort. »So machen die Taschendiebe das doch für gewöhnlich, sieht man ja dauernd im Fernsehen.«
Zweihundert Euro – heute Abend würde es wohl keine Schläge geben für die kleine Diebin.
Andere gesellten sich zu dem empörten Opfer, musterten mich finster, manche neugierig, andere schon drohend. Ich hörte Sätze wie: »Sieht gar nicht aus, als hätt er es nötig …«, »Diese Jugend heutzutage …«, »Jetzt sogar schon Kinder …«, »Hat’s doch früher nicht gegeben«, »Bestimmt wieder Ausländer!«
Ich versuchte, mir Gehör zu verschaffen, aber ein älterer Herr mit Silberhaar und Goldzahn schnitt mir das Wort ab und winkte entschlossen jemanden herbei.
»He, Sie da! Kommen Sie doch mal rasch her, ja?«
Augenblicke später stand ich zwei uniformierten Polizisten gegenüber.
»Was ist passiert?«, fragte der ältere der beiden gemütlich in die Runde.
»Diese Dame ist soeben bestohlen worden«, erklärte der Silberhaarige empört, »und wir vermuten, dass dieser … Herr hier gemeinsame Sache mit der Diebin macht.«
Der Kollege grinste mich an, wandte sich dann wieder dem aufgebrachten Wortführer zu, dessen Gesichtsfarbe einen nahenden Schlaganfall fürchten ließ.
»Das glaub ich jetzt eigentlich nicht.«
»Darf man erfahren, aus welchem Grund Sie das nicht glauben?«
»Weil ich den Herrn zufällig gut kenne. Das ist nämlich unser Herr Gerlach.«
»Es ist mir völlig wurscht, wie der Mann heißt. Ich verlange, dass Sie ihn auf der Stelle und vor Zeugen durchsuchen.«
Der Kollege hörte auf zu grinsen. »Das werden wir schön bleiben lassen. Der Herr Gerlach ist nämlich der Chef von unserer Kripo. Wir verdienen zwar nicht besonders viel bei der Polizei, aber so arm sind wir dann auch wieder nicht, dass wir stehlen müssen, gell, Herr Kriminaloberrat?«
»Kann ich dann jetzt gleich hier meine Anzeige aufgeben?«, wollte die bestohlene Frau nach kurzer Verblüffung wissen.
»Das erledigen die beiden Kollegen«, erwiderte ich verbindlich. »Und keine Sorge, Taschendiebe sind normalerweise nur auf Geld aus. Ihren Geldbeutel und den restlichen Inhalt können Sie bestimmt noch vor Weihnachten im Fundbüro abholen.«
2
»Alter circa dreißig bis fünfunddreißig«, berichtete mir Sven Balke am Donnerstagmorgen. Er hatte einen mehrseitigen Computerausdruck vor sich liegen – den Obduktionsbericht des Rechtsmedizinischen Instituts. »Größe eins neunundsiebzig, aber nur fünfundsechzig Kilo, ein ziemliches Fliegengewicht also. Von der Konstitution her war er wohl kein großer Sportler. Todesursache ist zweifelsfrei die Kugel, die er sich in den Kopf gejagt hat. Anschließend hat er drei bis vier Tage im Wasser gelegen. Hinweise auf seine Identität haben wir bisher keine.«
Spaziergänger hatten die männliche Leiche am Tag zuvor im Badesee nördlich von Heddesheim entdeckt, vielleicht fünfzehn Kilometer nordwestlich von Heidelberg.
»Steht denn fest, dass er sich selbst erschossen hat?«
»Aus meiner Sicht ja. Aufgesetzter Schuss in die linke Schläfe, an der linken Hand sind Schmauchspuren. Die waren sogar nach drei Tagen im Wasser noch nachweisbar.« Balke demonstrierte mit dem Zeigefinger, wo der Tote die Waffe angesetzt hatte. »Wird Linkshänder gewesen sein, nehme ich an.«
Was die Anzahl der infrage kommenden Menschen schon einmal beträchtlich reduzierte. Von den gut vierzig Millionen deutschen Männern mochte jeder Zwanzigste im passenden Alter sein. Und ungefähr zehn bis fünfzehn Prozent davon bevorzugten die linke Hand …
Im Vorzimmer hörte ich Sönnchen telefonieren. Vor den Fenstern schrie eine Krähe, als wollte sie gegen irgendetwas Beschwerde einlegen. Mein Blick ruhte kurz auf dem Tannenzweig, den mir meine Töchter zur Zierde meines kargen Beamtenbüros geschenkt hatten. Er war mit einigen winzig kleinen goldenen Kugeln geschmückt, in der Mitte steckte eine rote Kerze, und manchmal bildete ich mir sogar ein, Harzduft zu riechen.
»Und wo ist die Waffe?«, fragte ich.
Die lag irgendwo im Wasser, vermutete mein engagierter Mitarbeiter.
»Der ganze See ist rundrum eingezäunt. Am südlichen Ende liegt das Strandbad. Mit großem Parkplatz, Umkleidekabinen, Liegewiesen, Spielplatz, Kiosk und so weiter. Bin selbst schon ein paarmal da gewesen. Ist echt nett da. Aber auch da kommt man um diese Jahreszeit nicht ans Wasser ran, weil alles verriegelt und verrammelt ist. Die einzige Stelle, wo man überhaupt eine Chance hat, ins Wasser zu fallen, ist am östlichen Ufer. Dort fehlen etwa fünf Meter Zaun, weil im Herbst ein Baum umgestürzt ist.«
Balke hatte bereits Taucher angefordert, die im Wasser nach der Tatwaffe und Dingen suchen sollten, die uns vielleicht die Identifizierung des Toten ermöglichten.
»Die Jungs haben aber erst noch einen Auftrag im Mannheimer Rheinhafen zu erledigen. Voraussichtlich rücken sie morgen Vormittag am Badesee an.«
Ich lehnte mich zurück und runzelte die Stirn.
»Sie glauben also, er hat sich erst erschossen, dann die Waffe ins Wasser geworfen und sich anschließend auch noch ertränkt?«
»Ertränkt natürlich nicht. Er hatte kein Wasser in der Lunge.«
Der Tote hatte also schon nicht mehr geatmet, als er ins eiskalte Wasser fiel.
»Das Ufer ist da sehr steil, und das Wasser wird schnell tief«, fuhr Balke fort. »Wenn er an der Kante gestanden hat, dann könnte er mitsamt der Waffe ins Wasser geplumpst sein.«
Balke schien sich seiner Sache plötzlich nicht mehr ganz sicher zu sein, wollte aber noch nicht aufgeben. Aus nachvollziehbaren Gründen hielt er an der Selbstmordhypothese fest. Weihnachten stand vor der Tür, und wir alle freuten uns auf ein paar ruhige Tage. Da kam ein Mordfall ungelegen. »Auch wenn er nicht direkt am Ufer gestanden haben sollte, könnte ihm der Rückstoß die Pistole aus der Hand gerissen haben. Dann ist sie vielleicht zwei, drei Meter weit geflogen, und platsch, liegt sie im See. Er selbst hat noch ein paar Schritte gemacht, bevor er zusammengebrochen ist … Klingt doch plausibel, finden Sie nicht?«
Ich war immer noch nicht überzeugt, aber nun gut.
»Und er hat nichts bei sich gehabt, was einen Hinweis auf seine Identität geben könnte?«
Seufzend schüttelte Balke den Kopf mit dem raspelkurz geschnittenen Blondhaar. »Papiere Fehlanzeige. In der Hosentasche hatte er knapp zwanzig Euro, einen Schlüsselring mit sage und schreibe einem einzigen Schlüssel dran und ein älteres Huawei-Smartphone.«
Dem der Aufenthalt im Wasser allerdings nicht gut bekommen war.
»Die KTU versucht gerade, es wieder zum Leben zu erwecken, macht mir aber wenig Hoffnung, dass da noch viel zu retten ist.«
»Was ist mit diesem Schlüssel?«
»Ist für ein Abus-Sicherheitsschloss, das seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr hergestellt wird. Seine Kleidung gibt auch nichts her, alles Kaufhausware. Nur bei der Jacke hat er sich in Unkosten gestürzt. Sie ist von Fjällräven.« Balke legte zwei Fotos vor mir auf den Tisch, die das Gesicht des Toten zeigten. Obwohl es vom Wasser aufgedunsen und bläulich verfärbt war, sah ich, dass die Wangen eingefallen waren. Tiefe Falten in den Mundwinkeln ließen ihn mürrisch wirken.
»Was halten Sie davon, wenn wir damit an die Presse gehen?«
»Vorläufig noch nichts. Wir geben nur eine Meldung raus, dass ein unbekannter Toter gefunden worden ist.«
Der Mann trug einen Ehering mit der Gravur T & H für immer, und ich wollte vermeiden, dass seine Frau morgen früh das Gesicht ihres Gatten in der Zeitung sehen und auf diesem Weg erfahren musste, dass sie Witwe geworden war.
Neben den Tauchern hatte Balke eine Hundertschaft Bereitschaftspolizisten angefordert, die in Kürze beginnen würden, den Uferbereich des Gewässers sowie das Umfeld nach Spuren abzusuchen. Auf verwertbare Fußspuren brauchten wir wegen des Regens der vergangenen Tage nicht zu hoffen.
»Mit ein bisschen Glück finden die Kollegen vielleicht seine Brieftasche oder wenigstens die Patronenhülse.«
»Sie gehen davon aus, dass er eine Pistole benutzt hat?«
»So wie die Schmauchspuren an seiner Hand aussehen, halte ich einen Revolver oder ein Gewehr für ausgeschlossen. Er hat die Hand über dem Hülsenauswurf gehabt und sich sogar einen Finger geklemmt, als der Schuss losging. Fragen Sie mich nicht, wie er das angestellt hat.«
»Wie ist er eigentlich da hingekommen?« Ich sah mir nebenbei im Internet eine Luftaufnahme des Tatorts an. »Steht irgendwo ein herrenloses Auto?«
»Gute Frage.« Balke hob die muskulösen Schultern, zog eine schiefe Grimasse. »Einen Autoschlüssel hatte er jedenfalls nicht in der Tasche. Am Eingang des Strandbads stehen ein paar verlassene Bikes herum, aber die kann man nur schwer einem Besitzer zuordnen. Ich tippe eher auf S-Bahn. Die nächste Haltestelle ist nur einen guten Kilometer entfernt.«
Allerdings hatte der Tote auch keinen Fahrschein bei sich gehabt. Wir beschlossen, die Ergebnisse der Suchaktion abzuwarten und uns morgen früh wieder zusammenzusetzen.
»Da fällt mir ein, ich soll Sie von Klara grüßen«, sagte Balke, als er sich erhob.
Klara Vangelis, meine Erste Kriminalhauptkommissarin, war schon seit zwei Wochen in Griechenland, um ihrer Großmutter oder einer alten Tante beim Sterben beizustehen.
»Es geht ihr gut, das Wetter ist super, und sie hat überhaupt keine Lust zurückzukommen.«
Was wir ihr beide nachfühlen konnten.
Am späten Nachmittag sah ich die schmutzig orangene Steppjacke zum zweiten Mal. Ich hatte im Erdgeschoss zu tun gehabt, bei einer Gegenüberstellung wegen eines Falls versuchter Vergewaltigung. Das Beinaheopfer, eine Frau um die dreißig, war etwas zu heftig geschminkt und herzzerreißend aufgeregt. Als sie die sechs Männer durch den Einwegspiegel betrachtete, begann sie vor Nervosität fast zu weinen. Fünf davon waren Kollegen, der zweite von rechts war der mutmaßliche Täter. Erst tippte sie auf den Richtigen, korrigierte sich dann hastig, hielt den Mann links daneben für wahrscheinlicher, der tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Verdächtigen hatte, schließlich den Kollegen ganz links, der überhaupt nicht zu ihrer Beschreibung passte. Am Ende war sie dann wirklich in Tränen ausgebrochen.
»Ich kann das nicht«, hatte sie geschluchzt. »Was, wenn ich auf den Falschen tippe? Und der muss dann ins Gefängnis? Nein, das kann ich nicht, tut mir leid, es geht nicht.«
Als ich den Raum verließ, sah ich die kleine Taschendiebin gerade noch um eine Ecke verschwinden, begleitet und bewacht von einer uniformierten Kollegin, die ich gut kannte. Polizeiobermeisterin Ilzhöfer trug die blaue Uniform der Schutzpolizei, war in den Vierzigern, stämmig gebaut und mit einem übergroßen Herzen gestraft, das ihr das Polizistinnenleben manchmal schwer machte. Allzu oft hatte sie zu viel Mitgefühl mit den Pechvögeln und lebensuntüchtigen Gestalten, mit denen wir es im Alltag meist zu tun hatten. Ich folgte den beiden.
»Geklaut hat sie«, erwiderte die Kollegin auf meine Frage. »Im Penny an der Bahnhofstraße. Hat sich aber dummerweise erwischen lassen.«
In der Hand trug sie den Rucksack des Mädchens.
»Haben Sie sie schon vernommen?«
»Hab’s versucht.« Sie rollte die Augen. »Aber sie lügt wie gedruckt. Angeblich heißt sie Mandy Spears, ist neunzehn und kommt aus London. Dabei redet sie astreines Heidelbergerisch.«
Die Lügnerin, die sie mit eisernem Griff am Oberarm festhielt, sah mich mit einer Mischung aus Neugier und Furcht an. Ihr Gesicht war rund, die Augen waren wasserblau. Die haselnussbraunen glatten und kinnlangen Haare sahen aus wie im Do-it-yourself-Verfahren geschnitten und waren heute noch nicht gebürstet worden. Aus der Nähe wirkte sie sogar noch jünger, als ich sie gestern geschätzt hatte. Eher acht oder neun. Und sie sah nicht aus, als würde sie auf der Straße leben. Das Gesicht war sauber gewaschen, auch die Hände waren nicht übermäßig schmutzig.
»Aus dem Ausland ist sie also nicht?«
»Definitiv nicht. Die stammt von hier.«
Ich wandte mich an das Kind. »Und du willst uns nicht sagen, wie du heißt und wo du daheim bist?«
Kurzes Kopfschütteln mit zugekniffenem Mund.
»Wieso nicht?«
Schweigen. Ihre Angst schien zuzunehmen. Die schmalen, blassen Lippen hielt sie fest aufeinandergepresst.
»Deine Eltern werden sich Sorgen um dich machen.«
Keine Reaktion.
»Wir haben uns schon mal gesehen, weißt du noch?«
Ihre Augen wurden schmal.
»Gestern Abend auf dem Weihnachtsmarkt.«
Nichts.
»Was geschieht jetzt mit ihr?«, fragte ich die Kollegin Ilzhöfer.
»Jugendamt natürlich. Ich hoffe, sie holen sie heut noch ab. Hier kann ich sie ja nicht unterbringen.«
Ich berichtete ihr von meinem Zusammenprall mit der angeblichen Mandy Spears aus London. Resigniert hob sie die gut gepolsterten Schultern. Die Kleine konnte hundert Diebstähle begangen haben und jeden einzelnen gestehen, und wir würden sie dennoch nicht festhalten können. Immer noch starrte die Taschendiebin mich an, jetzt aber nicht mehr furchtsam, sondern eher so, als erhoffte sie sich etwas von mir. Ihr Blick war wach und aufmerksam.
Ich ging in die Hocke, um auf Augenhöhe mit ihr zu kommen. »Du sprichst also nicht mit uns?«
Erst kam wieder keine Reaktion, der Blick irrte ab, aber dann immerhin ein angedeutetes Kopfschütteln.
»Wie alt bist du?«
Endlich öffnete sie den Mund. Mit klarer Stimme und in selbstbewusstem Ton verkündete sie: »Sechzehn.«
»Ha!«, rief Kollegin Ilzhöfer grimmig. »Die Ärztin hat gesagt, du bist noch nicht mal zehn.«
»Was wird deine Mama dazu sagen, dass du jetzt bei der Polizei bist?«, fragte ich.
Die Kleine schluckte, sah zu Boden, blinzelte. Schließlich murmelte sie: »Die ist weggegangen. Nach Amerika.«
»Ach herrje, du armes Ding.« Die Kollegin ließ sie unwillkürlich los. »Und dein Papa?«
Die jetzt sehr kleinlaute Delinquentin zuckte mit den selbst in der wattierten Jacke noch schmalen Schultern. Soweit ich erkennen konnte, war sie nicht gerade unterernährt, aber nicht weit davon entfernt.
»Weiß nicht«, flüsterte sie schließlich.
»Bestimmt sucht er dich schon überall«, behauptete ich.
Sie war offensichtlich hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, nach Hause zu kommen, nach Schutz und Geborgenheit, und der Angst vor Gott weiß was. Vielleicht davor, ausgeschimpft zu werden, weil sie ausgerissen war? Bei Kindern dieses Alters überwog eigentlich früher oder später immer das Heimweh.
Ich richtete mich wieder zu voller Größe auf, wandte mich an die Kollegin und fragte so leise, dass das Mädchen es nicht verstehen konnte: »Irgendwelche Anzeichen von Gewaltanwendung?«
»Die Ärztin sagt, da ist alles in Ordnung. Auch sexuell, alles okay so weit. Da war nichts.«
Das Mädchen beobachtete uns jetzt wie ein Kaninchen, das Gefahr wittert, sich aber noch nicht zur Flucht entschließen kann. Doch auf einmal wieselte es los, wie der Blitz den Flur entlang. Die Kollegin stieß einen unterdrückten Fluch aus, versuchte noch, es festzuhalten, griff jedoch daneben. Im nächsten Augenblick war die Kleine schon um die nächste Ecke verschwunden.
»Festhalten!«, brüllte ich. »Das Kind in der orangefarbenen Jacke, festhalten!«
»Stopp!«, hörte ich eine sonore Männerstimme rufen. »Jetzt bleib doch stehen, Menschenskind!« Und kurz darauf leiser: »Na also. Geht doch.« Dann wieder lauter: »Aua, verdammich!«
Sekunden später war sie wieder bei uns. Sie hatte den reaktionsschnellen Kollegen in die Hand gebissen, der eine ärztliche Versorgung der Wunde jedoch für unnötig hielt.
Zu dritt gingen wir weiter. Frau Ilzhöfer schob das jetzt wieder lammfromme Mädchen in ein Büro.
»Mach’s dir hier erst mal bequem«, sagte sie mit mütterlicher Strenge. »Setz dich auf den Stuhl da, damit kannst du Karussell fahren. Hast du Hunger? Oder Durst?«
Gehorsam setzte sich das Mädchen auf den Schreibtischsessel. Das anfängliche Kopfschütteln ging übergangslos in heftiges Nicken über.
Polizeiobermeisterin Ilzhöfer schloss kurz die Tür, um mich zu verabschieden und mir mitzuteilen, dass bisher keine auf das Kind passende Vermisstenmeldung eingegangen war.
3
Um kurz vor sieben kam ich nach Hause und traf meine Tochter Louise und ihren Freund Michael in der Küche an. Sie saßen am Esstisch, hatten beide aufgeklappte Notebooks vor sich stehen und begrüßten mich mit dem unheilschwangeren Satz: »Paps, wir müssen reden.«
»Okay«, sagte ich gedehnt und setzte mich zu ihnen an den runden Kiefernholztisch. »Wird es arg teuer werden?«
»Im Gegenteil«, behauptete Louise. »Vieles wird sogar billiger, weil wir es gar nicht erst kaufen.«
»Na ja«, widersprach Mick. »Manches wird schon teurer.«
Die beiden hatten beschlossen, wir müssten ab sofort mehr für die Umwelt tun. Viel mehr. Mir war nicht entgangen, dass sie in den vergangenen Wochen hin und wieder an einschlägigen Demonstrationen und Fahrradcorsos teilgenommen hatten. Selbst bei schlechtem Wetter.
»Aber immer bloß quatschen und Schilder schwenken, das bringt nichts«, sagte Louise mit Überzeugung. »Wir müssen was tun. Wir alle müssen dringend was tun, sonst geht die Menschheit unter.«
Wie ihre Zwillingsschwester Sarah hatte sie vor wenigen Monaten das magische Alter von achtzehn Jahren erreicht. Ihre langen Haare waren immer noch schwarz gefärbt, während die ihrer eine halbe Stunde älteren Schwester nach wie vor gerstenblond waren. Mick, der seit einem guten Jahr bei uns lebte, war zwei Jahre älter als sie und studierte an der hiesigen Universität Mathematik.
»Ich bin dabei«, sagte ich erleichtert. »Ihr habt schon einen Plan, nehme ich an?«
Selbstverständlich hatten sie den. Stolz präsentierte Louise mir eine Liste der Aktivitäten und Verbesserungen, die sie für kurzfristig realisierbar hielten.
Ganz oben stand: weniger Auto fahren.
»Unser Auto steht sowieso die meiste Zeit bloß rum«, erklärte ich.
Bei vielen Positionen waren wir uns überraschend schnell einig. Mehr Rad fahren, den öffentlichen Nahverkehr nutzen, den Müll akkurater trennen. Überhaupt weniger Müll erzeugen. Weniger Essen wegwerfen. Weniger Kleidung kaufen, dafür von besserer Qualität und Haltbarkeit.
Behältnisse für die Mülltrennung hatten sie schon beschafft, wenn auch aus Kunststoff – das hatte sich in dem Fall wohl nicht vermeiden lassen.
»Ab sofort gibt’s keine abgepackte Wurst mehr, kein Obst oder Gemüse in Folie, kein Shampoo aus der Plastikflasche.«
»Das bedeutet natürlich mehr Lauferei beim Einkaufen.«
Auch das hatten sie schon bedacht.
»Shampoo machen wir selber«, wurde ich aufgeklärt. »Seife und Waschmittel auch. Geht total easy. Bei YouTube gibt’s jede Menge Videos dazu.«
»Was haltet ihr davon, wenn wir Arbeitsteilung machen?«, schlug ich vor. »Ich geh am Samstag auf den Wochenmarkt und ihr bei Bedarf zum Biometzger und zum Bäcker.«
»In der Bahnstadt und in Neuenheim drüben gibt’s sogar Unverpackt-Läden.« Louise wirkte ein wenig überrascht, bei mir auf so wenig Widerstand zu stoßen. »Ist das nicht cool?«
»Seltener und nicht so heiß duschen würde auch was bringen«, fuhr ich fort. »Die Spülmaschine wird nur noch eingeschaltet, wenn sie wirklich voll ist. Und man muss auch nicht jedes T-Shirt in die Wäsche tun, nachdem man es einen halben Tag getragen hat.«
Diesen Vorschlag fand nur Mick gut.
»Was aber meines Wissens am meisten bringt: weniger heizen. Man braucht keine vierundzwanzig Grad im Zimmer, achtzehn oder neunzehn tun’s auch. Zieht euch Pullover und dicke Socken an. Zu warme Luft ist sowieso nicht gut für die Atemwege.«
»Echt jetzt?«, fragte meine Tochter verdattert.
»Und euren Plan, nächstes Jahr in Australien Work and Travel zu machen, solltet ihr noch mal kritisch überdenken.«
Nach Louises Abitur planten sie, ein Gap-Jahr einzulegen, um die Welt zu erkunden, vor allem die untere Hälfte, und sich unterwegs hie und da etwas zu verdienen, um die Kosten zu decken. Michael würde sein Studium zu diesem Zweck für zwei Semester unterbrechen, was offenbar kein Problem war. Das Projekt fand ich im Prinzip lobenswert. Reisen bildet, erweitert den Horizont, fördert den Zusammenhalt und die Frustrationstoleranz.
»Ihr habt ja wohl nicht vor, mit dem Rad nach Down Under zu fahren«, setzte ich launig nach.
Die beiden sahen sich an, sahen mich an, dann wieder sich.
»Wieso eigentlich nicht?«, meinte Mick schließlich mit hochgezogenen Brauen. »Wär mal ’ne echte Challenge.«
Louise nickte zögernd, schien jedoch ebenfalls Gefallen an meiner Idee zu finden. »Bis nach China oder Indien wird geradelt, und von dort fahren wir mit einem Frachtschiff nach Australien. Geile Idee, Paps!«
Mich beschlich das Gefühl, soeben einen fatalen Fehler begangen zu haben. Schon sah ich die beiden am Khaiberpass von einer Horde mordlustiger Talibankämpfer umringt.
»Vielleicht fangen wir erst mal klein an«, versuchte ich, das Gespräch wieder in eine weniger beunruhigende Richtung zu biegen. »Wir schreiben jeden Freitag einen Wochenplan, was es wann zu essen gibt. Danach machen wir Einkaufslisten und notieren, wer für die Beschaffung zuständig ist. Wie gesagt, ich gehe freiwillig jeden Samstag auf den Markt.«
»Man kann auch Gemüsekisten bestellen«, fiel Mick ein. »So macht’s meine Mama. Jede Woche kommt ein Bauer und stellt ihr eine Kiste voll Grünzeug hin. Je nachdem, was gerade wächst.«
Auf jeden Fall würden wir künftig darauf achten, keine Äpfel mehr zu kaufen, die in Neuseeland gewachsen waren, und keinen Wein aus Kalifornien, Chile oder Australien zu trinken.
Das Projekt »Shampoo aus eigener Herstellung« hatten sie bereits gestartet. Waschmittel planten sie aus Kastanien zu fabrizieren, und Frischhaltefolie sollte durch Bienenwachstücher ersetzt werden. Ein winziges Randproblem dabei war nur, dass unser Folienvorrat noch für Jahre reichen würde.
»Tupperschüsseln und so kommen alle weg«, verkündete Louise tatendurstig. »Ab heute gibt’s im Haushalt Gerlach bloß noch Glas oder Blech.«
Und zunächst einmal eine ziemliche Menge Kunststoffmüll.
Mick nickte eifrig. »Und mit der Raumtemperatur, da müssen wir echt was machen, Loui. Wir gucken bei eBay nach einem richtig dicken, fetten Kuschelpulli für dich. Gebraucht, logisch.«
»Sarah macht übrigens auch mit.« Louises Zwillingsschwester war zurzeit in der Stadt, um jemanden zu treffen.
Sie schienen es wirklich ernst zu meinen. Noch vor Kurzem waren solche kreativen Schübe und Weltverbesserungspläne meist nach wenigen Wochen wieder eingeschlafen. Dieses Mal, fürchtete und hoffte ich, würde es anders sein, und im Grunde war es mir ganz recht so. Wie so viele plagte mich schon seit Langem das schlechte Gewissen, weil ich zu denen gehörte, die nicht die nötige Energie aufbrachten, ihr Verhalten ernstlich zu verändern. Womöglich würden meine Kinder mir nun dabei helfen, zumindest in dieser Beziehung ein besserer Mensch zu werden.
Als ich mir später noch ein Gläschen Rotwein gönnte – ein hiesiges Gewächs vom Kaiserstuhl –, dachte ich noch einmal an die kleine Diebin, die jetzt in einem fremden Zimmer unter fremden Menschen vermutlich sehr unglücklich war. Hoffentlich war jemand da, der sich um sie kümmerte und sie tröstete, wenn sie weinte.
»Tut mir leid, ich verstehe es immer noch nicht so richtig.«
Es war Freitagmorgen, und Sven Balke war erneut bei mir wegen des nach wie vor namenlosen Toten, der seit gestern Abend kein Selbstmörder mehr war. Am späten Nachmittag hatten die armen Kollegen, die im Umfeld des Badesees im Regen herumstapften, die Patronenhülse gefunden. Sie war vor nicht allzu langer Zeit abgefeuert worden und vom Kaliber 9 mm Luger, passend zum Geschoss. Allerdings hatte sie nicht an der Stelle gelegen, wo der Unbekannte ins Wasser fiel, sondern auf dem etwa dreihundert Meter entfernten Parkplatz. In der Nähe hatten unsere Spurensicherer mithilfe ihrer chemischen Nachweismethoden außerdem bis zur Unsichtbarkeit verwässerte Blutspuren auf dem Asphalt entdeckt.
Damit war die Sache klar – wir hatten es mit einem Tötungsdelikt zu tun. Nur Balke wollte es immer noch nicht einsehen, seine Hoffnung auf geruhsame Feiertage nicht aufgeben.
»Vielleicht hat irgendein Hirni die Hülse gefunden und auf den Parkplatz geschmissen?«
»Und auch gleich noch ein bisschen Blut dazu geträufelt?«
»Wieso kann dieser blöde Tümpel nicht einen halben Kilometer weiter nördlich liegen?«, grummelte er nach kurzer Pause gekränkt.
Wenige Hundert Meter von der Fundstelle entfernt, verlief die Landesgrenze zu Hessen. Hätte der Unbekannte sich dort erschießen lassen, wäre sein Tod nicht unser Problem gewesen.
»Eines wissen wir immerhin schon mal«, sagte Balke, als er sich frustriert erhob. »Der Täter hat Muckis. Auch wenn sein Opfer nur gut sechzig Kilo wiegt, so ein Gewicht dreihundert Meter weit zu tragen, das schafft nicht jeder.«
Nur drei Stunden später war Balke erneut bei mir. Die beiden Taucher waren mit dem Auftrag im Mannheimer Hafen früher fertig geworden als erwartet und hatten die vermisste Waffe im Heddesheimer Badesee nach kaum mehr als einer halben Stunde gefunden. Und zwar an der Stelle mit dem defekten Zaun wie von Balke schon vermutet. Offenbar hatte der Täter zusammen mit dem Opfer auch gleich die Tatwaffe entsorgt.
»Es ist eine Kahr P9«, erklärte Balke, der seine Enttäuschung vom Morgen inzwischen überwunden zu haben schien. »Typisches Handtaschenpistölchen, leicht, flach, einfach in der Handhabung. Die Blutgruppe des Toten passt übrigens zu den Spuren auf dem Parkplatz.«
»Auf wen ist die Waffe registriert?«
»Auf niemanden. Habe ich schon gecheckt.«
Also handelte es sich vermutlich um eine illegale, aus dem Ausland eingeschmuggelte Pistole.
»Das übliche Programm«, entschied ich. »Stellen Sie ein kleines Team zusammen. Erst mal reichen drei, vier Leute, viel zu tun gibt es bisher ja nicht. Schicken Sie die besten Fotos des Toten an die Reviere im Umkreis von – sagen wir – hundert Kilometern. Vorerst aber noch nicht an die Medien. Vielleicht meldet sich übers Wochenende jemand, der den Mann vermisst.«
Auf die Zeitungsmeldung von der namenlosen Wasserleiche hin waren bisher keine Reaktionen gekommen.
Wir waren zurzeit nur schwach besetzt. Viele Kolleginnen und Kollegen waren schon im Winterurlaub oder würden diesen in Kürze antreten. Rolf Runkel genoss seit Anfang November seinen Ruhestand, und wir hatten noch keinen geeigneten Ersatz für ihn gefunden. Klara Vangelis, meine fähigste und verlässlichste Mitarbeiterin, ließ sich von der mediterranen Sonne das Gesicht wärmen.
»Für den Fall, dass er wirklich mit dem Zug angereist ist, lassen Sie die Zugbegleiter befragen«, fuhr ich fort. »Der Mann kann die Fahrkarte ja weggeschmissen haben.«
»Oder er hatte sie digital auf dem Handy. Das ist übrigens wirklich hinüber. Keine Chance, noch an irgendwelche Daten zu kommen.«
Wenigstens die Speicherkarte war heil geblieben. Darauf waren zwar keine Kontaktdaten oder andere Dinge, die uns hätten weiterhelfen können, aber mehrere hundert Fotos.
»Die klicke ich gleich mal durch. Wenn ich was Interessantes finde, hören Sie von mir«, versprach Balke.
Kurz darauf meldete er telefonisch einen ersten Hoffnungsschimmer. »Auf einem der Fotos ist ein Parkplatz zu sehen, schräg von oben geknipst, vielleicht von einem Balkon oder durch ein Fenster. Das Foto ist zwar verwackelt, aber ich versuche trotzdem, von einem der Autos auf dem Parkplatz das Kennzeichen zu entziffern. Mit etwas Glück …«
Das mit dem Kennzeichen klappte nicht, aber Balke hatte schon zwei Minuten später eine neue Idee: »Da steht ein grüner Ford Mustang, so ein richtig alter aus der Steve-McQueen-Ära. Davon gibt’s bestimmt nicht allzu viele in der Kurpfalz.«
So war es, und wenig später kannten wir die Adresse des Hauses, bei dem sich dieser Parkplatz befand: Franz-Kafka-Straße 5 in Dossenheim.
»Das sehen wir uns an«, entschied ich, da ich ohnehin nicht viel auf dem Schreibtisch hatte und von der muffigen Büroluft allmählich Gähnkrämpfe bekam. Der Regen legte netterweise gerade eine Pause ein, und der Himmel hellte sich sogar ein wenig auf.
Dossenheim lag wenige Kilometer nördlich von Heidelberg an der Bundesstraße B 3. Das Haus war ein weitläufig verwinkelter, fünfstöckiger und weiß gestrichener Kasten mit vermutlich eher preiswerten Mietwohnungen. Der Parkplatz war groß, und der Mustang stand noch an derselben Stelle wie auf dem zehn Wochen alten Foto. Die lichten Flecken am Himmel hatten sich schon wieder verzogen, inzwischen nieselte es. Wir stellten uns vor die Kühlerhaube des amerikanischen Sportwagens, sahen nach oben und versuchten, anhand des ausgedruckten Fotos den Balkon zu identifizieren, auf dem der Fotograf gestanden hatte. Letztlich kamen nur vier infrage, aber bevor wir die dazugehörigen Klingelknöpfe drücken konnten, trat eine junge, schrill bunt gekleidete Frau mit Rastafrisur aus der Haustür und wollte wissen, was wir hier machten.
»Soll etwa schon wieder was renoviert werden?«, fuhr sie mich mit kämpferischer Miene an. »Wollt ihr die Miete schon wieder erhöhen?«
Ich zeigte ihr meinen Dienstausweis, Balke eines der Leichenporträts, und bevor er ein erklärendes Wort dazu sagen konnte, rief sie: »Fuck, ist das nicht der Dings, der Gerstner? Aus dem Vierten? Jesus, wie sieht der denn aus? Ist der tot?«
Herr Gerstner hieß mit Vornamen Helge, wusste sie, weil man irgendwann einmal im Treppenhaus einige Worte gewechselt und gemeinsam auf den raffgierigen Hausbesitzer geschimpft hatte. Dummerweise war Helge Gerstner jedoch vor einigen Wochen ausgezogen.
»Ende November, wenn ich mich nicht irre. Eigentlich war er ganz nett, der Helge, bloß ein bisschen schüchtern. Mehr kann ich eigentlich nicht über ihn sagen.«
»Wissen Sie, was er beruflich gemacht hat? Wo er gearbeitet hat?«
»Ich glaub fast, der war arbeitslos. Jedenfalls hat er die meiste Zeit daheim rumgehangen. Wie der sich oft bewegt hat – vielleicht war er auch krank?«
An der Klingel stand immer noch T. & H. Gerstner.
»T und H für immer«, erinnerte sich Balke an die Gravur im Ehering des Toten. »Wahrscheinlich ist T. seine Frau.«
Die seit Neuestem leer stehende Dreizimmerwohnung zu besichtigen, war kurzfristig nicht möglich, da der Hausmeister krank und die Hausverwaltung in Frankfurt war. So läuteten wir nach und nach an den übrigen Wohnungen, aber niemand öffnete uns. Einen Aufzug gab es nicht, sodass wir die Treppen bis ins fünfte Obergeschoss zu Fuß bewältigen mussten.
Ganz oben trafen wir dann doch jemanden an, einen offenbar verwirrten Greis, der ständig mit einem Küchenmesser herumfuchtelte und mit kreischender Stimme nach der Polizei rief. Er schien uns für Diebe oder Trickbetrüger zu halten, die an seinen Sparstrumpf wollten, und interessierte sich kein bisschen für unsere Ausweise oder die Beteuerungen, die Polizei sei bereits da.
Balke beschloss, gegen Abend noch einmal herzukommen, in der Hoffnung, dann mehr Bewohner anzutreffen.
Der erste Mensch, der mir nach unserer Rückkehr in der Polizeidirektion über den Weg lief, war die sichtlich schlecht gelaunte Kollegin Ilzhöfer.
»Diese Blödköpfe aber auch!«, schimpfte sie. »Das Jugendamt hat die Kleine in das Heim im Mühltal draußen gesteckt. Und diese Torfköpfe haben ihr ein Zimmer im Erdgeschoss zugewiesen, und wie sie das Mädel heut zum Frühstück holen wollen, da steht das Fenster sperrangelweit offen, und unsere Freundin ist über alle Berge.«
»Hat sie eigentlich Geld?« Während ich die Frage aussprach, fiel mir ein, dass das Kind erst vorgestern Abend ein Portemonnaie gestohlen hatte, in dem sich angeblich über zweihundert Euro befanden.
»Ich hab sie mitsamt ihrem Rucksack abgeliefert, hab das Ding aber nicht groß durchsucht. Ich hab bloß nach einem Ausweis geschaut oder irgendwas anderem, wo ihr Name draufsteht oder wenigstens eine Telefonnummer. Eine Leibesvisitation hab ich natürlich nicht veranstaltet.«
»Die Kollegen in den Streifenwagen sollen die Augen offen halten«, sagte ich. »Mit ihrer signalfarbenen Jacke fällt sie ja zum Glück auf.«
4
Am Montagmorgen erwarteten mich zwei Neuigkeiten im Büro: Die kleine Taschendiebin war wieder bei uns, gut bewacht im Büro von Kollegin Ilzhöfer, und der Ermordete vom Heddesheimer Badesee war tatsächlich Helge Gerstner. Balke hatte sein Foto am Freitagabend einigen seiner früheren Nachbarn gezeigt, und alle hatten ihn wiedererkannt.
Zur Welt gekommen war Gerstner 1982 in Schwetzingen, hatte Balke bereits herausgefunden. Seine Eltern waren vor über zwanzig Jahren verstorben, Geschwister hatte er keine gehabt.
»Die dortigen Kollegen haben übers Wochenende ein bisschen in der Nachbarschaft herumgefragt, aber kaum jemand kann sich noch an die Familie erinnern.«
Bis vor zwei Jahren war Helge Gerstner berufstätig gewesen, anschließend einige Zeit arbeitslos und später Frührentner.
»Wo er vorher angestellt war, konnte mir niemand sagen. War wohl nicht besonders gesprächig, der Typ. Allzu viel Geld scheint er jedenfalls nicht gehabt zu haben. Wenn ich richtig rechne, hat er nicht mal zwanzig Jahre in die Rente eingezahlt.«
»Waren Sie inzwischen in der Wohnung?«
Balke schüttelte den Kopf. »Der Hausmeister liegt immer noch mit seiner Grippe im Bett. Am Telefon sagte er mir aber, die Nachbarin gegenüber hätte einen Schlüssel zur Wohnung, eine Frau Ziller. Die habe ich aber bisher noch nicht erreicht. Außerdem sagt er, Gerstner hätte eine kleine Tochter gehabt.«
Die hieß Marie und war neun Jahre alt. Mein Mitarbeiter hatte auf der Speicherkarte aus Gerstners ertrunkenem Smartphone Fotos des Mädchens gefunden und zeigte mir eines davon.
»Süßes Mädel, finden Sie nicht?«
Ich sank in meinen Sessel zurück und schloss die Augen.
»Herr Gerlach? Irgendwas nicht in Ordnung?«
»Das süße Mädel sitzt zurzeit bei uns im Erdgeschoss. Sie hat geklaut und sich erwischen lassen, und jetzt …«
Jetzt saß das arme Kind bei Frau Ilzhöfer, fuhr auf einem Schreibtischsessel Karussell und wusste vermutlich noch nicht einmal, dass es keinen Vater mehr hatte.
»Wissen wir schon was über die Frau?«, fragte ich.
»Hab ich noch nicht gecheckt, sorry.«
Ich zog mein Notebook näher zu mir heran und tippte den Namen Gerstner in eine Suchmaske.
»Sie hatten recht«, sagte ich Sekunden später. »Die Frau heißt Tanja mit Vornamen, Mädchenname Schwarz. Dann ist sie wohl Maries Mutter.«
Somit war die Kleine doch nicht ganz allein auf der Welt. Aber weshalb hörte man nichts von dieser Mutter? Warum hatte niemand in Gerstners Nachbarschaft sie erwähnt? Warum hatte sie ihr Kind nicht längst als vermisst gemeldet? Noch einmal sah ich mir das Foto an. Es war unsere Taschendiebin, keine Frage. Das Haar war länger, das Gesicht voller, um den Mund spielte ein charmantes, spitzbübisches Lächeln, das ich bisher nicht an ihr gesehen hatte.
Seufzend stemmte ich mich aus dem Sessel.
Die Kollegin Ilzhöfer freute sich über meinen Besuch.
»Wo haben Sie sie diesmal geschnappt?«, fragte ich.
»Im Kaufhof an der Hauptstraße. Sie ist einem Hausdetektiv aufgefallen.«
Die kleine Delinquentin saß auf demselben Drehstuhl wie beim letzten Mal, hatte jedoch anscheinend den Spaß am Karussellfahren verloren. Die Hände hatte sie unter die Oberschenkel geklemmt, den Blick stur auf irgendeinen Punkt von Frau Ilzhöfers Schreibtisch gerichtet.
»Hat sie wieder geklaut?«
»So weit ist es gar nicht gekommen.«
»Hallo, Marie«, sagte ich freundlich zu dem Mädchen.
Es zuckte zusammen, als wäre es von einem Tier gebissen worden. Ich bedeutete der Kollegin, uns allein und die Tür offen zu lassen. Dann setzte ich mich auf den Schreibtischsessel der Kollegin.
»Du machst ja Sachen!«
Marie hockte mit wieder einmal zusammengepressten Lippen auf ihrem Stuhl, starrte die Wand hinter mir an und stellte sich tot. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass es keine gute Idee gewesen war, aus dem Kinderheim zu fliehen.
»Es gibt auch Heime mit Fenstern, die man nicht aufmachen kann, weißt du? Mit dicken Türen und Schlössern dran.«
Sie zog es weiter vor, meine Anwesenheit zu ignorieren.
»Früher habt ihr in Dossenheim gewohnt, habe ich rausgefunden, deine Eltern und du.«
Keine Reaktion.
»Aber vor ein paar Wochen seid ihr umgezogen.«
Immer noch nichts.
»Wohin? Wo habt ihr zuletzt gewohnt?«
Sie senkte erst den Blick, dann den Kopf.
»Habt ihr eine schönere Wohnung gefunden? Schöner als die in Dossenheim? Oder größer? Hast du ein eigenes Zimmer gekriegt?«
Kaum merkliches Kopfschütteln.
»Wo ist deine Mama?«
Nichts.
»Sie ist doch nicht wirklich in Amerika, oder?«
Stille.
»Du und dein Papa, ihr habt aber nicht … auf der Straße gelebt?«
Immerhin ein etwas deutliches Kopfschütteln.
Noch einmal fragte ich: »Wo bist du daheim, Marie? In der Nähe von der alten Wohnung oder weiter weg?«
Schweigen.
»Ist es schön da? Schöner als in Dossenheim?«
Kopfschütteln.
»Wohnt deine Mama auch da?«
»Die ist doch in Amerika«, wisperte Marie mit feuchten Augen.
»Willst du mir nicht sagen, wo du und dein Papa jetzt wohnt, oder darfst du es nicht?«
Die Unterlippe begann zu zittern, und Sekunden später strömten die Tränen.
»Komm mal mit«, sagte ich und versuchte, ihre Hand zu ergreifen.
Doch sie fuhr zurück, als würde sie sich vor mir ekeln. Nachdem ich noch ein Weilchen auf sie eingeredet hatte, packte sie schließlich doch ihren Rucksack und folgte mir mit zwei Schritten Abstand. Dieses Mal machte sie keinen Versuch wegzulaufen. Hintereinander stiegen wir die Treppen zu meinem Büro im zweiten Obergeschoss hinauf, wo ich sie in Sönnchens Obhut gab.
»Hier hast du es gemütlicher als unten im Erdgeschoss. Aber du versprichst mir, dass du nicht wieder abhaust, okay?«
Nicken. Schwach nur, aber immerhin.
»Ehrenwort?«
Etwas entschiedeneres Nicken.
Die Tränen waren inzwischen versiegt, die Lippen immer noch zusammengepresst, als dürfte kein einziges Wort ihren kleinen Mund verlassen. Ich ließ die beiden allein, betrat mein Büro und schrieb Sönnchen eine E-Mail, in der ich ihr erklärte, weshalb sie so überraschend zur Pflegemutter einer schweigsamen Neunjährigen geworden war. Wie ich durch die geschlossene Tür hören konnte, war sie ihrer neuen Rolle vollauf gewachsen. Sie organisierte Kakao für Marie, gab ihr ein Stück von einem Kuchen, der von der Weihnachtsfeier übrig geblieben war, stellte ihr nebenbei Fragen, auf die sie so wenig Antworten erhielt wie ich. Was mir auffiel: Marie lachte nie. Nicht einmal ein verschämtes Kichern hörte ich von ihr. Was mochte sie erlebt haben, dass sie seit Neuestem die Heidelberger Altstadt unsicher machte, ihr Essen stehlen musste und nicht verraten wollte oder durfte, wo sie wohnte? Wusste sie vielleicht schon, dass ihr Vater nicht mehr lebte? War sie womöglich Zeugin des Mordes geworden und deshalb Hals über Kopf geflohen?
Balke rief an, um mir mitzuteilen, niemand in dem Haus in Dossenheim habe Maries Mutter jemals zu Gesicht bekommen. Gerstner hatte sich als alleinerziehender Vater, Arbeitsloser oder Frührentner die große Wohnung nicht mehr leisten können, mutmaßten wir. Er hatte eine billigere Bleibe für sich und sein Kind gesucht, und dann musste etwas vorgefallen sein, das dazu geführt hatte, dass er erschossen wurde und Marie auf der Straße landete. Gerstners Vorstrafenregister war blütenrein, hatte Balke inzwischen eruiert, das Führungszeugnis makellos. Offiziell wohnte er immer noch in Dossenheim.
»Was ist mit der Frau?«, fragte ich. »Haben Sie über die schon irgendwas rausgefunden?«
Das hatte er immer noch nicht. Laila Khatari, die er inzwischen als Verstärkung akquiriert hatte, begann gerade erst, Gerstners Umfeld auszuleuchten, Bekannte zu finden, Freunde, Verwandte. In wenigen Stunden würden wir hoffentlich mehr wissen. Vor allem auf Maries Mutter setzte ich Hoffnungen. Und auf die Nachbarin, die einen Schlüssel zu Gerstners Wohnung hatte. Vielleicht würde es ja doch noch klappen mit friedlichen und sorgenfreien Weihnachten. Bis zum 24. Dezember blieben uns noch dreieinhalb Tage. In dieser Zeit konnte eine Menge geschehen.
Mein Wochenende war herrlich erholsam gewesen. Theresa hatte keine Zeit für mich gehabt, da sie mit ihrer Freundin Viola zusammen ein Musical in Köln besuchte. So hatte ich die zwei Tage mit Lesen, Entspannen und Faulenzen verbracht. Da es die meiste Zeit regnete, hatte ich die Wohnung nur am Samstagvormittag verlassen, um auf dem Wochenmarkt in Rohrbach einige Einkäufe zu erledigen. Meine Töchter und Mick hatten an ihrem Weltverbesserungsprojekt gearbeitet, mich nur manchmal mit Fragen, dezenter Kritik oder meist erstaunlich vernünftigen Vorschlägen behelligt. Ich hatte nur hin und wieder »ja« zu sagen brauchen, und kein einziges ihrer Anliegen hatte dazu geführt, dass ich mich von der Couch erheben musste.
Unter anderem sollte unbedingt ein wasser- und energiesparender Duschkopf angeschafft werden. Dagegen war nichts einzuwenden, da der alte ohnehin restlos verkalkt und verrottet war. Mein eigener Versuch, einen neuen zu kaufen, hatte im Sommer dazu geführt, dass ich meinen geliebten, neunzehn Jahre alten Peugeot 504 zu Schrott fuhr. Auch an der Toilettenspülung wollten meine Mädchen irgendwelche Veränderungen vornehmen mit dem Ziel, den Wasserverbrauch zu senken. Den Spalt am unteren Rand der Wohnungstür würden sie mit einer Art Borstenleiste abdichten, sodass wir nicht mehr sinnlos das Treppenhaus heizten. Auch mit der Dichtheit der Fenster waren sie unzufrieden, und die Waschmaschine musste dringend gegen ein zeitgemäßes Modell ausgetauscht werden. Praktischerweise hatten sie im Internet bereits ein gebrauchtes Gerät gefunden, das nur hundertfünfzig Euro kosten sollte. Außerdem hatten sie die alte Maschine dort angeboten, für achtzig Euro, sodass auch dieser Teil des Projekts keinen größeren finanziellen Flurschaden anrichten würde.
Noch selten hatte ich sie so engagiert und kreativ erlebt, und das Schöne dabei war, dass ich mich ein wenig als Retter der Menschheit fühlen durfte, ohne mehr zu tun, als hin und wieder zu nicken und die überschaubaren Kosten zu tragen.
Den Sonntag hatten Louise und Mick damit verbracht, im Internet Reiseberichte zu lesen von Menschen, die eine ähnlich weite und waghalsige Radtour gemacht hatten, wie sie es vorhatten. Noch hatte ich Hoffnung, dass das Vorhaben schon vor Beginn an den geografischen und politischen Bedingungen scheitern würde. Der letzte Stand der Planung, von dem ich Kenntnis erhielt, lautete: die Donau abwärts bis zum Schwarzen Meer, dann südwärts über Bulgarien, die Türkei, den Libanon, Israel, Saudi-Arabien bis Oman. Von dort wollten sie per Schiff nach Indien übersetzen und so weiter und so weiter. Dem Alter, in dem man seine Kinder durch Verbote oder Versprechungen von einem solchen Wahnsinnsplan abbringen konnte, waren die beiden leider entwachsen.
»Das da draußen ist sie?«, fragte Balke, als wir am frühen Nachmittag zu dritt in meinem Büro saßen, um die neuesten Erkenntnisse auszutauschen. Er hatte die junge, aufgeweckte und überaus fleißige Kollegin Laila Khatari mitgebracht, die es nach meiner Einschätzung noch weit bringen würde. Marie saß im Vorzimmer an einem Tisch und malte still und mit verbissenem Eifer ein Bild nach dem anderen. Ich hatte inzwischen nach einer geeigneten Psychologin telefoniert, die sich des Mädchens annehmen könnte, war aber bislang nicht fündig geworden.
In den vergangenen Stunden hatte sich manches geklärt. Helge Gerstner war bereits mit Tanja verheiratet gewesen, als Marie zur Welt kam. Seine Frau stammte aus Hamburg und war angeblich eine dunkelhaarige Schönheit.
»Gewohnt haben sie anfangs in einem gemieteten Haus in Kirchheim. Als Marie zwei war, sind sie dann nach Dossenheim gezogen.«
Die Nachbarin mit dem Schlüssel ging immer noch nicht an ihr Telefon. Auch der kranke Hausmeister wusste nicht, wo sie abgeblieben war. Jemand von der Hausverwaltung hatte Balke jedoch nach einigem Nörgeln die Handynummer der, wie es hieß, schon etwas betagten Dame verraten.
»Wenn ich da anrufe, kriege ich immer nur die Ansage, die Nummer sei zurzeit nicht erreichbar«, berichtete Balke.
»Dann reden Sie doch mal mit den früheren Nachbarn in Kirchheim«, schlug ich vor. »Vielleicht hat ja von denen jemand in letzter Zeit noch Kontakt zu Gerstner gehabt.«
Balke winkte ab. »Ich muss leider passen. Arzttermin.«
Seit er im vergangenen Sommer bei einem harmlosen Routineeinsatz um ein Haar getötet worden wäre, musste er regelmäßig ins Uniklinikum zu Kontrolluntersuchungen. Obwohl ihn nicht die geringste Schuld an den dramatischen Vorkommnissen auf der Theodor-Heuss-Brücke traf, schien ihm dieser Umstand merkwürdigerweise peinlich zu sein.
Laila hingegen, eine kleine, zarte Frau Mitte zwanzig mit dunkler Kurzhaarfrisur, freute sich wie ich darauf, an die frische Luft zu kommen. Fast alle Polizistinnen und Polizisten, mit denen ich jemals zu tun hatte, hassten Schreibtischarbeit.
Eine halbe Stunde später stiegen Laila und ich in einer ruhigen Wohnstraße im Westen Heidelbergs aus unserem zivilen Dienstwagen. Die Autobahn war nicht weit, der Wind wehte das Rauschen und Zischen von Reifen auf nassem Asphalt zu uns herüber. Der Regen hatte vorübergehend aufgehört. Nach der Helligkeit im Westen zu schließen, vielleicht sogar für länger. Die Luft war kalt. Der Wetterbericht hatte für die kommenden Tage sogar mit Schnee gedroht.
»Das da drüben ist es.« Laila deutete auf eines der Einfamilienhäuser auf der anderen Straßenseite. »Nummer siebzehn.«
Die Häuser schienen in den Fünfziger- oder frühen Sechzigerjahren entstanden zu sein, als man sich noch große Grundstücke leisten konnte. Auch die ursprünglich eher schlichten Gebäude waren geräumig. Über die Jahre hatte sich Wohlstand breitgemacht, was daran abzulesen war, dass überall mit mehr oder weniger Geschick renoviert, umgebaut oder vergrößert worden war. Man hatte Fenster ergänzt, Wintergärten angebaut, billige Haustüren durch eindrucksvolle Portale ersetzt und Carports errichtet.
Nummer siebzehn war das gepflegteste von allen, offenbar grundlegend instand gesetzt und geschmackvoll modernisiert. Die vorherrschenden Farben waren weiß und dunkelbraun, der Stil war Bauhaus-inspiriert. Auch der Zustand des Vorgartens verriet, dass die Bewohner Wert auf ein stilvolles Ambiente legten.
Wir läuteten, aber niemand öffnete uns. So versuchten wir unser Glück bei Nummer fünfzehn. Dort empfing uns eine Frau mittleren Alters, die uns mit hochgezogenen Brauen und misstrauischem Blick musterte. Beim Anblick unserer Dienstausweise erblasste sie, beruhigte sich jedoch wieder, als sie hörte, es gehe nur um ihre ehemaligen Nachbarn.
»Ich dachte schon, es ist wieder was mit Claus«, stieß sie hervor und seufzte.
Claus war ihr Sohn – gerade zwanzig geworden und mit einem Hang zu hubraumstarken Motoren und hohen Geschwindigkeiten. »Erst im Oktober hat er einen schweren Unfall gehabt. Seither bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, wenn Fremde vor der Tür stehen.«
Sie bat uns herein, führte uns in ein für meinen Geschmack etwas zu modern und rechtwinklig eingerichtetes Wohnzimmer, in dem es nach Rosen duftete, obwohl nirgendwo Blumen zu sehen waren. Mitten im Raum stand ein beeindruckend großer Tannenbaum, geschmückt mit goldenem Lametta und Kugeln und tausend aufgeregt blinkenden Lichtlein.
Die Dame des Hauses war eine Spur zu groß und breit geraten, jedoch keineswegs unattraktiv. Sie trug einen taubenblauen Kaschmirpullover zu einem aschgrauen, knielangen Rock. An der Klingel hatte ich den Namen Däublein gelesen.
»Ein Kaffee gefällig? Sie haben freie Auswahl«, erklärte sie breit lächelnd. »Espresso, Café au Lait, Cappuccino, Latte … Außerdem habe ich siebzehn Sorten Tee anzubieten: Assam, Earl Grey, Darjeeling, diverse Kräutertees …«
»Für mich bitte eine Latte«, bat Laila erschrocken.
Ich begnügte mich mit einem Glas Wasser.
»Ach ja, die Gerstners.« Frau Däublein seufzte schwer, als wir endlich am eckigen Chrom-und-Rauchglas-Couchtisch Platz nahmen. Sie auf einer signalroten Ledercouch, Laila und ich in üppigen und sehr bequemen weißen Sesseln. »Wenn ich offen sprechen darf: Richtig warm geworden sind mein Mann und ich nie mit den Leuten.«
»Wie waren sie denn so?«, fragte Laila.
Während der Fahrt hatten wir vereinbart, dass ich ihr heute die Gesprächsführung überlassen würde.
»Schwierig. Die Abneigung beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit. Aber ich meine etwas anderes. Sie haben einfach nicht hierher gepasst. Sehen Sie, mein Mann ist Steuerberater mit eigenem Büro und fünf Angestellten. Dr. Großfuß von Nummer zwölf war bis zu seiner Pensionierung Oberstudiendirektor am Hölderlin-Gymnasium. Die Nachbarn links von ihm, übrigens auch beide promoviert, betreiben in der Innenstadt ein exquisites Antiquariat, und dann plötzlich diese – verzeihen Sie – Proletenfamilie. Die Frau – ich kann es nicht anders ausdrücken, tut mir leid – ein Flittchen und dumm wie Bohnenstroh. Auch der Mann eher einfach gestrickt, man wusste ja nicht einmal, wie und wo er sein Geld verdient hat. Kurz und gut, sie passten nicht hierher. Weder vom finanziellen noch vom kulturellen oder intellektuellen Niveau her.«
»Anscheinend hatten sie aber genug Geld, um sich so ein schönes Haus leisten zu können«, warf Laila ein.
»Es hat ihnen natürlich nicht gehört.« Frau Däublein lachte abfällig. »Die Miete war meines Wissens äußerst günstig, weil der Vertrag befristet war. Das Ehepaar Clarin, beide übrigens seeehr erfolgreiche Innenarchitekten, war für einige Zeit in den Staaten drüben. Gerstner und seine … hm … Frau hätten sich ohnehin bald wieder etwas anderes suchen müssen. Etwas, das ihren finanziellen Möglichkeiten eher entsprach.«
Wie eine Dreizimmerwohnung in Dossenheim zum Beispiel.
»Sie haben vermutlich einiges mitbekommen davon, wie es nebenan zugegangen ist.«
Frau Däublein strich eine ihrer kastanienbraunen Locken hinters Ohr, nahm ein Schlückchen von ihrem Espresso doppio und verdrehte theatralisch die graugrünen Augen.
»In der Tat. Und leider nicht immer Erfreuliches. Um die Wahrheit zu sagen, sie haben viel gestritten, die beiden. Worüber, weiß ich nicht und will ich auch nicht wissen. Ja, es war häufig laut da drüben, sehr laut. Das Gezänk, die ewige Musik und dazu das ständig schreiende Kind …«
Helge Gerstner und seine junge Frau waren offenbar Hardrock-Fans und im Besitz einer leistungsstarken Stereoanlage gewesen.
»Hübsch war sie ja, die Tanja, das muss ich zugeben, beneidenswert hübsch. Und blutjung. Anfangs habe ich mich gefragt, ob sie überhaupt schon volljährig war.«
»Und Marie?«
Wieder nippte sie an ihrem Tässchen.
»Dass das Kind nicht taub geworden ist bei dem ständigen Lärm, grenzt an ein Wunder.«
Als die kleine Familie einzog, war Marie noch nicht auf der Welt gewesen.
»Übrigens haben sie kein Umzugsunternehmen beschäftigt wie normale Menschen, sondern alles selbst gemacht. Aber sie hatten ja auch nicht viel zum Umziehen.«
»Die Eltern haben also öfters gestritten …«
»Täglich. Vor allem im Sommer, wenn die Fenster offen standen, war es oft kaum zu ertragen. Da wurde gezetert und gebrüllt, Türen wurden geknallt und die Musik noch lauter gedreht. Hinzu kam, dass Helge in seiner Freizeit viel im Haus gearbeitet hat. Unentwegt hat er gehämmert und gebohrt und geschliffen. Und wenn es ausnahmsweise einmal ruhig war, dann hat todsicher das Kind geschrien. Glauben Sie mir, niemand hier war traurig, als sie endlich ihre Siebensachen gepackt haben.« Frau Däublein lachte herablassend. Laila nahm einen Schluck von ihrer Latte macchiato. »Knapp zwei Jahre sind sie geblieben, hab ich gelesen.«
Unsere Gastgeberin zog die noch beneidenswert faltenfreie Stirn kraus, blinzelte über unsere Köpfe hinweg. »Das mag stimmen, ja. Aber, ach, das hatte ich völlig vergessen: Die Frau war schon früher weg. Sie war Monate vorher … ausgezogen.«
Laila machte sich eine Notiz auf ihrem Smartphone.
»Sie hat ihren Mann mit dem kleinen Kind sitzen lassen?«, fragte sie verwundert und sah wieder auf.
»So war es, ganz richtig. Auf und davon ist sie. Ungefähr ein Vierteljahr bevor er dann auch das Feld geräumt hat. Auf einmal war sie nicht mehr da, von heute auf morgen. Mein Mann und ich haben sogar überlegt …« Sie verstummte, senkte den Blick, sah wieder auf. »Er ist tot, sagen Sie?«
»Leider. Nach allem, was wir bisher wissen, ist er ermordet worden.«
Frau Däublein nickte, als hätte sie nichts anderes erwartet. »Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll …«
»Sagen Sie es ruhig. Alles kann wichtig sein.«
»Es ist nämlich … Es ist mir ein wenig peinlich, aber mein Mann und ich, wir haben einige Zeit sogar überlegt, ob er sie nicht umgebracht hat.«
Bei den letzten Worten hatte sie sich weit vorgebeugt und die Stimme bedeutungsvoll gesenkt.
»Niemand hat gesehen, wie sie gegangen ist. Das war alles … so merkwürdig. Anfangs ist uns nur aufgefallen, dass es drüben plötzlich keinen Streit mehr gab. Dann haben wir bemerkt, dass man sie überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekam. Anzeige wollten wir letztlich aber doch nicht erstatten. Man möchte sich ja nicht ohne Not lächerlich machen, nicht wahr?«
»Wissen Sie noch, bei welcher Firma er gearbeitet hat?«
Frau Däublein schüttelte seufzend ihren Lockenkopf. Auch sonst konnte sie nicht mehr viel Erhellendes beitragen.
»Er hat wohl aus der Gegend gestammt, aber ein leidliches Hochdeutsch gesprochen. Sie war aus dem Norden, das hat man gehört. Wir haben auf Hamburg getippt, dieses hanseatische ›s‹, Sie wissen schon. Aber wenn ich ehrlich sein darf – der Background dieser Leute war mir von Herzen gleichgültig.«
5
Die seeehr erfolgreichen Innenarchitekten bewohnten ihr Eigenheim seit dem Auszug der unbeliebten Mieter wieder selbst, waren jedoch immer noch nicht zu Hause. So versuchten wir unser Glück bei Hausnummer neunzehn. Hier begrüßte uns ein freundliches Paar im Rentenalter. Der Name an der Tür lautete Anheuser.
»Wir haben’s schon gehört«, sagte der massige, grauhaarige Mann schnaufend, als wir unsere Ausweise vorzeigten. »Der Gerstner ist tot. Die Frau Däublein hat uns gleich angerufen.«
»Wie furchtbar!«, rief seine Frau, die schräg hinter ihm stand und zwei Köpfe kleiner war als ihr Gatte. »Was passiert denn jetzt mit Marie? Wie alt ist sie eigentlich inzwischen?«
Ich schätzte die beiden auf Anfang siebzig. Die Frau trug ein apartes, lindgrünes Kleid und drollige Silberlöckchen auf dem Kopf, er eine abgewetzte Jeans und einen verblichenen und hoffnungslos aus der Form gegangenen Schlabberpulli.
»Neun«, sagte ich. »Derzeit ist sie in unserer Obhut.«
»Und Tanja? Wie geht’s der?«
»Das wissen wir nicht«, sagte Laila. »Wir haben sie bisher nicht finden können.«
»Ja … aber dann ist die Kleine ja ganz allein. Gibt es Verwandte, oder muss sie jetzt etwa in ein Heim?«
»Das ist alles noch nicht geklärt«, sagte ich. »Wir stehen noch ganz am Anfang. Wir hoffen vor allem, dass wir ihre Mutter bald finden.«
»Haben sie denn später wieder zusammengelebt?«, fragte Frau Anheuser über die Schulter ihres Mannes hinweg. »Der Helge und seine Tanja?«
Nun ließ ich Laila wieder den Vortritt: »Jedenfalls stehen beide Namen an der Klingel, wo sie zuletzt gewohnt haben. Aber es ist alles ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.«
»Und wenn Sie die Tanja … Ich meine, wenn Sie sie nicht finden? Was wird dann aus Marie?«
»Wenn es gar nicht anders geht, kommt sie wahrscheinlich in eine Pflegefamilie, wo sie es gut hat.«
»Wär’s vielleicht okay, wenn wir reingingen?«, fragte Laila, die sichtlich fror.
»Aber natürlich«, rief Frau Anheuser erschrocken. »Gott im Himmel, wir lassen Sie hier einfach in der Kälte stehen. Kommen Sie doch, kommen Sie bitte. Die Schuhe können Sie anlassen.«
Beim Ehepaar Anheuser ging es eher kleinbürgerlich zu. Die mit braunem Leder bezogene Couchgarnitur war vielleicht vor vierzig Jahren modern gewesen, die aufwendig gerahmten und überwiegend großformatigen Fotos an der Wand zeigten größtenteils Landschaften und Sonnenuntergänge am Meer. Es roch nach frisch gebackenem Kuchen und älteren Herrschaften, die es gerne warm hatten. Der Weihnachtsbaum war noch nicht aufgestellt. Dafür machte sich auf dem Couchtisch ein riesiger, vermutlich selbstgefertigter Adventskranz breit, der schon dramatisch Nadeln verlor und kräftig weihnachtlichen Duft verströmte.
»Wir wollen uns schon länger mal was Neues kaufen«, entschuldigte sich der Hausherr mit Blick auf das Mobiliar. »Aber irgendwie – man hat sich halt dran gewöhnt, an das alte Zeug, nicht wahr?«
Seine Frau bot frisch zubereitete Zitronenlimonade an, die wir gerne akzeptierten. Der Kaffee bei Frau Däublein war kriminell stark gewesen, hatte mir Laila berichtet.
»Sie ist so eine Süße gewesen, die kleine Marie, so ein Sonnenschein. Oft war sie bei uns, nicht wahr, Richard?«
Herr Anheuser nickte mit grimmigem Blick.
»Der Helge hat ja unter der Woche arbeiten müssen, und der Tanja ist es oft zu viel geworden mit dem Kind. Da ist sie froh gewesen, dass Marie bei uns gut aufgehoben war, nicht wahr, Richard?«
Herr Anheuser nickte mit einer Miene, als würden gerade weltbewegende Themen besprochen.
»Bloß stillen konnt ich die Kleine natürlich nicht.« Sie kicherte verschämt und strich sich durchs silberne Lockenhaar. »Aber die Tanja hat sie ja sowieso bald abgestillt, und Fläschchen machen, das konnt ich natürlich noch, nicht wahr, Richard?«
Herr Anheuser nickte, als wäre seine Frau amtierende Weltmeisterin im Anwärmen von Baby-Fertigmilch.
»Wir haben gehört, es hätte manchmal Streit gegeben nebenan«, sagte Laila.
Nun ergriff der Mann das Wort. »Gut, ja. Aber wie meine Beatrix und ich jung waren, da haben wir uns auch manchmal gestritten, gell, Bea? Wenn man jung ist, dann muss man sich erst mal zusammenraufen, das ist doch ganz normal. Und dass junge Leute manchmal die Musik ein bisschen lauter drehen, das ist auch normal. Manche Leute sollten sich nicht so anstellen, finde ich.«
»War Frau Gerstner krank?«, fragte ich mit Blick auf die Frau.
»Körperlich nicht. Aber die Seele. Oft ist sie traurig gewesen, ist den halben Tag im Bett geblieben. Mit ihrer Rolle als Mutter ist sie gar nicht zurechtgekommen. Wir haben gedacht, das gibt sich mit der Zeit, sie muss sich erst daran gewöhnen, dass sie jetzt ein Kind hat. Aber so war’s nicht. Sie hat sich nicht dran gewöhnt. Im Gegenteil. Immer empfindlicher ist sie geworden, nicht wahr, Richard?«
Laila übernahm wieder: »Wie war das eigentlich, als sie ausgezogen ist?«
»Ausgezogen kann man ja nicht sagen«, antwortete Frau Anheuser mit unglücklicher Miene. »Eines Tages ist sie einfach nicht mehr da gewesen. Erst haben wir es gar nicht gemerkt, man hat sie sowieso oft länger nicht gesehen. Aber dann läutet irgendwann der Helge bei uns und fragt, ob wir tagsüber auf seine Kleine aufpassen können, weil die Tanja verreist ist.«
»Hat er gesagt, wohin sie gefahren ist?«
»Nur, dass sie ein paar Tage Erholung braucht. Aber sie ist nicht zurückgekommen.«
»War vielleicht vorher ein besonders schlimmer Streit gewesen?«
Die beiden Alten sahen sich an. Zuckten gleichzeitig die Schultern. Auch sie konnten nicht sagen, wann genau Maries Mutter verschwunden war.
»Wir wissen schon, was manche Leute rumerzählen, dass der Helge die Tanja umgebracht hätte«, brummte Herr Anheuser mit abgewandtem Blick. »Aber, entschuldigen Sie, ich persönlich halte das für gequirlten Quark. Ein ausgemachter Blödsinn ist das. Der Helge ist ein anständiger Kerl gewesen, der es nicht leicht gehabt hat im Leben.«
»Immer ist er so lieb gewesen zu der kleinen Marie«, stimmte die Frau in sein Loblied ein. »Nach der Arbeit hat er mit ihr gespielt, wenn das Wetter gut war, im Garten. Er hat ihr einen Sandkasten gebaut und Liedchen vorgesungen, hoppe Reiter gespielt, was man halt so macht mit kleinen Kindern. Er hat ihr das Laufen beigebracht, nicht sie.«
Ende der Leseprobe