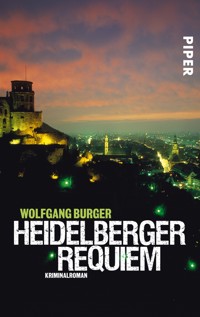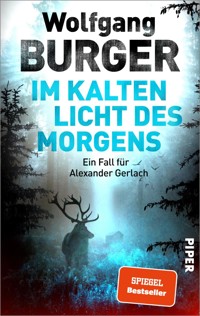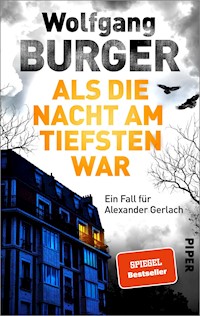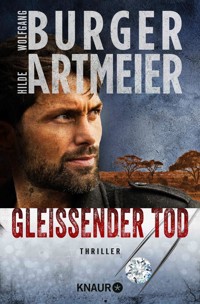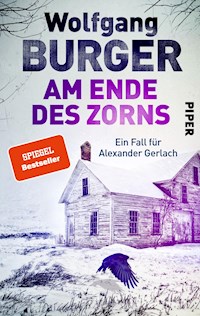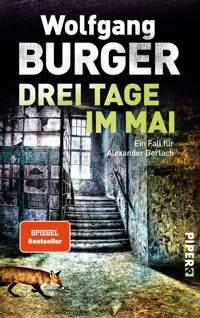9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Fröstelnd steht Kriminalrat Alexander Gerlach vor der Leiche von Anita Bovary. Die Frau, die erstochen in ihrer kleinen Wohnung aufgefunden wurde, lebte isoliert, hatte weder Freunde noch Bekannte. Im Umfeld der Toten stößt er auf mehr und mehr Ungereimtheiten, doch jede Spur führt in eine Sackgasse. Erst als eine zweite Leiche gefunden wird, fügen sich die Indizien zum alarmierenden Bild. Gerlach beginnt zu fürchten, dass es noch mehr Opfer geben könnte. Es kommt jedoch noch sehr viel schlimmer, denn er hat ein wichtiges Detail übersehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Thea
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Originalausgabe
5. Auflage Dezember 2012
© Piper Verlag GmbH, München 2010
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlagabbildung: Egon Bömsch, mauritius images/imagebroker
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-492-95116-6
1
»Die Leiche heißt A Punkt Bovary«, verkündete der junge uniformierte Kollege mit vor Aufregung roten Ohren. »Wie es aussieht, ist sie erstochen worden.«
Vermutlich war das, was hinter der angelehnten Wohnungstür lag, der erste Mordfall in seiner Polizisten-Laufbahn. Die Uniform des pickligen Mannes war zu weit, als müsste er erst noch hineinwachsen, und die Mütze saß auf seinem Kopf, als wäre es nicht seine. Er gehörte zur Besatzung eines der beiden Streifenwagen, die ich eben mit sinnlos zuckenden Blaulichtern vor dem Hauseingang gesehen hatte. Den Namen der Toten hatte er von einem handbeschriebenen Schildchen unter dem abgegriffenen Klingelknopf abgelesen.
Wir – vier etwas übernächtigt dreinschauende Schutzpolizisten, eine fröstelnde ältere Dame in Rosa und ich selbst – standen im neonbeleuchteten Flur des vierzehnten Stocks eines Hochhauses am Rand von Heddesheim. Es war Sonntagmorgen, der achtzehnte Januar, meine Uhr zeigte sieben Minuten nach fünf, und mir war gar nicht gut.
An der Tür, hinter der die aus meiner Perspektive zum Glück nicht sichtbare Tote lag, hielt mit ernster Miene ein stämmiger Kollege Wache. Er hatte sich seine Mütze unter den Arm geklemmt.
»Es ist alles veranlasst«, verkündete er selbstbewusst. »Ihre Kollegen sind schon unterwegs, Herr Kriminaloberrat.«
»Wer war drin?«, fragte ich und unterdrückte ein Gähnen.
»Ich.« Der Dicke hob das Kinn noch ein wenig höher. »Sie ist wirklich mausetot, Herr Kriminaloberrat. Nichts mehr zu machen.«
Alle zuckten zusammen, als ein scheppernder Gong ertönte. Einer der beiden Aufzüge stoppte, und die Tür glitt mit eierndem Quietschen auf. Drei Kollegen und zwei Kolleginnen vom Kriminaldauerdienst gesellten sich zu uns. Einzig eine kleine, energisch um sich blickende Aschblonde, an deren Namen ich mich nicht erinnern konnte, schien schon – oder immer noch – halbwegs wach zu sein.
»Irgendeine Sau hat den Aufzug vollgekotzt!«, beschwerte sich der Anführer der Gruppe. Ihn kannte ich gut: Rolf Runkel, trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch Oberkommissar und leider nicht der intelligenteste meiner Untergebenen. Vielleicht war es doch nicht so dumm gewesen, vorhin den Taxifahrer zu bitten, die Fahrtrichtung zu ändern und mich zum Tatort statt nach Hause zu fahren. Auch ich hatte den falschen Lift erwischt, und mein Magen rebellierte immer noch bei dem Gedanken an die stinkende, grüngelbe Pfütze am Boden.
Der junge Schupo mit den roten Ohren nahm wieder Haltung an und wiederholte seinen Bericht. Bei aller Aufregung machte er seine Sache nicht einmal schlecht. Unauffällig sah ich mich nach einer Sitzgelegenheit um. Meine Augen brannten, mein Kopf dröhnte, mein Magen wollte sich nicht beruhigen. Aber meine Suche nach einem Stuhl war vergeblich, so lehnte ich mich möglichst unauffällig an die Wand.
Die tote Frau liege im Flur des Einzimmerappartements nur zwei Schritte hinter der angelehnten Tür, hörte ich ein zweites Mal, und ich meinte, ihr schweres Parfüm zu riechen.
»Sie ist bestimmt erstochen worden«, beendete er seinen Rapport. »Da drin ist unglaublich viel Blut.«
»Was ist mit der Tatwaffe?«, fragte ich und rieb mir die Augen.
»Hab ich nicht gesehen«, erwiderte der mit dem Bauch sofort. »Aber ich bin da drin natürlich auch nicht groß hin und her gelaufen.«
Ich nickte. Die beiden hatten es richtig gemacht. Nur einer darf bei Verdacht auf eine nicht natürliche Todesursache den potenziellen Tatort betreten, und seine einzige Aufgabe ist festzustellen, ob es noch etwas zu retten gibt. Im Fall eines offensichtlichen Gewaltverbrechens hieß es: Nichts anfassen, darauf achten, wohin man seine Füße setzt, und so schnell wie möglich wieder hinaus. Anschließend hat der Betreffende den Eingang zu bewachen und niemanden hineinzulassen, der am Tatort nichts verloren hat. Das bekommt jeder Polizist im Lauf seiner Ausbildung eingebläut.
»Haben Sie das schon gesehen?« Ich wies auf deutlich sichtbare Blutspuren am Boden, die sich erst wenige Meter vor den Aufzugtüren verloren. »Waren Sie das?«
»Was denken Sie denn!« Der Türbewacher schüttelte entrüstet den Kopf. »Sieht ganz so aus, als wäre der Mörder in das Blut getreten.«
An manchen der Abdrücke war deutlich ein grobes Profil zu erkennen. Größe dreiundvierzig, schätzte ich, maximal fünfundvierzig. Unsere allererste Spur im Mordfall A Punkt Bovary. Ich kniff die Augen zu und riss sie wieder auf. Aber das Bild, das sich mir bot, blieb verschwommen.
Wieder ertönte der Gong. Aus der Tür des zweiten Fahrstuhls trat eine junge Frau, grüßte mit irritiertem Blick stumm in die Runde und ging dann mit vorsichtigen und leicht schwankenden Schritten den Flur bis zum Ende hinunter, wo sie eine Wohnungstür aufschloss und, ohne noch einmal zurückzusehen, verschwand. Sie trug einen leichten, für die Kälte eindeutig zu kurzen Mantel, unter dem lange Beine in hauchdünnen, glitzernden Strümpfen hervorragten. Die Füße steckten in ganz und gar nicht zu ihrem restlichen Outfit passenden gefütterten Stiefeln, in der Hand hielt sie zwei ebenfalls glitzernde Schuhe mit schwindelerregend hohen Absätzen. Nach ihrer Aufmachung zu schließen, kam sie von einer alkoholreichen Party. Oder von der Arbeit? Draußen herrschte eine arktische Kälte, es lagen über zwanzig Zentimeter Neuschnee, und auch ich hatte noch keine Sekunde geschlafen in dieser nun schon fast vergangenen Nacht.
»Wer hat sie gefunden?«, fragte ich.
Die etwas zerbrechlich wirkende, vielleicht fünfzigjährige Nachbarin in rosa changierendem Seidenmorgenmantel und Plüschpantoffeln hob so zaghaft die Hand, als wäre sie damit die erste Verdächtige in diesem Drama. Sie bewohnte die Wohnung genau gegenüber dem Tatort. Auch dort stand die Tür ein wenig offen. Insgesamt gingen zwölf Türen von dem langen Flur ab, zählte ich. Das für die frühe Stunde erstaunlich akkurat frisierte Haar der Zeugin war schon fast vollständig ergraut, doch ihr Gesicht sah trotz des fahlen Neonlichts erstaunlich jung aus.
Was wollte ich hier? Im Bett sollte ich liegen und schlafen, endlich schlafen. Warum hatte ich vorhin meine Neugier wieder einmal nicht bändigen können, als die Meldung per Handy kam? Aber nun stand ich hier, und als Chef der Heidelberger Kriminalpolizei konnte ich mich nicht einfach wieder verkrümeln. Meine Glieder waren bleischwer, und zudem war ich ziemlich betrunken. Nein, es war nicht nur die Neugier gewesen, die mich hergetrieben hatte. Es war auch die Sorge, ob hier alles seinen richtigen Gang ging, wenn drei Viertel meiner Leute mehr oder weniger betrunken unter irgendwelchen Tischen lagen oder immer noch weitertranken.
Im Grunde hatte ich hier nichts verloren. Als Chef hat man keine Bereitschaftsdienste mehr. Als Chef hat man an Wochenenden frei. Was zu tun war, würden die diensthabenden Kollegen erledigen, und einem so übersichtlichen Fall dürfte hoffentlich selbst Rolf Runkel gewachsen sein.
Eine griechische Hochzeitsfeier gilt erst dann als gelungen, wenn sich keiner mehr aufrecht halten kann, hatte ich in den vergangenen Stunden gelernt. Soweit es mich betraf, hatte die Veranstaltung ihr Ziel fast erreicht. In meinen Ohren dröhnte noch immer die Musik, in meinem Kopf tanzte dieser verteufelt süffige Athos mit diversen Ouzos Sirtaki, und in meinem Magen rumorte zentnerschwer alles, was die griechische Küche an gut Gewürztem und scharf Gebratenem zu bieten hat.
Endlich kam mir eine Idee. Ich wandte mich an die rosafarbene Dame: »Können wir uns irgendwo setzen? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.«
»Natürlich.« Zaghaft wies sie auf die Tür zu ihrer Wohnung. »Wenn Sie mögen, könnte ich auch einen Kaffee …«
Ich verkniff mir ein Lächeln. Meine Idee hatte funktioniert.
Ich gab Runkel die Anweisung, schon einmal mit der Befragung der anderen Nachbarn zu beginnen und ansonsten auf die Spurensicherung zu warten, und folgte der Frau in ihre etwas muffig riechende Wohnung. Meine Gastgeberin hielt sich für die frühe Stunde sehr aufrecht.
Stumm bot sie mir einen Platz auf dem Sofa an, das wirkte, als wäre es für Kinder gemacht. Das Wohnzimmer war klein, die ganze Wohnung war klein, wie die Bewohnerin auch. Ich setzte mich vorsichtig, sie verschwand mit einer gemurmelten Entschuldigung in der Küche. Nach Sekunden sprang ich wieder auf, öffnete eines der beiden Fenster und nahm ein paar tiefe Atemzüge von der eiskalten Luft, die hereinströmte. Das tat gut.
Ich hörte die Frau in der Küche hantieren. Bald begann es, nach Kaffee zu duften.
Der Kaffee, den sie wenige Minuten später hereinbrachte, war genauso stark, wie er am Ende einer durchzechten Nacht zu sein hat.
»Wie haben Sie die Tat entdeckt?«, fragte ich nach dem ersten Schluck. »Sind Sie morgens immer so früh auf dem Flur?«
»Aber nein.« Ernst schlug sie die grauen Augen nieder und errötete zart. »Ich musste zur Toilette. Da habe ich vor der Tür Geräusche gehört. Leise, eilige Schritte. In den vergangenen Monaten ist im Haus einige Male eingebrochen worden, und deshalb habe ich dann – wirklich ganz entgegen meinen Gewohnheiten – durch den Spion geblickt.«
»Haben Sie jemanden gesehen?«
»Nein. Es war Licht im Flur, aber gesehen habe ich niemanden. Ich meine, ich hätte dann noch den Aufzug gehört, aber da bin ich mir nicht sicher. Dann ist mir aufgefallen, dass Frau Bovarys Tür einen Spalt offen stand. Erst dachte ich, was geht es mich an, und habe mich wieder hingelegt. Aber dann konnte ich nicht wieder einschlafen. Schließlich bin ich aufgestanden und habe nachgesehen. Und da …« Sie schluckte zweimal, schüttelte fassungslos den Kopf. »Im Flur war es jetzt dunkel, Frau Bovarys Tür stand immer noch offen, und innen war Licht. So habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin hinaus, habe durch den Türspalt gesehen, und nun ja … da lag sie dann.«
»Wann war das?«
»Als ich die Polizei angerufen habe, war es halb fünf. Das erste Mal, als ich zur Toilette war, dürfte es etwa eine Stunde früher gewesen sein. Aber da habe ich nicht auf die Uhr gesehen.«
»Was wissen Sie über Ihre Nachbarin?«, fragte ich nach einem weiteren Schluck Kaffee, an dem ich mir die Zunge verbrannte. »Der Name Bovary klingt französisch.«
»Sie war aber keine Französin. Das A steht für Anita, und nach ihrem Akzent zu schließen, stammte sie aus Berlin. Ihre Vorfahren waren vielleicht Hugenotten. Die hat der Alte Fritz ja seinerzeit eingeladen, nach Preußen umzusiedeln. In ihrer alten Heimat Frankreich wurden die Hugenotten wegen ihres Glaubens ständig unterdrückt und drangsaliert.«
Sprach ich mit einer Geschichtslehrerin? Die wenigen Bücher, die ordentlich gestapelt auf dem kleinen Couchtisch lagen, ließen keinen Schluss auf ihre Interessen zu. Es waren ausschließlich Romane: Döblin, Brecht, Grass, Muschg.
»Haben Sie sie gut gekannt?«
Sie sah in ihre Tasse, die sie die ganze Zeit in der Hand hielt, ohne einmal daran zu nippen.
»Nein«, erwiderte sie ein wenig verlegen. »Ich weiß so gut wie nichts über sie. Sie hat ja auch noch nicht lange hier gewohnt.«
»Gibt es Angehörige, die man benachrichtigen muss?«
Sie hob die schmalen Schultern und raffte mit der rechten Hand den Morgenmantel am Hals zusammen, als wäre ihr kalt. Das Fenster hatte ich längst wieder geschlossen.
»Ich weiß es nicht. Wir haben uns nur hin und wieder im Flur getroffen und sind zwei- oder dreimal zusammen im Lift gefahren. Gesprochen haben wir, was man so spricht, wenn man sich kaum kennt. Das Wetter, der viele Regen über Weihnachten. Sie war auch nicht übermäßig mitteilsam. Freundlich war sie, ja, aber Frau Bovary hat keinen großen Wert auf nachbarschaftliche Kontakte gelegt.«
Ich suchte und fand ein Blatt Papier in der Innentasche meines Jacketts sowie einen Kugelschreiber, der sogar funktionierte.
»Seit wann genau hat sie nebenan gewohnt?«
»Im Oktober ist sie eingezogen, daran erinnere ich mich noch genau. Es war an dem Tag so furchtbar heiß.«
»Wo hat sie vorher gewohnt?«
Erneutes Schulterzucken. Plötzlich entschlossen, leerte sie ihre Tasse und stellte sie mit einer zielsicheren Bewegung ab.
»Was ich merkwürdig fand: Sie hat kaum etwas mitgebracht, als sie hier auftauchte. Einen Koffer, eine oder zwei Taschen, ein bisschen Kram, hat mir Frau von Freithal erzählt.«
»Frau von Freithal ist eine weitere Nachbarin, nehme ich an?«
Sie nickte. »Die Wohnung gegenüber ist möbliert, müssen Sie wissen. Aber in ihrem Alter, Frau Bovary dürfte um die vierzig sein, da hat man doch eigene Möbel, nicht wahr? Einen Hausstand und nicht nur einen Koffer. Vielleicht hat sie sich getrennt, haben wir gedacht. Frau von Freithal meinte, sie habe sich vielleicht Hals über Kopf von einem Mann getrennt. Und wer weiß, vielleicht hat er ja …«
Sie verschluckte den Rest des Satzes und sah mich erschrocken an.
»Sie wollten sagen, er hat sie aufgespürt und umgebracht?«
Es wäre nicht der erste Fall, bei dem ein verlassener Ehemann seine Frau lieber tot als in den Armen und im Bett eines anderen sieht.
»Die Wohnung ist also möbliert«, nahm ich den Faden wieder auf. Inzwischen war der Kaffee auf Trinktemperatur abgekühlt. Meine Gastgeberin nickte und schenkte ungefragt nach.
»Da drüben, nun ja … es handelt sich um eine – wie sagt man? – Hostessenwohnung? Eine Wohnung eben, wo gewisse Damen gegen Bezahlung gewisse Dienste anbieten. Ob so etwas hier überhaupt erlaubt ist, bezweifle ich. Aber solange die Herren sich anständig betrugen, wollte ich nicht so sein. Anfangs dachte ich natürlich, auch Frau Bovary …«
Nach ihrer überkorrekten Grammatik zu schließen, war sie wohl doch eher Deutschlehrerin.
»Hat sie denn häufig Männerbesuch gehabt?«
»Das nun nicht.« Zögernd, als müsste sie erst noch einmal nachdenken, schüttelte sie den Kopf. »Aber ich habe auch nicht sonderlich darauf geachtet, was gegenüber vorging. Erstens schätze ich selbst die Anonymität dieses Hauses, und zweitens … war es mir ein wenig peinlich. Deshalb habe ich bewusst nicht darauf geachtet, wer drüben ein- und ausging. Aber mein Eindruck war, dass es deutlich ruhiger geworden ist, seit Frau Bovary hier wohnt.« Sie schluckte, schlug wieder die Augen nieder. »Gewohnt hat, mein Gott.«
»Gibt es sonst jemanden im Haus, der etwas über sie weiß?«
»Den Hausmeister habe ich hin und wieder drüben gesehen. Es gab wohl irgendein Problem mit der Heizung, habe ich im Vorübergehen aufgeschnappt. Und dann, gleich nebenan, Frau von Freithal eben. Da werden Sie aber leider kein Glück haben. Frau von Freithal reist viel. Sie hat einen wohlhabenden Mann beerbt und sich vorgenommen, vor ihrem Tod – sie ist schon über siebzig – noch die ganze Welt zu sehen und wenn irgend möglich nichts von ihrem Erbe übrig zu lassen für ihre undankbaren Kinder. Im Augenblick ist sie in Neuseeland. Wandern, wenn ich richtig verstanden habe. Mit dreiundsiebzig!«
Alle Möbel, die mich umgaben, waren neu und von schlichter Modernität. Ein weicher Teppich am Boden war in warmen Farben gehalten, die Aquarelle an den Wänden schienen alle vom selben Künstler zu stammen. Auf einem Sideboard prangte ein üppiger Blumenstrauß, der jetzt, mitten im Winter, ein wenig deplatziert wirkte.
»Die Bilder sind von mir«, sagte meine Gastgeberin und lächelte zum ersten Mal ein wenig. »Ein kleines Hobby.« Ihr Lächeln verschwand so schnell, wie es erschienen war. »Und die Möbel … Ich habe mich letztes Jahr neu eingerichtet, nachdem mein Mann gestorben war. Mein Mann war ein wenig … konservativ in solchen Dingen, und als er nicht mehr war, habe ich das Haus verkauft, bin hierhergezogen, weg von dieser geschwätzigen Nachbarschaftsmischpoke, und habe mein Leben neu begonnen, wenn Sie so wollen.«
Der Kaffee tat seine Wirkung. Mein Blick war jetzt klar, es gelang mir wieder, einen Gedanken zu Ende zu denken. Meine Gastgeberin hob die silberne Kanne mit fragendem Blick. Ich nickte, sie schenkte zum zweiten Mal nach.
»Und mit Frau von Freithal hatte Frau Bovary also Kontakt?«
»Sie hat ihre Pflanzen versorgt, wenn sie auf Reisen war. Aus irgendeinem Grund haben die beiden miteinander gekonnt. Wie gesagt, Frau Bovary war sonst eher ein wenig verschlossen. Aber Frau von Freithal … es gibt ja diese beneidenswerten Menschen, die jeden sofort für sich einnehmen.«
»Wissen Sie, wo und was Frau Bovary gearbeitet hat?«
»Nichts. Jedenfalls hat sie nicht zu geregelten Zeiten die Wohnung verlassen. Vielleicht war sie freiberuflich tätig?«
»Das heißt, sie hat mehr oder weniger die ganze Zeit allein in ihrer Wohnung gesessen?«
Mit einem Mal wurde mir bewusst, dass ich den Namen meiner Gesprächspartnerin nicht kannte. Ich reichte ihr ein Kärtchen, das sie mit einer förmlichen Geste entgegennahm und aufmerksam studierte.
»Herr Gerlach?« Jetzt lächelte sie wieder und reichte mir ihre schmale, kühle Rechte über den Tisch.
»Ute Hasenkamp. Bis zu meiner Pensionierung Lehrerin für Deutsch und Geschichte.«
Na also.
Sie legte die Visitenkarte mit dem Emblem der Baden-Württembergischen Polizei achtsam auf den Tisch und fuhr fort: »Hin und wieder musste sie natürlich einkaufen. Ein- oder zweimal hat sie auch einen kleinen Ausflug gemacht. Die Decke ist ihr wohl ein wenig auf den Kopf gefallen. Und manchmal ist sie auch abends weggegangen, meist an Samstagen. Aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich habe ihr nicht nachspioniert. Man kennt mit der Zeit den Klang der Türen. Man erkennt die Nachbarn am Schritt, an der Art, wie sie mit dem Schlüssel klimpern.«
»Wo ist sie hingegangen an diesen Abenden?«
»Sie ist immer gegen sieben, halb acht aufgebrochen, bei diesen Gelegenheiten hat sie auch Parfüm aufgelegt und sich schick gemacht. Was ihre Kleidung betraf, hatte sie Geschmack, das muss ich sagen. Meist ist sie spätestens gegen elf wieder nach Hause gekommen. Sie wird essen gegangen sein, denke ich. Man muss hin und wieder hinaus, ich weiß, wovon ich rede. Und das ist leider alles, was ich Ihnen über Frau Bovary berichten kann.«
Mein dritter Kaffee war getrunken. Mein Magen hatte sich endlich beruhigt. Frau Hasenkamp brachte mich zur Tür.
»Was meinen Mann betrifft«, sagte sie leise, als wir uns zum Abschied die Hände reichten, »nicht dass Sie Schlimmes von mir denken. Frau von Freithal, die hat den Tod ihres Gatten am Ende herbeigesehnt. Die hat sich darauf gefreut, endlich ein neues Leben beginnen zu dürfen. Ihr drittes Leben, sagt sie immer. Nach der Jugend, wo einem jeder sagen darf, was man zu tun und vor allem zu lassen hat, nach der Ehe, wo der Mann bestimmt, genießt sie jetzt ihre Freiheit in vollen Zügen. Bei mir war es nicht so. Ich …« Für eine Sekunde presste sie die schmalen Lippen zusammen. »Für mich ist dies hier schon mein viertes Leben. Ich habe meinen Mann sieben Jahre lang gepflegt. Mein drittes Leben hat eine heimtückische Krankheit bestimmt.«
Ich nickte ihr stumm zu. Auch ich hatte nach dem Tod meiner Vera unser Haus verkauft und den Wohnort gewechselt. Aus diesem Grund war ich in Heidelberg gelandet. Aus diesem Grund war ich jetzt Kripochef. Eine Karriere aus Verzweiflung, wenn man so will.
Die ehemalige Lehrerin schloss ihre Tür sorgfältig und mit Nachdruck hinter mir.
2
Der schmucklose, neonbeleuchtete Flur hatte sich inzwischen fast völlig geleert. Nur der Kollege mit der Uniformmütze unterm Arm hielt unerschütterlich Wache vor der Tür der gegenüberliegenden Wohnung. Von innen hörte ich unaufgeregte Stimmen und leise Geräusche – die Spurensicherung war also schon am Werk.
Meine Untergebenen befragten inzwischen die Nachbarn, soweit diese zu Hause waren und morgens um halb sechs Wildfremden die Tür öffneten, welche behaupteten, Polizisten zu sein.
Polizeiroutine. Der Alltag eines gewaltsamen Todes.
Ich beschloss, endlich nach Hause zu fahren, und zückte mein Handy. Der Akku war schon wieder fast leer, aber für einen Anruf bei der Taxizentrale würde es noch reichen. Es wurde Zeit, mir einen neuen zu besorgen. Vielleicht konnte ich diese Aufgabe meinen Zwillingen aufs Auge drücken? Glücklicherweise kam dieses Mal der Aufzug, in den sich niemand erbrochen hatte. Trotz eines großen Aufklebers mit der rot durchgestrichenen Zigarette hatte jemand kürzlich darin geraucht. Der zerkratzte Spiegel zeigte mir einen blassen, sichtlich übernächtigten, fast einsneunzig großen und nicht mehr ganz schlanken Mittvierziger in zerknautschtem dunklem Anzug. Er trug zu seinem Leidwesen eine Brille, sein Haar war schon deutlich ergraut, die Krawatte hing auf Halbmast, über dem Arm trug er einen anthrazitfarbenen Wintermantel.
Es gab einen Ruck, der Aufzug sank in die Tiefe.
Dreimal war in der vergangenen Nacht die Polizei gekommen. Eine griechische Hochzeit, bei der die Polizei nicht kommt, taugt nichts, hatte ich gelernt. Jedes Mal war es mir gelungen, die Kollegen zu besänftigen, und nach einem gut eingeschenkten Schnaps aufs glückliche Brautpaar waren sie wieder abgezogen. Eine griechische Hochzeit muss laut sein, hatte ich gelernt. Je lauter, desto glücklicher die neu gegründete Familie.
Das Hochzeitsfest meiner Ersten Kriminalhauptkommissarin Klara Vangelis war nicht nur gemessen an Lautstärke, Alkoholkonsum und Polizeipräsenz ein durchschlagender Erfolg gewesen. In diesem Punkt waren wir uns alle einig gewesen, als wir uns vor etwa einer Stunde in einer Armada von Taxis auf den Heimweg über die verschneiten Straßen der Kurpfalz machten. Der Brautvater war – ebenfalls schwer betrunken – nicht davon abzubringen gewesen, sämtliche Taxis zu bezahlen. Nur Sven Balke und einige Unentwegte hatten es vorgezogen, zu bleiben und später auf einer Sitzbank zu übernachten, oder vielleicht auch darunter. Das Brautpaar selbst war schon früher verschwunden, was jedoch erst nach vier Uhr bemerkt wurde.
Von ungefähr tausend schnauzbärtigen, unentwegt rauchenden und nichts als Griechisch sprechenden Männern war ich kraftvoll umarmt worden. Vielleicht waren es auch immer wieder dieselben gewesen, ich konnte sie bald nicht mehr unterscheiden. Ungefähr tausend mehr oder wenig füllige Tanten oder Großtanten oder Cousinen hatten mich aufs Herzlichste an den Busen gedrückt, auf die Wangen geküsst und beglückwünscht, wozu auch immer. Natürlich hatte auch die Flüge der gesamten Verwandtschaft der Brautvater bezahlt, erfuhr ich nebenbei, und bei der Vorstellung, dass auch ich zwei Töchter hatte, die dereinst möglicherweise heiraten würden, hatte mir ein wenig gegraust. Immerhin hatte ich keine Heerscharen von Verwandten zu füttern und zu tränken, die von weit her eingeflogen werden mussten.
Als ich durch die breite gläserne Tür ins Freie trat, schlug mir die Kälte schmerzhaft ins Gesicht. Es schneite immer noch. Während der gestrigen Trauungszeremonie im Dossenheimer Standesamt hatte ein solches Wintergewitter getobt, dass die Beamtin manche Sätze zweimal wiederholen musste. Der kalte Sturzregen war bald in Schnee übergegangen, und im Lauf des Nachmittags war die Temperatur um fast zwanzig Grad gefallen. Jetzt rieselten feine, glitzernde Flocken lautlos und regelmäßig vom windstillen Himmel, als wollte es niemals wieder aufhören zu schneien. Wenn ich die Luft anhielt, war es vollkommen still.
Im Schritttempo fuhr ein dunkelgrauer, überlanger Kombi vor. Am Beifahrerfenster ein bleiches Mondgesicht mit übergroßen Augen auf der Suche nach der richtigen Hausnummer. Der Leichenwagen.
Ich wartete mit dem Anziehen des Mantels, bis ich die Kälte nicht mehr ertragen konnte.
Am Sonntagnachmittag fand die erste Besprechung der eilig gegründeten Sonderkommission »Hochhaus« statt. Das Kickoff-Meeting, wie Balke so etwas neuerdings nannte. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mich dieses Mal herauszuhalten. Aber nach einem späten und sehr spartanischen Frühstück hatte ich mich überraschend gut gefühlt. Und als Runkel mir per Telefon den Termin übermittelte und völlig selbstverständlich mit meiner Anwesenheit rechnete, hatte ich mich dann doch nicht bremsen können. Immerhin war ich einer der Ersten am Tatort gewesen, und wenigstens zu Beginn der Ermittlungen wollte ich dabei sein und ein wenig nach dem Rechten sehen.
Meinem Magen ging es sehr viel besser. Athos und Ouzo hatten endlich Frieden geschlossen.
Sowie alles seinen geordneten Gang ging, würde ich mich zurückziehen, hatte ich mir vorgenommen. Sven Balke, jüngst zum Hauptkommissar befördert, hatte ich die Leitung der vorerst noch kleinen Soko übertragen, da Klara Vangelis aus naheliegenden Gründen nicht zur Verfügung stand. Die schwebte vermutlich zusammen mit ihrem frisch Angetrauten irgendwo über der Adria, auf dem Weg nach Griechenland, wohin ihre Hochzeitsreise selbstverständlich führte. Rolf Runkel, der wie fast alle in der Runde übernächtigt wirkte, war mit Leitungsaufgaben überfordert.
Einige der knapp zehn Gesichter am Tisch hatte ich in der vergangenen Nacht schon gesehen. Balke, der erst am Nachmittag in der Direktion aufgetaucht war, steckte noch im selben hellgrauen Anzug wie gestern und schien direkt aus Dossenheim zu kommen. Unrasiert und vermutlich noch nicht wieder ganz nüchtern stierte er vor sich hin. Die Luft im Raum war schon stickig, bevor die Sitzung begann.
Balke hatte das kleine Besprechungszimmer gebucht, und irgendeine gute Seele hatte wenigstens für reichlich Kaffee gesorgt. Runkel war dabei, eine Reihe von Farbfotos an die Pinwand zu heften.
Die Tote hatte ein kurzes, cognacfarbenes Seidennachthemd getragen, das bis über die Hüften hochgerutscht war, als sie auf ihren Mörder traf. Darunter trug sie nichts. Das üppige Schamhaar auf dem ausgeprägten Venushügel war dunkelblond, die glatten Haare, die ihren Kopf umrahmten, dagegen schwarz. Das etwas zu volle Gesicht war nichtssagend. Die schön geformten Füße nackt, Oberschenkel und Hüften füllig, aber nicht dick, der Blick der weit offenen, blaugrauen Augen wirkte eher verwundert als erschrocken. Als lausche sie einer fernen Musik, die nur sie allein hören konnte.
Der Täter hatte nur ein einziges Mal zugestochen, in den Bauch, und nach der Menge des Blutes zu schließen, hatte er die Hauptschlagader getroffen. Ich sah Balke auffordernd an, der offenbar noch nicht ganz begriffen hatte, dass er hier den Chef spielen sollte. Endlich verstand er, sah Hilfe suchend um sich, öffnete den Mund.
»Okay. Wer fasst bitte mal zusammen?«, fragte er heiser und räusperte sich.
Die schmale, aschblonde Kollegin, die mir in der vergangenen Nacht schon aufgefallen war, hob die Hand. Sie hieß Evalina Krauss, war Oberkommissarin und hatte eines dieser neuen, superkleinen Notebooks vor sich stehen. Über ein langes Kabel war es mit dem summenden Beamer verbunden, der seit einigen Monaten, die meiste Zeit unbenutzt, an der Decke hing. Sie drückte zwei Tasten, und auf der Leinwand erschien die erste Folie einer Power-Point-Präsentation, die sie anscheinend in der knappen Zeit zwischen ihrer Rückkehr vom Tatort und dem Beginn der Besprechung vorbereitet hatte. Balke kniff die Augen zu und riss sie wieder auf, als sähe er Gespenster.
»Ihr kriegt das alles später noch ausgedruckt«, erklärte Kollegin Krauss gut gelaunt. »Keiner muss mitschreiben.« Sie hatte eine klare, helle Stimme, die sie noch jünger wirken ließ, als sie aussah.
Anita Bovary war zwischen fünfunddreißig und fünfundvierzig Jahre alt, erfuhren wir in den folgenden Minuten. Wo sie früher gelebt hatte, war noch nicht bekannt. Und das war leider auch schon fast alles, was meine Truppen bisher über die Tote im knappen Seidennachthemdchen in Erfahrung gebracht hatten.
»Wir haben in der Wohnung praktisch nichts Persönliches gefunden«, schloss Evalina Krauss ihren angenehm knappen und präzisen Bericht. »Keinen Ausweis, keine Briefe, keine Kontoauszüge, einfach nichts. Bloß den Mietvertrag. Das wirkt da alles irgendwie, als hätte sie … Ups!«
Die Kollegin begann mit hochgezogenen Brauen und zunehmender Ungeduld auf ihrem Computerchen herumzutippen.
»Das Mistding ist mir abgestürzt!«, seufzte sie schließlich und hämmerte noch einige Male hilflos auf die Return-Taste.
»So viel zum Thema ›Keiner muss mitschreiben‹«, sagte Balke gerade so laut, dass sie es mit Sicherheit hörte.
»Die Waffe?«, fragte ich.
»Ein Messer«, erwiderte Evalina Krauss, ohne aufzusehen. »Auffallend schmale Klinge. Ein Stilett vielleicht, meint der Doktor.«
»Haben wir das Ding inzwischen gefunden?«
Sie sah auf, als würde die Frage sie überraschen. »Nein. Alle Mülltonnen und das Gelände ums Haus herum haben wir am Vormittag abgesucht. Aber da war nichts. Es hat aber die ganze Nacht und den halben Vormittag geschneit. Wenn wir Pech haben, müssen wir warten, bis es taut.«
Balke öffnete den Mund und schloss ihn wieder.
»Was ist mit Hunden?«, fragte ich.
»Haben wir probiert«, seufzte Runkel. »Aber die Viecher sind bloß in der Gegend rumgerannt wie die Hühner. Die riechen nichts in dem vielen Schnee.«
»Was erzählen die Nachbarn über das Opfer?«
»Herzlich wenig«, sagte ein Kollege, der letzte Nacht ebenfalls am Tatort gewesen war. »Der Hausmeister kennt sie noch am besten, weil sie mal eine Weile Theater mit der Heizung gehabt hat. Er ist ein paar Mal in der Wohnung gewesen, und einmal hat sie ihm zum Dank sogar einen Kaffee spendiert.«
Balke kratzte sich ratlos an der Stirn. Kollegin Krass hackte immer noch auf ihrer Tastatur herum. Plötzlich war das Bild an der Wand wieder da.
»Okay, die Nachbarn«, setzte sie ihren Vortrag fort. »Hier seht ihr eine Skizze der Wohnungen mit den dazugehörigen Namen. Interessant sind natürlich vor allem die, die Wand an Wand mit ihr liegen. Rechts von ihr wohnt ein schwerhöriger Rentner, Alkoholiker, der die meiste Zeit am Computer daddelt. Links haben wir ein junges Paar, er Student, sie, weiß man nicht so genau, die sich auch um nichts kümmern und die meiste Zeit poppen, so wie die aus der Wäsche geguckt haben. Direkt darunter wohnt eine türkische Familie mit zwei kleinen Kindern. Die wussten gerade mal, dass über ihnen noch wer wohnt. Über Frau Bovary ein arbeitsloser Automechaniker, der Tag und Nacht seltene Blümchen presst. Der meint, er hätte nachts einen Schrei gehört. Könnte aber auch aus einem Fernseher gekommen sein, sagt er.«
»Um welche Uhrzeit?«
»Gegen drei, sagt er, vielleicht auch ein paar Minuten später.«
Mit einem feinen, siegessicheren Lächeln um den Mund sah sie mich an. Mir fiel auf, dass sie Balkes Blick mied. Hier bahnte sich möglicherweise ein kleines Kompetenzgerangel an.
Sie wandte sich wieder ihrem Bildschirm zu.
»Kommen wir zum Tatablauf, soweit man dazu schon was sagen kann.« Tastendruck, nächste Folie. »Hier seht ihr einen Grundriss der Wohnung. Ein Zimmer mit Kochecke, hier der Flur, das Bad. Das Ganze hat sich im Flur abgespielt. Der ist zwei Meter und elf Zentimeter lang und einsdreiundzwanzig breit. Der Täter hat sie frontal von vorn angegriffen. Sie muss ihm die Tür geöffnet haben, jedenfalls gibt es keine Einbruchspuren. Dann ist sie vermutlich ein, zwei Schritte rückwärts. Ihr Pech war, dass die Tür in den Wohn- und Schlafraum nach außen aufgeht. Das heißt, sie hat sich selbst den Fluchtweg abgeschnitten. Und dann muss er auch schon zugestochen haben. Sie dürfte sofort das Bewusstsein verloren haben, sagt der Doktor. Sie hat nicht leiden müssen.«
Ein weiteres Foto erschien auf der Leinwand. Es zeigte die Tote mit bloßem Unterkörper aus der Vogelperspektive.
»Wie ihr an den Wischspuren deutlich seht, hat der Täter anschließend die Tür zum Wohn- und Schlafraum aufgezogen und die Leiche damit zur Seite geschoben. Dann hat er sich ihre Handtasche geschnappt und ist getürmt.«
»Wirkte die Wohnung durchsucht?«, fragte ich.
Zwei schläfrige Kollegen von der Spurensicherung schüttelten einhellig die Köpfe.
»Die Handtasche ist jedenfalls weg«, sagte Evalina Krauss. »Der Hausmeister ist sich sicher, dass sie abends mit einer schwarzen Lackhandtasche losgezogen ist. Da werden ihre persönlichen Sachen drin sein.«
Balke öffnete den Mund, und ich dachte, er werde nun endlich die Initiative ergreifen, aber er gähnte nur. Rechts neben mir begann jemand leise zu schnarchen. Rolf Runkel war eingeschlafen. Evalina Krauss stupste ihn an, jedoch ohne Erfolg.
Das Gespräch erstarb, alle starrten jetzt den mit offenem Mund schlafenden Runkel an. Die Luft schien inzwischen kaum noch Sauerstoff zu enthalten. Kollegin Krauss stupste stärker, die ersten begannen zu grinsen. Der dritte Weckversuch, ein kräftiger Ellbogenstoß in die Rippen, brachte schließlich den gewünschten Erfolg. Runkel schrak hoch und stieß dabei seinen fast vollen Kaffeebecher um. Mit spitzem Schrei und enormer Reaktionsgeschwindigkeit brachte Evalina Krauss ihr Computerchen in Sicherheit.
»Noch mal kurz zur Spurenlage«, fuhr sie unerbittlich fort, als alle sich wieder beruhigt hatten und der Kaffee mit Hilfe eines Packens Papierservietten aufgesaugt war. Ein neues Bild erschien an der Wand. »Der Arzt meint, der Todeszeitpunkt müsse gegen drei Uhr morgens gewesen sein, plus minus ein bisschen. Passt zu dem Schrei, den der Nachbar gehört haben will. Fingerspuren waren praktisch überall, von verschiedenen Personen und natürlich noch lange nicht alle ausgewertet. Und hier …«, wieder ein neues Bild, »… seht ihr einen Fußabdruck. Der Täter muss in das Blut getreten sein, ist sogar ein bisschen ins Rutschen gekommen, und da haben wir ein paar wirklich hübsche Abdrücke.«
»Keine Einbruchspuren, hast du gesagt?« Balke schien endlich das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. »Wie ist er denn reingekommen?«
Wieder wechselte das Bild an der Wand.
»Hier seht ihr eine Makroaufnahme vom Türschloss. Auf den ersten Blick sieht man nichts. Auf den zweiten auch nichts. Das Schloss ist definitiv nicht geknackt worden. Aber wer ein bisschen Übung hat, kriegt diese alten Dinger mit einer Büroklammer auf. Über den Balkon kann er jedenfalls nicht gekommen sein. Erstens ist das viel zu hoch, und außerdem hätte er im Schnee Spuren hinterlassen.«
Jemand sprang auf und riss endlich ein Fenster auf. Schon nach Sekunden erhob sich Protest. Denen, die in der Nähe saßen, wurde kalt, und nach einigem Hin und Her wurde das Fenster wieder geschlossen.
»Wer hat einen Schlüssel zur Wohnung?«
»Der Hausmeister natürlich«, erwiderte Evalina Krauss, als habe sie nur auf meine Frage gewartet. »Der hat einen Generalschlüssel. Sonst …?«
»Hat er den verliehen in letzter Zeit? War er mal vorübergehend verschwunden?«
Sie sah mich ratlos an. Ich machte mir eine Notiz. Solche Flops passierten immer wieder in der Hektik des Anfangs.
»Für mich ist das ganz klar ein Einbrecher«, mutmaßte Runkel, der – inzwischen wieder wach – auf seinem Stuhl fläzte. »Sie ist aufgewacht, ist ihm im Flur in die Arme gelaufen und zeng …«
»Glaube ich persönlich eher nicht«, unterbrach ihn Evalina Krauss. »Die kommen normalerweise am Tag. Wenn sie wissen, dass die Wohnung leer ist. Und sie haben normalerweise auch keine Messer dabei.«
»Außer, er hat geglaubt, sie ist nicht daheim …« Runkel klang ein wenig gekränkt, wie so oft, wenn man seine Ansichten nicht teilte.
Balke versuchte, nach einem unsicheren Seitenblick auf mich, endlich die Diskussionsleitung an sich zu ziehen.
»Und wie machen wir jetzt weiter?«, fragte er in die Runde.
»Ich schlage vor: Zweiter Durchgang bei den Nachbarn.« Kollegin Krauss schob ihr glattes Haar hinters Ohr. »Heute Morgen sind die meisten ja noch halb im Koma gewesen, und einige hatten auch die Klingel abgestellt. In der Zwischenzeit ist dem einen oder anderen vielleicht auch noch was eingefallen.«
Balke nickte. »Außerdem Telefon, Handy, Internet, die übliche Latte …«
»Hat sie nicht. Kein Telefon, kein Handy.«
Er starrte sie ungläubig an. »Kein Telefon? Gibt’s so was?«
»Ich nehme an, sie hat ein Handy, und das dürfte in der Handtasche sein.«
»Internet auch nicht?«
»Du sagst es.«
Der frischgebackene Hauptkommissar Sven Balke war offensichtlich alles andere als glücklich mit seinem ersten Einsatz als Chef. Zufrieden klappte seine Kontrahentin ihr Notebook zu.
Ich sah sie an. »Sie wollten vorhin noch etwas sagen.«
»Ich?«
»Kurz bevor Ihnen der Computer abgestürzt ist.«
Sie stutzte, nickte dann. »Das hat ausgesehen, als habe … wie soll ich sagen … als habe sie gar nicht richtig da gelebt. Normalerweise liegt doch in jeder Wohnung Zeug rum, es sammelt sich Trödel an, es hängen Fotos an den Wänden. Das Einzige, was wir bei ihr gefunden haben, war der Mietvertrag. Sie hat übrigens eine Schweinemiete bezahlt. Neunhundertfünfzig Euro für nicht mal vierzig Quadratmeter!«
»Die Wohnung war früher eine Art Privatbordell«, klärte ich sie auf. »Ich glaube aber nicht, dass Frau Bovary sie in diesem Sinne genutzt hat. Ich vermute, sie hat auf die Schnelle einfach nichts Billigeres gefunden und wollte nicht lange bleiben.«
Die junge Kollegin nickte nachdenklich.
»Was ist eigentlich mit dem Erbrochenen im Lift?«, fragte ich, als die Ersten ihre Glieder dehnten und Anstalten machten, sich zu erheben. »Ist eine Probe von dem Zeug im Labor?«
»Nee, oder?«, schnappte Evalina Krauss. »Das meinen Sie jetzt aber nicht …« Sie brach ab und wurde über und über rot. »Scheiße!«, murmelte sie dann und legte beide Hände flach auf den Tisch. »Scheiße, Scheiße, Scheiße!«
»Ich glaub«, meinte ein Kollege neben ihr nicht weniger betreten. »Also, ich glaub fast, das hat der Hausmeister schon weggeputzt.«
Als könnte er den Fehler so wiedergutmachen, zückte er sein Handy, drückte eilig einige Tasten, und Sekunden später hatten wir Gewissheit: »Ist sogar extra noch mit einem scharfen Reinigungsmittel hinterher, damit es nicht mehr so stinkt. Die ganze Sauerei hat er ins Klo gespült, und den Eimer hat er natürlich auch schon ausgewaschen.«
»Na, super!« Stöhnend legte Balke den Kopf in den Nacken. »Das darf ja wohl nicht wahr sein!«
»Du hättest letzte Nacht gerne kommen können und die Kotze zusammenkratzen!«, fauchte Oberkommissarin Krauss ihn an. Zum ersten Mal seit Beginn der Besprechung sah sie ihm direkt ins Gesicht.
»Haben Sie früher mal was mit ihr gehabt?«, fragte ich Balke, als wir später allein waren. »Oder wieso ist sie so sauer auf Sie?«
»Eher umgekehrt«, erwiderte er mit verkniffenem Blick. »Sie hat mal versucht, mich anzumachen, und – na ja.«
Es kann offenbar auch ein Fluch sein, beim anderen Geschlecht beliebt zu sein.
»Was halten Sie von der Geschichte?«
»Einbruch würde ich ausschließen.« Balke unterdrückte mit Mühe eine heftige Gähnattacke. »Da steckt was anderes dahinter. Ich tippe auf eine Beziehungstat.«
»Und die Handtasche?«
»Ein billiger Trick, um uns auf eine falsche Fährte zu locken. Vorgetäuschter Raubmord. Nein, mein Bauch sagt mir: Beziehungstat.«
»Ich habe heute Morgen mit der Nachbarin gesprochen, die sie gefunden hat. Sie meinte, die Tote habe sich eventuell kürzlich von ihrem Mann getrennt.«
»Erst mal müssen wir wissen, wer sie ist und woher sie kommt. Der Rest klärt sich dann vermutlich ziemlich schnell.« Balke atmete tief ein und aus und freute sich sichtlich auf das Ende unseres Gesprächs.
»Legen Sie sich hin!« Ich schlug ihm auf die Schulter. »War eine harte Nacht. Schlafen Sie sich aus. Morgen früh sehen wir weiter.«
3
»Paps, hast du mal kurz Zeit?«, fragte Louise mit unsicherem Blick, als sie abends um kurz nach zehn zu mir ins Wohnzimmer kam.
Aus den Lautsprecherboxen drang ruhige Klaviermusik von Keith Jarrett. Ich war dabei gewesen, Theresa, meiner Geliebten, eine Gute-Nacht-SMS zu schreiben. So, wie meine fünfzehnjährige Tochter guckte, gab es ein Problem. Ich legte das Handy zur Seite.
»Natürlich«, erwiderte ich ohne Begeisterung. »Setz dich.«
An ihrem Hals befand sich seit neuestem ein Tattoo, das allerdings abwaschbar war, wie man mich beruhigt hatte, bevor ich mich aufregen konnte. Am Oberkörper trug sie ein zu knapp sitzendes, bauchfreies Top, an den Beinen eine Uralt-Jeans voller Löcher und Risse. Seufzend plumpste sie auf den zweiten Sessel. »Es ist wegen Sarah.«
»Habt ihr schon wieder Streit?«
»Die ist total unmöglich!«
»Hat es mit der Band zu tun?«
Erst vor wenigen Monaten hatten meine Töchter überraschend ihr sängerisches Talent entdeckt, ohne mein Wissen an einem Casting teilgenommen und auf diesem Weg einen Produzenten und Manager gefunden, der mit meinen Mädchen als Frontfrauen eine kleine Band zusammenstellte: »The Twins«. Seither hatten sie viel geprobt und leider auch gestritten und den einen oder anderen mehr oder weniger erfolgreichen Auftritt in drittrangigen Clubs absolviert. Inzwischen umfasste ihr Repertoire fast zwanzig Stücke, meist Titel aus den Hitparaden, die das Publikum kannte und mochte. Schon dreimal waren sie in der Zeitung erwähnt worden, einmal sogar mit Foto.
Betrübt betrachtete Louise ihre zartgliedrigen Hände. Heute waren ihre Fingernägel giftgrün lackiert. Vorgestern waren sie noch blasslila mit Flitter gewesen. »Sarah zickt bloß noch rum. Mal singe ich angeblich einen halben Ton zu tief, mal einen halben Takt zu schnell. Immer, immer weiß sie alles besser!«
»Schließlich ist sie ja auch die Ältere von euch beiden.« Ich quälte mir ein Lächeln ab.
»Die halbe Stunde!«, schnaubte sie und lächelte nicht. Es schien wirklich ernst zu sein. Meine Töchter waren eineiige Zwillinge, schlank, gerstenblond und sahen sich immer noch zum Verwechseln ähnlich. Was bei der Band natürlich zum Konzept gehörte.
»Und was sagt Sam dazu?«
Sam, das war der ebenfalls noch junge Manager, der sie entdeckt hatte.
»Dem sind wir doch total egal. Der hat ja nicht mal Zeit, zu ’ner Probe aufzutauchen.«
»Und die anderen? Der Schlagzeuger, der Gitarrist?«
»Jo und Pit?« Sie schlug die Augen nieder und schien ein wenig zu erröten. »Ach, die …«
Bahnte sich hier die erste große Krise der neu gegründeten Band an? Teamprobleme, das kannte ich aus diversen Führungsseminaren, an denen ich in den letzten Jahren hatte teilnehmen müssen.
Ich nahm einen Schluck von dem dunklen Rioja in meinem Glas. Er war gut, und ich versuchte mich daran zu erinnern, wo ich die Flasche gekauft hatte. Ich kam nicht drauf.
»Und jetzt?«, fragte ich.
»Weiß nicht«, murmelte Louise und malte mit dem Zeigefinger Figuren auf die Tischplatte. »Könntest du nicht mal mit ihr reden?«
»Wo steckt Sarah überhaupt?«
»Na, im Bad, wo sonst? Da ist sie ja immer. Ständig guckt sie in den Spiegel. Morgens steht sie extra eine halbe Stunde früher auf, damit sie sich ordentlich aufbrezeln kann!«
Ich versuchte einen Trick, den ich in einem meiner Seminare gelernt hatte: »Was müsste passieren, damit alles wieder so wäre wie früher?«
»Sie müsste bloß wieder normal werden. Und nicht mehr ständig rumzicken. Meinst du, sie wird jetzt langsam erwachsen?«
Aus dem Bad hörte ich Sarah singen. Es klang, als probe sie eine schwierige Passage aus einem neuen Stück. Meine Töchter hatten tatsächlich Talent, stellte ich wieder einmal fest. Und noch immer war ich mir nicht ganz sicher, ob ich mich darüber freuen sollte oder nicht.
Am Montagmorgen saß ich trotz meiner guten Vorsätze doch wieder in der Soko-Besprechung. Vor mir selbst rechtfertigte ich meine Inkonsequenz damit, dass ich ein wenig auf Balke aufpassen musste. Gestern hatte er wirklich keine gute Figur gemacht. Heute hatte er seinen eigenen Laptop mitgebracht und sich des Beamer-Kabels bemächtigt, bevor jemand ihm zuvorkommen konnte. Heute war er auch ordentlich rasiert und ergriff das Wort, ohne dass man ihn dazu eindringlich ansehen musste.
»Das ist alles ziemlich komisch.« Schon sein erster Satz ließ mich fürchten, dass der Fall doch nicht so einfach war, wie ich gehofft hatte. »Die Frau ist amtlich nicht gemeldet, in keiner unserer Dateien taucht eine Anita Bovary auf, es gibt kein Handy, jedenfalls nicht in Deutschland, das auf diesen Namen läuft.«
»Vielleicht ist ihr Haus abgebrannt?«, grübelte Runkel mit dem Zeigefinger an der Nase. »Oder sie ist ausgeraubt worden? Oder sie stammt aus dem Ausland und ist erst vor Kurzem …?«
»Sie hat Deutsch gesprochen«, unterbrach ihn Balke grob. »So viel wissen wir immerhin schon.«
»Die ist vor irgendwas auf der Flucht gewesen«, spekulierte Evalina Krauss mit gerunzelter Stirn. »Die hat sich vor irgendwem versteckt.«
»Leider nicht gut genug«, sagte ich.
Balke drückte eine Taste, eine Liste erschien auf der Leinwand.
»Aber es gibt schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Eine junge Frau, die auf demselben Stockwerk ganz hinten links wohnt, will gestern Morgen gegen drei Uhr einen Mann beobachtet haben, der auffallend eilig das Haus verlassen hat.«
»Ich glaube, die Frau habe ich gesehen«, sagte ich langsam. »Aber sie ist doch erst nach fünf heimgekommen.«
»Sie ist früher schon mal kurz zu Hause gewesen, sagt sie, weil ihr irgendein Knallkopf in der Disco eine Bloody Mary über die Bluse gekippt hat.«
Balke drückte eine Taste. Der Mann, dessen Phantombild wir nun bewundern durften, mochte zwischen dreißig und fünfzig Jahre alt sein. Das Gesicht war hager und glatt rasiert. Die Augen lagen tief in den Höhlen.
»Käseweiß sei er gewesen.« Balke starrte so konzentriert auf das Bild, als wollte er so die Motive des Unbekannten ergründen. »Und sehr eilig habe er es gehabt. Hat sie in der Haustür praktisch über den Haufen gerannt. Was er anhatte, kann sie nicht mit Bestimmtheit sagen. Möglicherweise eine Lederjacke, schwarz oder dunkelbraun. Aber die Zeugin sagt selbst, sie sei ziemlich angeschickert gewesen. Er hat nicht gerade wohlhabend gewirkt, nicht besonders gut gerochen und ist anscheinend in heller Panik gewesen.«
»Hat er etwas in der Hand gehalten?«, fragte ich aufmerksam.
»Kann die Zeugin nicht mit Bestimmtheit sagen«, erwiderte Evalina Krauss, bevor Balke den Mund aufbekam. »Ich habe selbst mit ihr gesprochen. Das sei alles so rasend schnell gegangen, sagt sie, und es war ja auch dunkel. Sie meint, er könne eventuell auch der Typ gewesen sein, der den Aufzug vollgekotzt hat. Die Schweinerei hat jedenfalls schon da gelegen, als sie einsteigen wollte.« Sie holte tief Atem. »Sie hat dann lieber den anderen Aufzug genommen.«
»Wir hatten schon schlechtere Phantombilder«, stellte ich fest.
»Ich lasse gerade fünfhundert Handzettel drucken«, sagte Balke. »Die werden noch heute im Umfeld des Tatorts verteilt.« Er räusperte sich, da einige angefangen hatten zu tuscheln. Es wurde wieder still. »Der Knaller kommt aber noch«, fuhr er fort. »Frau Bovary hat in der Nacht vermutlich nicht allein im Bett gelegen. Die Spusi hat Haare gefunden, die nicht von ihr stammen. Ein paar Sackhaare und auch welche vom Kopf. Die einen waren schwarz, die vom Kopf ziemlich lang für einen Kerl und schon ein bisschen angegraut. Und unsere Zeugin meint nun, der Typ, mit dem sie in der Haustür zusammengerasselt ist, könnte lange Haare gehabt haben.«
»Hatte die Tote in der Nacht Geschlechtsverkehr?«
»Nach dem ersten Augenschein nicht, meint die Gerichtsmedizin. Aber die Autopsie ist natürlich noch nicht abgeschlossen.«
»Was hat die Spurensicherung sonst noch zu bieten?«
Balke zog eine säuerliche Grimasse. »Bisher leider wenig. Ein bisschen Sand, ein paar Körner.«
»Körner?«
»Sonnenblumenkerne.« Ratlos hob er die muskulösen Schultern, die sich unter seinem olivgrünen T-Shirt abzeichneten, und kratzte sich am Oberarm. »Da steht ein kleines Tischchen neben der Balkontür. Und darum herum sind Reste von feinem Sand am Boden.«
»Die hat einen Vogel gehabt«, meinte einer, und ein paar lachten.
Für Sekunden blieb es still. Jedem im Raum war klar, dass das Phantombild, das uns immer noch von der Wand herab mit dunklen Augen anstarrte, mit hoher Wahrscheinlichkeit Anita Bovarys Mörder zeigte.
Balke erhob sich zum Zeichen, dass die Sitzung beendet war. »Heute Abend wissen wir mehr. Gehen wir an die Arbeit.«
Nun begann das Übliche: Die Publicity des menschlichen Unglücks, die uns oft genug die Aufklärung eines Falles liefert, bevor die Ermittlungen richtig in Gang gekommen waren. Fotos in Zeitungen, Berichte in Radio und Fernsehen, Aktuelles auf den Internetseiten der Polizeidirektion Heidelberg. Parallel dazu sammelten meine Untergebenen akribisch alle greifbaren Informationen, und mochten sie auf den ersten Blick noch so nebensächlich und unbedeutend scheinen. Der Rest war Warten.
Warten auf Gutachten.
Warten darauf, dass jemandem das Foto des Opfers in der Zeitung bekannt vorkam oder das Phantombild des potenziellen Täters.
Warten auf einen Geistesblitz, einen Telefonanruf, die entscheidende E-Mail.
Nicht nur die Öffentlichkeit, auch die Zeit arbeitete meist für uns.
In meinem Büro war es ungewöhnlich still an diesem Montag. Der Schnee draußen verschluckte die Geräusche des ohnehin spärlichen Verkehrs. Heidelberg schien unter der ungewohnten weißen Pracht erstarrt zu sein. Die heiße Phase der weihnachtlichen Familientragödien und handgreiflichen Ehekräche anlässlich alkoholgesättigter Silvesterfeiern war vorüber. Die trübe Kälte vor den Fenstern schien jede Emotion zu ersticken. Bis auf die Küstenregionen lag ganz Deutschland unter einer dicken Schneedecke. In den Alpentälern steckten Tausende Skiurlauber fest, weil die Schneefräsen nicht mehr durchkamen. Der Neckar war zum ersten Mal seit vielen Jahren zugefroren, erste Waghalsige fuhren schon Schlittschuh darauf oder riskierten einen Spaziergang auf der glatten Ebene. Der Verkehr schleppte sich durch die Straßen, manche Autofahrer, solche Schikanen der Witterung nicht gewohnt, kamen schon beim Anblick der weißen Pracht ins Schlingern, und selbst die Kriminellen schienen vorsichtshalber auf Tauwetter zu warten, bevor sie sich wieder ihrer riskanten Tätigkeit widmeten. In Weinheim hatten die dortigen Kollegen in der vergangenen Nacht einen Tankstellenräuber einfach dadurch gefasst, dass sie durch die halbe Stadt hindurch und bis zu seiner Garage seinen Reifenspuren im frisch gefallenen Schnee folgten.
Januar war mein Monat für Statistik. Auf meinem Schreibtisch türmten sich die alljährlichen Datenabfragen, mit deren Hilfe das Innenministerium den dringenden Bedarf an weiteren Mitteln und zusätzlichem Personal begründen würde und die Landesregierung das Gegenteil. Da Kriminaldirektor Egon Liebekind, der Chef unserer Polizeidirektion und mein direkter Vorgesetzter, seit Wochen krank war, musste ich als sein Stellvertreter auch seinen Teil des mühseligen Zahlengefummels erledigen. Fallzahlen, Zunahmen und Abnahmen, Aufklärungs- und Fehlquoten, Krankheitstage, gefahrene Kilometer, verfallene Urlaubstage, verbrauchtes Benzin, gestiegene Telefonkosten, Verlustmeldungen. Selbst für die Menge des im vergangenen Jahr verbrauchten Klopapiers interessierte sich jemand in Stuttgart. Hier konnte ich sogar einen kleinen Erfolg melden: Es war uns gelungen, diese Kosten um sensationelle fünfkommadreiacht Prozent zu senken. Wie, entzog sich meiner Kenntnis. Vermutlich hatte ich mich bei den Zahlen vor einem Jahr einfach nur verrechnet.
Liebekind schien dieses Mal einen besonders heimtückischen Grippevirus erwischt zu haben. Seit Weihnachten hatte ich ihn nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen, anlässlich meiner Inauguration zum Kriminaloberrat am zweiten Januar. Eine halbe Stunde hatte er mir zu Ehren der kleinen Feier beigewohnt, dabei viel gehustet und hoffentlich nicht allzu viele angesteckt. Dann hatte er sich von Theresa, seiner Frau und meiner Geliebten, wieder nach Hause fahren lassen.
Beim Gedanken an Theresa lächelte ich unwillkürlich. Ich unterbrach die elende Rechnerei, um ihr eine längere Gute-Morgen-SMS zu schreiben. Sie antwortete fast sofort. Wie ich freute sie sich auf morgen. Dienstagabend war unser Jour fixe. Und irgendwie schaffte sie es zu kommen, auch wenn ihr Gatte nicht, wie an Dienstagen üblich, die Rotarier mit seiner Anwesenheit beehrte. Mit welcher Ausrede sie sich morgen davonstehlen würde, wusste ich nicht.
Sönnchen, meine tapfere Sekretärin, unterstützte mich nach Kräften und mit ihrer langjährigen Erfahrung als engste Vertraute diverser Kripochefs vor mir. Ihr richtiger Name war Sonja Walldorf, aber das wusste kaum jemand, da sie von allen und jedem nur Sönnchen genannt wurde.
Auch wir, die Polizei, verfolgten natürlich unsere Interessen bei dem Datenerfassungs-Wahnsinn. Deshalb rundete ich hier etwas auf, dort eher ab, schwindelte hier ein wenig, mogelte dort ein bisschen, reklamierte ohne Hoffnung Baumängel unserer immer noch neuen und schon wieder maroden Polizeidirektion, die schon mein Vorgänger erfolglos reklamiert hatte.
Ich verabscheute diese Art von Tätigkeit aus tiefstem Herzen. Aber sie gehörte nun einmal zum Job eines Kripochefs. Wie so oft beneidete ich meine Untergebenen, die jetzt draußen waren, mit Menschen zu tun hatten, Spuren suchten, Fakten sammelten, Vermutungen anstellten und wieder verwarfen. Und abends nach Hause gingen mit dem Gefühl, etwas getan und nicht nur Papier beschrieben zu haben.
Nach zwei Stunden legte ich Sönnchen die ersten Ergebnisse meiner lustlosen Bemühungen zum Nachrechnen auf den Schreibtisch. Dann schob ich noch ein Weilchen Papierstapel hin und her, schrieb Theresa eine zweite SMS, und eine halbe Stunde später war ich unterwegs nach Heddesheim. Der kleine Ort lag etwa fünfzehn Kilometer nordwestlich von Heidelberg.
4
Die Sonne war durchgebrochen, aber immer noch herrschte eine sibirische Kälte bei fast völliger Windstille. Der Schnee war so weiß, dass es in den Augen schmerzte, und im Wagen wurde es lange nicht warm. Als ich Heidelberg hinter mir gelassen hatte und endlich ein wenig schneller fahren konnte, wirbelte hinter mir eine gleißende Schleppe von Schneekristallen über die Straße.
Heute sah ich das sich in den tiefblauen Himmel türmende Hochhaus bei Tageslicht. Vermutlich, um das Ganze etwas aufzulockern, wechselte die Farbe der Balkons alle zwei, drei Etagen. Ich zählte zwanzig Stockwerke. Das Haus passte an den Ortsrand von Heddesheim ungefähr so gut wie ein Flugzeugträger in einen Yachthafen.
Der Hausmeister wohnte im Erdgeschoss gleich links hinter dem Eingang. Er war ein massiger Mann Ende dreißig, den man mit seiner mächtigen Vollglatze, dem schon etwas angegrauten Rübezahlbart und der nietenübersäten schwarzen Biker-Hose für den Anführer einer drittklassigen Hells-Angels-Gruppe hätte halten können. Auf seinem grauen und zu engen T-Shirt prangte dann auch das rote Emblem von Moto Guzzi und der Schriftzug: Where Eagles fly.
»Hört das denn nie auf?«, maulte er, als er meinen Dienstausweis erblickte.
»Es hört dann auf, wenn wir den Täter haben.«
Aus der engen und mit Sperrmüllmöbeln vollgestellten Wohnung roch es nach gekochtem Kohl und alten Socken.
»Muss ich mit rauf, oder ist es okay, wenn ich Ihnen den Schlüssel gebe?«
»Schlüssel reicht.«
Seufzend griff er nach dem Bund, der neben der Tür an einem Haken hing. »Ich hab nämlich gerade was auf dem Herd. Und außerdem hat der Kleine Fieber. Ich möchte ihn ungern allein lassen.«
Wie zur Bestätigung hörte ich klägliches Wimmern. Der Hausmeister – den handgekrakelten Namen an der Klingel hatte ich inzwischen als Stachowiak entziffert – löste einen Schlüssel vom Ring und überreichte ihn mir, als wäre er froh, das lästige Ding endlich los zu sein.
»Wie lang werden Sie ihn brauchen?«
»Bis ich fertig bin.«
Er grinste schief. »Was suchen Sie eigentlich da oben? Ihre Leute haben doch jeden Millimeter schon dreimal mit der Lupe abgesucht.«
»Das weiß ich nicht«, antwortete ich wahrheitsgemäß.
Aus Anita Bovarys Wohnung schlug mir ein süßlicher, Übelkeit erregender Hitzeschwall entgegen. Irgendjemand hatte die Heizung bis zum Anschlag hochgedreht. Mit vorsichtigen Schritten durchquerte ich den winzigen Flur mit dem inzwischen eingetrockneten Blut am Boden, betrat den sonnendurchfluteten Wohn- und Schlafraum mit Kochnische, drehte den Thermostat auf null und riss die Balkontür auf. Die Wohnung war deutlich kleiner als die gegenüberliegende von Frau Hasenkamp. Ich hängte meinen Wollmantel an einen Haken im Flur, steckte die Hände in die Taschen und begann, mich umzusehen. Ich betrachtete die Dinge, die die Tote umgeben hatten, versuchte mir vorzustellen, was hier geschehen war vor kaum mehr als dreißig Stunden.
Die Einrichtung war gelinde gesagt ungewöhnlich und definitiv nicht gemacht, um bei Tageslicht besichtigt zu werden. Ein zerwühltes Polsterbett beherrschte den Raum. An der Wand über dem Kopfteil hing ein riesiger, goldgerahmter und stark nach vorne geneigter Spiegel. Er war so weit geneigt, dass Personen, die sich auf dem Bett tummelten, ungehinderte Aussicht auf sich selbst genossen. An den übrigen Wänden hingen zum Schreien schlechte Reproduktionen semipornografischer Ölschinken, den Boden bedeckte ein plüschiger, bordeauxfarbener Teppichboden, der hie und da schon Wellen warf. Auch die Wände waren rot gestrichen, die Vorhänge im selben Ton gehalten.
Über einer Stuhllehne hing ein schwarzes Kleid mit Spaghettiträgern, das sie vermutlich am Samstagabend getragen hatte. Ein ebenfalls schwarzes, knappes Spitzenhöschen, der dazu gehörige BH und schwarze Nylonstrümpfe lagen neben dem Bett verstreut.
Ende der Leseprobe