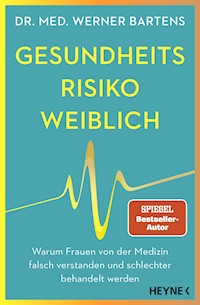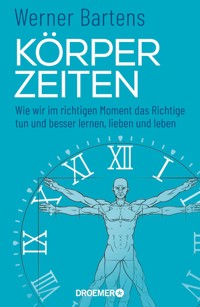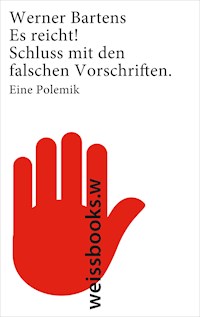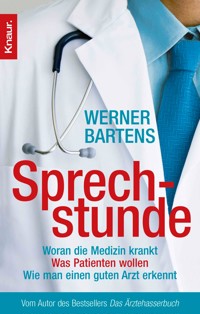17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Dr. med. Werner Bartens, renommierter Wissenschaftsjournalist der "Süddeutschen Zeitung", ist selbst fünffacher Vater und kennt die Unsicherheiten, mit denen sich besorgte Eltern unter Druck setzen. Und gerade dadurch verhalten sich viele falsch. Werner Bartens gibt einen leichtverständlichen Überblick über neueste Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen Disziplinen. Er trägt zusammen, was Kinder zu starken, an Körper, Seele und Geist gesunden Menschen heranreifen lässt, die in der Lage sind, jahrzehntelang den Stürmen des Lebens zu trotzen. Robustheit gegenüber Stress, psychischen und körperlichen Erkrankungen, eine optimistische Grundeinstellung und Lebensfreude wurzeln sehr oft in einer glücklichen Kindheit. Nach den Bestsellern »Körperglück« und »Glücksmedizin« wendet sich Werner Bartens den »Glücklichen Kindern« und ihren Eltern zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Werner Bartens
Glückliche Kinder
Was sie stark und gesund macht
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dr. med. Werner Bartens, renommierter Wissenschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung, ist selbst fünffacher Vater und kennt die Unsicherheiten, mit denen sich besorgte Eltern unter Druck setzen. Und gerade dadurch verhalten sich viele falsch.
Werner Bartens gibt einen leichtverständlichen Überblick über neueste Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen Disziplinen. Er trägt zusammen, was Kinder zu starken, an Körper, Seele und Geist gesunden Menschen heranreifen lässt, die in der Lage sind, jahrzehntelang den Stürmen des Lebens zu trotzen. Robustheit gegenüber Stress, psychischen und körperlichen Erkrankungen, eine optimistische Grundeinstellung und Lebensfreude wurzeln sehr oft in einer glücklichen Kindheit. Nach den Bestsellern »Körperglück« und »Glücksmedizin« wendet sich Werner Bartens den »Glücklichen Kindern« und ihren Eltern zu.
Inhaltsübersicht
Für meine Kinder Helene, [...]
Einleitung
Jahrhundert-Babys
I. Bindung, Nähe, Selbstvertrauen
Kindern Kraft fürs Leben geben
Der Zauber der Berührung
Frühe Nähe macht robust und stark
Seid nett zu den kleinen Genen und Rezeptoren
Prägende Erfahrungen als Starthilfe
Es ist nie zu spät
19 kräftigende Tatsachen über die frühe Stärkung von Kindern
Das Leid, das bleibt
Die Last der frühen Jahre
Ständig unter Strom
Frühe Dämpfer für das Gehirn
Geschwächte Abwehrkräfte
Dirigenten des Leidens
Vernachlässigt und abgestumpft
Chronisch auf Entzug
14 bleibende Erkenntnisse über die Folgen früher Schädigungen
II. Individuell, unabhängig, stolz
Sehen lernen
Respekt, Eigenständigkeit und Stolz
Unterschiedliche Bedürfnisse erkennen
Mobbing verhindern
Jungs – aggressiv und ängstlich zugleich
24 erhellende Einblicke in die Wahrnehmung von Kindern
Selbständig werden
Mysterium Pubertät: Wegen Umbau geschlossen
Der Unterschied zwischen körperlicher und seelischer Reife
Wenn Jugendliche rauchen und trinken
22 Erkenntnisse über Selbständigkeit und Pubertät
III. Erziehen, Fordern, Fördern
Das Drama mit der Konsequenz
Nein heißt nein
Ein Ja aus vollem Herzen – oder klare Kante
Raus aus der Endlos-Argumentation
Kuss und Schluss – der Abschied im Kindergarten
Unsichere Eltern – und ihr übersteigertes Sicherheitsbedürfnis
Kein Plan: ein Lob der Langeweile
24 eindeutige Tatsachen über konsequente Erziehung
Übertriebene Förderung und medizinische Exzesse
Optimale Förderung oder zu viel des Guten?
Schwer begabt? Das wächst sich noch aus
Krank zu sein bedarf es wenig
Der Streit um ADHS
Medizin im Exzess: Pillen statt Pausenbrot?
15 Tatsachen zu übertriebener Förderung und Exzessen
IV. Schlafen, Schreien, Schmerzen
Schlaf, Kindchen, schlaf
Warum genügend Schlaf so wichtig ist
Wie Kinder besser in den Schlaf finden
Aus Verzweiflung: schreien lassen, Brei geben, ins Auto?
Schnuller oder nicht?
Das Buch unter dem Kopfkissen
Weder Kissen noch Kuscheltier – Risiken für plötzlichen Kindstod
Ausreichend Schlaf in der Pubertät?
Gesunder Schlaf vor Mitternacht?
36 ausgeschlafene Tatsachen über richtige Ruhezeiten
Schreien und schreien lassen
Auf der Suche nach der Ursache
Das Schmerzempfinden von Föten, Neugeborenen und Kleinkindern
Dreimonatskoliken und andere Bauchschmerzen
Wenn der Bauch immer wieder weh tut
Was tun, wenn das Kind schreit?
18 schmerzhafte Tatsachen zum Empfinden von Kindern
V. Bewegen lernen, bewegen lassen
Haltung bewahren
Gesundes Lümmeln
Gefährliches Vorbeugen – Babys droht Atemnot im Kindersitz
Geschüttelt und gekrümmt – Kinder im Fahrradanhänger
Mobiles Lernen
Wenn der Schuh drückt
20 entspannte Tatsachen über die angemessene Haltung
VI. Essen und Trinken
Auf den Geschmack kommen
Stillen oder Brei?
Speikinder sind Gedeihkinder
Trinken auf Obst oder nach einem Eis
Multivitamintabletten – oft mehr Schaden als Nutzen
11 appetitanregende Inhaltsstoffe
Essen, was auf den Tisch kommt?
Entlastung für die Pausen-Pommes
Hamburger sind besser als ihr Ruf – wenn Regeln beachtet werden
Brötchen und Toast statt Graubrot?
Ohne Frühstück in die Schule?
Trinken vor dem Essen
20 nahrhafte Tatsachen über die angemessene Ernährung
Der Kampf um die Kilos
Dicke Kinder, dicke Erwachsene?
Schlanker in die Schule – Der Anteil übergewichtiger Kinder sinkt
Machen Oma und Opa dick?
12 pfundige Tatsachen zur richtigen Gewichtung
VII. Erkennen, wo es fehlt: Krank oder unpässlich?
Erkältungen und andere banale Infekte
Zieh dich warm an! Körper in der Kälte
Kalte Füße = Erkältung?
In kühlen Räumen zu schlafen ist gesünder als in warmen
Viel trinken bei Grippe und Erkältung?
Kinder brauchen auch bei Erkältung keine Vitaminzusätze
Antibiotika bei banalen Infekten
Hustensäfte – weg damit
Mittelohrentzündung – zunächst abwarten
Nebenhöhlen – Zurückhaltung mit Antibiotika
Medikamente für Kinder in der richtigen Dosis
Verzögerte Warnung – Nebenwirkungen von Arzneien für Kinder
26 ansteckende Wahrheiten über Kälte und Infekte bei Kindern
Lästig, bedrohlich oder sogar gefährlich?
Was tun nach Gehirnerschütterung?
Schon wieder Läuse
Zecken – Gefahr aus dem Unterholz
Hodenhochstand – Frühe Korrektur lohnt
Vorhautverengung – Zeit lassen, aber nur bis zur Pubertät
Passivrauchen – tödliche Atemzüge
25 Tatsachen, die helfen, Beschwerden richtig einzuschätzen
VIII. Streitthemen: Zwischen Erfahrung, Wissenschaft und Ideologie
Wie viel Fernsehen, PC und iPod? Der Kampf um die Medien
Gefahr oder Gerücht?
Zeiten und Auszeiten
13 nicht-virtuelle Hintergründe zum Medienkonsum von Kindern
Empfindlich: Impfen, Allergien, Unverträglichkeiten
Impfen oder nicht? Riskante Ignoranz
Mythen über Impfnebenwirkungen gefährden Dritte
Allergisch gegen alles und jeden
Wenn die Pollen kommen
Schützender Dschungel: globale Ungleichheit bei Allergien
Vom Wert der Keime – Kita-Kinder und Allergien
Hilfe aus dem Stall
18 reizende Tatsachen zu Impfungen und Allergien
Natürlich und sanft heilen
Pflanzlich und harmlos?
12 energetische Weisheiten über alternative Heilverfahren
IX. Bangemachen gilt nicht – Mythen, Vorurteile, Irrtümer
Augen verdrehen und schielen
Bei schlechtem Licht lesen
Nasenbluten und die richtige Kopfhaltung
Ein Apfel statt Zähneputzen?
Kortison – das Nordkorea unter den Medikamenten?
Der Reiz destillierten Wassers
Die mythische Kraft von Cola
Blutvergiftung und der »rote Strich« zum Herzen
Fette Ernährung, mangelnde Hygiene und Akne
Ohrenschmalz drinlassen oder entfernen?
Frühes Rasieren und der Haarwuchs
Schwimmen nach dem Essen
Weiße Flecken auf den Fingernägeln
Kaugummi als Klebstoff im Magen?
Hygiene-Alarm: Kinder auf fremden Klos
14 vorurteilsfreie Tatsachen über Mythen und Irrtümer
Literaturverzeichnis
Für meine Kinder Helene, Nikolaus, Till, Jonas und Florian
Einleitung
Jedes Kind ist wunderbar, einzigartig und besonders. Vor allem natürlich das eigene. Kinder lernen fortwährend dazu, sie machen permanent neue Erfahrungen, werden ständig geprägt, geformt, gebildet und geschult. Eltern sind begeistert von den schier unendlichen Möglichkeiten, die sich dem eigenen Kind quasi nebenbei bieten, während es Stück für Stück seine Umgebung erkundet und den Blickwinkel erweitert. Was es alles wahrnimmt, und welches Entwicklungspotenzial es hat! Gerade im Baby-, Vorschul- und Grundschulalter scheint jedem Kind noch die ganze Welt offenzustehen.
Gleichzeitig haben viele Eltern eine diffuse Angst: Was sie alles falsch machen können! Sie befürchten, in den wichtigen prägenden Phasen ihres Kindes nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um was sie sich alles sorgen! Wie lange soll gestillt werden? Sie wägen ab, ob Stoff- oder Fertigwindeln besser für ihr Kind und die Umwelt sind. Sie sind auf der Suche nach einer artgerechten Frühförderung und stehen vor der schwierigen Entscheidung, in welchem Alter die Kinder eingeschult werden sollen – und vor allem welche Schule die richtige ist. Und die optimale Ernährung. Und das passende Maß an Herausforderungen und Erfahrungen. Denn viel weniger als eine ständige Stimulation für Geist und Körper und eine schadstoffarme Erziehung sollte es bitte nicht sein.
Eltern machen sich, gerade wenn es sich um ihr erstes Kind handelt, vielerlei Sorgen. Die meisten dieser Bedenken sind allerdings unnötig.
Natürlich gibt es schädliche Einflüsse auf die Entwicklung von Kindern. Ungesunde Lebensverhältnisse wie Armut, Unterernährung und körperlicher oder seelischer Missbrauch können ebenso wie emotionale Vernachlässigung jedes Leben zerstören. »Armut ist in unserem Land immer noch der wichtigste Risikofaktor für eine schlechte Entwicklung des Kindes«, sagt Karl Heinz Brisch, Leiter der Psychosomatik am Haunerschen Kinderspital der Universität München. »In Deutschland nimmt das Problem zu, und die Schere zwischen Arm und Reich wird ja immer größer.«
Aber auch wer nicht die optimalen Reize und die beste Förderung bekommt, kann sich zu einem wunderbaren, vielseitigen und wachen Menschen entwickeln. Das wachsende Kind und sein Gehirn wollen schließlich ständig neue Eindrücke aufnehmen und miteinander verknüpfen. Permanent bilden sich neue neuronale Netzwerke, das Kind ist begierig, neue Erfahrungen zu machen und auf diese Weise immer mehr kennenzulernen. Der menschliche Geist kann gar nicht anders, als zu sammeln, zu verbinden und daraus Neues entstehen zu lassen. Er will lernen und sich vernetzen – und zwar auch dann, wenn gerade kein Pädagoge und kein Elternteil in der Nähe sind.
Es gibt gefühlte 287000 Ratschläge und Empfehlungen zum richtigen Umgang mit Kindern. Viele davon sind ideologisch überfrachtet, dogmatisch erstarrt und entsprechen weder medizinischen noch psychologischen oder pädagogischen Erkenntnissen. Eltern werden dadurch schnell eingeschüchtert, denn sie halten sich sofort für Erziehungsversager, wenn sie in der »falschen« Geburtsklinik einchecken, dem Baby nicht sofort die allergiefreie Matratze, dem Kindergartenkind nicht das vitaminangereicherte Joghurt und dem Grundschüler nicht die Förderhefte begleitend zum Unterricht besorgt haben.
Lassen Sie sich nicht verrückt machen!
So viel machen Sie nicht falsch. Wenn Sie Ihrem Kind die elementaren Grundbedürfnisse an Nahrung, Wohnung und Zuwendung erfüllen und ihm mit Aufmerksamkeit und Liebe begegnen, machen Sie vermutlich sogar das meiste richtig. Ein paar weitere Empfehlungen, Hintergründe und Erklärungen zum Wohl Ihres Kindes finden Sie auf den nächsten Seiten. Dabei werden nicht die Entwicklungsphasen eines Kindes nach Altersgruppen behandelt. Oftmals sind die Übergänge ja fließend – und trotzig kann ein Dreijähriger wie ein Dreizehnjähriger sein. Schmerzen wie Schlafprobleme, die Sehnsucht nach Bindung wie nach Autonomie kommen im Vorschulalter, in der Grundschule wie auch bei Jugendlichen vor, die schon fast erwachsen sind. Deswegen habe ich die vielfältigen Lebensbereiche, die Kinder betreffen, thematisch und nicht chronologisch geordnet. Viele Aspekte der frühkindlichen Entwicklung und der prägenden Phasen von Kindern und Jugendlichen habe ich aufgenommen, aber mit meiner subjektiven Gewichtung und Wertung. Wenn Sie Anregungen haben, die ich für die Weiterentwicklung dieses Buches aufnehmen kann, freue ich mich über Ihre Rückmeldung unter:
www.werner-bartens.de
Jahrhundert-Babys
Wer glaubt, dass die Entwicklung der Kinder, ihre Gesundheit und sogar ihre Lebenserwartung nur eine Frage der Gene ist, der hat sich getäuscht. Die Idee einer erblich vorgegebenen Lebensspanne ist in der wissenschaftlichen Forschung längst nicht mehr so vorherrschend wie noch vor wenigen Jahrzehnten. In Studien mit Zwillingen hat sich beispielsweise nicht bestätigt, dass identische Erbanlagen auch zu einer identischen Lebenserwartung führen. Genetische Faktoren haben nur zu etwa 25 Prozent Einfluss auf die Lebenserwartung. Die Lebensumstände und das Gesundheitsverhalten sind weitaus prägender. Zudem verfügt der Mensch – anders als etwa der Fadenwurm – auch nicht über ein »Alters-Gen«. Hunderte wenn nicht Tausende verschiedene Orte im Genom haben einen je minimalen Anteil daran, wenn Menschen vor oder nach der statistischen Lebenserwartung ihrer Altersgruppe sterben.
Ein 100. Geburtstag wird in vielen Lokalzeitungen immer noch als besonderes Ereignis gemeldet. Vor 30, 40 Jahren war dieser Ehrentag tatsächlich eine Rarität, heute erreichen immer mehr Menschen dieses Alter. Bald könnten sogar große Teile der Bevölkerung ihr Jahrhundertjubiläum erleben, prognostizieren Experten. Die Hälfte aller Babys, die in reichen Ländern derzeit zur Welt kommen, könnte 100 Jahre oder älter werden. Zu diesem Ergebnis kommen Altersforscher aus Dänemark und Rostock.1 Allerdings gilt die Vorhersage nur, wenn der seit 150 Jahren stetig ansteigende Trend der Lebenserwartung weiter anhält.
Wissenschaftler um Kaare Christensen und James Vaupel vom Max-Planck-Institut für Bevölkerungsforschung in Rostock haben die Alters- und Krankheitsentwicklung in etlichen Industrienationen untersucht. Ihre Daten zeigen, dass von den Frauen, die 1950 ein Alter von 80 Jahren erreicht hatten, 15 Prozent auch ihren 90. Geburtstag erlebten. 2002 schafften bereits 37 Prozent der Hochbetagten diesen Zehn-Jahres-Zeitraum.
Die Menschen werden nicht nur älter, sie bleiben erfreulicherweise auch länger gesund und selbständig. Viele von ihnen können deshalb bis ins hohe Alter ohne Hilfe auskommen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Insgesamt führen die Änderungen der Lebensführung und die Fortschritte der Medizin dazu, dass die Menschen immer länger leben. »Die 75-Jährigen heute sind vermutlich so leistungsfähig, wie es die 65-Jährigen vor 30 Jahren waren«, sagt Martin Halle, Direktor des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der Technischen Universität München. »Das macht bestimmt zehn Jahre mehr in der Lebenserwartung aus.«
Nach Daten des Statistischen Bundesamts beträgt die Lebenserwartung für neugeborene Jungen in Deutschland derzeit etwa 77,2 Jahre, für Mädchen sogar 82,4 Jahre. Jedes Jahr steigt sie um drei Monate. Die Differenz zwischen den Geschlechtern beträgt 5,2 Jahre und ist immer kleiner geworden. In den 1970er Jahren betrug sie sieben Jahre, 1993 waren es noch 6,5. Die Unterschiede im Arbeits-, Freizeit- und Ernährungsverhalten zwischen Mann und Frau sind zurückgegangen. Immer weniger Männer üben noch riskante Berufe aus, viele Frauen holen in ihrer Freizeit mit dem Risikoverhalten gegenüber den Männern auf. Aus Studien in Klöstern weiß man aber, dass die Angleichung biologische Grenzen hat. Auch wenn ihr Tagesablauf und die Ernährung ähnlich sind, leben Nonnen ein Jahr länger als Mönche.
I. Bindung, Nähe, Selbstvertrauen
Kindern Kraft fürs Leben geben
Leben kann Last oder Lust sein. Doch wieso empfindet der eine Mensch im Alltag hauptsächlich Spaß und Freude, der andere Frust und Ärger? Liegt es allein am subjektiven Blick auf die Welt – ob das sprichwörtliche Glas als halb voll oder halb leer wahrgenommen wird? Und weshalb wirken manche Menschen permanent angestrengt und besonders anfällig für Stress? Andere hingegen erscheinen robust und widerstandsfähig – und bleiben das selbst bei den stärksten Belastungen. Einer fühlt sich stets überfordert im Beruf, vom Partner unter Druck gesetzt, und sogar die Freizeitgestaltung strengt ihn an. Er bekommt Magengeschwüre, Tinnitus, Herzrhythmusstörungen und leidet ständig unter grippalen Infekten. Ein anderer bleibt hingegen auch in größter Terminnot gelassen, kümmert sich hingebungsvoll um seine Freunde und die Familie und geht nebenbei noch aufwendigen Hobbys nach.
Stress kennt zwar jeder – aber der Umgang damit gelingt auf sehr unterschiedliche Weise: Die einen scheint Stress eher anzuspornen, die anderen hingegen zu zermürben und auf Dauer sogar krank zu machen. Forscher interessieren sich erst in jüngster Zeit intensiver für dieses Phänomen. Als Resilienz bezeichnen sie jene Fähigkeit, mit den Widrigkeiten des Lebens gut zurechtzukommen und körperlich wie psychisch robust zu bleiben. Wie das gelingen kann, dafür gibt es viele Erklärungen. »Frühe Erfahrungen legen den Grund für die neuronalen und hormonellen Reaktionen des Körpers auf Belastungen – und zwar ein Leben lang«, sagt Michael Meaney, Neurobiologe an der McGill University im kanadischen Montreal. Auf die Frage, ob der Mensch stärker durch die Natur, das heißt hauptsächlich durch die Gene, geprägt wird oder durch die Umwelt – damit sind Sozialisations- und Umgebungserfahrungen im Familien und Bekanntenkreis gemeint –, antwortet er mit einer klugen Gegenfrage: »Kann man sagen, was stärker zu einem Rechteck beiträgt, die Längs- oder die Breitseite?«
Der Zauber der Berührung
»Babys zeigen mit ihrem Verhalten ja, was sie wollen. Es ist alles direkt da, so offensichtlich, so deutlich.«Thomas Berry Brazelton, Kinderarzt aus Harvard
Am Anfang ist es nur ein etwa sieben Pfund schweres Wesen. Neun Monate wächst es im Dunkeln heran und kann in dieser Zeit weder hören noch sehen. So dachte die Mehrzahl der Mediziner noch vor 50 Jahren über Neugeborene. Mittlerweile weiß die Forschung, dass Föten während der Schwangerschaft nicht nur sehen und hören können, sondern auch viele andere Hirnleistungen vollbringen. Zwischen 100000 und 250000 Nervenzellen werden in manchen Schwangerschaftswochen pro Minute im Gehirn des Ungeborenen gebildet. »Dass schon der Fötus lernt, steht außer Frage«, sagt der Neurobiologe Niels Birbaumer von der Universität Tübingen. »Der Fötus träumt, wenn er schläft, und er reagiert auf äußere Reize und emotionale Einflüsse.«
Besonders wichtige Stimulationen für die Entwicklung eines Kindes sind freundliche Berührungen. Zuwendung und körperliche Nähe können gar nicht früh genug beginnen. Die Kinderpsychiaterin Heidelise Als aus Boston hat in etlichen Studien gezeigt, dass Frühgeborene sich besser entwickeln, schneller wachsen, weniger Hirnschäden bekommen, sich ihre Lungen und Herzen rascher kräftigen und sie früher entlassen werden können, wenn sie viel Wärme und Zuwendung erfahren.2
Dieses Phänomen lässt sich inzwischen auch neurobiologisch erklären, denn durch die sensuellen Impulse – das heißt, wenn die Kinder immer wieder gestreichelt und berührt werden – reift ihr Gehirn schneller, und die schützenden Markscheiden um die Nervenbahnen bilden sich dann früher. Das fördert die Vernetzung und Entwicklung und wirkt sich günstig auf alle Organsysteme aus.
Anfangs ist das Programm von Heidelise Als, die Pflege Frühgeborener individueller zu gestalten, auf viel Widerstand bei Schwestern und Ärzten gestoßen – die professionellen Heiler und Helfer fühlten sich offenbar davon in ihrem Tagesablauf gestört. Eltern, die Nähe und individuellen Umgang wollen, gelten im Krankenhaus ja traditionell als schwierig. »Vielen Schwestern wurden Nähe, Pflege und Wärme abtrainiert«, sagt Als. »Dabei sind die liebevolle Zuwendung und Pflege der Weg zur Heilung und nicht die Maschine.«
Inzwischen werden immerhin in vielen Kliniken die Intensivstationen für Frühgeborene anders gestaltet, und so gibt es beispielsweise mehr Platz zwischen den Inkubatoren, damit Mütter und Väter die Babys streicheln können. »Die Hände der Eltern sind wichtiger als jede Kuscheldecke«, so Als. »Jeder hat schließlich nur ein Gehirn im Leben. Es verdient es, dass man sich darum kümmert.«
Da der Tastsinn der erste Sinn ist, der sich beim Menschen entwickelt, kann er auch schon früh stimuliert werden. »Das Neugeborene macht bereits vielfältige haptische Erfahrungen«, sagt Maria Hernandez-Reif von der University of Alabama. Sie hat am Touch-Forschungsinstitut in Miami beobachtet, dass sich ein zu früh geborenes Zwillingspaar zunächst schlecht entwickelte, als es getrennt behandelt wurde. Nachdem die beiden zusammengelegt wurden, schlangen sie die Arme umeinander und erholten sich schneller.3
»Berührung ist die erste Sprache«, so Hernandez-Reif. »Verstehen kommt erst viel später als fühlen.« Das kennen schließlich auch Erwachsene. Manchmal hilft es viel mehr als jedes Wort, einfach nur fest in den Arm genommen zu werden. Bei Säuglingen kräftigt regelmäßige Berührung sogar die Knochen, beschleunigt die Entwicklung – zudem sind die Mütter dann weniger unruhig und depressiv, während Väter auf diese Weise mehr Nähe entwickeln.
Bindungsforscher erkennen immer deutlicher, dass auch die kognitive Entwicklung bei Kindern viel früher beginnt, als bisher angenommen – und durch Zuwendung und liebevolle Berührung stimuliert werden kann. Gisa Aschersleben von der Universität Saarbrücken hat 56 Mutter-Kind-Paare untersucht: »Kinder können schon im Alter von sechs Monaten einfache Handlungen als zielgerichtet verstehen.«4 Die Untersuchung der Babys im Alter von zehn Monaten hat ergeben, dass die Kinder sensitiver Mütter einfache Zusammenhänge – etwa ob schwere oder leichte Kugeln weiter rollen – besser verstehen als Kinder, deren Mütter eher abweisend waren und ihre Kleinen seltener berührten.5 »Zudem entwickeln sich Sprache, Ausdauer und soziale Kompetenz besser, wenn Kinder sich sicher gebunden fühlen.«
Auch das Verständnis dafür, dass Handlungen emotional sind, ist bei Kindern offenbar schon früh vorhanden. »Ein mentales Bewusstsein gibt es seit der Geburt«, hat Maria Legerstee von der York University in Toronto herausgefunden. »Es wird durch Zuneigung verstärkt, und es ist besonders die mütterliche Sensibilität, die Kinder sozial und emotional macht.«6 Die Befunde anderer Forscher, etwa zur Entwicklung eines eigenen Selbstverständnisses, deuten ebenfalls darauf hin, dass Kinder schon viel früher wichtige Entwicklungsschritte vollziehen, als bisher Lehrmeinung war. »Im Vorschulalter sind die Förderprogramme schon zu spät dran«, sagt Mechthild Papousek von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. »In breiten Kreisen verstummt und verarmt die Kommunikation in den Familien, da muss man schon früher etwas tun.«
Damit die Bindung zwischen Eltern und Kindern von Anfang an gestärkt wird, hat Karl Heinz Brisch in München das Programm SAFE (Sichere Ausbildung für Eltern) initiiert, das es längst auch in anderen Städten gibt.7 Eltern können in den Wochen vor und nach der Geburt ihre Ängste verstehen lernen und einen feinfühligen Umgang mit dem Baby einüben. »Kinder triggern manchmal traumatische Erfahrungen der Eltern und holen deren eigene Geister aus dem Kinderzimmer hervor«, so Brisch. Darauf sollte man vorbereitet sein. Eine liebevolle Beziehung zum eigenen Kind kann schließlich gar nicht früh genug beginnen.
Frühe Nähe macht robust und stark
Eine frühe, enge und warmherzige Bindung kann dauerhaft psychische Stabilität verleihen. Nicht nur für die nächsten Tage, Wochen und Monate, sondern ein ganzes Leben lang. Kinder, die im achten Lebensmonat besonders fürsorglich von ihrer Mutter behandelt wurden, profitierten in einer großen Untersuchung noch 30 Jahre später davon und blieben zeitlebens weniger anfällig für Stress.8 Ein Forscherteam um die amerikanische Sozialepidemiologin Joanna Maselko von der Duke University hat dies eindrucksvoll beschrieben. Die Wissenschaftler bewerteten die Bindung zwischen 482 Müttern und ihren Kleinkindern während eines umfangreichen Entwicklungstests. Drei Jahrzehnte später wurde die emotionale Stabilität der mittlerweile Erwachsenen erneut beurteilt. Wer als Kleinkind besonders liebevoll von seiner Mutter betreut worden war, klagte im mittleren Alter über weniger Ängste, war seltener feindselig und aggressiv gestimmt und konnte auch besser mit Belastungen umgehen. »Biologische Erinnerungen setzen sich schon früh fest und können später im Erwachsenenalter verletzlich oder eben auch widerstandsfähig gegenüber Problemen machen«, sagt Maselko. In einer anderen Untersuchung hatte ihre Arbeitsgruppe entdeckt, dass bei Frauen das Risiko für Herzerkrankungen erhöht war, wenn sie als Kinder nicht sehr warmherzig betreut worden waren, sondern immer wieder schroff und abweisend behandelt wurden.9
Japanische Kinderärzte und Ärzte für Psychosomatik haben noch weitere Auswirkungen kindlicher Belastungen entdeckt. Sie konnten zeigen, dass die Kinder von gestressten Müttern heftigere Asthmasymptome entwickelten als jene, deren Mütter zumeist entspannt und freundlich mit ihnen umgingen.10 Bei mehr als 220 Kindern im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren verschlimmerten sich die Luftnot und die Hustenanfälle, wenn die Mütter immer wieder überlastet und ärgerlich auf Belastungen reagierten – und Gefühle der Zuneigung kaum zeigen konnten. »Der Stress einer Mutter – wie auch ihr Wohlbefinden – überträgt sich verbal oder nicht-verbal auf das Kind«, sagt Jun Nagano vom japanischen Ärzteteam. »Dadurch wird es im negativen Fall eben auch anfälliger für Allergien und Atemwegsinfekte.«
Es ist also nicht nur eine Volksweisheit, dass es krank macht, wenn man schlecht und schäbig behandelt wird. Inzwischen haben Ärzte aus vielen Untersuchungen etliche Beweise dafür gefunden, wie und weshalb auch der Körper mitleidet, wenn die Seele in Not ist – und warum sich die Folgen jahrelang bemerkbar machen können, auch wenn die äußerlichen Wunden längst verheilt sind.
Seid nett zu den kleinen Genen und Rezeptoren
Ärzte und Bindungsforscher beobachten seit Jahrzehnten, wie sich Kinder in welchem Alter verhalten, worauf sie positiv reagieren und was sie verstört.11 Nun decken Wissenschaftler nach und nach auf, was sich im Detail in den verschiedenen Entwicklungsphasen des frühkindlichen Gehirns abspielt. Erfahrungen und Umwelteinflüsse beeinflussen in dieser Zeit besonders stark, welche Gene aktiviert werden, und entscheiden daher mit darüber, welche körperlichen und charakterlichen Eigenschaften ausgebildet werden.
Warmherzige Zuwendung führt beispielsweise dazu, dass Kinder mehr Rezeptoren für Stresshormone ausbilden.12 Als Erwachsene erleben sie zwar ebenso belastende Situationen wie jene Menschen, die keine glückliche Kindheit hatten. Die Folgen sind jedoch nicht so gravierend, denn die vielen Andockstellen für Alarmmoleküle im Körper machen diese schnell unschädlich. Der Stress ist zwar da, wird aber nicht als so »stressig« empfunden.
Das lässt sich sogar in den kleinsten Bausteinen des Lebens nachvollziehen, es kann bis auf die Ebene der Erbsubstanz DNA hinab verfolgt werden: Mit Hilfe von sogenannten Transkriptionsfaktoren und Methylierungsschritten werden die entsprechenden Gensequenzen im Erbstrang aktiviert oder gehemmt. Es bilden sich also die Erbanlagen gegen Stress aus – oder eben nicht. Je nach Bindungserfahrung werden mehr oder weniger Rezeptoren produziert, um später die im Körper anflutenden Stresshormone abfangen zu können.
Michael Meaney von der McGill University in Montreal hat in zahlreichen Untersuchungen auf molekularer Ebene nachgezeichnet, wie sich die Erfahrungen in früher Kindheit im Körper niederschlagen. Zunächst zeigte er bei Rattennachwuchs, dass jene Tiere, die häufiger geleckt und beschmust werden, weniger stressanfällig sind. Das Gen, das dafür verantwortlich ist, wie viele Glukokortikoid-Rezeptoren (GR) ausgebildet werden, wird offenbar entscheidend durch die Nähe der Mutter reguliert. Erfährt ein Jungtier viel Körperkontakt, besitzt es mehr körpereigene Andockstellen für das Stresshormon Kortisol. In der Folge reagiert es auf belastende Situationen weniger aufgewühlt. Die Stressreaktion fällt milder aus, weil die entsprechenden Hormone rascher gebunden und abgebaut werden.
Inzwischen wurden diese Befunde auch bei Menschen bestätigt. Nach Missbrauch, Vernachlässigung, aber auch bei Suizidenten finden sich weniger Andockstellen für Stresshormone. Die Widerstandskraft der psychisch Angeschlagenen bleibt zeitlebens geschwächt. Kürzlich konnte sogar der molekulare Mechanismus entschlüsselt werden, der nach frühkindlichen Traumatisierungen dazu beiträgt, dass im Erbstrang DNA weniger Gene zur Bildung der stressdämpfenden Glukokortikoid-Rezeptoren aktiviert werden.13
»Trotzdem wissen wir nicht genau, warum manche Menschen auch unter den widrigsten Umständen psychisch gesund bleiben und andere nicht«, sagt Meaney. »Sogar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und dem Attentat in Oklahoma (1995) waren je knapp 40 Prozent der Bürger in folgenden Jahren von psychischen Leiden betroffen – das waren nicht mehr als sonst und genauso viele wie in anderen Regionen des Landes.« Es gebe zwar »Prädiktoren« wie ein früh erlebtes Trauma, niedriges Geburtsgewicht und Armut, die psychische Erkrankungen wahrscheinlicher machen. »Aber keiner dieser Vorhersagefaktoren allein rechtfertigt eine Intervention«, so Meaney. »Wir brauchen endlich genauere Risikofaktoren!« Jay Giedd von den Nationalen Gesundheitsinstituten der USA sucht diese in den Gehirnen von Kindern und Jugendlichen.14 Allerdings dämpft er die Erwartungen, dass mit den funktionalen Kernspin-Aufnahmen, die er seit Jahren verfeinert, das Rätsel der mentalen Stabilität gelöst werden könne. »Man kann in diesen Bildern ja nicht mal das Gehirn eines Mädchens von dem eines Jungen unterscheiden«, räumt er ein. Dass sich bei vielen psychischen Leiden überzufällig oft Auffälligkeiten der Gehirnanatomie finden, hat das Wissen über die Krankheiten zwar vertieft, heißt aber noch lange nicht, dass jeder mit diesen Merkmalen auch erkrankt. Immerhin hat Giedd in seinen Untersuchungen zeigen können, wie empfindlich gerade das jugendliche Gehirn ist – und wie schnell es auf Belastungen, Stress und negative Erlebnisse regiert.15
Prägende Erfahrungen als Starthilfe
Hat eine mütterliche Glattechse häufiger den Geruch einer gefährlichen Schlange wahrgenommen, ist das günstig für die Nachkommen. Dann wird ihr Echsen-Nachwuchs nämlich größer und stärker und fällt deshalb später seltener einer Schlange zum Opfer. Auch an Ratten zeigt sich, wie stark die frühe Bindung und das Ausmaß des körperlichen Kontaktes darüber bestimmen, ob die Nager als Erwachsene anfällig oder widerstandsfähig auf Stress reagieren.
Die ersten Bindungserfahrungen entscheiden also mit darüber, wie Menschen später mit Anforderungen umgehen. »Es kommt allerdings immer auf den Kontext an, ob eine Fähigkeit hilfreich für die Anpassung ist oder ob sie pathologische Auswirkungen hat«, sagt Peter Henningsen, Leiter der Klinik für Psychosomatik an der Technischen Universität München. So waren die Kinder von Menschen, die im holländischen Hungerwinter 1944/45 starken Belastungen ausgesetzt waren, klein und von niedrigem Geburtsgewicht – wie auch ihre Enkel. Später erkrankten diese Kinder und ihre Enkel häufiger an Diabetes und verengten Herzkranzgefäßen. Nach der Geburt 1945/46 war es für die Kinder wichtig, im Körper mehr Fett, Zucker und andere Reserven mobilisieren zu können – diese Neigung wurde im Erwachsenenleben jedoch zur Bedrohung. »Was akut hilft, um zu überleben, erhöht später manchmal das Risiko«, sagt der Humangenetiker Klaus Zerres von der Universität Aachen. »Diese Einflüsse lassen sich sogar über Generationen hinweg verfolgen.«
Weitere Beispiele für die frühe biologische Prägung: Starke mütterliche Belastungen während der Schwangerschaft führen dazu, dass die Pubertät der Kinder früher einsetzt, wie Hormonexperten von der Universität Edinburgh beobachtet haben. Wenn Mütter viel Stress haben, kommen die Kinder früher auf die Welt. Sie holen ihren Wachstumsrückstand aber schnell auf und geraten in der Folge auch früher in die Pubertät. »Die genetische Idee dahinter könnte sein, dass man sich schnell weiter fortpflanzen muss, wenn das Leben anstrengend und ständig bedroht ist«, sagt der Münchner Endokrinologe Felix Beuschlein. »Dieses Gefährdungsgefühl mahnt den Körper zur Eile, und dann wird eben alles früher fertig.«
Eine Untersuchung der Universität von Arizona ergab, dass Mädchen früher pubertieren, wenn sie bei der Trennung ihrer Eltern zwischen drei und acht Jahre alt waren und wenn ihre Väter als sozial auffällig gelten, also zum Beispiel Drogen nehmen, gewalttätig sind oder im Gefängnis sitzen.16 Das gleiche Forscherteam veröffentlichte 2011 weitere Ergebnisse: Kinder kommen früher in die Pubertät, wenn sie in schwierigen Elternhäusern aufwachsen.17 Evolutionspsychologen folgern daraus: Eine unangenehme Kindheit regt den Körper dazu an, früh zu pubertieren.
»Es scheint fast so etwas wie eine psychosomatische Genetik zu geben«, sagt Peter Henningsen. Die Aufklärung der genetischen Mechanismen mache verständlich, wie frühe Beziehungserlebnisse nicht nur psychische, sondern auch stabile körperliche Spuren hinterlassen. »Aber auch wenn immer mehr neurobiologische und hormonelle Strukturen verstanden werden, die dem Verhalten zugrunde liegen, heißt das aber nicht, dass psychische Störungen nur neurobiologisch, sprich: pharmakologisch behandelt werden können.«
Inzwischen konnte längst gezeigt werden, dass der Zusammenhang zwischen frühen Bindungserfahrungen und Stressresistenz nicht nur bei Labortieren, sondern auch für Menschen gilt. So besitzen Menschen, die versucht haben, sich umzubringen, weniger Andockstellen für Stresshormone. Wer als Kind traumatisiert wurde oder an einer Depression leidet, besitzt ebenfalls weniger von den Rezeptoren, an denen die Stressmoleküle abgebaut werden. Wem also beispielweise die Mutter zumeist kühl und sachlich-distanziert gegenübergetreten ist, der verfügt auch über weniger dieser körpereigenen Schutzreserven.18
Es ist nie zu spät
Jeder kennt diese kleinen Nervensägen – sie können sich nicht konzentrieren, sie stehen ständig unter Strom, ihre Frustrationstoleranz ist gleich null, und warten, bis sie in der Schule oder in der Gruppe drankommen, können sie auch nicht. Für Lehrer und Eltern ist dieses Verhalten von Kindern vor allem anstrengend, im Erwachsenenalter wird es womöglich zu einem gravierenden Nachteil. Denn leider setzt sich das Muster oft fort: Wer mit drei Jahren häufig unausgeglichen ist und seine Gefühle kaum unter Kontrolle halten kann, der bekommt auch 30 Jahre später noch Schwierigkeiten mit seinen Impulsen: Emotional überschießende Kinder werden als Jugendliche und Erwachsene häufiger krank und drogenabhängig. Im arbeitsfähigen Alter sind sie finanziell schlechter gestellt und geraten öfter mit dem Gesetz in Konflikt.19
»Man kann den voraussichtlichen späteren Erfolg im gesundheitlichen wie im beruflichen Bereich oft schon im Vorschulalter bestimmen«, sagt die Psychologin Terrie Moffitt von der Duke University. Die Wissenschaftler um Moffitt hatten fast 1000 Kinder im Alter von drei Jahren untersucht und 30 Jahre lang ihre Entwicklung begleitet und beobachtet. Unruhige und emotional labile Kinder litten später nicht nur häufiger an Bluthochdruck, Übergewicht und waren anfälliger für Geschlechtskrankheiten und Atemprobleme. Sie hatten auch im Durchschnitt mehr Schulden, seltener ein Eigenheim, hatten mehr Trennungen hinter sich, waren häufiger alleinerziehend und tranken öfter zu viel Alkohol. Auch mit dem Gesetz kamen sie häufiger in Konflikt.
Weil die Ergebnisse so überraschend deutlich waren, untersuchte das Forscherteam weitere 500 Zwillingspaare in Großbritannien. Auch hier zeigte sich, dass Geschwister, die ihre Gefühlsausbrüche im Alter von fünf Jahren kaum im Griff hatten, mit zwölf Jahren häufiger rauchten, schlechter in der Schule abschnitten und sich öfter unsozial verhielten. »Die Selbstkontrolle macht sogar bei Zwillingen einen wichtigen Unterschied aus, die ja die gleichen Eltern, einen ähnlichen Alltag und nahezu identische Gene haben«, sagt Avshalom Caspi, der Leiter der Forschungsgruppe.
Eine andere Forschergruppe kam zu ganz ähnlichen Ergebnissen.20 Sie untersucht in regelmäßigen Abständen den körperlichen wie seelischen Zustand von mehr als 17600 Menschen, die alle in ein und derselben Märzwoche in Großbritannien geboren wurden. Dadurch sind zumindest die zeittypischen und geographischen Lebensumstände der Probanden ganz ähnlich (und auch die astrologischen, für den, der daran glaubt …). Dabei zeigte sich, dass die Teilnehmer, die mit 16 Jahren psychische Schwierigkeiten hatten und als »emotional nicht angepasst« galten, im Alter von 50 Jahren 28 Prozent weniger Geld verdienten als die anderen, dass sie öfter allein lebten oder geschieden und arbeitslos waren. Häufig waren sie auch im Erwachsenenalter weniger verträglich und erlebten mehr Belastungen und Konflikte.
Ein vorbestimmtes Schicksal bedeuten die scheinbar unkontrollierbaren Gefühlswallungen im Kindes- und Jugendalter dennoch nicht. Wer es lernt, mit seinen Gefühlen besser umzugehen, kann sein Leben trotzdem noch in günstigere Bahnen lenken. »Es ist nie zu spät dafür, gute Erfahrungen zu machen«, sagt Bindungsexperte Karl Heinz Brisch. »Aber je älter die Kinder sind, desto dichter müssen die positiven emotionalen Neuerfahrungen sein, die sie dann noch machen. Erfahren die Kinder in einer therapeutischen Beziehung oder durch Vorbilder immer wieder, wie sie mit starken Gefühlen wie Angst, Panik oder Wut besser umgehen können, wird das irgendwann auch innerlich verankert.«
Oft haben die Eltern allerdings ebenso professionelle Hilfestellung nötig wie die Kinder, hat Brisch erfahren. »Ein Zehnjähriger mit einem heftigen Wutanfall braucht jemanden, der ihn nicht barsch in sein Zimmer zurückschickt, sondern der bei ihm bleibt«, sagt Brisch. »Der sich einfühlt in die Innenwelt des Jungen und mit Worten widerzuspiegeln versucht, wie elend sich das Kind gerade fühlt.« Der Zehnjährige ist dann im Idealfall nicht mehr wütend, sondern schimpft vor sich hin, bis er ruhig darüber reden kann. Darum geht es schließlich: Heftige Gefühle in Worte und nicht in feindliches, aggressives Handeln umzusetzen. Das schont private wie berufliche Beziehungen und die Gesundheit, statt sie früh und dauerhaft zu ruinieren.
19 kräftigende Tatsachen über die frühe Stärkung von Kindern
Zuwendung und körperliche Nähe können gar nicht früh genug beginnen.
Gehen Sie liebevoll mit Ihren Kindern um! Das stärkt und schützt sie ihr ganzes Leben lang.
Frühgeborene entwickeln sich besser, wachsen schneller, bekommen weniger Hirnschäden, ihre Lungen und Herzen kräftigen sich besser, und sie können früher aus der Klinik entlassen werden, wenn sie viel Wärme und Zuwendung bekommen.
Wenn Kinder immer wieder gestreichelt und berührt werden, reift ihr Gehirn schneller, und die schützenden Markscheiden um die Nervenbahnen bilden sich früher. Das fördert die Vernetzung und wirkt sich günstig auf alle Organsysteme aus.
Kleinkinder sensitiver Mütter verstehen einfache Zusammenhänge besser als Kinder, deren Mütter eher abweisend sind und die ihre Kleinen seltener berühren. Zudem entwickeln sich Sprache, Ausdauer und soziale Kompetenz besser.
Kinder, die warmherzig von ihren Eltern erzogen werden, bekommen als Erwachsene seltener Depressionen, weniger Herzerkrankungen und sind nicht so anfällig für Erkrankungen aller Art.
Kinder, die im achten Lebensmonat besonders fürsorglich von ihrer Mutter behandelt werden, profitieren noch 30 Jahre später davon und bleiben zeitlebens weniger anfällig für Stress.
Kinder von gestressten Müttern entwickeln heftigere Asthmasymptome als jene, deren Mütter entspannt und freundlich mit ihnen umgehen.
Wer als Kind körperlich oder seelisch missbraucht wurde, wird als Erwachsener eher psychisch oder körperlich krank.
Wer als Kind freundlich behandelt wurde, kann später besser mit Stress umgehen. Schlechte Erfahrungen und belastende Situationen erleben zwar alle Menschen irgendwann. Die Stressreaktion hält jedoch nicht so lange an.
Je positiver die Reize und Einflüsse in früher Kindheit, desto gesünder und widerstandsfähiger werden die Kinder – und bleiben es ihr Leben lang.
Fordern Sie Ihre Kinder, aber überfordern Sie sie nicht. Und quälen Sie sie nicht mit Ihren eigenen unerfüllten Wünschen.
Kinder sind anstrengend, und es gibt Phasen in der Erziehung, in denen man verzweifeln kann. Das ist normal. Wenn die Probleme überhandnehmen, ist professionelle Unterstützung von Ärzten und/oder Psychologen sinnvoll.
Liebevoller Umgang wirkt sich direkt auf körperliche Regulationsmechanismen aus: Kinder, die viel Nähe erfahren haben, bilden mehr Rezeptoren, um Stressmoleküle unschädlich zu machen.
Emotional labile Kinder bekommen als Erwachsene häufiger Bluthochdruck, Übergewicht, Geschlechtskrankheiten und Atemprobleme; sie verdienen weniger, haben mehr Schulden, seltener ein Eigenheim, sind öfter alleinerziehend und trinken mehr Alkohol.
Auch in höherem Alter können Kinder und Jugendliche lernen, mit ihren Gefühlen besser umzugehen. Das Leben kann trotzdem noch in günstige Bahnen geraten. Dazu müssen emotionale Neuerfahrungen aber positiv sein und häufig vorkommen, um innerlich verankert zu werden.
Je älter ein Kind oder Jugendlicher ist, wenn er erstmals positive Erfahrungen macht, umso schwieriger wird es, davon zu profitieren.
Wütende Kinder sollten nicht in ihr Zimmer geschickt werden, bis sie sich »beruhigt« haben. Besser wäre es, sich in sie einzufühlen und ihnen dieses auch zu vermitteln.
Menschen, die versucht haben, sich umzubringen, besitzen weniger Andockstellen für Stresshormone. Wer als Kind traumatisiert wurde oder an einer Depression leidet, besitzt ebenfalls weniger dieser körpereigenen Schutzreserven.
Das Leid, das bleibt
Manche Wunden bleiben ein Leben lang. Auch wenn sie äußerlich verheilen, bestehen die Verletzungen weiter. Besonders langfristige Beeinträchtigungen erleiden Kinder, die früh und über einen langen Zeitraum körperlich wie seelisch vernachlässigt werden und in wichtigen Entwicklungsphasen zu wenig Zuwendung bekommen. Besonders ausgeprägt ist diese Verletzlichkeit bei Kindern wie jenen aus den rumänischen Waisenhäusern des Ceauşescu-Regimes, von denen viele jahrelang ans Bett gebunden und emotional völlig vernachlässigt wurden.21 Sie bekamen zwar gerade so viel zu essen, dass sie nicht verhungerten, doch freundlich oder gar liebevoll und zärtlich war niemand zu ihnen. Man ließ sie seelisch verkümmern.
Diese Vernachlässigung wurden die Kinder ihr Leben lang nicht mehr los. Auch nachdem sie von harmonisch-intakten Familien aus den USA adoptiert worden waren und bereits ein Jahrzehnt dort gelebt hatten, blieben diese Kinder anfälliger für psychische Leiden wie Ängste und überschießende Stressreaktionen mit Schweißausbrüchen und Panikattacken. Auch körperlich waren diese Kinder noch Jahrzehnte später verletzlicher und infizierten sich beispielsweise häufiger mit banalen Erregern als jene Kinder, die in jungen Jahren nicht ein solches Martyrium hatten durchleiden müssen.
Ärzte und Psychologen haben viel damit zu tun, bei ihren erwachsenen Patienten die Geister aus den Kinderzimmern zu verscheuchen, von denen manche Patienten ihr Leben lang immer wieder heimgesucht werden. »Wir bauen späte Nester«, sagt deshalb Thomas Loew, Chefarzt für Psychosomatik an der Universitätsklinik Regensburg, zu seiner Arbeit. »Wir haben jetzt eine Erklärung dafür, wie die Erfahrung in den Körper kommt«, sagt Carl Scheidt, Chefarzt für Psychosomatik an der Thure-von-Uexküll-Klinik in Freiburg. Weil die frühe Bindung so wichtig sei, würden Verfahren wie Psychotherapie und Psychoanalyse oft auch so viel Zeit benötigen – Zeit, um das wieder aufzuholen, was sich in frühen Jahren nicht entwickeln konnte oder verschüttet worden ist.
Joanna Maselko fordert, dass die Erziehung in Institutionen wie auch in problematischen Familien genauer und vor allem früher beobachtet und kontrolliert werden sollte. »Man muss verhindern, dass sich negative Erfahrungen dauerhaft einprägen und den Rest des Lebens so verheerend beeinflussen«, fordert die Forscherin. Denn dieser Aufwand und diese Zeit lohnen, um Kinder davor zu bewahren, dass sie verstört, verunsichert und krank durchs Leben gehen.
Die Last der frühen Jahre
Bindungsforscher und Ärzte für Psychosomatik wissen, dass frühkindlicher Missbrauch, emotionale Verwahrlosung, extreme Strenge und häufiger Familienstreit zu mehr Depressionen, zu mehr Angststörungen und anderen psychischen Leiden in späteren Jahren führen. »Eine unsichere Bindungsentwicklung ist ein großer Risikofaktor« sagt Karl Heinz Brisch von der Ludwig-Maximilians-Universität München. »Bei Belastungen droht später häufiger eine psychische Entgleisung, und Beziehungskonflikte können dann zumeist auch weniger gut geklärt werden.« Aber auch organische Leiden wie Diabetes, verkalkte Herzkranzgefäße, Übergewicht, Bluthochdruck und viele weitere Erkrankungen treten häufiger auf, wenn die frühe Entwicklung stark belastet war, auch wenn noch nicht genau klar ist, warum manche Kinder derartige Belastungen besser wegstecken als andere.
Aus Befragungen zur frühen Kindheit wissen Forscher, dass geringe mütterliche Zuwendung dazu führt, dass Menschen schlechter mit Stress umgehen können. Offenbar fällt es ihnen auch schwerer, sich selbst etwas Gutes zu tun. Kanadische Wissenschaftler zeigten dies am Beispiel von Freiwilligen, die am Bildschirm Rechenaufgaben lösen mussten und – fälschlicherweise – ständig eingeblendet bekamen, dass sie langsamer und schlechter als der Durchschnitt waren. Das als Glückshormon geltende Dopamin, das ein Maß für das körpereigene Belohnungssystem ist, wurde bei den gestressten Probanden in deutlich geringerer Konzentration ausgeschüttet, die von einer unterkühlten Bindung zu ihren Eltern berichteten.22
Bekommen Kinder hingegen früh viel Zuwendung, sind die Chancen groß, dass sie sich schneller und umfassender entwickeln. Kleinkinder registrieren viel mehr, als ihnen die meisten Menschen zutrauen. Je mehr Zuwendung Eltern einem Kind schenken, desto aufnahmefähiger wird es. Dann lernt es zum Beispiel früher sprechen und entwickelt rascher soziale Kompetenzen. Haben Eltern und Kinder eine frühzeitig gepflegte liebevolle und stabile Beziehung, macht das die Kinder später widerstandsfähiger gegen Stress und Depression und begünstigt zudem einen gleichmäßigeren Herzrhythmus, der sie auch Jahrzehnte später noch weniger anfällig für Infarkte macht.23
Ständig unter Strom
Die Geister aus der Kinderstube können immer wieder zurückkehren. Wer Opfer einer Misshandlung, eines Unglücks oder einer anderen Traumatisierung geworden ist, hat mit den seelischen Auswirkungen oft noch Jahrzehnte zu kämpfen, solche Erfahrungen verblassen nie ganz. Geister aus der Kinderstube – so nennen Psychologen Ängste und andere seelische Notlagen, die auf mangelnde Liebe und Fürsorge in jungen Jahren zurückzuführen sind, und meinen damit in erster Linie die langfristigen Folgen für das Gemüt.
Schlimme Erfahrungen in der Kindheit hinterlassen jedoch nicht nur Narben in der Seele, sondern auch im Körper. Wer als Kind zu wenig Wärme erfahren hat und emotional vernachlässigt wurde, ist zwar ein Leben lang anfälliger für psychische Leiden – aber auch für körperliche Gebrechen wie Bluthochdruck, verstopfte Herzkranzgefäße und Zwölffingerdarmgeschwüre.
Christine Heim von der Emory University in Atlanta hat in zahlreichen Forschungsprojekten gezeigt, wie sich frühe Stresserfahrungen bereits auf das junge, kindliche Gehirn auswirken und die Neigung zu Depressionen verstärken.24 Aus epidemiologischen Untersuchungen ist bekannt, dass Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend traumatisiert worden sind, später viermal häufiger an einer Depression erkranken. Mittlerweile erkennen Forscher, was dabei im Gehirn vor sich geht, so dass es zeitlebens verletzlicher bleibt und stärker auf Belastungen reagiert, auch wenn die ursprüngliche Traumatisierung bereits Jahrzehnte zurückliegt.
»Körperliche Misshandlungen wie auch emotionale Vernachlässigung kann man als negative soziale Lernerfahrungen auffassen«, sagt Heim. »Leider prägt sich so etwas dauerhaft ein.« So wie manche Vokabeln oder in der Schule gelernte Gedichte ein Leben lang haften bleiben – besonders dann, wenn sie mit viel Begeisterung oder in großer Angst gelernt wurden –, verschwinden auch Momente des Unglücks, der Erniedrigung und Schmerzen so leicht nicht mehr aus dem Kopf und aus dem Herzen.
Biologen und Psychologen versuchen, die prägenden Entwicklungsschritte genauer zu verstehen. Moduliert wird die körperliche Reaktion auf Stress zumeist über zwei Wege. Eines der wichtigsten Systeme steuert der Hypothalamus im Zwischenhirn. Bei Belastung oder Gefahr wird hormonell die Hirnanhangsdrüse stimuliert, die wiederum die Nebenniere anregt, das Stresshormon Kortisol auszuschütten. Über einen zweiten Reaktionsweg, das vegetative Nervensystem, werden bei Stress vermehrt Adrenalin und Noradrenalin freigesetzt. Beide Systeme zu aktivieren ist im Notfall sinnvoll, denn so ist es möglich, Energiereserven schnell zu mobilisieren und den Körper in höchste Anspannung zu versetzen.
Was im Kampf gegen Bär und Mammut und angesichts anderer körperlicher Bedrohungen in der Steinzeit evolutionär sinnvoll gewesen sein mag, ist im heutigen Alltag allerdings zumeist überflüssig und kann sogar die Gesundheit gefährden. Wenn der Ärger auf den Lehrer, der Druck in der Familie oder andere psychosoziale Ursachen den Organismus permanent in Alarmbereitschaft versetzen, kann der erhöhte Ausstoß an Adrenalin, Kortisol und Co. krank machen. Die Stressreaktion dreht dann im Leerlauf und schwächt innere Organe wie auch die Immunabwehr – anstatt den Körper zu stärken.
Besonders gesundheitsschädlich ist es, wenn die Stressreaktion des Körpers permanent hochreguliert bleibt. Stimuliert vom Hypothalamus im Zwischenhirn, schüttet die Hirnanhangsdrüse dann das Hormon ACTH aus, wodurch wiederum die Freisetzung des Stresshormons Kortisol in der Nebennierenrinde angefeuert wird. Herzrasen, Anspannung, beschleunigte Atmung und ein Stoffwechsel auf Hochtouren sind die Folge. Diese Alarmreaktion ist bei einer kurzfristigen Belastung zwar sinnvoll, um für einen Kampf oder die Flucht gerüstet zu sein – auf Dauer macht sie jedoch krank.
Heims Forschungsgruppe konnte zeigen, dass unter Stress auch der Pegel des C-reaktiven Proteins im Nervenwasser erhöht ist; dieser Eiweißstoff zeigt entzündliche Prozesse im Körper an. Bei Frauen, die in ihrer Kindheit missbraucht worden sind und daraufhin an einer posttraumatischen Belastungsstörung litten, waren die entsprechenden Entzündungswerte sogar noch im Erwachsenenalter spürbar erhöht.25 Liegen die Entzündungswerte dauerhaft im oberen Bereich, treten diverse Krankheiten häufiger auf.
In Tierversuchen hat sich zudem ergeben, dass bei erwachsenen Rhesusaffen der Zuckerstoffwechsel im Gehirn erhöht ist und bleibt, wenn sie frühkindlichen Stress erlebt haben.26 Dies ist ein Anzeichen dafür, dass im Gehirn mehrere Bereiche damit beschäftigt sind, die unangenehmen Erfahrungen zu verarbeiten. Bei Ratten unter chronischem Stress bleiben sogar jene Zentren im Gehirn kleiner und werden gehemmt, die das Gefühlserleben modulieren. Zwar lassen sich Experimente mit Affen oder Nagern längst nicht immer auf den Menschen übertragen, aber in jüngster Zeit wurden eine Verkleinerung des Hippocampus und eine gestörte Neubildung der dortigen Nervenbahnen auch bei Frauen beobachtet, die ein frühkindliches Trauma erlitten hatten und später an einer Depression erkrankt waren.