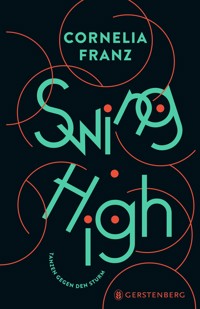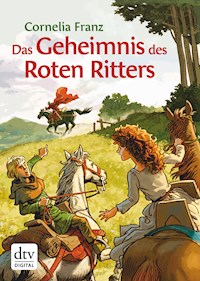9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 2023: Leon hat beim Herumalbern einem Mann auf der Straße sein Käppi vom Kopf geschnappt, ohne zu begreifen, was er da tut. Als er es später aus Jux aufsetzt, wird er von zwei Unbekannten brutal zusammengeschlagen – aber warum? Nikolai ahnt, dass der Angriff auf Leon eigentlich ihm galt. Schließlich ist er einer der wenigen Juden in der Gegend hier. Doch wer kennt überhaupt die Herkunft seiner Familie? Yara wohnt in einem Haus mit Stolpersteinen vor der Tür. Immer wieder kreisen ihre Gedanken um das Mädchen Ella, dem einer der Steine gewidmet ist. Ist das alles inzwischen längst Geschichte? Als die drei sich kennenlernen, finden sie nicht nur viel über die Hintergründe der Tat heraus, sondern auch über sich selbst – und über den Wert von Freundschaft … *** Vielschichtig und einfühlsam erzählt, mit drei ganz unterschiedlichen Jugendlichen im Zentrum des Romans***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cornelia Franz
Goldene Steine
Yara mag die goldenen Stolpersteine vor ihrer Tür. Und die alte Frau Winter, die ihr von Ella erzählt hat – dem Mädchen, dem einer der Steine gewidmet ist.
Leon hat beim Herumalbern einem Passanten sein komisches rundes Käppi vom Kopf geschnappt. Als er es später aufsetzt, wird er brutal zusammengeschlagen.
Nikolai vermutet gleich, dass der Angriff auf Leon eigentlich ihm galt, schließlich ist er einer der wenigen Juden in der Gegend hier. Als die drei Jugendlichen sich kennenlernen, finden sie nicht nur ganz viel über die Hintergründe der Tat heraus, sondern auch eine ganz besondere Freundschaft …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
HAMBURG
1
YARABALANCIERTE den doppelstöckigen Käfig die Treppen hinunter. »Keine Panik, Maxi«, sagte sie zu der Maus, die verschreckt von einer Ecke in die andere rannte. Vor dem Haus machte sie automatisch einen größeren Schritt, um nicht auf die goldenen Steine im Pflaster zu treten. Sie ging an dem offenen Transporter vorbei, der schon ziemlich beladen war. An der Rückwand stapelten sich die Kartons, davor standen Bücherregale, das Ledersofa und die Sessel. Das komplette Wohnzimmer auf ein paar Quadratmeter zusammengeschoben und trotzdem noch zu viel Zeugs. Die neue Wohnung war nicht einmal halb so groß wie die alte.
Ihr ganzes Leben war halbiert worden. Kleinere Wohnung, kleineres Zimmer, kleinere Familie. Sogar Mini würde das neue Zuhause nicht mehr kennenlernen, am Morgen hatte sie tot im Käfig gelegen. Yara hatte ein winziges Grab im Vorgarten angelegt, während ihr Vater und seine Freunde den Umzugswagen beluden. Die machten sich natürlich über sie lustig. Ein dreizehnjähriges Mädchen, das eine Trauerfeier für eine tote Maus abhielt … Missmutig stellte sie den Käfig auf den Beifahrersitz.
»So, die letzte Fuhre. Das lief doch alles wie am Schnürchen.« Ihr Vater versprühte betont gute Laune, als sie durch den Feierabendverkehr stadtauswärts rollten. Doch Yara kamen die Straßen mit jedem Kilometer hässlicher vor. Nur noch langweilige Wohnblocks, von denen einer wie der andere aussah.
»Du machst ein Gesicht, als müsstest du nach Sibirien«, meinte ihr Vater. »Dabei ändert sich doch kaum was. Du bleibst ja auf deiner Schule, nur der Weg ist ein bisschen weiter.«
»Ein bisschen ist gut. Ich brauch mindestens eine halbe Stunde.« Yara starrte durch die Windschutzscheibe, ohne noch etwas wahrzunehmen. Klar, es war keine Riesensache, von einem Stadtteil in den nächsten zu ziehen. Aber trotzdem lag Papa falsch. Alles würde sich ändern.
»Wer trägt denn jetzt Frau Winter die Einkaufstaschen nach oben?«, fragte sie unvermittelt.
»Da findet sich schon jemand von den Nachbarn.«
»Ich hab ihr nicht mal richtig Tschüss gesagt.«
»Du kannst doch jederzeit nach der Schule bei ihr vorbeifahren.«
»Ja, schon. Aber ich hätte trotzdem bei ihr klingeln sollen. Ich hab sie komplett vergessen bei dem Stress heute.« Yara nagte an ihrer Unterlippe. Und die goldenen Steine? X-mal war sie heute an ihnen vorbeigelaufen, ohne einen einzigen Blick darauf zu werfen. Sie sah zu ihrem Vater hinüber. Nein, Papa verstand garantiert nicht, dass sie die Steine vermissen würde, genauso wie die schöne große Wohnung, die alte Frau Winter und das ganze Haus.
Solange sie zurückdenken konnte, war ihre Fantasie um die glänzenden Steine gekreist. Als kleines Mädchen hatte sie sie geputzt, wenn sie schmutzig waren. Sie waren ihr Schatz gewesen, ein echter Goldschatz! Einmal hatte sie sich aus der Wohnung geschlichen, weil sie das Gold ausgraben wollte. Mit einem spitzen Stein hatte sie um die Quadrate herumgekratzt, aber die hatten sich keinen Millimeter bewegt. Dann sollte es wohl so sein – der Schatz gehörte zum Haus und das Haus gehörte zum Schatz. Und irgendwie gehörte das alles ein bisschen Yara.
Den Erwachsenen schien diese Kostbarkeit egal zu sein. Achtlos traten sie auf die Steine, als würden sie das Gold gar nicht sehen. »Wer wohl den Schatz hier vergraben hat? Ob das eine Fee war?«, hatte Yara ihren Vater einmal gefragt. Doch der hatte sie angeschaut, als hätte sie etwas ganz und gar Dummes gesagt. »Nun frag nicht immer so viel«, hatte er sie abgewimmelt. Auch Maman hatte nicht darüber reden wollen. Um diesen Schatz gab es ein Geheimnis, das die Erwachsenen nicht verraten wollten, das hatte Yara damals genau gespürt. Und schließlich war es Frau Winter gewesen, die ihr die Geschichte der Steine erzählt hatte.
»Nun lass mal das Rumgrübeln, Yara.« Ihr Vater gab ihr einen Stups. »Wenn du willst, können wir Frau Winter ja mal zum Kaffee einladen, sobald das größte Durcheinander beseitigt ist. Ich hole sie mit dem Auto ab. Dann kommt sie auch mal raus aus dem Haus.«
»Wenn sie will«, korrigierte Yara ihn. Frau Winter hatte ihren eigenen Kopf. Und sie wohnte schon über neunzig Jahre in dem Haus, unglaublich! Bestimmt würde sie so wie Mini einfach tot umfallen, wenn sie jemals umziehen müsste. Vor allem in eine so öde Straße wie die, in die sie jetzt einbogen.
2
DIEBEIDEN TYPEN standen vor ihm, als wären sie aus dem Nichts aufgetaucht. Sie mussten sich hinter den Altglascontainern versteckt haben. »Da ist er ja«, sagte der Kleinere der beiden. Leon guckte verunsichert. Hatten die auf ihn gewartet?
»Wie läufst du hier eigentlich rum, du Jude?« Der andere, ein Honk mit einem grottenhässlichen Tattoo am Hals, grinste ihn an. Und zack, riss er ihm die Mütze vom Schädel – das witzige kleine Käppi, das er selbst vor einer Woche einem Typen vom Kopf gezupft hatte, in Frankfurt, auf dem Rückweg vom Kletterturnier, einfach so aus Spaß.
Leon grinste ebenfalls. Saudämlicher Scherz, klar, aber er würde garantiert nicht nach der Polizei brüllen wie der Mann in Frankfurt. Der hatte einen Aufstand gemacht, als hätten sie ihm die Brieftasche geklaut. »Was soll der Scheiß?« Er streckte die Hand nach dem Käppi aus, doch der Idiot warf es ihm vor die Füße.
»Hallooo?!« In Leon wallte die Wut auf.
Im nächsten Moment rissen sie ihm die Beine weg und er lag am Boden, zwischen Scherben und Schmutz. Er wollte sich aufrappeln, doch der Größere stieß ihm mit Wucht vor die Brust. »Na, ist dir das Grinsen vergangen?«
Leon verstand nicht, was da mit ihm passierte. Nichts begriff er. Sie drückten ihm das Gesicht in die Mütze, sie bespuckten ihn, sie traten ihn, wieder und wieder, sie brüllten ihn an. »Du hast hier nichts zu suchen! Scheiß-Drecksjude, verrecke!« Ihre Stimmen so böse, so voller Hass. Er kniff die Augen zusammen, sein Herz raste. Die Angst flatterte in ihm wie ein gefangener Vogel. Kein Ausweg, nur Panik.
So plötzlich, wie sie vor ihm gestanden hatten, verschwanden sie wieder. Doch Leon traute sich nicht aufzustehen. Noch immer den Kopf mit den Armen schützend, lag er da. »Zwei gegen ein’ ist gemein. Zwei gegen ein’ ist gemein.« Das war das Einzige, was er denken konnte. Er weinte vor Schreck und Schmerzen und Nichtverstehen und weil ihn eine Brutalität getroffen hatte, die es in seiner Welt bisher nicht gegeben hatte.
3
ESWARREINE ROUTINE, dass Nikolai die Straßenseite wechselte, als ihm die beiden schwarz gekleideten Typen entgegenkamen, breitbeinig, mit dicken Eiern. Jungs, die schon auf dreißig Meter Entfernung nach Ärger rochen. Provokation vermeiden, vorsichtshalber, egal wie harmlos die zwei sein mochten. Mit gesenktem Blick ging er einen Schritt schneller, bog um die Ecke und lief an den Altglascontainern vorbei, die Sporttasche über der Schulter und Kopfhörer auf den Ohren. Er zerknüllte das fettige Papier des Döners, den er sich am Bahnhof gekauft hatte, und warf es in einen Papierkorb.
Nikolai wurde langsamer, als er auf den Eingang des Mietshauses zuging, in dem er in der dritten Etage wohnte. Natürlich würde seine Mutter den Döner riechen und natürlich würde sie zetern. Warum hatte er den eigentlich gekauft? Sein letztes Taschengeld war dafür draufgegangen. Er kramte ein Kaugummi aus der Jackentasche und steckte es sich in den Mund, bevor er die Wohnungstür aufschloss. Wie immer kam seine Mutter aus der Küche, kaum dass sie ihn gehört hatte.
Spontan entschloss er sich zur Vorwärtsverteidigung. »Ich riech nach Imbissbude, ich weiß. Reg dich mal nicht gleich auf.«
»Was heißt, reg dich nicht auf? Wie soll ich mich nicht aufregen, wenn mein einziger Sohn immer wieder …«
Er nahm sie kurz in die Arme. Schon vor mehr als zwei Jahren, noch vor seinem dreizehnten Geburtstag, hatte er sie überholt, jetzt überragte er sie um mehr als einen Kopf. »Hab mir nur ’ne Cola gekauft, Mamotschka. Ich hatte Durst nach dem Training«, murmelte er in ihre zerzauste Frisur hinein. »Man muss nur eine Minute in dem Laden warten, dann hat man den Geruch in den Klamotten. Ehrlich.«
Kopfschüttelnd schob sie ihn weg. Nikolai sah ihr an, dass sie ihm nicht glaubte. Aber auch seine Mutter wollte offenbar keinen Zoff. »In der Familie streitet man nicht« war einer ihrer Sprüche, mit denen sie alle Risse zukleisterte. Sie zeterte zwar, wenn sie ihn bei Verbotenem erwischte. Aber dabei blieb es dann auch.
»Es ist noch Bohneneintopf da. Du hast bestimmt Hunger, oder?«, fragte sie, schon auf halbem Weg zurück in die Küche.
»Klar, Riesenhunger«, sagte er, um sie endgültig zu besänftigen.
»Und stell die Fußballschuhe nach draußen zum Auslüften!«
»Mach ich.« Nikolai brachte seine Sportsachen auf den Balkon. Als er die verschwitzten Adidas an die Wäscheleine klammerte, streifte sein Blick den Platz mit den Altglascontainern. Es dämmerte bereits, aber die Straßenlaternen reichten aus, um die Szene zu beleuchten: Da lehnte ein Junge am Container, den Rücken an die Betonwand gedrückt. Mann, sah der elend aus … Sein Gesicht und sein Pulli waren voller Blut. Was war dem denn passiert? Und das zerknautschte Ding vor seinen Füßen, das war doch eine Kippa, oder nicht? Gehörte der Junge zur Gemeinde? Er hatte ihn jedenfalls noch nie gesehen. Was allerdings nichts zu bedeuten hatte, so selten, wie er sich im Gottesdienst blicken ließ.
»Hey!« Nikolai beugte sich über das Geländer. »Hey, du! Brauchst du Hilfe?!«
Der Junge zuckte zusammen und schaute hoch. In seinen Augen lag Verwirrung, als wüsste er nicht, wo er sich befand. Er öffnete den Mund, vielleicht um zu antworten. Doch er spuckte nur Blut aus.
»Warte, ich komme!«, rief Nikolai. In diesem Moment rollte ein Umzugswagen die Straße entlang und hielt ausgerechnet so, dass er ihm die Sicht versperrte. Einen Moment zögerte er, dann lief er los. »Bin gleich wieder da«, rief er seiner Mutter zu, während er zur Tür hinausrannte.
Als er bei den Containern ankam, war der Junge nicht mehr zu sehen. Nur die Kippa lag noch zwischen den Scherben. Nikolai nahm sie in die Hand und fasste in eine feuchte Mischung aus Blut und Spucke. Hastig ließ er sie fallen, nur um sie im nächsten Moment wieder aufzuheben. Mit spitzen Fingern trug er die Kippa zum Haus zurück. Er hatte das Gefühl, beobachtet zu werden, und zog unwillkürlich die Schultern hoch. Doch als er sich umdrehte, sah er nur ein Mädchen aus dem Umzugswagen klettern.
Zu Hause stopfte er die Kippa zusammen mit seinen Sportsachen und ein paar Handtüchern in die Waschmaschine. »Oha, es brechen neue Zeiten an«, sagte seine Mutter. »Mein Sohn weiß, wie man die Waschmaschine bedient.«
Für eine Sekunde überlegte er, ob er ihr von dem Jungen mit der Kippa erzählen sollte. Doch er ließ es lieber bleiben. Sie würde sich nur aufregen. Warum sollte er ihr Angst machen?
4
LEONWISCHTESICH mit dem Ärmel seiner Jacke das Gesicht ab, bevor er den Schlüssel aus der Hosentasche zog und die Wohnungstür öffnete. Das Hellgrau der Marmorfliesen, die weiß getünchten Wände, die grellen Lichtfluter, die ganze klinisch saubere Wohnung überforderte ihn. Er lehnte sich an den Türpfosten zum Wohnzimmer und sah zu seinen Eltern hinüber. Sein Vater schnippelte an der Küchentheke Gemüse. Seine Mutter saß auf dem Sofa und tippte auf ihrem Handy herum. Als Leon »Hallo« murmelte, schauten sie kaum auf.
»Wolltest du nicht zum Kletterkurs?«, fragte sein Vater.
Seine Mutter schrieb ihre Nachricht zu Ende und musterte ihn dann genauer. »Du siehst ja furchtbar aus. Was ist denn passiert, Leon? Bist du abgestürzt? Ich hab doch gleich gesagt, dass das zu gefährlich ist!«
Leon presste die Lippen zusammen. Er wollte nicht schon wieder heulen.
»Nun zieh erst mal die schmutzigen Schuhe aus und dann setz dich.« Seine Mutter klopfte neben sich aufs Sofa.
Als Leon sich in dem Sessel gegenüber vom Sofa niederließ, verzog er das Gesicht vor Schmerz. Jetzt sah ihn auch sein Vater aufmerksamer an. »Sag bloß, ihr werdet nicht angeseilt?! Dann hat dein Trainer aber eine Klage am Hals, das verspreche ich dir.«
»Zeig mal, hast du da eine Schürfwunde? Bist du verletzt, Leon? Sollen wir den Notarzt rufen?« Seine Mutter strich ihm mit besorgter Miene die Haare aus der Stirn.
Leon antwortete mit einem kaum wahrnehmbaren Kopfschütteln. »Ist nicht nötig, Mama, ehrlich nicht. Und die Trainerin, die kann nichts dafür, Papa. Das waren … das waren …« Er stockte. Doch dann brach es aus ihm heraus, zusammen mit den Tränen, die er nicht mehr zurückhalten konnte. Der plötzliche Angriff, die Schläge und Tritte, die Schimpfwörter … Nur das geklaute Käppi, das sie ihm vom Kopf gerissen hatten, erwähnte er nicht. Das hatte er ja vor den Augen seiner Eltern nicht getragen.
»Die haben dich als Juden beschimpft?« Leons Vater war empört. »Das wird ja immer absurder. Unglaublich! Wo leben wir denn? Die zeigen wir an!«
Leon antwortete nicht. Klar, sein Vater hatte recht. Die Scheißtypen gehörten angezeigt. Doch eigentlich wollte er nichts anderes als unter seine Bettdecke kriechen und nie wieder daran denken. Löschtaste drücken, alles ausradieren.
»Haben sie dich beklaut, Leon?«
»Nein, Papa.«
»Aber was wollten die dann?«
»Keine Ahnung. Das waren einfach Idioten.«
»Aber …«
»Lass mal, Papa.«
»Ich glaube, Leon sollte erst einmal unter die Dusche«, meinte seine Mutter. »Alles andere können wir auch morgen erledigen. Bist du sicher, dass du keinen Arzt brauchst, Leon?«
»Ich bin okay, Mama.«
»Das Essen ist in einer Viertelstunde fertig.« Leons Vater schob das Gemüse vom Schneidebrett in die Pfanne.
»Ich hab keinen Hunger«, wehrte Leon ab. »Ich leg mich lieber hin.«
»Möchtest du wirklich nichts? Soll ich dir schnell eine heiße Brühe machen?« Seine Mutter wollte vom Sofa aufstehen.
»Danke, Mama, muss nicht sein.« Leons Magen rebellierte allein bei dem Gedanken daran, etwas zu sich zu nehmen. Selbst die Schmerztablette, die seine Mutter ihm anbot, lehnte er müde ab.
Mit einem Pling zeigte ihr Handy eine neue Nachricht an und sie warf ihm ein entschuldigendes Lächeln zu. »Dann ruh dich aus, Großer. Und du meldest dich, wenn was ist, ja?«
»Unglaublich«, murmelte sein Vater noch einmal, über die Pfanne gebeugt.
Mühsam rappelte sich Leon hoch und ging ins Badezimmer, wo er sich unter der Dusche das heiße Wasser in den Nacken prasseln ließ. Er war seiner Mutter dankbar, dass sie ihn in Ruhe ließ. Doch als er dann im Bett lag und ins Halbdunkel seines Zimmers starrte, hoffte er, sie würde noch mal nach ihm schauen. So wie früher. Wann hatte sie eigentlich damit aufgehört? Er zog seinen Stoffhund vom Regal, der da seit einer Ewigkeit einsam vor sich hin lag, und drückte ihn an sich. »Schlaf schön«, flüsterte er in den vertrauten Geruch hinein. Am liebsten hätte er Schnuffel von der Angst erzählt, die ihm immer noch durch den Körper pulsierte. Aber natürlich sprach er nicht mehr mit seinem Kuscheltier.
5
YARASASSAUFDEM TEPPICHBODEN, die Arme um die Knie geschlungen, und versuchte das Chaos um sich herum auszublenden. Aus dem Wohnzimmer, wo ihr Vater ein Regal aufbaute, drangen Hämmern und Klopfen. Um neun Uhr abends noch solch einen Krach zu machen, da hätten sich ihre früheren Nachbarn schon längst beschwert. Aber hier dröhnte aus der Wohnung über ihnen Techno-Gewummer und neben ihnen schien es einen ziemlichen Ehestreit zu geben, so wie die Leute sich anbrüllten. Yara hatte jetzt schon Heimweh nach ihrem alten Zuhause.
»Yara, bestell uns doch mal was«, hörte sie ihren Vater rufen. »Wie wär’s mit einer großen Spinaci, einem Salat und zwei Tiramisus?«
»Bei Tonio? Liefern die auch hier?« Freudig sprang sie vom Bett. Vor lauter Rumräumerei war ihr gar nicht aufgefallen, wie hungrig sie war. Die Nummer des Pizzaladens hatte sie im Handy gespeichert. Sie bestellte öfter mal was, wenn ihr Vater spät nach Hause kam. Er gab Mal- und Bildhauerkurse an der Volkshochschule, und die fanden meist abends statt.
Eine halbe Stunde später saßen sie sich am Esstisch gegenüber und teilten sich die Spinatpizza. In der winzigen Küche füllte der Tisch fast den ganzen Raum aus.
»Und?« Yaras Vater lächelte. »Ist doch nicht ungemütlich, oder?«
Yara zuckte mit den Schultern. »Geht so«, sagte sie.
»Wir gewöhnen uns schon dran.«
»Und wenn Maman da ist? Dann wird es ziemlich eng.«
»Wenn wir den Tisch ins Wohnzimmer stellen, können wir auch zu dritt dran sitzen.«
»Und wann kommt Maman?«
»Vielleicht schon über Pfingsten, und in den Sommerferien fahren wir zu ihr. Versprochen.«
Schweigend pikste Yara in dem Salat herum. Sie verstand noch immer nicht wirklich, warum sie aus ihrer schönen großen Wohnung ausgezogen waren, wenn ihre Mutter doch nur vorübergehend in Frankreich arbeitete. Sie kam doch wieder, oder nicht? Trauten die Eltern sich nur nicht, ihr zu sagen, dass sie sich scheiden ließen? »So ein Blödsinn, Kleines!« Maman hatte gelacht, als Yara sie gefragt hatte. »Wir sind eine Familie und ich liebe euch alle beide.« Und dann hatte sie von dieser tollen Chance geschwärmt, für ein Jahr in Südfrankreich bei einem archäologischen Projekt mitmachen zu können.
»Yara, die alte Wohnung war einfach zu teuer. Die hätten wir uns eh nicht mehr lange leisten können«, sagte ihr Vater jetzt, als hätte er ihre Gedanken gelesen. »Hier zahlen wir vierhundert Euro im Monat weniger.«
»Kein Wunder. In so einer öden Gegend …«
Ihr Vater ertrug ihre schlechte Laune geduldig. »Es gibt in der Nähe einen Jugendclub. Ich hab mal im Internet geguckt. Die bieten ganz schöne Sachen an. Eine Mädchengruppe, Tischtennis, Billard und sogar einen Kletterkurs. Hast du das Clubhaus gesehen? Wir sind vorhin dran vorbeigefahren.«
Yara nickte. Die Fassade mit den Graffiti war ihr auch aufgefallen. Nett von Papa, dass er sich bemühte, ihr den Umzug schmackhaft zu machen. Aber ganz allein in einen fremden Jugendclub zu gehen, war nicht gerade ihr Ding. Sie war nun mal nicht besonders cool.
»Komm, mach mal ein Selfie von uns, das schicken wir Mama«, schlug ihr Vater vor.
So grinsten sie also beide so fröhlich wie möglich in die Kamera. Und als keine zehn Sekunden später der Rückruf aus Frankreich kam, war für diesen Moment Yaras Welt wieder in Ordnung.
6
ESWAR NIKOLAIS GROSSMUTTER, die die gewaschenen Sachen aus der Maschine geholt und zum Trocknen aufgehängt hatte. »Seit wann chast du denn eine Kippa, Nikosch?«, fragte sie ihn, als sie gemeinsam beim Mittagessen saßen. »Die chab ich noch nie gesehen.« Man hörte immer noch ihren russischen Akzent, obwohl sie schon fast dreißig Jahre in Deutschland lebte.
Nikolais Mutter kam erst abends von der Arbeit und er fand es absolut okay, nur seine Babuschka um sich zu haben. Sie war deutlich entspannter als seine Mutter. Manchmal brachte er auf dem Heimweg von der Schule für sie beide Currywurst und Pommes mit, die sie dann mit viel Mayo und noch mehr schlechtem Gewissen verputzten. Das Ganze war so weit von koscherem Essen entfernt wie der Mond von der Erde … Da half sicher auch das Dankesgebet nicht, das Oma Sofia hastig murmelte, obwohl sie nicht besonders religiös war. Das Einzige, worauf sie wirklich Wert legte, waren die Kerzen, die sie freitagabends zum Schabbat anzündete, verbunden mit einem Segensspruch. Sie sah dann immer ganz ernst und feierlich aus.
Nikolai sah von seinem Suppenteller hoch. »Die Kippa? Ach so, die hab ich gefunden«, sagte er. Nein, auch seiner Oma erzählte er lieber nichts von dem Jungen, der so übel zusammengeschlagen worden war. Sie machte sich genau wie seine Mutter ohnehin ständig Sorgen um ihn. Wenn er mal eine halbe Stunde später als verabredet nach Hause kam, befürchteten sie alle beide gleich ein Unglück.
»Gefunden?« Sie runzelte die Stirn. Doch dann lächelte sie. »Schön, dann chast du jetzt eine Kippa. Musst du nicht Mütze aufsetzen beim Beten. Wird sich deine Mutter freuen.«
»Ich wollte eigentlich mal gucken, wem sie gehört.«
»Frag deine Mutter. Die kennt alle jüdischen Männer chier.« Jetzt grinste Oma Sofia. Sie wussten beide, dass Ewa auch deshalb am Gemeindeleben teilnahm, um einen Ehemann zu finden. Nikolais Vater war schon fast zehn Jahre tot. Sofia verstand nicht, warum sich ihre Tochter nicht endlich mal für einen Mann entschied. »Musst du sein so wählerisch? Sogar auf der Sonne gibt es Flecken«, schimpfte sie manchmal mit Ewa. Aber ihre Gemeinde war nun mal nicht besonders groß. Da gab es nicht viele Männer, die infrage kamen, mit oder ohne Flecken. Und an Nikolais Vater kam niemand so leicht heran.
Nikolai hatte nur wenige Erinnerungen an ihn. Er wusste noch genau, wie er ihn einmal mit dem Motorroller mitgenommen hatte. Er hatte sich fest an ihn geklammert und das Gesicht an seine Lederjacke gedrückt. Es war großartig gewesen, aber Mama hatte sich furchtbar darüber aufgeregt. Ein so kleines Kind auf dem Motorroller! Kurz darauf war sein Vater verunglückt – mit dem Rennrad … Nikolai hatte deshalb nicht Rad fahren dürfen und es nur heimlich von seinem Freund Cem gelernt. Bestimmt war er der einzige fünfzehnjährige Junge an seiner Schule, der noch nie einen Roller, ein Fahrrad oder ein Skateboard besessen hatte.
»Die Kippa gehört ja nicht unbedingt einem Erwachsenen«, antwortete er. »Könnte doch auch ein Junge sein. Gibt’s hier in der Siedlung neuerdings noch eine jüdische Familie?«
Oma Sofia zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Muss Gott sei Dank niemand mehr einen Stern auf der Jacke tragen. Noch nicht jedenfalls!«
Nikolai nickte und begann das Geschirr zusammenzustellen. Er hatte keine Lust auf die Schwarzmalerei seiner Oma. Seine Gedanken wanderten zu dem Mädchen, das am Tag zuvor aus dem Umzugswagen geklettert war. Schräg gegenüber war anscheinend wirklich eine neue Familie eingezogen. War der blutverschmierte Junge der Bruder des Mädchens? Schade, dass er nicht darauf geachtet hatte, in welchen Eingang sie gegangen war. »Auf der anderen Straßenseite sind gestern Leute eingezogen, oder?« Nikolai sah seine Großmutter fragend an.
Doch die hatte davon nichts mitgekriegt, mittwochs war sie immer bei ihrer Schwester zum Kartenspielen. Sie musste nur sechs Stationen mit dem Bus fahren, aber wenn sie wieder heil zu Hause ankam, war sie so erleichtert, als hätte sie eine Abenteuerreise hinter sich. Wie sie es damals geschafft hatte, mit Mann und Kind aus ihrem russischen Dorf in eine fremde deutsche Großstadt zu ziehen, war Nikolai ein Rätsel. Er seufzte. Warum musste ausgerechnet er eine Familie haben, die sich ständig Sorgen machte?
Durch das gekippte Fenster drang Kindergeschrei in die Wohnung. Er ging auf den Balkon und sah nach unten. Ein paar Kids hatten sich auf dem schmuddeligen Platz mit den Müllcontainern versammelt, zwei hockten oben auf dem Betonkasten, vier andere dribbelten mit einem Ball herum. Es war eine ziemlich öde Gegend hier, in die niemand freiwillig zog. Aber eigentlich gab es alles, was er brauchte. Die Schule, den Fußballverein, den Jugendclub, wo man Billard spielen konnte, und das Einkaufszentrum. Nur keinen Laden mit koscheren Lebensmitteln – und das war gut so. Denn zumindest was Fleisch anging, achtete seine Mutter auf die Regeln. Und so hatte sie endlich eingewilligt, dass er ein Rad bekam, damit er zum Einkaufen ins Grindelviertel fahren konnte. Dort gab es mehr jüdisches Leben und auch die entsprechenden Läden. Sein Blick wanderte die Straße entlang. Um fünfzehn Uhr kam der Typ, der ihm sein gebrauchtes Stevens verkaufen wollte.
Eine halbe Stunde später drehte er ein paar Proberunden auf dem Platz und seine Großmutter schaute ihm von oben zu. »Vorsichtig, Nikosch!«, rief sie zum x-ten Mal, worüber sich die Kids natürlich schlapp lachten. Aber das war ihm egal. Er hatte ein eigenes Fahrrad. Ein Stück Freiheit! Er winkte seiner Großmutter zu, nahm Fahrt auf, bretterte über den Kantstein und bog auf die Straße ein. Einfach raus hier …
7
LEONHATTESCHLECHTGESCHLAFEN, er hatte kaum gewusst, wie er liegen sollte. Beim Aufwachen taten ihm sämtliche Knochen weh, aber das Dröhnen in seinem Kopf hatte sich gelegt. Zum Frühstück löffelte er teilnahmslos sein Schälchen aus. Immerhin hatte er Hunger, obwohl die Honigpops, die seine Mutter ihm hingestellt hatte, wie Pappe schmeckten. Als sie ihn fragte, ob sie zur Hausärztin gehen sollten, lehnte er ab. Er war viel zu müde für so eine Aktion, die eh nichts brachte.
»Aber vielleicht hast du innere Verletzungen. Wenn wir Anzeige erstatten wollen, solltest du vorher untersucht werden«, sagte sie.
»Das sind bloß Prellungen.«
»Weswegen hattet ihr eigentlich Streit miteinander?« Leons Vater sah ihn prüfend an.
»Wir hatten keinen Streit! Ich kenn die Typen doch gar nicht!«
»Was wollten die denn von dir, wenn sie nicht mal was gestohlen haben?«, hakte sein Vater nach. Er trank den Kaffee im Stehen an der Theke, die die Küche vom Wohnzimmer trennte, und sah aus, als wollte er in der nächsten Sekunde aufbrechen. »Hast du sie denn irgendwie provoziert?«
»Nein!« Leon warf ihm einen bösen Blick zu. »Das waren einfach nur Arschlöcher, die Stress machen wollten.«
»Tja …« Seine Mutter schaute verstohlen auf ihre Armbanduhr.
»Vergiss die Sache, Mama. Ich würde die nicht mal wiedererkennen. Was soll ich da bei der Polizei?«
Sein Vater stellte die Espressotasse in die Spülmaschine. »Nun gut, deine Entscheidung, Leon. Dann gehe ich mal los. Bin eh spät dran, ich muss heute nach Bremen.«
Leon konnte ihm die Erleichterung ansehen. Klar hatte er keine Lust, irgendein wichtiges Treffen mit Kunden sausen zu lassen, um mit seinem Sohn auf einer Polizeiwache zu hocken. Und auch seine Mutter war offenbar froh, pünktlich im Geschäft sein zu können.
»Gönn dir heute noch ein bisschen Ruhe«, sagte sie. »Bleib lieber einen Tag zu Hause.«
Leon nickte. Doch als er dann allein am Frühstückstisch saß, wurde er kribbelig. Er knabberte an einer Toastbrotscheibe und verschüttete aus Versehen die Hälfte seines Kakaos. Was sollte er hier in der Wohnung abhängen? Da kamen nur die Bilder von gestern wieder hoch.
Er hatte seinen Eltern nicht die Wahrheit gesagt. Natürlich würde er die Typen wiedererkennen, selbst in hundert Jahren noch. Der Große mit der Glatze hatte irgendwelche Tattoos am Hals, die aus seinem Kragen zu kriechen schienen. Und der Kleinere, mit rötlichen Stoppeln auf dem rasierten Schädel, hatte wie das Sams ausgesehen, nur dünner. Absolute Honks, alle beide. Er hätte sie bei der Polizei zeichnen lassen können, so genau sah er sie vor sich. Und dann? Selbst wenn man sie erwischte, würden die nicht im Knast landen. Zwei gegen einen. Aussagen gegen Aussage. Das ging doch nach hinten los. Sogar sein eigener Vater hielt es ja für denkbar, dass Leon es war, der angefangen hatte.
Leon nahm seinen Schulrucksack und verließ die Wohnung. Auf der Straße sah er sich misstrauisch um, obwohl er nicht glaubte, dass die Idioten hier so früh am Morgen auftauchen würden. Die wohnten sicher nicht in dieser Gegend. Nein, die hatten ihm aufgelauert, auf dem Weg zur Kletterhalle. Aber warum? Das konnte doch nicht angehen, oder? Die kannten ihn doch gar nicht. Warum er? Nicht mal beklaut hatten sie ihn. Sein Handy, die teure Jacke, die Sporttasche, das Geld in seiner Hosentasche … alles noch da. Die hatten ihm einfach nur wehtun wollen. Wie krank war das denn?
8
YARASCHLITTERTE mit ihrem Fahrrad über das Kopfsteinpflaster. Ausgerechnet heute, wo sie nach der Schule bei Frau Winter vorbeischauen wollte, hatte es passenderweise zu schneien begonnen. Mit vor Kälte steifen Fingern schloss sie ihr Rad am Gitter des Vorgartens an und schaute zum zweiten Stock hoch. Hinter den Fenstern war nur Leere, ihre Wohnung schien noch unbewohnt zu sein. Vielleicht könnten sie ja doch wieder hier einziehen, wenn Maman aus Frankreich zurückkam.
Dann fiel ihr Blick auf die goldenen Steine, von denen sie längst wusste, dass sie aus Messing waren, und sie holte tief Luft. Wie konnte sie rumjammern, nur weil sie in einen anderen Stadtteil umziehen musste? Ella war zwei Jahre jünger gewesen, als sie ihr Zuhause verloren hatte. Alles hatte sie verloren, für immer.
Als Yara lesen gelernt hatte und die Inschrift der Steine entziffern konnte, war es ihr klar geworden, dass die drei Steine kein Goldschatz waren. Sie sollten an ein furchtbares Unglück erinnern – an eine Familie, die am selben Tag und am selben Ort gestorben war. Ermordet! Das war einfach schrecklich. Immer wieder hatte sie sich ausgemalt, was wohl mit Ella und ihren Eltern passiert war, am 15. Mai 1942, in einem Ort namens Chelmno. Aber zum Glück hatte ihre Fantasie dafür nicht gereicht. Jetzt glaubte Yara endlich zu verstehen, warum Mama und Papa nicht mit ihr über die Steine sprechen wollten: Es war einfach eine zu gruselige Geschichte.
Die wahre Geschichte hatte sie dann erst von Frau Winter gehört. »Ich kann sie verstehen, Yara«, hatte Frau Winter ihr erklärt. »Sie dachten, dass das nichts ist, was man einem Kind erzählt.«
Yara musste lange warten, bis nach mehrmaligem Klingeln endlich die Tür aufging. Frau Winter brauchte immer endlos, um vom Wohnzimmer zum Türöffner zu trippeln. Aber dann setzten sie sich in die Sofaecke, stippten Kekse in den Tee und Frau Winter fragte Yara nach ihrem neuen Zuhause.
»Ach, langweilig«, winkte Yara ab. »Da ist nix los. Tote Hose.«
»Tote Hose? Papperlapapp. Überall ist was los. Man sieht es vielleicht nur nicht sofort. Überall, wo Menschen wohnen, passiert was, davon kannst du ausgehen. Und jedes Haus hat seine eigene Vergangenheit.« Frau Winter stützte sich an der Tischkante ab und stemmte sich hoch. »Warte mal, mein Mädchen, ich will dir was schenken«, sagte sie.
Nach einer gefühlten halben Stunde kam sie zurück. Yara war in dem überhitzten Zimmer schon fast eingeschlafen. Doch als sie sah, was jetzt vor ihr auf dem Tisch lag, wurde sie hellwach. »Aber das ist ja Ihr altes Fotoalbum!« Überrascht schaute sie von dem in brüchiges Leder gebundenen Album zu Frau Winter. »Ist das wirklich für mich?«
Yara ahnte, warum Frau Winter ihr das Album vermachte, das sie sich schon so oft zusammen angeschaut hatten. Es war wegen Ella. Denn auch Ella war auf einigen der alten Fotos zu sehen. Einmal zusammen mit Frau Winter im Hof: zwei Mädchen, ein blondes und ein dunkelhaariges, Arm in Arm, die Blonde einen halben Kopf kleiner. »Allerliebste Nachbarinnen«, hatte Frau Winters Mutter vor Urzeiten in einer altmodischen Schönschrift daruntergeschrieben. Irgendwie kaum zu begreifen, dass das grinsende pummelige Mädchen mit der Puppe auf dem Arm der gleiche Mensch war wie die runzelige, spindeldünne Frau Winter heute.
Yara schlug das Album auf und blätterte die Seiten um, bis sie das Foto von Ella und ihren Eltern fand. Sie hatten sich vor der Haustür aufgebaut, steif starrten sie in die Kamera. »Familie Cohen 1942«, stand unter dem Bild. »Da ist sie ungefähr zehn«, hatte Frau Winter ihr mal erklärt. »Schau, wie hübsch sie war. Sie hatte einen Zopf, der ihr bis zum Po ging. Um den hab ich sie immer beneidet.«
Yara betrachtete das Bild genauer und ein Schatten senkte sich auf sie: Ella stand genau an der Stelle, wo heute ihr Stolperstein lag.
Frau Winter trank ihren kalt gewordenen Tee aus. »So, ich brauche jetzt mein Nachmittagsschläfchen. Ich bin mal unhöflich und bringe dich nicht zur Tür.«
Ende der Leseprobe