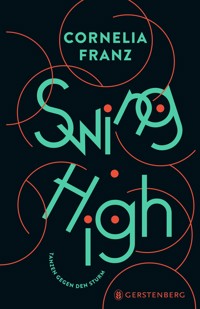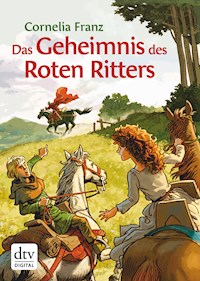9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kann Liebe wirklich alle Grenzen überwinden? Als Joyce den jungen Flüchtling Elias aus Äthiopien kennenlernt, passiert das Unerwartete: Sie verliebt sich Hals über Kopf in Elias, ist fasziniert von seiner manchmal so rätselhaften Art und seiner Schönheit. Doch trotz all der wunderbaren Momente ist die Beziehung schwierig. Immer wieder ist Joyce irritiert durch Elias' Wechsel zwischen Ausgelassenheit und Traurigkeit. Oft weiß sie nicht, warum es Missverständnisse gibt. Liegt es daran, dass er aus einer anderen Kultur kommt? Dass er Flüchtling ist? Passen sie überhaupt zusammen? Dann erfährt Elias, dass ihm die Abschiebung droht. Auf einmal ist er von heute auf morgen verschwunden und Joyce versucht verzweifelt, ihn wiederzufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Cornelia Franz
So fremd, so schön
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
1
Es war wie immer. Als Joyce von der Schule nach Hause kam, saß Martin auf dem Sofa, die Vorhänge zugezogen, und schaute sich eine dieser Sendungen an, aus denen er sich seit Monaten sein Weltbild zurechtzimmerte; irgendetwas über Jugendliche in einem Camp, die abspecken sollten. Im Dämmerlicht des Wohnzimmers starrte er auf den Bildschirm, eine Tüte Chips zwischen den nackten Knien, und ließ eine Flasche Bier aufploppen. Bier … um zwei Uhr nachmittags. Das allerdings war neu. Martin war fünfzehn.
»Spinnst du! Willst du so werden wie Dad?« Joyce schob die Vorhänge zur Seite und riss das Fenster auf. Das Dröhnen der Lastwagen auf der Straße und die Sommerhitze waren immer noch besser als der schwitzige Kneipendunst, den Martin hier verbreitete.
Ihr Bruder sah sie hinter seinen Brillengläsern an, als hätte sie Chinesisch gesprochen. Dad … wer war das noch? Seine braunen Augen, durch die dicken Gläser unnatürlich groß, hatten etwas rehhaft Hilfloses.
»Vergiss es«, sagte Joyce. Sie ging in die angrenzende Küche, die so schmal war, dass sie mit einer Hand den Kühlschrank und mit der anderen die Mikrowelle auf dem gegenüberliegenden Einbauschrank aufmachen konnte. Nur drei Tage alter Nudelauflauf, der aussah, als wollte er lieber nicht mehr gegessen werden.
Sie knallte die Mikrowelle wieder zu, nahm sich einen Becher Vanillequark und setzte sich damit zu Martin aufs Sofa. Die Bilder im Fernsehen taten fast weh, so peinlich waren sie, aber sie schaute trotzdem hin, während sie ihren Becher leer löffelte. Das Festnetztelefon, das ihre Mutter eigentlich schon längst gekündigt haben wollte, weil sie fast nur mit den Handys telefonierten, erlöste sie.
Es war Gloria, Moms ältere Schwester.
»Joy«, schallte ihre Stimme laut wie immer aus dem Telefon, »Joy, ihr müsst mir helfen. Ich komme an den Jungen nicht ran. Er ist stumm wie ein Fisch. Am besten, ihr kommt zum Abendessen, alle beide. Seid mal so gegen neunzehn Uhr hier, okay?«
Joyce hielt den Hörer ein Stück vom Ohr ab. »Wer? Wen meinst du?«
»Na, dich und Martin.«
Joyce hatte eigentlich den Jungen gemeint, der stumm wie ein Fisch war. Aber die Kommunikation mit Gloria war wie gewohnt leicht gestört. Genau wie Mom hatte sie ein unglaubliches Talent, sich in ihrer eigenen Gedankenwelt einzunisten und nur das zu verstehen, was sie verstehen wollte.
»Ich hab keine Zeit«, sagte Joyce ohne große Hoffnung, dass ihr das etwas nützen würde. »Ich bin verabredet. Und Martin auch.« Das stimmte zwar nicht, weil ihr Bruder am Freitagabend nie mit jemandem verabredet war, sondern vor dem Computer hockte, bis Mom das Internet ausschaltete. Aber so, wie er das Gesicht verzog, als er Glorias Stimme aus dem Hörer mitbekam, war klar, was er dachte.
»Come on, ihr könnt doch wohl mal für eine Stunde vorbeikommen. Erzähl mir nicht, dass eure Partys schon so früh anfangen.« Ihre Tante lachte, aber es war klar, dass sie nicht locker lassen würde.
Während sich Joyce das Telefon an den Bauch drückte, besprach sie sich kurz mit Martin. Er schüttelte wie erwartet heftig den Kopf. Sie fühlte sich plötzlich zu kraftlos, um sich mit irgendjemandem auf eine Diskussion einzulassen. »Na gut«, antwortete sie. »Neunzehn Uhr. Aber lange kann ich nicht bleiben.«
Als sie das Telefon auf die Anlage zurückstellte, freute sie sich sogar ein bisschen über die Einladung. Gloria war im Vergleich zu Mom eine Drei-Sterne-Köchin. Einen derartig verwahrlosten Kühlschrank wie hier gab es bei ihrer Tante mit Sicherheit nicht.
Den Jungen, der stumm wie ein Fisch war, hatte sie bereits vergessen.
2
Hier draußen war es frischer und grüner als in der Stadt, der Duft von gemähtem Gras hing in der Luft, und in den Vorgärten rieselten die Rasensprenger. Joyce ließ sich im Vorbeigehen besprühen, sodass ihr weißes T-Shirt auf den Schultern dunkel wurde.
Gloria und ihr Mann Rainer wohnten am Stadtrand, eine Dreiviertelstunde mit der U-Bahn und tausend Euro Miete im Monat von den Wohnblocks entfernt, in denen Martin, Mom und sie lebten. Ein weißes Fachwerkhäuschen mit Reetdach, hübsch wie aus einem Ferienkatalog. Cozy Cottage stand auf dem Türschild, das Gloria selbst getöpfert hatte.
Als Joyce den gedeckten Tisch auf der Terrasse sah, fünf Teller, fünf Gläser, fünfmal Besteck, fiel ihr wieder ein, warum ihre Tante sie eigentlich beim Essen dabei haben wollte. »Für Martin kannst du wieder abräumen, der kommt nicht«, sagte sie. »Und wer ist denn nun dieser Typ, von dem du geredet hast?«
»Er heißt Elias.« Gloria schaute sie nicht an, sondern rückte die Tischsets noch ein bisschen akkurater zurecht.
»Wer ist denn das?«
»Ich gebe ihm Gitarrenunterricht.«
»Cool …« Joyce versuchte, Glorias Gesicht zu sehen, doch ihre dunklen, von grauen Strähnchen durchzogenen Haare verdeckten es. Sie hatte das Gefühl, dass irgendetwas faul war. Seit wann versuchte ihre Tante, sie mit ihren Gitarrenschülern bekannt zu machen?
Die mit Bohnen und Mais gefüllten Enchiladas waren längst fertig, da waren sie immer noch zu zweit. Rainer hatte angerufen und sich entschuldigt, weil er noch arbeiten musste, wichtige Termine, was sonst … Und von diesem Elias war nichts zu hören und zu sehen. Gloria versuchte, ihn auf seinem Handy zu erreichen, aber er ging offensichtlich nicht ran.
»Kein Verlass auf niemanden«, schimpfte sie. »Hoffentlich ist er nicht mit meiner Gitarre durchgebrannt … Na ja, wir fangen an.« Sie legte Joyce eine Riesenportion auf.
Es war ein warmer Juniabend und noch so hell, als wollte die Sonne überhaupt nicht untergehen. Unter einer gelbweiß gestreiften Markise saßen sie nebeneinander am Tisch, beide mit Blick in den üppig blühenden Sommergarten. Joyce beobachtete die Buchfinken, die in den Zweigen des Kirschbaums herumhüpften, schlürfte Eistee durch einen Strohhalm und hörte mit halbem Ohr ihrer Tante zu, die irgendetwas aus ihrer Kirchengemeinde erzählte. »Alles Heuchler«, sagte sie, »hypocrites, I tell you!« Sie lachte dabei, als würden ihr diese Heuchler Spaß machen.
Seit zwanzig Jahren lebte Gloria in Hamburg, aber immer noch tupfte sie englische Ausdrücke in ihre Sätze. Joyce liebte Glorias weichen, schwingenden Akzent, der aus allem, was sie sagte, Musik machte, Südstaatenblues. Mom dagegen fand ihn schlampig. Sie sprach besser Deutsch als Gloria, obwohl sie längst noch nicht so lange aus Alabama fort war wie ihre große Schwester. Damals, in den ersten Monaten, als sie noch bei Gloria und Rainer wohnten, hatte sie sich auf die deutsche Sprache gestürzt, als würde sie dafür bezahlt werden. Martin und Joyce hatten die fremden Wörter schnell gelernt, im Kindergarten und in der Schule war das wie von selbst gegangen. Bitte … danke … lass das … das ist meins … Mom hatte immer ein spitzes Gesicht gemacht, wenn sie zu Hause miteinander englisch redeten. Als wollte sie alles auslöschen, was vorher gewesen war. Also hatten sie zu Hause bald nur noch deutsch gesprochen.
Die übrig gebliebenen Enchiladas waren kalt geworden und Gloria scheuchte die Fliegen weg, die sich darüber hermachen wollten. »Wie ärgerlich, dass er mal wieder so spät kommt.«
Joyce ahnte, von wem die Rede war. Nicht von Rainer, sondern von dem Jungen. »Warum soll ich den überhaupt kennenlernen?«, fragte sie.
»Du hast doch Italienisch in der Schule, oder? Du hättest mir ein bisschen übersetzen können. Er ist in deinem Alter, Darling, und vielleicht hättest du ihn ein bisschen aus der Reserve gelockt.« Gloria fuhr sich mit den Fingern durch ihre langen Haare und massierte sich die Schläfen. »Er ist stumm wie ein Fisch«, wiederholte sie.
Joyce warf ihr einen Blick zu. War dieser Typ wieder einer von ihren Problemfällen? Gloria hatte ständig irgendein Projekt, um das sie sich kümmerte. Die Gesangsstunden, die sie gab, füllten ihren Tag nicht aus, sodass sie ihre überschüssige Energie in Freiwilligenarbeit steckte. Suppe verteilen für Hartz-Vier-Empfänger, Seniorenarbeit, in letzter Zeit vor allem Flüchtlingshilfe, von Hausaufgabenbetreuung für Asylantenkinder bis hin zur Organisation von Kleiderspenden. Immer wieder versuchte sie, ihre Familie da mit reinzuziehen. Joyce hatte zwar ein latent schlechtes Gewissen, weil sie den Kopf angesichts all der Not um sie herum in den Sand steckte. Aber sie schaffte es nicht, sich aufzuraffen, um bei irgendeiner Hilfsaktion mitzumachen. Es war schon schwer genug, das eigene Leben auf die Reihe zu kriegen. In der elften Klasse hatte das Tempo ganz schön angezogen, und eigentlich hätte sie viel mehr tun müssen, um ein halbwegs gutes Abi hinzukriegen.
Joyce stand auf und schob ihren Stuhl entschlossen zurück. »Ein anderes Mal«, sagte sie, »ich muss jetzt leider los. Danke fürs Essen, war sehr lecker.« Sie gab ihrer Tante einen Kuss auf die Wange, atmete ihr üppiges Parfüm ein und machte sich auf den Weg.
Es war kurz nach acht. Bis sie an der Elbe war, wo sie mit ein paar Leuten feiern wollte, würde sie eine Ewigkeit brauchen. Sie lief einen Schritt schneller, um die U-Bahn zu erwischen, die hier draußen nur alle zwanzig Minuten fuhr.
Als sie den Jungen sah, war ihr klar, dass er es war, auf den sie gewartet hatten. In diesem verschlafenen Vorort begegnete man nur selten Typen wie ihm.
Er kam ihr mit langen Schritten entgegen, den Kopf gesenkt, weil er auf seinem Handy herumtippte, die andere Hand in den Taschen seiner ausgebeulten Jeans vergraben. Im ersten Moment hielt sie ihn für Tadesse, den Typen, der für ein paar Monate in ihrer Klasse gewesen war, um dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr aufzutauchen. Er trug genauso eine schwarze Wollmütze mit grün-gelb-roten Streifen, hatte genauso eine Haut wie dunkles Kupfer und so ausdrucksvolle Lippen. Und er hatte diesen ernsten, eigensinnigen Gesichtsausdruck, den auch Tadesse gehabt hatte. Er sah verdammt gut aus …
Sie versuchte sich an den Namen zu erinnern, den ihre Tante genannt hatte.
»Elias?«, rutschte es ihr raus, als sie fast auf gleicher Höhe waren.
Er hob den Kopf, erstaunt, misstrauisch, wie ertappt.
Zögernd blieb sie stehen, nach Worten suchend, die passten. Doch vielleicht wartete sie eine Sekunde zu lange. Er senkte die Lider mit den langen Wimpern und ging weiter, doch jetzt aufrecht und so, als wüsste er genau, dass sie ihm nachblickte. Wie auf dem Laufsteg ging er, wie jemand, der sich beobachtet fühlt.
Die U-Bahn war zu hören, das Bremsen der Räder auf den Gleisen. Joyce rannte los, die Treppen hinunter. Sie schaffte es gerade noch, durch die sich schließenden Türen zu schlüpfen. Mit klopfendem Herzen ließ sie sich auf eine Bank sinken und schaute hinaus auf den menschenleeren Bahnsteig. Ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe, die braungrünen Augen, die auch im Sommer blasse Haut mit den Sommersprossen, die rotblonden Locken. Sah sie aus wie jemand, vor dem man Angst haben musste?
Elias’ Erinnerungen. Erinnerungen wie Träume, wirr und ohne Zusammenhang. Bilder und Szenen, die ihn trösten. Die Katze, die er sich nachts auf den Bauch legt, wenn es kalt ist … Margitu, die ihm einen Bissen Injera in den Mund schiebt, ihre Finger rot gefärbt vom Berbere, mit dem sie das Essen gewürzt hat … Das himmelblau gestrichene Klassenzimmer, wo er Seite an Seite mit den Freunden sitzt, Nahom und Tesfaye, voller Stolz, lesen zu lernen … Die Schwärme von Braunseglern am Himmel, ssssiiiiirrr … Gerüche, die ihn an zu Hause erinnern, gerösteter Kaffee, gebratene Zwiebeln, Kerzen und Räucherstäbchen. Die halbdunkle, warme Hütte, in der sie alle schlafen. Glimmendes Feuer. Das Gesicht seiner Mutter.
Und so viele andere Bilder, Albtraumbilder, die ihn verfolgen, die er nicht sehen will, an die er nicht denken will. Es werden immer mehr, je länger er unterwegs ist.
3
Drei Tage später sah sie ihn wieder, zufällig, in der Innenstadt. Er ging ein Stück weit vor ihr. Sie erkannte ihn an seinem Gang, an den langen, wiegenden Schritten und dem geraden Rücken. Fast, als würde er seine abgeschnittene, ausgefranste Jeans und das verblichene T-Shirt zur Schau stellen. Selbst in Flip-Flops schritt er die Einkaufsstraße geradezu elegant entlang, obwohl er nicht auf den Weg achtete, sondern ins Handy sprach. Ob er schwul war, so wie er sich bewegte? Na ja, konnte ihr eigentlich egal sein.
Er hielt vor Daniel Wischer an, einem Fischladen, wo er sich an der Außentheke etwas kaufte. Sie war ein paar Meter entfernt stehen geblieben und sah ihm zu, wie er ein dick mit Zwiebeln belegtes Matjesbrötchen kaufte. Matjes … und das bei dieser Hitze. Sie schüttelte sich. Das passte irgendwie überhaupt nicht zu ihm. Er telefonierte weiter, während er sein Brötchen aß. Na also, stumm war er ganz bestimmt nicht.
Plötzlich wurde Joyce sich bewusst, was sie da machte. Wie eine Stalkerin ging sie diesem Typen nach, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob es angebracht war, dass er ein Fischbrötchen aß … Hastig betrat sie den Laden, vor dem sie stand, eine Boutique mit XXL-Größen, ausgerechnet.
An einem der Drehständer blieb sie stehen und zog wahllos ein paar Sommerkleider in Übergröße hervor. Jamie hätte da reingepasst, Moms jüngste Schwester, die immer noch in Birmingham lebte. Jamie … mollig und weich, ganz anders als Mom. Joyce hatte auf ihrem Schoß sitzen dürfen, als sie mal an Weihnachten zusammen im Kino gewesen waren. In Moms Zimmer hing ein Foto von den drei Schwestern, Gloria, Julia und Jamie, auf dem sie der Größe nach nebeneinander am Strand des Atlantiks standen, das Meer im Hintergrund türkis.
Sie fröstelte in der runtergekühlten Luft des Ladens. Was war eigentlich los mit ihr? Wieso dachte sie in letzter Zeit ständig an Alabama? Lag es an den vielen afrikanischen Flüchtlingen, von denen es von Monat zu Monat mehr in Hamburg gab? In Birmingham waren mehr als die Hälfte aller Menschen dunkelhäutig gewesen, eine Tatsache, die für sie selbstverständlich gewesen war.
Oder es hatte mit der ungewöhnlichen Hitze zu tun, die die Stadt seit einer Woche im Griff hatte. Die Leute stöhnten, im Radio liefen Überlebenstipps. Aber sie, sie liebte dieses Wetter. In ihrer Erinnerung waren die Sommer in Alabama eine einzige Kette heißer Tage und schwüler Nächte gewesen. Mom hatte ihnen zerstoßenes Eis mit Sirup gemacht, das sie im Schatten der immergrünen Eiche gegessen hatten. Es knirschte wie Sand zwischen den Zähnen. Nachts gab die Klimaanlage ein beständiges Rauschen von sich. Martin und sie hatten sich ein Zimmer geteilt, obwohl der Bungalow in Birmingham mehrere Schlafzimmer gehabt hatte. In Hamburg, in ihrem eigenen Zimmer, konnte sie lange abends nicht einschlafen, weil sie das Rauschen der Klimaanlage genauso vermisste wie die leisen Gespräche mit ihrem Bruder. Joy, why has Yoda such big ears? Joy, I saw a rabbit in the garden. Joy, why is Mommy crying in the kitchen?
Und natürlich vermisste sie ihren Vater, über den nicht geredet wurde, gerade so, als hätte es ihn nie gegeben. Dad … von dem in der Wohnung kein einziges Foto existierte.
»Kann ich Ihnen helfen?« Die Verkäuferin steuerte auf sie zu und Joyce nahm Reißaus. Wie peinlich, sich hier zu verstecken, nur um dem fremden Jungen nicht nachzulaufen.
Als sie wieder in der Fußgängerzone stand, sah sie sich natürlich trotzdem nach ihm um. Sie entdeckte ihn sofort. Neben der Parfümerie lehnte er an der Hauswand. Er hielt sein Handy in der Hand, aber er telefonierte nicht mehr. Was machte er? Er hatte das Handy auf einen Typen und dessen Hund gerichtet, beide mit der gleichen rotbraunen Haarfarbe, beide verwahrlost und struppig und mit unruhigem Blick. Der Typ saß im Schneidersitz auf dem Boden und streckte den Passanten einen verbeulten Plastikbecher entgegen.
Jetzt nahm er die Frau ins Visier, die eine Münze in den Becher fallen ließ. Fotografierte er die Szene? Filmte er sie? Die Verkäuferin, die im Eingang zur Parfümerie aufgetaucht war, beäugte ihn misstrauisch. Merkte er nicht, dass er Aufsehen erregte, mehr als der Obdachlose mit seinem Hund? Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite war jemand stehen geblieben, der den Jungen ansah, als ob er ihn am liebsten wegjagen wollte. Es würde nicht lange dauern, bis der Typ mit dem Hund merken würde, dass er fotografiert wurde. Joyce konnte den Ärger, der in der Luft lag, geradezu riechen.
Ohne nachzudenken, ging sie auf den Jungen zu. »Hey, Elias«, sagte sie. »Lass uns mal lieber gehen.« Sie fasste ihn leicht am Ellenbogen.
Als hätte sie eine schmerzende Wunde berührt. Er zuckte zusammen und riss den Kopf herum. In der nächsten Sekunde sah sie, dass er sie wiedererkannte. Verwirrung in seinen braunen Augen und eine Intensität, die sie nicht aushielt. Sie senkte den Blick im selben Moment wie er.
»Komm, lass uns gehen«, sagte sie noch einmal. Doch er reagierte nicht, schaute sie nur an.
Der Schweiß lief ihr zwischen den Schulterblättern hinunter. Am liebsten hätte sie ihn stehen gelassen, diesen fremden Jungen, der sie nichts anging. Aber da war etwas, das sie nicht losließ.
Hatte Gloria nicht gemeint, er würde Italienisch sprechen? »Andiamo«, wiederholte sie zögernd. Ihr Italienisch war eine Katastrophe, aber den Ausdruck kannte sie immerhin.
Jetzt grinste er plötzlich, als hätte sie einen Witz gemacht. Er steckte sein Handy in die Hosentasche und löste sich von der Hauswand.
Seite an Seite gingen sie die Fußgängerzone hinunter. Joyce spürte seine Nähe wie ein Kribbeln auf der Haut. Vergeblich suchte sie nach den Vokabeln, mit denen sie ihm klarmachen konnte, weshalb sie ihn angesprochen hatte. Schließlich entschloss sie sich, deutsch mit ihm zu reden, auch wenn er sie vielleicht nicht verstand. Besser als zu schweigen …
»Hast du nicht gemerkt, dass es gleich Ärger geben würde?«, fragte sie. »Warum hast du die Leute fotografiert?«
Er zuckte die Schultern. »Das ist Kunst«, sagte er.
Kunst? Sie zog die Augenbrauen hoch und schaute ihn von der Seite an. Was für ein merkwürdiger Typ! Als er jetzt auf einmal lachte, offen und frei, da war er absolut hinreißend. So ausdrucksvoll war sein Gesicht, so voller Leben, dass sie sich zusammenreißen musste, ihn nicht anzustarren. Wie schaffte er es nur, durch die Menschenmenge zu gehen, als schritte er über den roten Teppich zur Oscarverleihung? Blass und plump kam sie sich neben ihm vor. Joyce Marsh – Marshmallow … Irgendjemand hatte sich mal diesen albernen Spitznamen ausgedacht.
»Hast du ein Aufladekabel?«, fragte er unvermittelt in ziemlich gutem Deutsch.
»Ja, für ein Samsung.«
»Passt.« Er nickte. »Ich kann das haben, bitte?«
»Wie … haben?« Wollte er sie anschnorren? Er kannte sie doch überhaupt nicht. Und hatte Gloria nicht erwähnt, dass er ihr die Gitarre nicht zurückgegeben hatte? Eigentlich wirkte er nicht wie einer, der es ausnutzte, wenn man freundlich zu ihm war. Aber trotzdem, sie hatte nicht die geringste Lust auf Stress, und dass dieser Junge ein bisschen neben der Spur lief, war ziemlich deutlich, oder?
Da war der Hauptbahnhof, die Treppe zur S-Bahn. »Sorry, ich hab keine Zeit mehr«, sagte sie. »Ich muss die Bahn kriegen.«
»Kein Problem.« Plötzlich war sein Gesicht wieder verschlossen. »Ciao.« Er hob die Hand, tippte sich an die Schläfe, was wohl eine Art Abschiedsgruß sein sollte, und schon verschwand er in der Menge der Leute, die aus dem Bahnhof strömten. Nach wenigen Sekunden konnte sie nur noch seine Wollmütze erkennen, die er trotz der Wärme trug.
Während Joyce zögernd auf die Treppe zuging, hatte sie das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben. Misstrauisch und blöd hatte sie sich benommen, richtig spießig. Kurz entschlossen kehrte sie um und lief ihm hinterher. »Elias, hey, warte mal!« Sie wedelte mit den Armen in der Luft herum. »Bleib doch mal stehen!«
Ein paar Leute warfen ihr neugierige Blicke zu und sie spürte, wie sie rot wurde. Wieso brachte sie dieser Junge eigentlich schon wieder dazu, sich so albern aufzuführen? Er hatte sie bestimmt gehört, aber er hielt nicht an. Im Gegenteil, er lief noch schneller.
»Hey, warte mal! Bleib stehen!« Eine harte Stimme, voller Argwohn und Arroganz. »Was hast du hier zu suchen? Zeig mal deinen Ausweis!« Hände, die ihn am Arm berühren. Böse Augen, die ihn anfunkeln. Ein Mund, aus dem ihm Speicheltropfen ins Gesicht sprühen. Ein Mann in einer schwarzen Uniform, der ihn wie einen Verbrecher behandelt.
Der Ausweis … Wo ist der verdammte Ausweis, der seine Duldung beweist? Er greift in seine Jackentasche, merkt, dass er den Ausweis in der Wohnung vergessen hat. Den Ausweis, der dem Mann zeigt, dass er hier sein darf, in diesem Park, in dieser Stadt, in diesem Land, in diesem Leben. Jedenfalls jetzt noch.
»Wird’s bald, Schmarotzer?! Oder soll ich suchen helfen?« Der Mann packt ihn am T-Shirt.
Sein Magen zieht sich zusammen, als hätte ihn jemand in den Bauch getreten. Bittere Galle steigt in ihm auf. Er reißt sich los und rennt davon.
4
Auch als die Sonne schon tief stand, hing die Hitze noch im Raum. Joyce war froh, aus der Wohnung rauszukommen, in der Martin und ihre Mutter mit Pizzakartons auf den Knien vor dem Fernseher saßen, Martin mit den Kopfhörern seines Handys in den Ohren. Als sie ihnen ein knappes »Tschüs, ich bin weg« zurief, kam ihre Mutter in den Flur. Ihre Haare waren an den Schläfen nass vor Schweiß.
»Wo gehst du denn hin?«, fragte sie. »Es gibt sicher gleich ein Gewitter.«
»Zu Marie.«
»Ich wollte uns gerade einen Eiskaffee machen.«
Joyce kräuselte die Stirn. Sie mochte keinen Kaffee, in dem Vanilleeis rumschwamm. Aber das kriegte Mom ebenso wenig mit wie die Tatsache, dass sie seit mindestens einem halben Jahr Vegetarierin war. Natürlich hatte sie wieder mal Salami-Pizza zum Abendessen kommen lassen und Joyce hatte wortlos die Wurstscheiben runtergepflückt und auf Martins Teller geworfen.
Mom war Übersetzerin. Morgens tauchte sie in ihr Zimmer in einer Bürogemeinschaft ab, verschwand hinter tausend Seiten dicken Manuskripten und kam am Abend mit rot geäderten Augen nach Hause. Oft arbeitete sie zwölf Stunden hintereinander, auch am Samstag, und dann war sie den Rest des Tages kaum noch ansprechbar. Wie ein Zwang kam Joyce das Ganze manchmal vor. Die Sucht zu arbeiten, um sich aus dem Leben auszuklinken.
»Nein, danke«, antwortete sie. »Eiskaffee mochte ich noch nie. Und dein Sohn trinkt übrigens überhaupt keinen Kaffee. Aber stell ihm doch ein Bier hin. Da wird er sich bestimmt freuen.«
Irritiert schaute ihre Mutter sie an. Doch ehe sie eine Frage stellen konnte, war Joyce auch schon zur Tür hinaus und rannte die Treppen hinunter.
»Joy!«, hörte sie ihre Mutter rufen, dann fiel die Haustür hinter ihr ins Schloss.
Während sie auf die Bushaltestelle zulief, wurde das Grollen des nahenden Gewitters lauter. Was das Wetter anging, hatte Mom direkt mal richtig gelegen. Dicke Tropfen klatschten auf den Gehweg, erst nur einige, dann wurden es mehr. Zum Glück kam in diesem Moment der Bus um die Ecke.
Maries Party sollte eigentlich im Garten stattfinden. Aber angesichts des Regens drängten sich alle im Wohnzimmer, wo sie Matsch und Dreck auf dem Teppich hinterließen. Als Joyce über die Terrasse ins Haus ging, war Marie schon so angetrunken, dass es ihr egal war, ob ihre Eltern am nächsten Tag einen Herzinfarkt bekommen würden.
Marie drückte Joyce ein Glas mit einem undefinierbaren Drink in die Hand. »Leon Cramer ist auch da«, flüsterte sie bedeutungsvoll und zeigte mit dem Kinn in Richtung Küchentheke, wo ein paar Jungs um einen Elektrogrill standen, auf dem Würstchen brutzelten. »Der mit der Grillzange.«
Die Bemerkung war überflüssig, denn natürlich wusste Joyce, wer Leon war. Er hatte gerade mit Marie zusammen Abi gemacht, so wie die meisten hier auf der Party, war schon neunzehn, ziemlich selbstsicher und wusste genau, dass er nicht schlecht aussah. Ihr gegenüber war er aber überhaupt nicht arrogant, im Gegenteil, sie hatte das Gefühl, dass er sie mochte. Allerdings hatten sie die paar Male, die sie sich begegnet waren, nie mehr als einige wenige belanglose Sätze miteinander gewechselt.
Marie hakte sie unter, zog sie zu den Jungs und schob Joyce geradezu neben Leon. Er lächelte sie an. »Hallo, Joyce.«
»Hallo«, antwortete sie. Mehr fiel ihr nicht ein. Sie verfluchte innerlich Marie, die sie jetzt losließ und davonflatterte, um andere Neuankömmlinge zu begrüßen. Um nicht nur so dazustehen, ließ sie sich von ihm gegrillte Paprika auf einen Pappteller geben, obwohl sie nach der Pizza eigentlich keinen Hunger hatte. Während sie an der Theke stand und aß, hörte sie den Jungs zu, die offenbar alle drei Work-and-Travel planten. Australien, USA, Kanada, Hauptsache weit weg. Klar, sie hatten alle drei ihr Abi in der Tasche und konnten schon vor den Sommerferien los. Beneidenswert.
Leon streifte sie mit einem Blick aus seinen graublauen Augen, von ihren zerzausten Locken über ihr nass gewordenes Minikleid bis zu den Flipflops und zurück zu ihrem Gesicht, das wieder einmal glühte. Wie sie das hasste, dass sie immer gleich rot anlief. Er hob sein Glas und prostete ihr zu. »Auf die Zukunft.«
»Auf deine. Meine sieht gerade nicht so spannend aus«, antwortete sie.
»Auf unsere!« Grinsend stieß er mit seiner Bierflasche gegen ihr Cocktailglas.
Das Blut in ihren Adern begann zu kribbeln. Hey, er flirtete mit ihr. Oder bildete sie sich das nur ein? »Na ja«, sagte sie nach einigen Sekunden. »Da du demnächst ans andere Ende der Welt fährst, glaube ich nicht, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben.«
»Komm doch mit.«
»Tolle Idee. Aber ich hab leider noch zwei Wochen Schule und danach werde ich jobben.«
»Schade.« Er lächelte sie wieder an, dann wandte er sich dem Grill zu.
Joyce kam sich plötzlich überflüssig vor. Suchend sah sie sich nach Marie um. Doch die war nirgends zu sehen. Ansonsten kannte sie hier niemanden wirklich. Vielleicht hätte sie lieber zu der Party gehen sollen, die ein paar Mädchen aus ihrer Profilklasse veranstalteten. Aber sie hatte keine Lust auf die Leute aus der Schule. In all den Jahren hatte sie dort nie eine richtige Freundin gefunden, keine, der sie sich wirklich nah fühlte.
Marie kannte sie noch aus dem Kinderchor, in dem sie ein Jahr gesungen hatte, als sie noch in der Grundschule gewesen war. Vor ein paar Monaten waren sie sich im Schwimmbad wiederbegegnet, wo sie schnell gemerkt hatten, dass sie sich immer noch gut verstanden. Wie schade, dass auch Marie demnächst abreisen würde, um bei Freunden ihrer Eltern als Au-pair zu arbeiten. In Atlanta, gar nicht weit von Alabama entfernt.
Mom, Martin und sie waren damals von Atlanta aus nach Deutschland geflogen. Joyce erinnerte sich an den riesigen Flughafen, so groß wie eine ganze Stadt. Und daran, dass ihr Vater nicht dabei gewesen war, um sie zu verabschieden. »Dad kommt nach«, hatte Mom behauptet, wohl weil sie die Abschiedsszene vermeiden wollte. Was für eine beschissene Lüge …
Um nicht schon wieder in sinnlosen Gedanken zu versinken, ging Joyce ins Esszimmer, wo der Tisch an die Wand geschoben war und Techno aus den Boxen dröhnte. Sie ließ sich vom Rhythmus mitreißen und tanzte, bis sie in Schweiß gebadet war. Das war das Beste – nichts mehr denken zu müssen, nicht ständig über irgendetwas zu grübeln. Einfach nur da zu sein.
5
»Vielleicht, wenn es mehr Liebe gäbe …«
Wer war das? Von wem kam dieser grandios naive Satz, der für einen Moment wie eine Seifenblase durchs Klassenzimmer schwebte, als flöge er direkt vom Schulhof der angrenzenden Grundschule durchs Fenster?
Joyce drehte sich um. Klar, nur Aylin schaffte es, so etwas zu sagen und nicht einmal zu merken, dass sie die halbe Klasse zum Kichern brachte, allen voran natürlich Miro und seine Freunde. Deppen … Kaum fiel das Stichwort Liebe, da mussten sie anzügliche Bemerkungen machen.
»Nun, immerhin habt ihr Spaß!« Frau Doberans Stimme wurde noch eine Spur eisiger als sonst. Sie konnte ausgesprochen ungemütlich werden, wenn jemand Witze machte, während sie mit der Klasse über das Elend dieser Welt reden wollte.
Ethik bei Frau Doberan – das bedeutete, dass die 11c mit den aktuellen Themen der Zeit konfrontiert wurde. Sterbehilfe, Genfood, Datenüberwachung … In dieser Doppelstunde ging es wie so oft in den letzten Wochen um die Situation der Flüchtlinge in Europa. Am Tag zuvor hatte es erneut ein Schiffsunglück in der Ägäis gegeben, bei dem mehr als fünfhundert Menschen ertrunken waren, Flüchtlinge aus Syrien. Und gleichzeitig diskutierten die Politiker wieder einmal, wie Europa sich vor dem Ansturm all der Menschen schützen konnte, die übers Meer oder zu Fuß nach Europa wollten. Menschen aus dem zerbombten Syrien, aus Afrika, Afghanistan, Irak … Frau Doberan zeigte Fotos von übervollen Lagern, in denen verzweifelte Menschen darauf warteten, dass man sie über die Grenze ließ. Niemand in der Klasse hatte Lust, sich schon wieder mit all diesen Dramen zu beschäftigen.
Miroslaw meldete sich. »Die sollen einfach bleiben, von wo sie herkommen«, sagte er, die Arme über der Brust verschränkt. »Wir können ja nicht alle Welt bei uns aufnehmen.«
Frau Doberans Lider zuckten, ein Zeichen, dass sie versuchte, sich zusammenzureißen und ihn nicht einfach anzubrüllen.
Miros Bemerkung war einmal mehr ein Beispiel dafür, dass sein Hirn im absoluten Gegensatz zu seiner großen Klappe stand. Ihre Schule wäre zu einer Zwergschule geschrumpft, wenn alle Leute dort geblieben wären, wo sie ursprünglich mal gelebt hatten. Auch Miroslaw und sein Bruder Mikolaj waren vor ein paar Jahren noch in irgendeinem polnischen Dorf herumgesprungen. Aber das hatte er offenbar vergessen.
Frau Doberan atmete tief durch und begann einen Vortrag über Kant und Lessing, die sich im Grabe umdrehen würden, angesichts dessen, wie Europa zunehmend die Ideale der Aufklärung verriet. »Kosmopolitismus statt Nationalismus«, dozierte sie, »Weltbürgertum! Alle Menschen werden Brüder